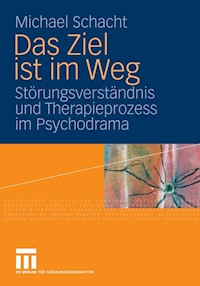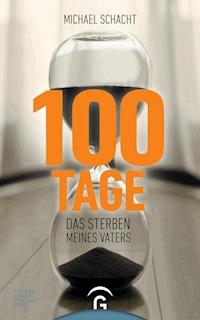
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
»100 Tage – 2400 Stunden – das klingt nach nichts ...« (Michael Schacht)
»›Ihrem Vater bleiben noch 100 Tage. Rechnen Sie damit, dass er den Sommer nicht mehr erleben wird.‹ Zwei Sätze, die sitzen. Zack – da ist sie, die Realität. Der Tod, er klopft nicht an die Gartenpforte, er hat bereits die Haustür eingetreten.«
Michael Schacht versucht in seinem Buch, den zu erwartenden Tod des Vaters zu begreifen, sich ihm in den verbleibenden 100 Tagen wieder anzunähern und die restliche Zeit wie einen »Countdown des Lebens« bewusst zu gestalten und zu genießen. Sehr emotional erzählt er von Versöhnung und Verständnis, von Angst und Hoffnung, von Anteilnahme und Loslassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 272
Ähnliche
Michael Schacht
100 Tage
Das Sterben
meines Vaters
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
Copyright © 2018 Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81 673 München
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
Umschlagmotiv: www.pixabay.com
ISBN 978-3-641-22544-5V003
www.gtvh.de
PROLOG
Ich sagte: »Ich mag meinen Vater eigentlich nicht.«
Julia sagte: »Puh. Das kannst Du einfach so sagen?«
Ich sagte: »Ja, wieso? Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre.«
Ich sitze im ICE von Hamburg nach Berlin, sage diesen wahrscheinlich für viele Menschen sehr ungewöhnlichen Satz und wundere mich, dass sich Julia, die mir gegenübersitzt, über meine Worte erschreckt. Nur wenige Wochen später werde ich mich sehr erschrecken – über das vielleicht größte Trauma meines bisherigen Lebens. Der Anfang vom Ende des Lebens meines Vaters und schließlich sein Tod.
Es ist Sommer 2015. Ich bin dabei, mich im Hamsterrad des Alltags selbst zu überholen. Ich denke – wenn überhaupt – nur sehr wenig an mich, an andere noch weniger und an meinen Vater wahrscheinlich am allerwenigsten. Das war die letzten Jahre schon so und wird sich wohl auch nicht mehr ändern. Lange wollte ich mit meinem Vater so wenig Zeit wie möglich verbringen. Lange interessierten wir uns wie so viele Söhne und Väter nicht wirklich füreinander. Wir hatten so etwas wie eine emotionslose Ko-Existenz. Doch die Diagnose, dass sein Leben sehr bald sehr tragisch enden wird, zwang mich dazu, mein Leben, sein Leben, unser Leben radikal zu überdenken. Kann man aus einer schlechten Vergangenheit eine gute Zukunft oder zumindest eine gute Gegenwart formen? Die Gefühle füreinander ändern? Lassen sich die eigenen Eitelkeiten, die Kränkungen und Verletzungen ignorieren, obwohl sie doch so stark sind? Erlaubt einem das Leben einen Neustart auch dann noch, wenn es eigentlich schon fast vorbei ist?
Ich hätte sehr lange jede dieser Fragen mit einem lauten Nein beantwortet. Doch das langsame Sterben und der schnelle Tod meines Vaters, das Abschiednehmen von ihm, haben mein Leben über Nacht auf den Kopf gestellt.
Ich sage: »Ich mochte ihn eigentlich doch.«
Das ist meine, das ist unsere Geschichte.
100
30. Januar 2016. Der Arzt sagt: »Ihrem Vater bleiben noch 100 Tage. Einer von Hunderttausend Patienten überlebt vielleicht länger. Rechnen Sie damit, dass er den Sommer nicht mehr erleben wird.«
Ich sage nichts. Schlucke nur.
Es sind drei Sätze, die sitzen. So muss ertrinken sein. Da ist sie, die Realität. Der Tod, er klopft nicht an die Gartenpforte, er hat bereits die Haustür eingetreten. Der Tod sucht meinen Vater, weil er ihn aus unserem Leben reißen will. Mein Vater ist ab heute seine Beute. Mein Vater ist jetzt angezählt. 100 Tage.
Ich lasse mir nichts anmerken, aber zum ersten Mal, seitdem mein Vater vor einem halben Jahr an Lungenkrebs erkrankt ist, weiß ich wirklich nicht, was ich sagen soll. 100 Tage Restlebenszeit? Drei Monate und eine Woche? 2400 Stunden? Das klingt nach nichts, so endgültig und auch so eindeutig. Ich weiß, dass mein Vater sterben wird. Aber so schnell? So real? So hoffnungslos? Und weiß er es auch? Will er es überhaupt wissen, oder will er seinen Tod ignorieren? Wie schon so vieles im Leben.
Alles, was nicht in sein Weltbild passte, gab es für ihn nicht. Einerseits eine große Kunst und für ihn wohl seine einzige Chance, ohne sichtbare Schrammen durchs Leben zu gehen. Andererseits war genau diese Eigenschaft für all seine Mitmenschen oft schwer zu ertragen, vor allem für mich. Doch einfach alles zu ignorieren, das geht jetzt für mich nicht mehr. Ich muss mich dem Tod stellen.
Mein Vater steht kurz vor seinem achtzigsten Geburtstag, doch merklich älter geworden ist er bislang nicht. Seine Jahre zwischen fünfundvierzig und jetzt, also die, die ich mehr oder weniger bewusst erlebt habe, waren irgendwie alle gleich. Wahrscheinlich hat mein Vater das Älterwerden einfach auch ignoriert.
Okay, seine Haare sind weniger und grauer, die Augenbrauen und die Ohren länger und die Abstände der nächtlichen Toilettengänge kürzer. Trotzdem stand er noch vor kurzem mit der Bohrmaschine auf der Leiter in meiner Wohnung oder fuhr fünfzig Kilometer lange Touren mit dem Rad – mit Fersensporn, aber ohne Pause.
Alt wird mein Vater also nicht, dafür über Nacht zum Tode verurteilt.
Der Krebs wurde durch einen Zufall entdeckt. Dass sich dieser traurige Zufall für mich im Rückblick als großes Glück herausstellen sollte, wusste ich zum Zeitpunkt dieser unumkehrbaren Diagnose ebenfalls noch nicht.
Mein erster Impuls bei der Erstdiagnose: Metastasierender Lungenkrebs – das ist ein Todesurteil für meinen Vater. Ich sollte Recht behalten. Das wusste ich damals nur noch nicht. Wahrscheinlich ist es die Berufskrankheit eines Journalisten, sofort zu googeln, was so eine Diagnose bedeutet.
Ein frühes Stadium bedeutet heilbar oder zumindest kontrollierbar. Ein fortgeschrittenes Stadium bedeutet fast immer den Tod, mal schneller, mal langsamer. Meist schneller. Ich las nächtelang über Tumorgrößen, Behandlungsmethoden und Krankheitsverläufe. Ich tat alles, was man in solch einer Situation besser nicht tun sollte, weil jeder Laie dann ziemlich schnell an seine emotionalen Grenzen kommt.
Der Krebs hat meinen Vater gezeichnet. Ihm einen Finger genommen, einen Teil seiner Lunge und seine Geschwindigkeit. Der Krebs bedroht seinen Zeh, seine Nebenniere, seine Wirbelsäule und seine Rippen. Er ist zurück in seiner Lunge. Und ob in seinem Gehirn wirklich keine Metastasen mehr wachsen werden, ist ungewiss.
Besiegen konnte der Krebs bislang noch nicht seine Würde und seinen Stolz. Seine Augen sind wach und wenn er uns zum Lachen bringen will, dann wackelt er mit den Ohren. Er tut das oft. Und er ist meines Wissens der einzige in der ganzen Familie, der das kann – und wird es wohl auch bleiben.
Mein Vater geht alleine. Er isst alleine. Er hat – wie immer – seinen eigenen Willen. Doch wie lange noch? Frisst der Krebs ihn bei vollem Bewusstsein auf? Oder streckt er ihn mit einem Schlag nieder? Ich wünsche mir Letzteres. Nur bitte nicht so schnell. Ich möchte noch so viel mit ihm bereden. Werden 100 Tage ausreichen?
99
Meine Mutter hat Geburtstag. Es ist ihr achtundsechzigster und vielleicht der bislang traurigste ihres Lebens. Wie wird der nächste sein, wenn mein Vater nicht mehr lebt? Ich möchte nicht daran denken.
Es dauert lange, bis mein Vater die Geburtstagskarte unterschreiben kann. Wir hatten vorher besprochen, dass ich für ihn ein Geschenk besorge und natürlich Blumen. Er selbst kann es ja nicht mehr. Die Karte schreiben wir gemeinsam. Also – ich schreibe, er stimmt zu.
Ich versuche, nicht zu weinen, als ich für meinen Vater und mich schreibe. Bis er endlich unterschreiben kann, vergeht viel Zeit, zehn Minuten vielleicht. Seine rechte Hand zittert so stark und es fehlt ja ein Finger. Seine Schrift ist klein und schwach, ganz anders als früher, aber er will unbedingt selbst unterschreiben. Zwischendurch kommt meine Mutter immer wieder ins Wohnzimmer.
Sie fragt: »Was heckt Ihr denn da aus?«
Es ist ein wenig wie früher zu Weihnachten, nur, dass uns gar nicht zum Feiern zu Mute ist.
Ich sage: »Nichts, gar nichts …«
Nach einer gefühlten Ewigkeit hat mein Vater auf der Karte unterschrieben. Er wirkt erschöpft, aber glücklich, dass er es noch einmal geschafft hat.
Es ist der Kampf um ein wenig Land, obwohl mein Vater die alles entscheidende Schlacht schon verloren hat. Auf der Landkarte seines Körpers hat der Krebs wohl schon die Territorialhoheit erobert.
Als meine Mutter die Geburtstagskarte später liest, weint sie. Wir schenken ihr einen Einkaufsgutschein, denn auch sie hat in den letzten Wochen das Haus kaum verlassen. Konkret schenkt sie sich ihr halbes Geschenk selbst, mein Vater hat kein Bargeld mehr, deshalb gibt sie mir rasch die halbe Summe zurück. Aber sie freut sich trotzdem.
Meine Mutter hat darauf bestanden, ihr Geschenk nicht vor allen anderen Gästen öffnen zu müssen. Manchmal ist es offenbar leichter, so zu tun, als sei alles gut, obwohl es ganz und gar nicht gut ist.
»Auch, wenn in diesem Jahr alles anders ist, wünschen wir Dir trotzdem einen schönen Tag«, habe ich für Papa und mich geschrieben.
Meinem Vater läuft eine Träne die Wange herunter. Noch bevor er sie stoppen kann, landet sie auf seinem Ledersessel. Über drei Jahrzehnte lang hätte ich vehement bestritten, dass mein Vater überhaupt zu Gefühlsausbrüchen in der Lage sei, geschweige denn weinen könne. Doch jetzt, wo der Tod naht, überrascht er mich immer wieder.
Mein Vater beruhigt sich nach zwei Zigaretten. Zwei hintereinander. Meine Mutter guckt etwas streng, aber lässt ihn gewähren. Wieso auch nicht. Ja, die Zigaretten haben ihn krankgemacht. Die Soft-Box-Schachtel »Camel« ohne Filter in der linken Brusttasche seiner Hemden ist eine meiner frühesten Erinnerungen. Die Zigaretten im Auto, die in der Küche. Der Geruch von kaltem Rauch und Tabak. Ich kann nicht behaupten, dass ich diesen Geruch als Kind annähernd so unangenehm empfunden habe, wie ich es heute tue. Er war mein Vater und der roch nun einmal so, wie er roch.
Meine Mutter und ich lassen ihm seine Droge. Mein Bruder, mein Onkel und meine Tante rümpfen – wenn es ums Rauchen geht – bei jeder Gelegenheit die Nase. Nicht nur, weil es riecht.
Meine Mutter fragt: »Soll ich es ihm verbieten?«
Mein Vater sagt: »Jetzt ist doch sowieso alles egal.«
Nachmittags, als die Familie zu Besuch ist, raucht er selbstverständlich nicht, jedenfalls nicht vor den Augen der Anderen. Wir sitzen wie immer an einer gedeckten Tafel, essen Kuchen. Mein Vater isst seinen Kuchen mit etwas zu viel Sahne. Es ist fast wie früher und doch ist er gar nicht so.
Mein Vater hört uns zu, er guckt uns an und ist doch seltsam teilnahmslos. Verzögert. Verlangsamt. So, als würde er träumen. Als wären wir, die Gesunden, nicht real. Doch sein vermeintlicher Traum wird für uns alle zum andauernden Alptraum. Ist er noch unter uns? Oder hat er sich schon verabschiedet? Seine Augen sind langsam, blicken manchmal ziellos in der Ferne.
Als er zur Toilette schleicht, nutze ich die Gelegenheit, meiner Familie eindringlich von der 100-Tage-Diagnose zu berichten, die ich vor einem Tag erhielt. Ich halte es für sinnvoll, das möglichst schnörkellos und direkt zu tun.
Ich sage: »Uns läuft die Zeit weg.«
Alle gucken mich ungläubig, fast irritiert an. »Der Überbringer schlechter Nachrichten wird erschossen«, sagt mein guter Freund Daniel immer. Und in diesem Moment fühle ich mich, als seien sechs Gewehrläufe direkt auf mich gerichtet.
Egal, ich spreche weiter. Sie müssen es wissen. Ich appelliere an meine Familie, dass niemand zögern solle, die Dinge zu tun, die er oder sie immer schon mit meinem Vater tun wollte, bevor es zu spät ist. Und es wird bald zu spät sein. Mein Onkel, der sonst nie um ein Wort verlegen ist, verstummt. Auch seine Augen sind plötzlich feucht. Unser Nachbar nimmt einen großen Schluck Bier und lässt sich einen Wodka nachschenken.
Mein Bruder sagt: »Dann fahre ich eben mit ihm in die Schweiz …«
Er meint zum Sterben. Zur Sterbehilfe. Mein Bruder, der Vordenker. Mein Bruder, der Fachmann fürs Leben. Ich will schreien, tue es aber nicht.
Ich sage: »Ich habe kein Problem mit einem assistierten Suizid, aber ich glaube, der Wunsch muss von dem Betroffenen selbst kommen. Willst Du Papa sagen, dass Du ihn ans Ende des Tunnels fährst, oder soll ich es besser tun?«
Mein Bruder sagt nichts mehr – und das ist auch besser so.
Als mein Vater von der Toilette zurückkommt, tun alle so, als sei nichts gewesen. Mein Vater hat ganz offensichtlich auch keinen Zweifel daran. Er wackelt mit den Ohren und alle lachen. Er sieht nicht, dass viele von uns feuchte Augen haben. Und falls doch, überspielt er es mit seinem Gewackel.
Ich gehe mit ihm zum Rauchen in die Küche, heimlich natürlich. Ich gebe ihm schon vor der Zigarette ein Kräuter-Bonbon, damit es hinterher keiner riecht, dass er geraucht hat. Er sitzt mit dem Rücken vor dem Fenster, ich gebe ihm Feuer. Ich knie vor meinem Vater nieder und bin ihm so nah, wie vielleicht seit Jahrzehnten nicht mehr. »Wenn die Eltern gehen, müssen die Söhne an die Front«, sagt meine Freundin Britta immer. Und sie hat Recht. Ich muss jetzt an die Front, dort wo gestorben wird. Nur, dass ich meinen Rucksack noch nicht packen möchte, sondern eher noch Dinge aus unserem gemeinsamen Rucksack auspacken und sortieren muss, bevor es zu spät ist. Dieser Gedanke ist fortan immer da. Ich trage unseren Rucksack jetzt vorne, direkt vor der Brust. Nicht hinten, wo ich ihn übersehen kann. Ist er schwerer geworden? Ich glaube ja.
Wann sage ich ihm, dass ich ihn liebe? Und wie? In meiner Erinnerung habe ich ihm das nie gesagt, eher sogar, dass ich ihn hasse. Ich schäme mich heute dafür. Sage mir, dass ich nichts Vergangenes ändern kann.
Ich sage meinem Vater, dass ich ab sofort immer kommen werde, wenn er mich sehen will. Dass er es nur sagen muss. Er hat mir versprochen, mein Angebot anzunehmen.
98
Mein Vater sagt: »Michi, mit meinem Kopf stimmt wieder etwas nicht.«
Gestern war ich noch in Hamburg, heute bin ich wieder in Berlin. Eigentlich hatte ich mir zur Abwechslung mal einen Tag ohne Hiobsbotschaften gewünscht. Aber dass meine Wünsche derzeit nicht erfüllt werden, daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Ich hole einmal tief Luft und halte den Telefonhörer eine Idee fester.
Mein Vater erlebte auch schon seine erste Metastase im Gehirn bei vollem Bewusstsein. Er begann, sich plötzlich zu verändern. Verließ das Haus ohne Schlüssel, kam ohne Schirm zurück und hatte Mühe mit dem Sprechen. Dass sich etwas veränderte, war ihm immer klar. Wie lange er es vor uns verbergen wollte oder gar konnte, weiß ich nicht.
Ich frage: »Was stimmt denn nicht?«
Mein Vater sagt: »Ich glaube, da wächst wieder was.«
Ich frage, ob ihm etwas wehtue, er verneint.
Er sagt: »Aber ich fühle mich komisch.«
Ich sage: »Du bist halt sehr mitgenommen gerade, das ist doch normal nach dem, was Du durchgemacht hast.«
Manchmal fühlt sich mein Vater so unsicher, dass er nicht allein vom Wohnzimmer in die Küche gehen möchte. Ohne einen zweistündigen Mittagsschlaf ist er am Nachmittag nicht zu gebrauchen. Manchmal ist er danach eigentlich so wie immer, manchmal geht es ihm nach dem Mittagsschlaf eher noch schlechter.
Meine Mutter verlässt seither das Haus kaum noch. Der Gedanke, meinem Vater könne in einer auch noch so kurzen Abwesenheit etwas zustoßen, wird von Tag zu Tag größer.
Ich sage: »Was soll ihm denn jetzt noch Schlimmes passieren? Denkst Du, er bricht sich das Genick beim Händewaschen? Das wäre für uns alle vielleicht ein Segen …«
Als sie meine Worte hört, lacht sie kurz. Nicht zu lang, das wäre unangebracht.
Meine Mutter sagt: »Ach, Michi. Das ist nicht witzig. Ich mag ihn einfach nicht allein lassen. Auch, wenn er uns bald allein lässt.«
Wir allein, ohne ihn. Geht das überhaupt? Es gab Zeiten, in denen ich meine Eltern nur streitend erinnere und mir gewünscht habe, dass wir ihn verlassen. Jetzt verlässt er uns und ich wünsche mir nichts mehr, als dass er noch ein bisschen bliebe. Wie sich die Perspektiven und Gefühle doch ändern können. Wer soll damit bloß zurechtkommen?
Ich lerne in diesen Tagen: Der Krebs lässt sich nicht beeinflussen, er tut, was er will. Und wir müssen mitspielen bis zum bitteren Ende. Und es wirkt in der Tat, wie ein Spiel. Nur, dass wir die Spielfiguren eines übermächtigen Spielers sind, der gleichzeitig auch Gegner ist.
Der Zustand meines Vaters ist besorgniserregend. Das höre ich sogar durchs Telefon. Ich versuche dennoch, ihn zu beruhigen. Woher ich meine Ruhe nehme? Ich weiß es nicht. Ich scheine im Ernstfall, mitten im Terroranschlag auf unser Leben, gerade Kräfte zu entwickeln, von denen ich nicht einmal zu träumen gewagt habe.
Ist das vielleicht auch sein Verdienst? Wundern würde es mich, stand mein Vater mir doch nie so nah, wie meine Mutter. Zumindest glaubte ich das drei Jahrzehnte lang. Aber kann es sein, dass ich mehr von meinem Vater gelernt habe, als mir immer lieb gewesen wäre? Nämlich im Notfall emotionslos zu sein? Sachlich, fast kalt? Es scheint mir so. Entscheide ich sonst überwiegend aus dem Bauch heraus oder bin Sklave meiner Launen, macht mich der Ernstfall jetzt zum sachlichen Analytiker.
Ich gestatte mir keine Panik. Denn alles, was mich panisch erscheinen lässt, muss jedem Kranken wie ein Schlag ins Gesicht vorkommen. Ist doch meine Panik im Vergleich zur Krankheit nur ein Fliegenschiss. Gleichzeitig mache ich mir immer wieder bewusst, dass die Zeit knapp wird. Es gibt ein heute, ein Morgen und wahrscheinlich auch ein Übermorgen. Aber nächste Woche? Nächsten Monat?
Ich klammere mich ans Telefon, wie ganz früher an seine Hand. Aber das sieht mein Vater zum Glück nicht.
Ich sage: »Ich habe nicht den Eindruck, dass Du wieder so abwesend bist, wie bei der ersten Metastase.«
Er antwortet: »Das sagt Mama auch. Aber … aber … aber …«
Sein Satz führt ins Leere. Das passiert jetzt häufiger. Wieder einmal ertappe ich mich dabei, dass ich meinen Vater beschützen möchte.
Ich sage: »Na siehst Du. Wir tricksen den Krebs einfach aus und geben ihm etwas, dass Du nicht brauchst.«
Mein Vater lacht, ich auch. Diese plötzliche, ungewöhnliche Nähe zwischen uns irritiert mich. Seine Ruhe beruhigt auch mich.
Als meinem Vater der Mittelfinger amputiert wurde, weil sich am Gelenk eine Metastase entwickelt hatte, war ich derjenige, der unruhig war. Wie würde ich ihm jemals wieder die Hand geben können? Wie würde ich allein den Anblick ertragen? Ich, der doch schon die Narbe nach der OP an der Lunge grausam fand.
Als Kind hatte ich Angst vor seiner Hand. Dass er mir eine Backpfeife verpasste – und zwar auch noch vor den Augen meines besten Freundes –, nur weil ich ihm mit der Wasserpistole ins Gesicht gespritzt hatte, das habe ich ihm lange nicht verziehen. Eigentlich bis heute nicht. Doch jetzt war diese Hand, die fortan nur noch vier Finger haben sollte, plötzlich merkwürdig klein und schwach. Ich hatte in Wahrheit wieder Angst vor ihr – nur aus anderen Gründen.
Doch mein Vater beruhigte mich. Er sagte mir, dass er den Finger nicht brauche und froh sei, dass er keine Schmerzen mehr habe, wenn der Finger endlich weg sei. Seinen Hintern, so sagte er, könne er sich zur Not auch mit links abwischen. Und an den Anblick an seine rechte Hand ohne Mittelfinger gewöhnte ich mich schon nach wenigen Minuten. Fast sah sie so aus, als habe sie niemals fünf Finger gehabt.
Ich weiß nicht, ob es sein Galgenhumor oder sein Desinteresse war – oder einfach nur die Kontrolle über seine Emotionen. Mein Vater nahm alles einfach so hin, wie es ihm passierte. Heute bewundere ich ihn fast für diese Haltung.
Ich habe mich im Verlauf seiner Erkrankung, ganz besonders am Anfang, oft mit ihm gestritten. Dass er nicht alles einfach so hinnehmen dürfe, dass er immer einmal mehr nachfragen müsse, als einmal zu wenig. Er sagte dann immer, dass die Ärzte schon wissen, was sie tun. Damit gab ich mich nie zufrieden.
Ich sage: »Du musst sie nerven, damit sie Dich im Kopf haben!«
Er antwortet, dass er das vermutlich nicht so gut könne, wie ich. Ich glaube, das war das erste Mal überhaupt, dass mein Vater mir sagte, dass ich irgendetwas gut oder sogar besser kann als er. Dabei war er es wohl, der sein Sterben von uns allen am besten akzeptierte.
Später an diesem Tag telefonierte ich nochmal mit meiner Mutter. Sie fragt mich, ob mein Vater mir vom Hospiz erzählt habe. Ich verneine. Das Thema beschäftigte uns schon eine Weile, allerdings ohne ihn.
Sie sagt: »Er hat sich heute eine Broschüre durchgelesen und gesagt, ›finde ich gut‹. Er will wissen, ob er ein Einzelzimmer bekommt und seine eigenen Sachen mitnehmen kann.«
Meine Mutter hat meinen Vater in den vergangenen Wochen fast rund um die Uhr betreut. Er kann zwar vieles noch allein, aber sie möchte ihn eben nicht allein lassen. Wir haben öfters überlegt, wie wir mit der Situation umgehen, wenn er zu Hause nicht mehr gut betreut werden kann. Wenn die Schmerzen zu stark oder die Luft zu knapp werden. Ich hätte alles verwettet, dass mein Vater sich lieber aus seinem Zuhause heraustragen lassen wird, als dass er eine Pflegeeinrichtung oder ein Hospiz beziehen würde. Wieder hat er mich überrascht.
97
Durch seine Krankheit fällt meinem Vater das Sprechen schwer. Dennoch reden meine Mutter und er – und auch er und ich – so viel und so oft wie selten zuvor. Oft ist Belangloses dabei. Manchmal möchte ich einfach nur seine Stimme hören. Und immer wieder muss ich mir einfach nur durch einen Anruf bestätigen lassen, dass er noch lebt. Früher haben wir manchmal wochenlang nicht miteinander gesprochen. Telefonate waren auf ein Minimum reduziert, weswegen meine Mutter sich die eine oder andere Standpauke über ihren Sohn anhören musste. Aber wir hatten uns einfach nicht viel zu sagen. Komisch, dass wir jetzt sogar zwanzigminütige Gespräche über das Wetter führen können. Habe ich ein schlechtes Gewissen oder hat er eins? Ich frage ihn nicht, warum wir jahrelang nicht richtig miteinander sprechen konnten. Aber ich merke, dass er sich auch wundert, warum wir es jetzt tun.
Erstaunlicherweise sprechen wir besonders intensiv über seinen Tod. Mein Vater, das ist der Mann, der stets hundertzwanzig Jahre alt werden wollte. Diese Zahl stand immer im Raum. Trotz Zigaretten und ohne Sport. »Schach ist auch Sport!«, konterte er immer, wenn ich ihm seine leicht nachlässige Figur vorhielt. Jetzt erlebt er wohl nicht mal mehr seinen achtzigsten Geburtstag im August.
Mein Vater fragt: »Wann kann ich ins Hospiz ziehen?«
Hospiz, auch so ein Wort, bei dem Leiden, Sterben und Tod automatisch mitschwingen. Dennoch hat meine Mutter das Thema mehr oder weniger subtil aufs Tableau gebracht – und sämtliche Broschüren dazu aus dem Krankenhaus und der onkologischen Praxis mitgebracht, damit mein Vater sie lesen kann, lesen muss. Das hat er offenbar getan.
Ich hätte nie angenommen, dass mein Vater sein Zuhause freiwillig verlassen würde. Wenn, dann nur mit den Füßen voraus. Ich kenne niemanden, der so stur ist wie er. Niemals hätte man ihn von einer Sache überzeugen können. Ich habe zwanzig Jahre erfolglos damit verbracht, ihn zu überreden, einmal Sushi zu probieren – abgelehnt. Elektrische Fensterheber, eine Zentralverriegelung, eine Klimaanlage oder – Gott bewahre! – Kabelfernsehen waren ähnlich vehement abgelehnte Neuerungen. Doch beim Thema Hospiz war er plötzlich offen für Veränderungen.
Meine Mutter sagt: »Es kann zwischen einer und drei Wochen dauern, bis Du ins Hospiz einziehen kannst.«
Dann Stille.
Mein Vater guckt meine Mutter traurig an. Noch drei Wochen. Früher sind wir in den Sommerferien immer drei Wochen nach Dänemark gefahren. Oder mit dem Auto nach Jugoslawien, als es noch so hieß.
Mein Vater sagt: »Drei Wochen werde ich wohl nicht mehr schaffen.«
Wieder Stille. Ob er es ernst meint, wissen weder meine Mutter noch mein Vater. Und ich weiß sowieso nicht mehr, was wahr und was unwahr ist. Meine Welt ist so unwirklich geworden.
Mein Vater fragt: »Wo willst Du denn eigentlich hin, wenn Du tot bist?«
Er fragt meine Mutter beinahe so, als würde er annehmen, dass sie gemeinsam in den Tod reisen würden. Mein Vater scheint zu sehen, dass seine Frage meine Mutter leicht irritiert.
Meine Mutter sagt: »Ich möchte anonym beerdigt werden. Irgendwann treffen wir uns da alle und können mit Wolfgang Karten spielen.«
Wolfgang, das ist mein Onkel, der älteste Bruder meines Vaters und seit ein paar Jahren tot.
Als meine Mutter mir Stunden später von diesem Dialog erzählt, bricht ihre Stimme. Überhaupt wird sie immer zerbrechlicher. Weinen ist Teil unseres Alltags geworden. Entweder weint mein Vater, meine Mutter, ich weine oder wir alle zusammen.
Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht weinen. Waren es früher – damals gefühlt seltene, aus heutiger Sicht vielleicht doch nicht so wenige – Glücksmomente, die uns als Familie zusammenschweißten, sind es jetzt unsere Tränen. Und es sind so viele.
Mein Vater sagt: »Anonym beerdigt werden. Das möchte ich auch. Einer von uns beiden muss ja zuerst gehen. Ich warte auf Dich.«
96
Er: »Hallo Michi!«
Ich: »Hallo Papa! Wie geht’s Dir?«
Er: »Es geht gar nicht.«
Schweigen.
Ich: »Warum? Tut Dir was weh?«
Er: »Nein.«
Ich atme tief ein.
Ich: »Aber das ist doch gut!«
Er: »Nein. Die Füße sind schlecht.«
Ich: »Es tut Dir also doch was weh?«
Noch nimmt mein Vater keine Schmerzmedikamente. Vielleicht müssen wir das ändern.
Er: »Nein. Keine Schmerzen. Aber die Füße wollen nicht.«
Ich: »Willst Du meine haben?«
Wir lachen beide.
Er: »Ja. Aber kommst Du denn ohne zurecht?«
Ich: »Nein. Nur wenn Du mich in Zukunft dann immer im Rollstuhl schiebst. Ohne Füße kann ich ja wohl schlecht laufen.«
Er: »Das ist richtig. Aber ich bin ja bald weg. Dann kann ich Dich nicht mehr schieben.«
Immer wieder dieser Tod. Immer wieder spricht mein Vater ihn an. Hat er sich abgefunden oder will er uns aufrütteln?
Ich: »Das wissen wir doch nicht so genau.«
Er: »Doch. Ich weiß das.«
Ich: »Dann behalte ich meine Füße wohl besser.«
Er: »Ich glaube auch.«
95
Sechs Wochen nach der OP am Gehirn. Mein Vater hat einen Kontrolltermin im Krankenhaus. Normalerweise sagt man Patienten zu solchen Gelegenheiten immer, wie gut alles verlaufen sei. Ein bisschen Schulterklopfen hier, ein bisschen Eigenlob da. Dr. S. sagt erst mal – nichts.
Dr. S. ist jünger als ich, Anfang dreißig vielleicht. Ich erinnere mich, wie er bei unserem ersten Treffen davon sprach, dass er seinem Großvater auch zu einer solchen Operation raten würde. Großvater? Mein Vater war zwar immer einer der ältesten Väter in meinem Umfeld, an meinen Opa, den ich nie gekannt habe, hätte ich in seinem Zusammenhang allerdings nie gedacht.
Er ringt mit Fassung, als er meinen Vater sieht. Vor wenigen Wochen, wie gesagt, sagte er meiner Mutter und mir noch, dass eine OP am Gehirn im Falle meines Vaters für alle Beteiligten das Allerbeste sei. Die Lage des Tumors? Ein Glücksfall. Seine Beschaffenheit? Nahezu ideal. Statistisch gesehen nur vier Prozent Risiko. Und: Welche Gefahr geht schon von lächerlichen vier Prozent aus, wenn man sowieso zu hundert Prozent dem Tod geweiht ist?
Jetzt kann Dr. S. meinem Vater nur schlecht in die Augen sehen. Meine Mutter wird mir später sagen, wie leid es Dr. S. getan habe, dass er anfangs so optimistisch gewesen sei, und am Ende meinem Vater doch nur mehr Strapazen zugemutet habe.
Diese Operation erschien für einen kurzen Augenblick als hoffnungsvolle Chance, den Verlauf seiner Krankheit beeinflussen zu können und das Schicksal meines Vaters abzuwenden. Trotzdem hat die Diskussion über das Für und Wider eines Eingriffs die Familie in zwei Lager geteilt.
Die Ärzte sagten: »Wir können Ihnen allenfalls Zeit schenken.«
Wie diese Zeit verlaufen würde, wagten sie allerdings nicht zu prognostizieren.
Wir wollten meinen Vater den zusätzlichen Belastungen einer Operation am Gehirn eigentlich nicht aussetzen. Er war ein paar Tage nicht in der Lage, selbst zu entscheiden. Wir wollten im wahrsten Sinne nicht über seinen Kopf hinweg entscheiden. Wie durch ein Wunder kam er nach ein paar Tagen wieder zu sich. Erkannte er vor wenigen Tagen nicht einmal mehr seinen eigenen Sohn am Telefon, wusste er plötzlich wieder, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin und Deutschland Fußball-Weltmeister ist. Wieder bei Sinnen, entschied er sich nun selbst für die Operation.
Natürlich war er nach dieser erneuten OP, der wohl fünften Vollnarkose innerhalb eines halben Jahres, nicht der Alte, aber wir hatten doch Hoffnung. Das hatten wir immer, selbst nach der 100-Tage-Diagnose.
Nun war klar, dass der Krebs die Oberhand zurückgewonnen hat. Und Dr. S. hat deshalb wohl ein schlechtes Gewissen. Er gibt meiner Mutter seine Handynummer und versichert ihr seine ganze Unterstützung. Er ruft in einer Palliativstation an, die meinen Vater, sollte die Wartezeit bis zum Hospiz zu lange dauern, ab sofort garantiert aufnehmen wird. Ebenso schreibt er, wie der Onkologe auch schon, eine Empfehlung für eine stationäre Unterbringung im Hospiz. Meine Mutter ringt mit der Fassung. Wieder mal. Meine Tante, die meine Eltern ins Krankenhaus gefahren hat, wartet zum Glück vor dem Sprechzimmer. Mein Vater hat in den letzten Wochen zwar das öffentliche Weinen gelernt, aber das es ihm angenehm ist, kann ich mir nicht vorstellen.
Dr. S. wünscht meinen Eltern alles Gute. Mein Vater sagt später zu mir, er glaube, er meine es ernst. Ich frage, ob er denn noch mal wiederkommen soll. Ich höre lange nichts.
Mein Vater sagt: »Nein, Michi. Wozu denn?«
Ich beginne daran zu zweifeln, dass die Hoffnung zuletzt stirbt. So, wie es aussieht, wird mein Vater dieses Duell gewinnen. Zumal er mir neuerdings immer wieder sagt, dass er nicht nochmal ins Krankenhaus wolle.
Ich frage: »Ist es so schlimm?«
Mein Vater sagt: »Mir ist nicht gut heute.«
Ich frage: »Wo denn?«
Mein Vater sagt: »Nirgends.«
Was soll man einem Mann sagen, der sich schon in den guten Tagen nie wirklich etwas sagen lassen wollte? Ich schweige und höre weiter zu. Immer wieder betont mein Vater auf einmal, dass er am liebsten sofort in ein Hospiz ziehen möchte. Auch die Tatsache, dass es nicht nur sein Abschied vom seinem Leben, sondern auch unser Abschied von ihm sein wird, lässt ihn nicht innehalten.
Mein Vater sagt: »Ich will nicht zu Hause an Nierenversagen sterben.«
Ich sage: »Das will ich auch nicht. Aber lass uns trotzdem bis morgen warten. Wir müssen jeden Tag so nehmen, wie er kommt.«
Mein Vater sagt: »Was soll denn da noch kommen?«
94
Heute kommt der MdK. Endlich. Der MdK, das ist der Medizinische Dienst der Krankenkassen. Meine letzte Begegnung mit dieser Institution liegt ungefähr zwanzig Jahre zurück. Ich war Zivildienstleistender im Pflegeheim und schon in jungen Jahren umgeben von Krankheit und Tod. Geschadet hat mir das nicht, im Gegenteil. Auch wenn es teilweise Menschen waren, die fünfmal so alt waren wie ich, bin ich jeden Tag gerne zum Dienst gegangen, auch wenn das bedeutete, dass Menschen, die mir teilweise so sehr ans Herz wuchsen, wie meine eigene Oma, plötzlich starben.
»Gestorben wird immer im November …« ist so ein Satz aus dieser Zeit. Oder auch: »Im Frühjahr stirbt man nicht.« Ich kenne keine Statistik, aber ich ahne, dass beide Sätze grober Unfug waren. Dass der Alltag im Altenheim meinen Umgang mit dem Tod allerdings entscheidend verändert hat, wurde mir erst später bewusst.
Der Tod hatte unsere Familie schon aufgesucht, als ich noch in die Grundschule ging. Es war mir schon damals klar, dass wir nicht ewig leben werden. Auf die Beerdigungen zahlreicher Familienmitglieder durfte ich, wohl zu meinem eigenen Schutz, trotzdem nicht gehen. Auch so ein Punkt in meinem Leben, den ich nie ganz verstehen werde oder verstanden habe.
Unser Verhältnis zum Sterben und zum Tod ist in meinen Augen auch deshalb so dysfunktional, weil wir alles tun, um ihn aus unserem Leben zu verbannen. Es ist okay, dass wir gerne jung oder zumindest gesund bleiben wollen, aber das Ziel unserer Reise sollten wir alle kennen.
Ich war das letzte Mitglied der Familie, das meine Großmutter mütterlicherseits lebend sah. Wir trafen uns auf der Straße, als ich auf dem Heimweg aus der Schule war. Meine Oma wünschte mir einen guten Appetit und freute sich schon darauf, dass sie mir am Ende der Woche wieder Kartoffelpuffer mit Apfelmus kochen werde. Daraus wurde leider nichts. In der Nacht nach unserer letzten, zufälligen Begegnung starb sie in ihrem Bett, weil sie ihr Asthmaspray nicht finden konnte. Gefunden wurde sie selbst einen Tag später, nachdem die Feuerwehr ihre Tür aufgebrochen hatte. Meine Mutter hat die Wohnung ihrer toten Mutter damals nicht betreten, weil sie ihre Leiche nicht sehen wollte.
Meine erste Leiche sah ich elf Jahre später. Der Anblick einer Dame, zu der ich im Pflegeheim damals nur selten Kontakt hatte, stand im krassen Widerspruch zu so allem, was das Fernsehen mich über Leichen glauben lassen wollte. Ich betrat für einen kurzen Augenblick das Zimmer der Toten. Sie war weit über achtzig und lag die letzten Jahre davon im Bett. Ich konnte mich an keinen schönen Moment von oder besser gesagt mit ihr erinnern, doch als ich ihren toten Körper sah, wirkte sie zufrieden und beinahe glücklich.
Ihr Zimmer war auf eine eigentümliche Art und Weise still, wie abgekapselt von der Welt. Ich weiß noch, dass ich sie namentlich angesprochen und mich von ihr verabschiedet, ihr alles Gute gewünscht habe. Damals konnte ich nicht einmal ahnen, dass es wie meine Generalprobe mit dem Tod war.