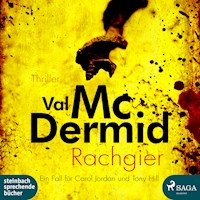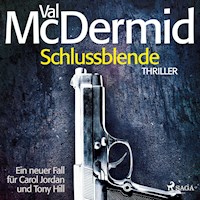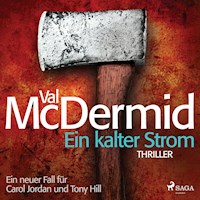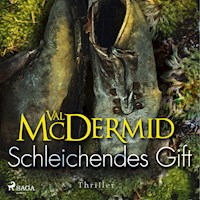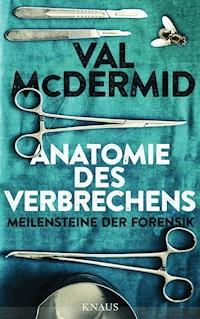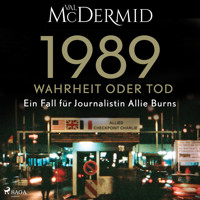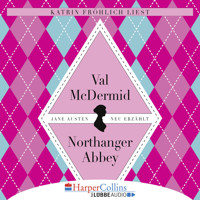9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Journalistin Allie Burns
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Journalistin Allie Burns im Hexenkessel Berlin: »1989 – Wahrheit oder Tod« ist der 2. Teil der rasanten Krimi-Reihe von Bestseller-Autorin Val McDermid um eine Journalistin, die kein Risiko scheut, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. 1989 ist ein Schicksalsjahr für Europa: Eine unheimliche neue Seuche breitet sich aus, und die Welt hinter dem Eisernen Vorhang verändert sich rasant. 10 Jahre nach einer journalistischen Enthüllung, die sie beinahe das Leben gekostet hätte, arbeitet Allie Burns als Leitende Redakteurin in Manchester und ist mehr denn je entschlossen, den Kranken und Ausgestoßenen der Gesellschaft eine Stimme zu geben. Ihr Recherchen weisen Allie jedoch einen gefährlichen Weg: nach Ost-Berlin, das am Rande der Revolution steht. Und der dunkle Kern ihrer Story ist schockierender, als Allie ahnen kann. Um diese Geschichte zu erzählen, muss die Journalistin erneut ihre Freiheit und ihr Leben riskieren … Mit ihren Kriminalromanen um die Journalistin Allie Burns erinnert die vielfache internationale Bestseller-Autorin Val McDermid an die großen, relevanten Themen, die Politik und Gesellschaft in den letzten 40 Jahren bewegt haben – und schafft dabei hoch atmosphärische Gänsehaut-Spannung zum Mitfiebern. »Die außergewöhnliche Atmosphäre und der ausgeprägte Charakter der Zeit machen den Roman neben der wundervollen Protagonistin zu einem besonderen Leseerlebnis.« Krimi-Couch über den 1. Teil der Krimi-Reihe, »1979 – Jägerin und Gejagte«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 617
Ähnliche
Val McDermid
1989
Wahrheit oder Tod
Aus dem Englischen von Kirsten Reimers
Knaur eBooks
Über dieses Buch
1989 ist ein Schicksalsjahr für Europa: Eine unheimliche neue Seuche breitet sich aus, und die Welt hinter dem Eisernen Vorhang verändert sich rasant. 10 Jahre nach einer journalistischen Enthüllung, die sie beinahe das Leben gekostet hätte, arbeitet Allie Burns als Leitende Redakteurin in Manchester und ist mehr denn je entschlossen, den Kranken und Ausgestoßenen der Gesellschaft eine Stimme zu geben. Ihr Recherchen weisen Allie jedoch einen gefährlichen Weg: nach Ost-Berlin, das am Rande der Revolution steht. Und der dunkle Kern ihrer Story ist schockierender, als Allie ahnen kann. Um diese Geschichte zu erzählen, muss die Journalistin erneut ihre Freiheit und ihr Leben riskieren …
Mit ihren Kriminalromanen um die Journalistin Allie Burns erinnert die vielfache internationale Bestsellerautorin Val McDermid an die großen, relevanten Themen, die Politik und Gesellschaft in den letzten 40 Jahren bewegt haben – und schafft dabei hoch atmosphärische Gänsehaut-Spannung zum Mitfiebern.
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
Zeitungsartikel vom 14. Mai 1989
Zeitungsartikel vom 6. Juni 1989
Zeitungsartikel vom 25. Juli 1989
Zeitungsartikel vom 10. November 1989
Danksagung
Meine vierzig Lieblingssongs für 1989 – Wahrheit oder Tod
Leseprobe »1979«
Für Jo zum 20. Geburtstag.
Keine Sorge, alles wird gut.
Im Rückblick erscheinen mir die 1980er-Jahre als eine echt fürchterliche, grottenschlechte Zeit.
Pete Burns
Wenn ich mich an die 1980er-Jahre zurückerinnere, muss ich mich immer kneifen. Habe ich das alles wirklich getan?
Cynthia Payne
Prolog
Endlich hatte sich das Wetter geändert. Erst als sich seine Schultern lösten, merkte er, wie angespannt er gewesen war. Er hatte nur eine Woche Urlaub, und als die Tage dahintröpfelten und immer nur weitere atlantische Stürme brachten, hatte er schon befürchtet, er müsse seinen Plan aufgeben. Doch schließlich hatte am vierten Tag der Wind nachgelassen, sodass ein Segeltörn möglich war. An einem kalten blauen Morgen lichtete er den Anker in der Tobermory Bay, startete den Motor, tuckerte in die Fahrrinne und steuerte in Richtung Nordwest.
Der Wind kam aus südwestlicher Richtung. Ungefähr Stärke vier, schätzte er. Das war nicht perfekt, aber er setzte die Segel so, dass er den Wind möglichst optimal nutzen konnte, und richtete sich auf eine rund vierstündige Segeltour an Coll vorbei nach Ranaig ein. »Segel« war dabei das entscheidende Wort. Den Motor wollte er nur so sparsam wie möglich nutzen, damit nicht nachzuvollziehen war, wie weit er gefahren war.
Das Boot, das er für eine Woche in Tobermory gemietet hatte, besaß eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Wanne, aber man gewöhnte sich schnell daran, und es war gut geeignet fürs Einhandsegeln. Die Dünung des Meeres war nicht ohne, manchem wäre wohl etwas mulmig zumute gewesen. Aber er hatte vor der nordwalisischen Küste segeln gelernt und hatte der Irischen See bei jedem Wetter getrotzt. Auf einem kleinen Boot bei gutem Wetter allein zu segeln, schreckte ihn nicht besonders.
Der Wind flüsterte in den Segeln, und der Bug teilte zischend das Wasser, doch beides unterbrach ihn nicht in seinen Gedanken. Er hatte Monate darauf verwendet, sich zu überlegen, wie er Wallace Lockhart töten würde. Plan über Plan hatte er entwickelt und wieder verworfen, bis er bei seinen Nachforschungen endlich auf eine Lösung gestoßen war. Sie passte zu dem, was er konnte, umfasste eine gewisse poetische Gerechtigkeit, und sie barg den wunderbaren Vorteil, dass kein Alibi notwendig war. Ein Mann würde sterben, aber der Zeitpunkt ließ sich nicht vorhersagen. Wann immer Lockhart das Zeitliche segnete, wäre sein Racheengel weit entfernt. Der einzige Wermutstropfen war, dass Lockhart, wenn er im Sterben lag, nicht wissen würde, für welche seiner Grausamkeiten er aus dem Leben scheiden musste.
Am frühen Nachmittag holte er die Segel ein und fuhr mithilfe des Motors in die Bucht auf der atlantischen Seite von Ranaig ein. Hinter dem kleinen Gezeitenkraftwerk, das die Insel mit Energie versorgte, gab es einen verwitterten Holzsteg, an dem er sein Boot festmachte. Er nahm seinen großen Rucksack und kletterte an Land. Als er festen Boden unter den Füßen hatte, atmete er tief ein. Die Luft roch nach Salz und Seetang – und sonst nichts. Er war allein auf der Insel. Er wusste, dass die Hauswirtschafterin und der Bodyguard nur anwesend waren, wenn der Inseleigner sich angekündigt hatte. Doch in dieser Woche sagte er als Zeuge vor einem parlamentarischen Ausschuss aus. Und wenn er nicht selbst befragt wurde, behielt er seine Konkurrenten genau im Blick.
Dem Eindringling würde sich niemand in den Weg stellen.
Ein kaum sichtbarer Fußpfad führte die Bucht hinauf bis zu einem asphaltierten Weg, der den Hubschrauberlandeplatz mit dem Haus verband. Er war breit genug für den Golfwagen, der im Carport auf der Rückseite des Hauses geparkt war, auf drei Seiten durch Balken in Blockhausbauweise vor dem Wetter geschützt. Er überquerte den Weg und näherte sich dem Carport querfeldein. Unter seinen Schritten federte das Machair, jenes typische Gemisch aus Muschelsand und Torf, das durchsetzt war mit heimtückischen Mulden aus nassem Torf, die nur darauf lauerten, ihm die Stiefel von den Füßen zu saugen.
Im Schutz des Carports überprüfte er die Positionen der Sicherheitskameras. Der Herr und Meister der Insel war offensichtlich überzeugt, dass es auf Ranaig nicht besonders gefährlich war: Die Kameras waren fest installiert und überblickten weitläufig das Gelände samt dem Weg. Doch bestimmte Ecken hatten sie nicht im Blick.
Dennoch holte er eine Sturmhaube aus seinem Rucksack und zog sie über. Danach Handschuhe. Es folgte eine Teleskopleiter aus Aluminium, die gerade lang genug war, um ihn in Reichweite der Regenrinne zu bringen. Diese war aus Gusseisen und fest in Mauerwerk und Traufsims verankert mit kräftigen Schrauben, die dafür gemacht waren, den Unwettern zu trotzen, die vom Meer heraufzogen. Zum Schluss schob er sich eine Plastiktüte mit klumpigem Inhalt über das Handgelenk.
Vorsichtig zog er die Leiter aus und lehnte sie gegen die Wand. Danach streifte er die Stiefel ab, erklomm die Sprossen und zog sich schnaufend vor Anstrengung aufs Dach hinauf. Er kroch über das Dach, bis er das erste der bodentiefen Erkerfenster erreicht hatte. Mit der geballten Faust schlug er fest gegen das Fenster. Erste Risse zeigten sich, und er schlug erneut zu. Dieses Mal brach das Glas, das Fenster hatte ein Loch, das groß genug war, um hindurchzugreifen und es zu entriegeln. Es gab dem Wind nach und schwang auf, und er schob sich über den Sims in ein Schlafzimmer.
Mit Bedacht trat er über die Scherben hinweg, öffnete die Einkaufstüte und ließ eine tote Möwe auf den Teppich gleiten, die er tags zuvor am Strand aufgelesen hatte. Würden Lockharts Leute sie entdecken, wäre die nächstliegende Schlussfolgerung, dass die Möwe bei einem Sturm durch das Fenster gekracht war. Das kam vor. Zugegebenermaßen nicht oft. Aber es kam vor.
Offenbar befand er sich in einem Gästezimmer. Gut ausgestattet, doch unpersönlich. Der Mann trat auf den Flur hinaus und öffnete die nächste Tür. Ein weiteres Gästezimmer. Er ging den Flur hinunter, und sobald er die Tür am anderen Ende geöffnet hatte, wusste er, dass er die Schlafräume des Hausherrn gefunden hatte. Gewaltige Panoramafenster führten hinaus aufs Meer und eröffneten einen weiten Blick auf kleine Inseln und große Berge. Es musste grandios sein, mit diesem Ausblick aufzuwachen.
Er interessierte sich jedoch nicht für das Schlafzimmer, sondern für das Bad. Die Idee für seinen Plan hatte er nach der Lektüre eines Interviews mit dem Besitzer der Insel im Condé Nast Traveller Magazine gehabt. Dort gab es die Rubrik »Die wichtigsten Reisebegleiter: Was ich auf Reisen immer dabeihabe«. Unter den Dingen, die seine Zielperson nannte, waren auch Vitamintabletten. »Maßgeschneidert für seine Bedürfnisse von einem der führenden Schweizer Naturheilkundler.« Daneben ein Foto von mehreren dunkelgrünen Gelkapseln. Selbst auf dem kleinen Bild war gut zu erkennen, dass sie aus zwei ineinandergesteckten, zylinderförmigen Hälften bestanden.
Das Bad war ungefähr so groß wie das Wohnzimmer des Eindringlings. Eine Wanne, die bequem einen sehr kräftigen Mann und eine Menge Wasser fassen konnte; eine separate Doppelduschkabine. Eine Toilette, ein Bidet und zwei Waschbecken. Warum ein einzelner Mann zwei Waschbecken brauchte, war ihm zwar unverständlich, aber was wusste er schon von einem solchen Luxusleben. Er öffnete den Badezimmerschrank und entdeckte dort zwischen Toilettenartikeln und verschiedenen Arzneimitteln – unter denen sich zu seiner großen Befriedigung auch drei Präparate zur Behandlung von Hämorrhoiden fanden –, was er gesucht hatte.
Er schraubte den Deckel des Tablettenfläschchens auf und holte eine Kapsel heraus. Sie waren dunkelgrün, damit ihr Inhalt durch Sonnenlicht nicht wirkungslos werden konnte, so hatte es im Artikel gestanden. Seiner Tasche entnahm er eine Phiole mit weißem Pulver. Äußerst vorsichtig trennte er die beiden Hälften der Gelkapsel voneinander und schüttete ihren Inhalt in das nächstgelegene Waschbecken. Dann ersetzte er die Vitamine durch das weiße Pulver und schob die Kapsel wieder zusammen. Er verglich sie mit den anderen im Fläschchen und war zufrieden mit dem Resultat. Dann verschloss er es und stellte es an exakt denselben Platz zurück. Mit ein wenig Wasser reinigte er das Waschbecken, um jegliche Spuren des Vitaminpulvers zu beseitigen.
Zurück ging es, wie er gekommen war: durch das Schlafzimmer, über den Flur, durch das Fenster. Dieses von außen wieder zu verriegeln, war ein bisschen schwierig, doch er bekam es hin. Dann über das Dach zur Leiter, die Füße wieder in die Stiefel und zurück zum Boot. An Bord streifte er Handschuhe und Sturmhaube ab. Irgendwo auf dem Rückweg würde er sie im Meer entsorgen, ebenso die Leiter.
Erst jetzt erlaubte er es sich, zu entspannen. In seinem Rucksack befand sich eine Halbliterflasche guten polnischen Wodkas, von dem er sich nun ein wenig eingoss. Er hob ihn in einem stillen Toast, kippte ihn in einem Zug hinunter und überlegte dann, wie er am besten nach Tobermory zurückkäme.
Er wusste nicht, wann das Zyanid seine Zielperson erwischen würde. Doch es war letztlich nur eine Frage der Zeit.
1
Es nieselte beständig aus den niedrig hängenden Wolken, die farblich zum Schieferdach der Gemeindekirche von Dryfesdale und deren ausgewaschenen Sandsteinmauern passten. Die Welt war monochrom vor Trauer.
Guter Einstieg, dachte Allie Burns und hasste sich sofort für diesen Gedanken. Sie hatte noch vor Sonnenaufgang bei der Kirche sein müssen, um dem Rest der Weltpresse beim Gedenkgottesdienst für die Opfer des Lockerbie-Attentats eine Nasenlänge voraus zu sein. Nur so hatte sie den Hauch einer Chance, einen vernünftigen Exklusivbericht zu schreiben, der noch für die Sonntagsausgabe aktuell sein würde. Der Haupteingang der Kirche war noch verschlossen gewesen, darum hatte sie zwischen den verwitterten Grabmälern aus Sandstein auf der Lauer gelegen, bis der Lieferwagen eines Blumenhandels den Zufahrtsweg hinaufgezockelt kam. Nun schlängelte sie sich durch die Grabsteine hindurch zur Kirchenfront. Eine Frau mittleren Alters in einem Nylonoverall unter der Regenjacke kämpfte mit einer eindrucksvollen Anzahl an Trauerkränzen.
»Ich helfe Ihnen«, sagte Allie. Sie wartete die Antwort nicht ab, sondern fasste sofort mit an.
»Gott sei Dank. Sind Sie von der Kirche?«, wollte die Frau wissen.
Die korrekte Antwort hätte gelautet: »Nein, ich bin die für den Norden zuständige Nachrichtenredakteurin des Sunday Globe.« Doch Allie entschied sich für die weniger problematische Erwiderung: »Ich konnte einfach nicht mit ansehen, wie Sie sich abmühen.«
Gemeinsam entluden sie den Lieferwagen und verfrachteten den Blumenschmuck durch eine unauffällige Seitentür ins Kircheninnere. Mit einem schnellen Blick registrierte Allie die spartanische Einrichtung, die für die Church of Scotland so typisch war: die einfachen Holzbänke, den schlichten Altar und die Kanzel aus heimischen Steinquadern. Die Empore darüber hatte ein Tonnendach, dessen Paneele im Kontrast zu den weißen Rippen in einem unerwarteten Rosa gestrichen waren. Im hinteren Teil der Kirche saß mit gesenktem Kopf ein Junge.
»Oje«, sagte Allies neue Freundin. »Das muss der arme kleine Kerl sein, der seine Mutter, seinen Vater und seinen Bruder verloren hat.«
Allie wusste genau, wen sie meinte. Er war bei einem Freund zum Tischtennisspielen gewesen. Als es den Pan-Am-Flug 103 aufgrund einer von Terroristen gezündeten Bombe über der schottischen Kleinstadt zerrissen hatte, hatten Teile des Flugzeugwracks acht Häuser zerstört. Eines davon war das Zuhause der Familie des Jungen gewesen. Vier Tage vor Weihnachten.
Nun hatte sie einen noch besseren Einstieg.
Bevor sie etwas erwidern konnte, eilten zwei gehetzt wirkende bullige Männer in dunklen Anzügen durch die Seitentür. Sie warfen der Floristin einen flüchtigen Blick zu und konzentrierten sich dann auf Allie, die sich durch ihren gegürteten schwarzen Regenmantel und das modische Schuhwerk verriet.
»Wer sind Sie?«
Allie lächelte gewinnend. Sie hob die Hände und streckte den beiden Männern die Handfläche entgegen. »Bin schon weg«, entgegnete sie.
Der Jüngere der beiden war schneller, als er aussah. Eine Hand schoss vor und ergriff ihren Arm. »Nicht so schnell. Was machen Sie hier?«
»Nichts Schlimmes. Ich bin von der Presse«, seufzte sie. »Ich bin gerade erst eingetroffen, und diese Dame hier sah so aus, als könnte sie Hilfe gebrauchen.« Mit ihrer freien Hand griff sie in ihre Tasche und holte den Presseausweis von der National Union of Journalists hervor. »Ich geh ja schon, wenn Sie mich einfach …« Mit einem Nicken deutete sie auf die Finger, die sie gepackt hielten.
»Sie dürfen hier nicht rein«, schnappte der Mann. »Haben Sie keinen Anstand? Dies ist ein Gedenkgottesdienst, keine Pressekonferenz.« Er ließ sie los. »Verschwinden Sie und mischen Sie sich unter den Rest des Gesindels.«
Allie rang sich ein Lächeln ab. Lass dir niemals anmerken, dass du eingeschüchtert bist, egal ob dein Gegenüber zu den Guten oder den Bösen zählte. Auf dem Weg nach draußen nickte sie der Floristin zu, deren Gesichtsausdruck nicht verriet, was sie dachte.
Während sie in der Kirche gewesen war, war rundherum alles abgesperrt worden, ganz wie Allie es vermutet hatte. Die Scharen von Polizisten waren nicht weiter überraschend, denn die Premierministerin wie auch der US-Botschafter würden am Gottesdienst teilnehmen. Nicht zu vergessen die siebenhundert Trauergäste aus der Stadt und der Umgebung.
Allie entdeckte den abgetrennten Pressebereich; Dutzende von Reportern und Fotografen wurden von einer zusätzlichen Absperrung zurückgehalten. Für sie war da nichts zu holen. Heute war Mittwoch, und die Einzelheiten der Trauerfeier würden von den Journalisten, die für die Tageszeitungen darüber berichteten, viele Male beschrieben werden. Mit etwas Glück bliebe ihr Exklusivbericht bis Sonntag aktuell. Aber es konnte nicht schaden, sich ein bisschen umzusehen. Darum gesellte sie sich nicht zu den anderen Pressevertretern, sondern mischte sich unter die wachsende Menge, die im Regen auf den Bürgersteigen die Hauptstraße säumte. Sie fand einen Platz, der einen guten Blick auf das Hauptportal der Kirche bot, zog einen faltbaren Regenschirm aus ihrer Umhängetasche und ließ ihn aufschnappen.
Die Trauergäste begannen einzutreffen. Manche hatten weiße Nelken dabei, andere Blumensträuße und Gebinde. Viele konnten die Tränen nicht zurückhalten. Allie konnte sich vorstellen, wie tief Schock und Trauer sitzen mussten. Die Katastrophe, die 270 Menschenleben gefordert hatte, lag gerade einmal zwei Wochen zurück, viel zu kurz, als dass der Schutzwall der reflexhaften Verleugnung hatte durchdrungen werden können. Wäre Rona eine derjenigen gewesen, die ohne jede Vorwarnung das Leben verloren hatten, hätte Allie es wohl kaum hinbekommen, auch nur aufrecht zu stehen, geschweige denn, vor den Augen der Weltöffentlichkeit in eine Kirche zu gehen.
Doch zum Glück hatte sie keinen Verlust zu betrauern, auch wenn sie im Ort unterwegs gewesen war in jener Nacht, als das Flugzeug auseinandergebrochen war und Trümmer und Körperteile auf die Stadt und die umliegenden Felder herabgeregnet waren; als sich die Straßen in Feuerströme verwandelt hatten. Allie war über herumliegende Nieten gestolpert und hatte sich das Bein an einem schartigen Stück Metall aufgerissen. Sie hatte die Luft eingeatmet, die von entsetzlichen Brandgerüchen unterschiedlichster Art erfüllt gewesen war, hatte mit Anwohnern gesprochen, die kaum einen Satz herausgebracht hatten. Es war ihr nah gegangen, doch sie hatte kein Recht, heute zu trauern. Mitgefühl, Mitleid, Zorn, ja. Aber keine Trauer.
Erst jetzt fiel ihr auf, dass zum ersten Mal seit zwei Wochen keine Rotoren zu hören waren. Die Militärhubschrauber, die bislang die Umgebung systematisch nach Wrackteilen absuchten, waren am Boden geblieben, vermutlich aus Respekt. Auch auf den Straßen war kein Verkehr. Stattdessen hatte sich Stille schwer auf die Stadt gelegt. Allie hatte noch nie in einer so schweigsamen Menschenmenge gestanden. Es gab keine Gespräche um sie herum, keine Spekulationen, wer wohl am Gottesdienst teilnehmen würde. Nicht einmal die Attentäter wurden mit Verachtung überzogen, auch keine Mutmaßungen über die Drahtzieher hinter dem Attentat ausgetauscht. Nur das sanfte Tröpfeln von Regen auf Regenschirmen war zu hören.
Doch als die Prominenz eintraf, durchlief ein Murmeln die Menschenmenge. Die Premierministerin und ihr Mann, der Oppositionsführer, der US-Botschafter, mehrere weniger bekannte Politiker. Und direkt dahinter der unverwechselbare massige Körper von Wallace »Ace« Lockhart. Über eins achtzig groß, mit kräftigen Beinen, auf denen der massige Rumpf eines aus der Form geratenen Schwergewichtsboxers thronte. Der Zeitungsmogul war gewandet in einen zweireihigen schwarzen Mantel mit Zobelbesatz. Abgerundet wurde dies mit dem unvermeidlichen Homburger. Allie war überzeugt, dass er ihn nur trug, weil er dadurch Churchill entfernt ähnlich sah, besonders wenn er eine seiner Cohiba Esplendidos rauchte.
Das war so typisch für Ace Lockhart. Er drängte sich in eine Veranstaltung, auf der er nichts zu suchen hatte, nur wegen der bizarren Effekthascherei, die ihm eigen war. Ace Lockhart – der alleinige Grund für all ihre aktuellen Probleme. Als wäre der Tag noch nicht hart genug, kam hier der Henker, um sie einen Kopf kürzer zu machen.
Sie erwog, sich aus dem Staub zu machen, bevor die Trauergäste die Kirche verlassen würden. Nur um ihren Chef nicht ein zweites Mal an diesem Tag sehen zu müssen. Auch jetzt versuchte sie, sich zu verbergen. Doch bevor sie eine Lücke in der Menge hinter sich entdecken konnte, hatte er den Kopf in ihre Richtung gedreht, als ob ihr giftiger Blick magnetische Kräfte hätte. Ihre Blicke trafen sich, und sie wusste, vor ihm vom Schauplatz zu verschwinden würde mehr Ärger einbringen, als es wert war. Wenn sie eines in all den Jahren in testosterongeschwängerten Redaktionsräumen überregionaler Zeitungen gelernt hatte, dann, niemals einem Fiesling auch noch Öl ins Feuer zu gießen.
Und sie hatte genug von Ace Lockhart mitbekommen, um zu wissen, was für ein Fiesling er sein konnte. Sie war sehr glücklich mit der Leitung des Investigativressorts des Sunday Globe gewesen, als Lockhart im Kielwasser von Rupert Murdochs Triumph über die Druckergewerkschaften die Globe-&-Clarion-Gruppe gekauft hatte. Lockhart hatte verkündet, Investigativjournalismus sei eine Verschwendung von Geld – zu viel Zeitaufwand für zu wenig Erfolg. Denn Erfolg maß er nur in Geld; Respekt oder die Anerkennung als moralische Instanz zählten für ihn nicht. Außerdem hatte er beschlossen, dass sich auch die Berichterstattung für die nördliche Region nicht lohnte. Lockhart hatte deshalb alle Journalisten außer Allie, zwei Fußballredakteuren und einem Fotografen gefeuert. Was an Arbeit anfiel, sollte von nun an vor allem von Freiberuflern erledigt werden.
Dem Unrecht hatte er noch eine Beleidigung hinzugefügt, indem er ihr den bedeutungslosen Titel »Nachrichtenredakteurin für den Norden« verlieh. Chefin von absolut nichts. Sie verwaltete Freiberufler, beutete Kontakte aus, jagte Schlagzeilen hinterher und hatte überhaupt keine Zeit mehr, die Storys zu verfolgen, die ihr wirklich am Herzen lagen. Er hatte ihr den Job weggenommen, zu dem sie sich mühsam hochgearbeitet hatte, und dann hatte er ihr ein vergiftetes Geschenk gemacht und sie auch noch gezwungen, dies als großmütig zu betrachten. Denn was er ihren Kollegen angetan hatte, war noch schlimmer. Allie wusste das und verachtete sich dennoch dafür, bei Lockharts skrupellosem Spiel mitzumachen. Sorry, Restrukturierungsplan.
Sie schlug den Mantelkragen gegen die Kälte hoch und war dankbar für das Fleecefutter ihrer halbhohen Stiefel – ein Werbegeschenk von einem Mode-Shooting, das ihre Partnerin Rona für das She-Magazin veranstaltet hatte. Allie hatte profitiert von Ronas Abneigung gegen jegliches Schuhwerk (einmal abgesehen von Wanderstiefeln) mit Absätzen, die niedriger waren als fünf Zentimeter.
Allie stand nicht müßig herum. Das tat sie nie. Ihre Blicke schossen umher, suchten die Menschenmenge ab, musterten die Polizei, die Kollegen. Auch ihre Ohren waren auf Empfang, bereit, alles aufzuschnappen, was ihrem Artikel für die Sonntagsausgabe – worum auch immer es darin gehen mochte – Farbe oder Gestalt verleihen konnte. Und sei es nur ein Hinweis, den sie einem der Freiberufler, die ihr nun die Kollegen ersetzten, geben konnte. Sie war vielleicht keine investigative Journalistin mehr, aber die entsprechenden Instinkte, die sie über ein Jahrzehnt lang kultiviert hatte, weigerten sich, zu verkümmern.
Der Gottesdienst war nicht zu überhören, Kirchenchoräle lagen in der Luft, das Gemurmel von Gebeten, vorgetragenen Bibelstellen und Segenssprüchen drang aus der Kirche, und auch die Liveübertragung in Funk und Fernsehen war zu vernehmen. Der Geistliche sprach davon, dass Vergebung wichtiger sei als Rache. Als ob es jemanden gäbe, an dem man sich hätte rächen können, dachte Allie bei sich.
Schließlich öffneten sich die Pforten, und die Trauergäste traten aus der Kirche. Die Köpfe gesenkt aus Schmerz oder gegen das Wetter, wegen der schwarzen Kleidung kaum voneinander zu unterscheiden. Bis auf Lockhart, der den Weg herunterschritt, erhobenen Hauptes, die markanten Augenbrauen hochgezogen, während er die Menge absuchte. Nachdem er die Straße erreicht hatte, löste er sich aus der Trauergemeinde und hielt auf Allie zu. Als er sie ansprach, stand seine honigwarme Stimme im Widerspruch zur Härte seiner Worte. Wie stets. »Burns.« Kunstpause. »Denken Sie daran, mich in Ihrem Artikel zu erwähnen, egal, was Sie für die Sonntagsausgabe schreiben. Vom Clarion sind ein paar Fotografen da, die werden Ihnen Fotos zur Auswahl vorlegen.« Dann ein Lächeln, das der Menge um sie herum ebenso galt wie Allie. Eine Hand zuckte nach oben, als wollte er huldvoll dem Publikum winken, doch er überlegte es sich noch einmal. Wie untypisch für ihn.
Das Jahr war gerade mal vier Tage alt, und doch verachtete sich Allie schon dafür, nach der Pfeife von Lockharts monströsem Ego zu tanzen. Nicht zum ersten Mal fragte sie sich, wie ihre Träume und Ziele so tief hatten sinken können.
2
Der Klang von Enyas »Watermark« begrüßte Allie, als sie die Haustür öffnete, augenblicklich gefolgt von der überglücklich herbeistürmenden Germaine, ihrem Border Terrier. Der Schwanz wackelte wie ein stummeliges Metronom. Allie ging in die Hocke, um ihr die Ohren zu kraulen, danach wandte sie sich der Quelle der Musik zu. Es war erst Mittwoch, doch als Allie in die Küche kam, schien es ihr nach der Schwermut von Lockerbie, als wäre eine fröhliche Samstagabend-Dinnerparty im Gang. Die Überreste einer Käseplatte waren auf dem Tisch verteilt, und Rona hielt Hof. Sie stand kurz vor der Pointe einer Anekdote, die Allie zwar schon kannte, die sie jedoch immer wieder gern hörte. Ronas violettes Seidenshirt, das im Licht schimmerte, verstärkte noch die Dramatik ihrer Geschichte. Um sie herum waren drei ihrer Freunde versammelt, allesamt hingerissen und kichernd. Niemand hatte Allies Eintreten bemerkt, sie blieb stehen und nahm die Szenerie in sich auf. Das waren einige jener Menschen, die sie willkommen geheißen hatten, als sie vor rund sechs Jahren nach Glasgow kamen. Die Menschen, die das Gefühl abschwächten, als wären sie im Exil.
Alix Thomas war Rockschlagzeugerin und Plattenproduzentin – leidenschaftlich, innovativ und provokant –, ihr Glorienschein aus schwarz glänzenden Locken ein Erbe ihres aus Barbados stammenden Vaters, die scharf geschnittenen Gesichtszüge und ihre auffällig grünen Augen hatte sie hingegen von ihrer Mutter aus Manchester. Sie trug ganz entspannt einen Sergio-Tacchini-Jogginganzug aus dem Ausverkauf. Jess Jones, Chemikerin in der Forschungsabteilung eines Pharmariesen, war das, was man als »English Rose« bezeichnete: blond, blauäugig, von unschuldiger Schönheit. Dahinter verbarg sich eine Intelligenz, die keine Gefangenen machte, und ein zynischer Witz, der allen den Boden unter den Füßen wegzog, die sich mit ihr anlegen wollten. Sie hatte ihre übliche Uniform aus gebügeltem weißen Shirt und Jeans an. Und dann war da noch Bill Mortensen, ein Privatdetektiv, dessen apartes Wikinger-Antlitz nicht düsterer hätte sein können und dessen Brillanz im Umgang mit Computern nur überboten wurde von seiner Suche nach der richtigen Frau – was aber möglicherweise durch seine Vorliebe für Poloshirts in Primärfarben und zerknitterte Chinos erschwert wurde. Die drei waren unabhängig voneinander in Allies und Ronas Leben getreten; und dank ihrer Freundschaft fiel es den beiden Frauen inzwischen schwer, sich an die erzwungene Enge ihres Lebens in Glasgow zu erinnern. Dort war es schon schwer genug gewesen, als Frau gleichberechtigt behandelt zu werden; ein Outing als lesbisch hätte für beide das berufliche Aus bedeutet.
Ein paar Jahre lang hatten sie es geschafft, unter dem Homosexuellenradar zu bleiben, indem sie beide ihre Wohnungen behielten, die Nächte jedoch gemeinsam in der Bleibe der einen oder anderen verbrachten. Für Allie hatte es das Fass zum Überlaufen gebracht, als sie eine Story über eine Sozialarbeiterin schreiben sollte, die ihre vier Kinder in der Obhut ihres Lastwagen fahrenden Mannes zurückgelassen hatte, um mit einer Frau zusammenzuziehen. Einer früheren Klientin obendrein, was die Boulevardpresse nur noch weiter anstachelte. Allie hatte ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass der Ehemann wegen häuslicher Gewalt aktenkundig war. Als sie dies dem stellvertretenden Nachrichtenredakteur mitteilte, hatte sich dieser vor Schadenfreude wortwörtlich die Hände gerieben. »Das ist sogar noch besser, Allie. Die herzlose Schlampe lässt ihre Kinder beim gewalttätigen Ehemann. Was für ein Fest!«
Sie kam nicht daran vorbei, den Artikel zu schreiben, deshalb verfasste sie ihn so langweilig wie möglich – eine Frau war gezwungen, ihre Kinder zu verlassen, um sich vor dem brutalen Ehemann in Sicherheit zu bringen –, doch was schließlich in der Zeitung abgedruckt wurde, war ein sensationslüsterner Beitrag über eine halbe Seite, von der Textredaktion so umgeschrieben, dass dessen Homophobie nur noch von seiner Frauenfeindlichkeit übertroffen wurde.
Darum hatte sie unter der Hand verlauten lassen, dass sie einen Job in Manchester suche – eine Stadt, die wegen ihrer Schwulenfreundlichkeit in den Boulevardblättern auch als Gaychester, Gunchester und Madchester bezeichnet wurde. Nach wenigen Monaten erfuhr sie, dass der Sunday Globe sein Investigationsteam vergrößern wollte. Es kam Allie vor wie ein Wunder: Ihr Traumjob eröffnete sich in genau der Stadt, in der sie leben wollte. Ihre einzige Sorge war, was das für ihre Beziehung mit Rona bedeutete.
Sie hätte es besser wissen müssen. Rona reagierte mit einem freudigen Aufschrei, einer Umarmung, bei der sie ihr beinahe den Brustkorb zerquetscht hätte, und einer Flasche Lanson Black Label, die im Kühlschrank nur darauf gewartet hatte, für einen so freudigen Anlass angebrochen zu werden. »Manchester! Absolut grandios!«, sagte sie und prostete Allie zu. »Eine Story an jeder Ecke. Dank meiner Kontakte werde ich leben wie die Made im Speck.«
»Wie das? Versteh ich nicht.«
»Freiberuflichkeit, Allie. Ich kann den engen Themenkorridor der Frauenseite des Clarion hinter mir lassen und endlich über die Sachen schreiben, die ich liebe. Mode, Design, Musik, Theater. Coronation Street.« Ihre Augen leuchteten. »Wir kommen voran in der Welt, Allie.«
Und es schien tatsächlich so. Allie hatte ihre Wohnung verkauft, Rona ihre ausgebaute Remise mit dem Wandgemälde von Alasdair Gray vermietet, und gemeinsam hatten sie ein Haus in Chorltonville gekauft mit einer Hypothek, die Allie immer noch ungeheuerlich hoch vorkam. Aber dank Allies höherem Einkommen und Ronas nie versiegendem Strom an Artikeln kam ausreichend Geld herein. Nach und nach wagten sie sich in die homosexuelle Subkultur der Stadt vor – sehr vorsichtig erst, dann, als ihre Ängste weniger wurden, immer offener – und schlossen Freundschaften.
Und so betrachtete Allie jetzt ihre Partnerin – lebhaft, selbstsicher, das blonde Haar schimmerte im hellen Licht der Küche – und fühlte die vertraute Mischung aus Stolz und Liebe aufwallen, noch genauso stark wie damals bei ihrem ersten Kuss vor fast zehn Jahren.
»Aber Chaz hatte sich die falsche Zimmernummer gemerkt«, sagte Rona und legte Dramatik in ihre Stimme. »Statt 354 nannte er dem Nachtportier die Nummer 345. Und so kam es, liebe Freunde, dass ich nachts um vier von einem nackten Fotografen in meinem Hotelzimmer geweckt wurde.« Während alle lachten, sprang Rona auf und durchquerte den Raum, um Allie in die Arme zu schließen. »Du bist wieder da«, flüsterte sie ihr ins Ohr und küsste sie zärtlich auf den Mundwinkel. Sie zog Allie zum Tisch, wo Alix ihr bereits ein Glas Rotwein eingegossen hatte.
»Wie war es?«, fragte Jess, als Allie ihren Mantel auszog und einen großen Schluck Wein trank.
»Anstrengend. Ich fühle mich wie versunken in der Trauer anderer Menschen.« Allie seufzte und fing Ronas besorgten Blick auf. »Aber sie tragen es mit so viel Würde.«
»Es ist erstaunlich, dass es keine schrillen Rufe nach Rache gibt«, sagte Bill.
»Ich glaube, die Leute stehen noch unter Schock. Sobald die Geheimdienste herausgefunden haben, wer dahintersteckt, gibt es garantiert Vergeltungsmaßnahmen.« Jess griff nach den Weintrauben, löste mehrere, legte sie auf einen Teller mit ein paar Weizencrackern und stellte ihn Allie hin. »Iss«, sagte sie und schob ihr die Käsereste zu.
»Das Bœuf Stroganoff haben wir leider schon aufgegessen«, bemerkte Alix.
»Ich bin nicht besonders hungrig.« Allie schnitt sich ein Stück von dem mürben weißen Lancashire ab und nahm eine Ecke Camembert. »Als wäre die Beerdigung nicht schon heftig genug gewesen, meinte auch noch der verdammte Ace Lockhart, mir klarmachen zu müssen, wo mein Platz ist.«
»Was meinst du damit, Burns?« Alix beugte sich mit zusammengezogenen Augenbrauen vor. Jeder kannte die Storys über Lockhart und seinen Zeitungskrieg mit Rupert Murdoch. Dank Allie hatten ihre Freunde das Gefühl, als wären sie ganz nah dran an dieser überlebensgroßen Person, der die Medienwelt mit einer tiefen Hassliebe anhing. Man verachtete ihn, aber man konnte ihm dennoch nicht widerstehen; er war immer für einen Artikel gut.
Allie seufzte. »Der übliche Egotrip. Er hat mich entdeckt, als er auf dem Weg zum Gottesdienst war, und forderte danach von mir, seine Anwesenheit in meinem Artikel am Sonntag zu erwähnen. Das ist so nervend. Erst macht er mir meine Karriere kaputt, und dann erwartet er auch noch, dass ich seinem Fanclub beitrete.«
»Vermutlich denkt er, er hat deine Karriere vorangebracht und nicht zerstört«, meinte Jessica. »Schließlich hat er das gesamte Team hier im Norden gefeuert, bis auf dich. Wahrscheinlich ist er überzeugt davon, dass du ihm eine Menge schuldest.«
Rona öffnete eine weitere Flasche und schenkte nach. »Falls er überhaupt einen Gedanken an dich verschwendet. Für ihn sind Menschen wie wir doch nur Staub unter den Rädern seines Triumphwagens.«
Allie verzog das Gesicht. »Genug von Lockhart. Tut mir leid, dass ich ihn erwähnt habe. Muntert mich auf, Leute. Einer von euch muss einen besseren Tag gehabt haben als ich. Jess, wie war deiner?«
»Es war eine aufregende Woche, ob du’s nun glaubst oder nicht. Meine Arbeitsgruppe bereitet eine klinische Studie vor für eine Kombinationstherapie, um Menschen, die HIV-positiv sind, davor zu schützen, an einer Pneumocystis-Pneumonie zu erkranken. Wir sind ziemlich gespannt, weil es für Patienten mit Aids eine so lebensbedrohliche Infektion ist. Außerdem habe ich heute gehört, dass eine der Forschungsgruppen glaubt, sie hätte auf dem Weg zu einer Impfung gegen HIV einen vielversprechenden Schritt nach vorn gemacht.«
»Das würde alles verändern«, sagte Bill.
»Ohne jede Frage«, pflichtete Jess ihm bei. »Ich erwäge, mich bei dem Team zu bewerben. Aber wahrscheinlich wird es in unsere Forschungseinrichtung in Groningen verlegt, und ich weiß nicht, ob ich nach Holland umziehen möchte.«
»Ziemlich flach da«, sagte Rona. »Du wirst die Berge vermissen.«
»Weit mehr noch werde ich Abende wie diesen vermissen.« Sie verzog das Gesicht, als die Musik zum Soundtrack von Die Stunde des Siegers wechselte. »Na ja, vielleicht nicht gerade die Hintergrundmusik.«
Allie zuckte mit den Schultern. »Das ist nur Dinnerparty-Untermalung. Aber, Jess, wir sind umgezogen, und das war das Beste, was wir je gemacht haben.«
»Na, vielleicht doch eher das Zweitbeste«, meinte Rona mit einem frechen Lächeln. »Jess, du solltest das wirklich machen. Du wirst uns vermissen und wir dich, aber es gehen jeden Tag Flüge nach Amsterdam, und wir können einander besuchen. Außerdem gibt es dort jede Menge bezaubernder Lesben, die dein Leben verändern könnten.«
»Teil der Forschungsgruppe zu sein, die die Welt verändern könnte, dürfte auch ziemlich aufregend sein«, ergänzte Allie trocken.
»Und diese Welt könnte weiß Gott Veränderung brauchen.« Alix seufzte. »Bill, erinnerst du dich an Matt Singleton?«
Bill zupfte an seinem Bart. »Bassist? Hat mit Trudge gespielt? Warst du nicht gemeinsam mit ihm bei den Anarcho-Syndikalisten damals, in der guten alten Zeit?«
Jess kicherte. »Eingängiger Name.«
Alix zuckte mit den Schultern. »Eingängiger als unsere Musik, glaub mir. Irgendwie hat es Mattie immer geschafft, der beste Musiker in einer mittelmäßigen Band zu sein. Als ich das Studio aufmachte, habe ich darum wieder den Kontakt zu ihm gesucht. Gute Studiomusiker werden immer gebraucht.« Sie zog einen ledernen Tabakbeutel aus ihrer Tasche und begann mit der Lässigkeit langjähriger Erfahrung, einen Joint zu drehen. »Ich wusste, dass er Heroin nimmt, aber lange Zeit sah es so aus, als hätte er die Droge im Griff und nicht sie ihn.« Sie krümelte etwas Dope über den Tabak. »Aber manchmal ist die Sucht stärker als die Vernunft: Er hat seine Nadel mit anderen geteilt.« Sie seufzte. Allie wusste, was jetzt folgen würde. »Und rumms, erwischte ihn HIV.«
»Ein hoher Preis für einen Moment der Dummheit«, sagte Rona.
HIV war das Todesurteil, das wussten alle. Die einzige Frage war, wie lange es dauern würde, bis man Aids bekam. Aber ganz gleich, ob im Schneckentempo oder im Galopp: Das Ergebnis war dasselbe.
»Jepp. Und deshalb, Allie, war das, was ich heute gemacht habe, persönliche Trauerarbeit. Ich habe den armen alten Mattie besucht, der zwar noch nicht tot ist, aber vor der Tür des Sensenmannes steht, sein Finger schwebt schon über der Klingel.« Sie rang sich ein Lächeln ab, das ihre Augen nicht erreichte, leckte den Klebestreifen des Zigarettenblättchens an und verschloss den Joint mit Akkuratesse.
Allie legte ihre Hand auf die von Alix, während Bill gleichzeitig der Musikproduzentin den Arm um die schmalen Schultern schlang. »Das ist scheiße«, sagte er.
Alix tat, als lachte sie. »Jepp. Ich habe keine Ahnung, woher ich jetzt einen anständigen Bassisten nehmen soll.« Sie zog ihre Hand unter der von Allie hervor und entzündete das Feuerzeug. Dann nahm sie einen tiefen Zug von dem Joint und reichte ihn weiter an Bill.
»Kümmert sich jemand um ihn?«, erkundigte sich Jess.
»Er ist in einer Rehaklinik in Prestwich. Na ja, es nennt sich Reha, aber eigentlich ist es mehr wie eine Wartehalle für Sterbende.« Alix schüttelte sich ein bisschen. »Das ist nicht fair, tut mir leid. Die Belegschaft ist großartig. Sie betreiben noch weitere Kliniken für Patienten, die zwar HIV-positiv sind, aber noch kein Aids haben. Helfen ihnen, clean zu werden und zu bleiben.« Sie sah Allie an. »Weißt du, was das Lustige daran ist? In der Einrichtung im Norden von Manchester gibt es fünfzehn Betten. Und mehr als die Hälfte davon ist mit euren Leuten belegt.«
Aufrichtig verwirrt fragte Allie: »Was meinst du mit ›unseren Leuten‹?«
»Schotten. Ihr exportiert heutzutage nicht nur Whisky. Sondern auch Junkies.«
3
Vor den getönten Scheiben des Jaguar war nichts zu erkennen, das Genevieve Lockhart hätte ablenken können. Der graue Bogen der Autobahn, die sie in Windeseile vom Flughafen zum Haus ihres Vaters brachte, war schon tagsüber langweilig genug; in der Dunkelheit hätte sie sonst wo sein können. Sie fragte sich, warum Ace Lockhart sie heute zu sich zitiert hatte. Seit ihrer frühesten Kindheit hatte er sie, sein einziges Kind, dazu erzogen, eines Tages sein Imperium zu übernehmen, das er mit unbeirrbarer Zielstrebigkeit aufgebaut hatte. Sie hatte nicht die geringste Chance gehabt, dem zu entkommen. Und außerdem machte er immer wieder deutlich, was für eine fantastische Zukunftsperspektive das war. Aber er liebte es, sie im Ungewissen zu lassen, sodass sie überhaupt keine Ahnung hatte, warum er sie von einem Essen mit Freunden abberufen hatte, um sofort den Privathubschrauber von Ace Media zu besteigen. Dieses Nichtwissen machte sie ein bisschen besorgt.
Sie fuhren von der Autobahn ab auf eine breite Straße, die von Wohnhäusern gesäumt war. Plötzlich wichen diese auf einer Seite zurück und gaben den Blick frei auf einen hohen, mit Speerspitzen bewehrten Zaun, hinter dem eine Reihe von hochgewachsenen Bäumen aufragte; sie waren nun kahl, doch im Sommer leuchteten sie in den unterschiedlichsten Grüntönen. Linden, Ahorn, Eichen, Buchen, Birken, Erlen und Ebereschen, Seite an Seite, sie verbargen die Parklandschaft dahinter. Nach einer Viertelmeile bog das Auto in eine breite Einfahrt. Der Fahrer betätigte eine Fernbedienung, und ruckelnd öffnete sich das kunstvolle schmiedeeiserne Tor.
Jedes Mal, wenn sie herkam, konnte sie sich ein ironisches Lächeln nicht verkneifen. Wenn irgendetwas der Geschäftstüchtigkeit ihres Vaters alle Ehre machte, dann Voil House. Das palladianische Herrenhaus war mit Einnahmen aus dem Sklavenhandel errichtet worden und gestopft voll mit wertvollen Möbeln, Gemälden, Keramik und Silber. Die weitläufige Parklandschaft war eigens angelegt worden, um eine einzigartige Sammlung von seltenen Pflanzen zur Schau zu stellen. Allein die Sammlung an Rhododendren war Weltklasse. Der Letzte der Familie Voil, Sir Alexander, war 1956 kinderlos gestorben. Er hatte ein Testament von vertrackter Eigenwilligkeit hinterlassen. Das Haus und das Grundstück fielen der Stadt Glasgow zu – unter der Bedingung, dass die Pflanzensammlung erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werde zu einem Preis, der dem eines Tickets für die Glasgower U-Bahn entspräche. Das Haus und sein Interieur mussten instand gehalten werden und durften für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sein. Sollte die Stadt diesen Verpflichtungen nicht nachkommen, sollte das Anwesen an den Höchstbietenden verkauft und die Einnahmen der Royal Horticultural Society, der Königlichen Gartenbaugesellschaft, gespendet werden. Vergeblich hatte die Stadt vor Gericht darum gestritten, die Bedingungen des Erbes abzuändern, doch sie konnte den teuren Klotz nicht loswerden.
Ihr unerwarteter Retter war Wallace Lockhart gewesen. Im Gegenzug zu einer symbolischen Miete war er bereit, das Herrenhaus instand zu halten. Das Testament sagte nichts darüber, dass die Einrichtungsgegenstände exakt an der Stelle zu bleiben hatten, wo sie sich zum Zeitpunkt des Todes von Alexander Voil befanden, darum ließ Ace alles auf den Dachboden verfrachten, was ihm nicht gefiel. Das Esszimmer und eines der Wohnzimmer blieben in ihrer ganzen Pracht erhalten, um Besucher zu beeindrucken, doch die Räume, die er und Genevieve tagtäglich nutzten, wurden mit bequemen modernen Möbeln ausgestattet. Das Einzige, was er nicht hatte durchsetzen können, war ein Helipad auf dem Grundstück.
An diesem Abend befand sich Ace Lockhart in dem Raum, den er als seine Höhle bezeichnete. Sie hatte in etwa die Maße eines halben Fußballfeldes und war eingerichtet mit riesigen Sofas, Tischen mit Marmorplatten, einem aufwendigen Barschrank und dem größten TV-Bildschirm, den Genevieve je gesehen hatte. Statt goldgerahmter Porträts waren die Wände voll mit Fotografien von Ace in Begleitung von Staatshäuptern und Filmstars. Er hatte sich in den einzigen Sessel im Raum gefläzt. Das Möbelstück war nach seinen Wünschen designt worden. Ace’ Füße lagerten auf einem ledernen Hocker. Die Schuhe lagen, wohin er sie beim Ausziehen geschleudert hatte, und sein Schlips befand sich zerknittert auf dem Teppich neben dem Sessel. Auf seinem paukenförmigen Bauch balancierte er einen Tumbler mit dem Hauch einer Flüssigkeit; wie sie wusste, handelte es sich dabei um einen seltenen und absurd teuren Whisky. Mit dessen Rarität entschuldigte Ace die knapp gefüllten Gläser; doch Genevieve vermutete, es hatte mehr damit zu tun, dass er immer die Kontrolle behalten musste. Sie hatte ihn noch nie betrunken erlebt.
»Ah, Genny«, brummte er und hob eine Hand zum Gruß.
»Hallo, Ace.« Sie durchquerte den Raum und gab ihm einen Kuss auf die Stirn.
Er stellte den Fernseher auf lautlos und nickte Richtung Barschrank. »Nimm dir einen Drink.« Er griff in ein Glas mit Salzstangen auf dem Beistelltisch und stopfte sich eine Handvoll in den Mund.
»Meinetwegen musst du ihn nicht ausmachen. Ich weiß, dass du es nicht ausstehen kannst, die Nachrichten zu verpassen.« Sie nahm ein ausladendes Sherryglas und goss sich einen Tio Pepe ein. Als sie sich wieder umdrehte, sah sie auf dem Bildschirm den Gedenkgottesdienst in Lockerbie. »Du warst dort, nicht wahr?«
Er schluckte und grunzte. »Maggie hat viel Gewese darum gemacht. Diese Leute wissen nicht, was eine wirkliche Tragödie ist. Wie viele sind bei dem Bombenattentat gestorben? Zweihundertsiebzig, verdammt noch mal. Die Nazis haben in meinem Schtetl weitaus mehr Menschen umgebracht. Und trotzdem gab’s keinen Gedenkgottesdienst für sie. Wegen meiner Familie hat sich kein Premierminister die Augen mit ’nem Taschentuch abgetupft.«
»Die Menschen, die bei dem Pan-Am-Flug 103 gestorben sind, hatten auch Familien, Ace«, protestierte sie. »Sie leiden genauso, wie du gelitten hast, als deine Familie ausgelöscht wurde.«
Er stieß die Luft aus. »Ich weiß, Liebes, ich weiß. Ich bin nicht herzlos, ich verstehe ihren Schmerz. Aber ich kann mir nicht helfen: Mir kommt diese Art von öffentlichem Gedenken wie ein Ablasshandel vor. Wie viele von denen, die heute da waren, sind persönlich betroffen? Es gleicht mehr einer Show als wirklicher Trauer.«
»Und dennoch wirst du morgen bei all deinen Zeitungen die ersten fünf Seiten damit zupflastern lassen. Der Clarion, der Globe, der Mercury – sie alle werden darum wetteifern, wer den rührseligsten Artikel hat.«
Er nippte an seinem Drink. »So läuft das Geschäft, Genny. So verkauft man Zeitungen. Aber ich wette mit dir, dass keiner von denen, die heute da waren, etwas aus seiner Trauer lernt, nicht einmal die, die direkt betroffen sind. Nicht so, wie ich es getan habe.«
Genevieve kannte die Geschichte in- und auswendig, sie hätte sie mitsprechen können. Das Dorf in den umkämpften Gebieten im Osten Polens. Die Ankunft der Nazis und das Zusammentreiben der Juden. Die Gewehrsalven, das Prasseln von Flammen. Die Schreie. Und Chaim Barak, der sich in einem Misthaufen in einem Kuhstall versteckte, bis sich eine gespenstische Stille über das Schtetl senkte. Dann die Flucht. Wie er in Gräben schlief, sich von Wurzeln und Beeren ernährte, auf die neu ausgehobene polnische Armee von General Anders stieß. Dann der Nahe Osten, die Hölle von Monte Cassino, die Auszeichnung für Tapferkeit, die Befreiung Berlins, die Entdeckung von versteckten deutschen Forschungsunterlagen und die brillante Idee, diese an sich zu nehmen. »Das Wissen befreien« hatte er dies selbstgerecht genannt. Sogar Genevieve konnte erkennen, dass darin auch eine gewisse Skrupellosigkeit lag. Doch Skrupel hatte man sich 1945 kaum leisten können.
Sie ließ ihn seine Geschichte erzählen und sagte dann: »Hoffentlich nutzen die Amerikaner das nicht als Vorwand für einen Rachefeldzug.« Sie ließ sich in der Ecke eines der Sofas nieder.
»Sie wissen immer noch nicht, wohin mit der Rache. Das Geld für das Attentat kam aus Libyen, aber es gibt keine Beweise.« Weitere Salzstangen, die mit einem winzigen Schluck Whisky heruntergespült wurden.
»Warum bin ich hier, Ace? Wollen wir etwas vorbereiten für die großen Feierlichkeiten nächstes Jahr?«
Einen Moment lang schien Ace überrascht, dann verbarg er dies hinter einem Lächeln. »Was genau feiern wir?«
»Erzähl mir nicht, du hast es vergessen! Glasgow, europäische Kulturhauptstadt 1990? Ich bin davon ausgegangen, dass wir opulente kulturelle Veranstaltungen ausrichten wollen, um unseren Namen am Himmel erstrahlen zu lassen.« Ein Anflug von Schalkhaftigkeit schwang in ihrer Stimme mit.
Er winkte ab. »Ich bin sicher, das kann jemand unterhalb deiner Gehaltsklasse erledigen.«
»Wenn es nicht darum geht, warum bin ich dann hier?«
Er beehrte sie mit seinem liebenswürdigsten Lächeln. »Reicht es nicht, dass dein alter Vater dich an seiner Seite wünscht?«
Sie schnaubte. »Wenn’s nur darum ginge, hättest du nicht den Hubschrauber geschickt. Dazu bist du zu geizig. Du hättest mir gesagt, ich solle den Nachtzug nehmen.«
Er zog eine übertriebene Clownsgrimasse, die Mundwinkel nach unten, die Augenbrauen in perfekten Bögen nach oben gezogen. »Nur gut, dass meine Feinde mich nicht so gut kennen wie du.« Er hievte seinen mächtigen Körper in eine aufrechtere Position, wobei der Bauch ein Eigenleben zu führen schien. »Ich brauche dich für etwas Wichtiges. Es geht nicht um mich, sondern ums Geschäft.«
»Du weißt, dass ich immer mein Bestes für uns geben werde.« Angesicht der Ernsthaftigkeit ihres Vaters setzte Genevieve sich gerade hin und stellte die Füße auf den Boden. Der tragische Tod ihrer Mutter vor ihrem fünften Geburtstag hatte unter anderem bedeutet, dass es niemanden gab, der den Enthusiasmus ihres Vaters hatte dämpfen können. Wenn sich die Dinge gegen ihn wandten – wie sie es mitunter unverschämterweise taten –, dann war sie diejenige, die ihn aus seiner Enttäuschung und seiner Wut herausholte und ihn besänftigte.
»Du kennst mein Motto. Wenn die Gelegenheit anklopft, dann reiß die Tür auf.« Lockhart wuchtete sich auf die Füße und watschelte zum Humidor, der auf dem Barschrank stand. »Tja, und heute donnerte die Gelegenheit mit einem Rammbock gegen unsere Hintertür.« Er nahm sich eine Zigarre, nestelte an ihr herum und kappte ein Ende. Auf dem Weg zurück zum Sessel entzündete er sie mit einem zerschrammten Zippo aus Messing, das er seit 1942 bei sich trug, und paffte. »Amerika, Genny, Amerika.«
Das war neu für Genevieve. Doch sie hielt sich zurück, sie wusste, dass ihr Vater immer erst einmal den Boden bereitete, bevor er zum eigentlichen Punkt kam. Stattdessen nickte sie ihm aufmunternd zu, was eigentlich nicht notwendig war.
»Simon Levertov war heute unter den Trauergästen.«
Diesen Namen kannte sie gut. Levertov stand einem Familienunternehmen vor, das ein großes Netz an Lokalzeitungen im Mittleren Westen kontrollierte. Flaggschiffe waren die Zeitungen in Chicago, Minneapolis/Saint Paul, Cincinnati und Indianapolis. Eine Ausnahmestellung nahm der New Yorker Daily Globe ein. Rupert Murdoch war nah dran gewesen, ihn zu kaufen, doch die Familie hatte dem einen Riegel vorgeschoben. Es hieß, dass Murdochs Boulevardblätter bei den konservativen Levertovs auf Ablehnung stießen. Seitdem umwarb ihr Vater die Familie beharrlich.
»Warum war er hier?«
»Fünfunddreißig Studenten aus Syracuse waren an Bord des Flugzeugs. Den Levertovs gehört eine der Lokalzeitungen.«
Sie nickte verständnisvoll. »Hattest du die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen?«
Er stieß eine blaue Wolke aromatisch duftenden Rauch aus. »Er ist von sich aus an mich herangetreten. Sie sind bereit, den Globe zu verkaufen. Das ist perfekt für uns. Wir hätten damit einen prestigereichen Einstand in den USA, ein Sprungbrett, das uns neue Märkte eröffnen kann.«
Genevieve wusste, wie sehr sich ihr Vater nach dem New Yorker Globe verzehrte. Er liebte die Vorstellung, neue Welten zu erobern, doch noch mehr liebte er alles, das half, einen Sieg im Weitpissen gegen Rupert Murdoch zu erringen. Eine Trophäe einzusacken, die auch der australische Medienmogul begehrte, wäre mehr als nur die Kirsche auf der Torte. Aber das hieß nicht, dass es eine gute Idee war. Vorsichtig sagte sie: »Es gibt einen Grund, warum sie den Globe abstoßen wollen, Ace. Er verliert Geld und Auflagenzahlen wie ein Flugzeug ohne Pilot.«
»Ja, natürlich«, sagte Lockhart und wischte ihren Einwand beiseite, als würde er eine lästige Fliege vertreiben. »Weil die Levertovs keine Ahnung haben, wie man eine wirklichkeitsnahe Zeitung macht, die hart arbeitende Männer anspricht.« Als er sah, wie sie die Augenbrauen runzelte, fügte er hastig hinzu: »Und die Frauen natürlich auch, Genny. Doch mit uns am Steuer könnte der Sturzflug beendet werden. Ich werde mein fähigstes Team aus London hinschicken, um dort anzupacken, und dann zeigen wir den New Yorkern, wie es richtig geht.«
Seine ungebremste Begeisterung für das Zeitungswesen und die Macht, die damit zusammenhing, war mitreißend. Seine stürmische Hingabe an den Erfolg hatte Genevieve schon in jungen Jahren angesteckt. Sie wusste, es hatte wenig Sinn, ihm zu widersprechen. Ace Lockhart war der Alleinherrscher in seinem Universum. »Habt ihr einen Gesprächstermin vereinbart?«
Lockhart lachte wiehernd auf. »Genny, wir haben den Deal abgeschlossen. Nach dem Gottesdienst haben wir uns in einem trostlosen Hotel an einen Tisch gesetzt, uns über den Preis geeinigt und mit Handschlag besiegelt.«
Sie wusste, dass von ihr nun Jubel erwartet wurde, und bekam auch etwas sehr Ähnliches zustande. Aber das ungute Gefühl, das sich in ihrem Magen ausbreitete, konnte sie nicht unterdrücken. Wenn es unkompliziert war, warum hatte er sie dann so dringend nach Voil House beordert? Auch wenn das die größte Anschaffung war, seit er den Clarion und den britischen Globe gekauft hatte, hätte er ihr doch einfach am Telefon davon erzählen können; sie hätten es dann bei ihrem nächsten Treffen in ein paar Tagen gefeiert. Sie kannte ihren Vater gut genug, um zu wissen, dass noch etwas nachkommen würde. Sie rief sich ins Gedächtnis, dass er oftmals ungewöhnliche und spektakuläre Wege zum Erfolg nahm. Was nur zeigte, wie einzigartig er war und mit welcher Nervenstärke gesegnet. Weder die analytische Schärfe der Universität St Andrews noch die des MIT, des Massachusetts Institute of Technology, hatten den Glauben an ihren Vater erschüttern können. Darum rang sie sich ein Lächeln ab und erhob das Glas auf ihn. »Was für ein Coup.«
Das Leder knarrte, als seine Körpermasse in Bewegung geriet und er sich ein bisschen aufrechter hinsetzte. »Es gibt nur ein Problem.«
Da kommt es, dachte sie. »Welches, Ace?«
»Liquidität. Wir sind bis an unsere Grenzen gegangen, um die neuen Druckereien in London zu bauen.«
Die noch lange nicht fertig und in Betrieb waren, ganz zu schweigen von ihrer Amortisierung. Genevieve versuchte, ihre Besorgnis zu verbergen. »Können wir einen Kredit aufnehmen?«
Ace stieß eine Rauchwolke aus. »Das könnte kompliziert werden. Und es wäre ohne Frage teuer. Und natürlich ein Zeichen von Schwäche. Ich möchte, dass wir aufrechten Hauptes in Amerika auftreten, nicht mit dem Hut in der Hand vor den Bankern buckeln. Das würde Murdoch sehr freuen.«
Sie spürte einen Anflug von Beklemmung in der Brust. Bislang hatte sie nichts zu tun gehabt mit den Vorzeigezeitungen und -magazinen, die das Bild von Ace Media in der Welt prägten. Die Cashcow, die alles finanzierte und am Leben hielt, war das akademische und wissenschaftliche Verlagswesen, und dort hatte er sie untergebracht. Ein Jahr lang hatte sie in jedem Bereich hospitiert und sich eingearbeitet, und nun leitete sie ein Verlagshaus, das sich mit den prestigereichsten Universitätsverlagen messen konnte. »Du willst aber nicht Pythagoras verkaufen?«
Er lachte ehrlich erstaunt auf. »Meine Gans, die goldene Eier legt? Sei nicht albern, Genny. Außerdem leistest du dort hervorragende Arbeit. Nein, ich habe eine andere Lösung gefunden.« Lockhart schenkte ihr sein huldvollstes Lächeln, doch sie kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass sich das oftmals als Judaskuss entpuppte.
»Und die wäre?«
»Der Pensionsfonds. Pythagoras und Ace Media haben da hohe Überschüsse erwirtschaftet. Eine halbe Milliarde, Genny. Eine. Halbe. Milliarde.«
»Aber das Geld gehört nicht dem Unternehmen«, widersprach sie. »Es gehört den Pensionären, den jetzigen wie den künftigen.«
»Das weiß ich doch. Wofür hältst du mich? Für eine Art Raubritter?« Seine Entrüstung klang fast echt. »Mir geht es um einen Kredit.« Lässig wedelte er mit seiner Zigarre in der Luft herum. »Ein vorübergehendes Arrangement. Ich weiß, dass ich das Steuer beim New Yorker Globe in kurzer Zeit herumreißen kann. Es wäre genauso, als würde man sich das Geld bei der Bank leihen. Nur dass es eben eine private Transaktion wäre.«
Genevieve verbarg ihr Unbehagen. Zeigte sie es, würde er sich darauf stürzen, das wusste sie. »Ist das legal?« Weiter wagte sie sich nicht vor.
Er lächelte verbindlich. »Natürlich ist es legal. Alles, was ich von dir als Geschäftsführerin von Pythagoras brauche, ist deine Unterschrift auf diesen Papieren.«
Das war keine Bitte.
Sie hatte gesehen, wie wütend ihr Vater auf jeden werden konnte, der seine Integrität infrage stellte. Niemals wollte sie das Ziel dieses Zorns werden. Und noch weniger wollte sie Anlass geben für diesen Blick tiefer Enttäuschung, der sich auf seinen markanten Gesichtszügen ausbreitete, wenn einer seiner engsten Mitarbeiter ihn im Stich ließ. Seine Augen wurden feucht, seine Lippen schürzten sich, seine Stirn legte sich in tausend Falten. Danach folgte in der Regel der Rauswurf. Okay, er konnte sie nicht entlassen. Dass sie seine Tochter war, war nicht zu ändern. Aber sie hatte gesehen, wie er einige seiner ältesten Freunde aus dem Kreis der Vertrauten verbannte, und sie wusste, wie sehr ihn das geschmerzt hatte. Genevieve liebte ihren Vater, sie würde es nicht ertragen können, seine Zuneigung und seinen Respekt zu verlieren.
Sie holte tief Luft. »Gib mir den Stift.«
4
Allie liebte es, Rona dabei zu beobachten, wie sie sich am Ende des Tages abschminkte. Die Maske, die sie für die Welt da draußen trug, wurde abgenommen, und zum Vorschein kam Ronas unverfälschte Schönheit, die nur sie kannte; es fühlte sich zutiefst intim an. Die Benommenheit dank des Haschs, das sie am Abend geraucht hatte, in Kombination mit dem Alkohol, hatte dem Tag die Schwere genommen, sodass sie sich jetzt entspannt fühlte. Vielleicht sogar ein bisschen sexy? Sie streckte sich genüsslich.
»Es war ein bisschen verstörend, was Alix uns da heute Abend an den Kopf geworfen hat«, sagte Rona, während sie mit einem Baumwollpad ihre Augenlider reinigte.
»Was meinst du?« Allie gähnte. »Die Schotten in der Rehaklinik?«
»Ja. Ich weiß, dass Edinburgh als Aids-Hauptstadt Europas gilt, aber ich wusste nicht, dass sie inzwischen aus dem Land fliehen.« Nun entfernte sie die Mascara.
»Ist es da wirklich so schlimm?«
»Das hab ich zumindest gehört. Die letzte Statistik, an die ich mich erinnere, ging davon aus, dass ein Prozent der männlichen Bevölkerung der Stadt HIV-positiv ist. Das klingt im ersten Moment nicht besonders beeindruckend, bis man sich die Zahl der Betroffenen klarmacht. Rund viertausend in einer so kleinen Stadt. Und zudem spazieren die nicht durch die georgianische Eleganz von New Town, nicht wahr? Sie finden sich alle in den Problemvierteln der Stadt. Und natürlich wird darüber hier nicht berichtet.« Sie hatte den Mund geöffnet, um den Lippenstift abzuwischen, darum klangen ihre Worte verzerrt. »Ein fremder Ort, von dem wir nichts wissen und so. Nicht zu vergessen, dass es sich dabei um die Unberührbaren handelt – Drogenabhängige und Schwule.«
»Du denkst, da wär eine Story drin? Warum die Edinburgher Junkies Richtung Süden fliehen?« Jetzt war Allie wieder munter. Die Aussicht auf ein Thema, das sich verfolgen ließ, war immer verlockend.
»Keine Ahnung. Aber sich das mal näher anzusehen, wär’s vielleicht wert. Wenn sie weggehen, weil der NHS, der Nationale Gesundheitsservice, mit der schieren Menge nicht zurechtkommt, hast du mehrere Möglichkeiten, deine Story aufzuziehen: Der NHS ist mit der Situation überfordert, die Edinburgher beschweren sich, dass andere Krankheiten ignoriert werden, oder die HIV-Patienten sind gezwungen, wegzugehen, weil ihre Heimatstadt sie vertreiben will.« Nachdem Rona die letzten Reste ihrer Foundation entfernt hatte, betupfte sie ihre Haut mit Gesichtswasser, um zuletzt eine teure Nachtcreme aufzutragen, die verführerisch nach Lavendel und Geranie duftete.
»Fallen sie, oder werden sie gestoßen?«
»Man weiß erst, was dabei herauskommt, wenn man anfängt zu recherchieren.« Ronas Augenbrauen wanderten im Spiegel nach oben.
»Du hast recht. Ich sollte dem nachgehen und mal schauen, was dahintersteckt. Vielleicht morgen schon, wenn ich etwas Zeit finde.« Als Rona neben sie unter die Decke schlüpfte, streckte Allie ihre Arme nach ihr aus. »Doch jetzt habe ich Wichtigeres im Sinn.«
»Genau wie ich«, sagte Rona in einem gänzlich anderen Tonfall. »Bist du sicher, dass du okay bist? Als du heute Abend nach Hause kamst, hast du ausgesehen, als hätte dich jemand in die Mangel genommen und jedes Leben aus dir herausgequetscht.«
»Ich hatte gedacht, ich hätte die Nacht, als das Flugzeug abstürzte, verarbeitet, hätte alles schön säuberlich in meinem Kopf verstaut und könnte einfach weitermachen. Doch diese tiefe Trauer heute mitzuerleben – das hat alles wieder hochgespült.« Allie atmete tief ein. »Aber es geht mir gut, ist jetzt überstanden.«
»Ich bin mir da nicht so sicher.« Rona streichelte Allie übers Haar. »Die ganzen Sachen, mit denen du in deinem Nachrichtenressort konfrontiert wirst – die fressen dich auf, Allie, das sehe ich doch.«
Allie tat Ronas Besorgnis ab. »Das sind nur kleine Läsionen, Rona. Das verheilt alles wieder. Tief drinnen, da bin ich in Ordnung. Das ist nun mal mein Job. Das bin nun mal ich.«
Rona schaute sie zweifelnd an, sagte aber nichts mehr. Als Allie schon tief und fest schlief, lag sie noch lange wach; sie war nicht überzeugt von dem, was ihre Partnerin gesagt hatte. Germaine, alarmiert von jenem Instinkt, der Hunde an Menschen bindet, kuschelte sich an sie. Rona drehte sich auf die Seite und zog Germaine an sich. Zusammen mussten sie einen Weg finden, wie sie Allie vor sich selbst schützen konnten.
Wegen des Besuchs eines Mitglieds der königlichen Familie, eines erneuten politischen Skandals in Liverpool und einer Reihe von langweiligen TV-Spin-offs fand Allie erst nach mehr als einem Monat die Zeit, die Aids-Story weiterzuverfolgen. Die einzige Redakteurin zu sein bedeutete, dass sie permanent auf Draht sein musste. Bis jeweils dienstags musste sie ausreichend Themen gefunden haben, die sie auf der wöchentlichen Redaktionskonferenz vorstellen konnte. Anschließend musste sie die auswählen, die am ehesten an Freiberufler weitergegeben werden konnten, was bedeutete, diese auf Trab und in der Spur zu halten – eine Aufgabe, die so frustrierend war, wie einen Sack Flöhe zu hüten. In der verbleibenden Zeit musste sie ihre Kontakte pflegen, um aus diesen mögliche Storys herauszukitzeln, die sie dann selbst verfolgen konnte. Wollte sie dem Drängen der Londoner Redaktion gerecht werden, blieb ihr nahezu keine Zeit, die Storys zu recherchieren, die sie wirklich interessierten. Es verging kein Tag, an dem sie nicht ihre Arbeit als Investigativjournalistin vermisste.
Letzten Endes beschloss Allie, an einem Montagnachmittag Anfang Februar ins Büro zu gehen. Eigentlich war der Montag ihr freier Tag, aber das hielt die Londoner Reportageredaktion nicht davon ab, sie zu Hause anzurufen und ihr weitere Aufträge zu erteilen, die im Laufe der Woche abgearbeitet werden mussten. Oder die Bildredaktion fragte nach den Kontaktdaten von Leuten, die für die farbige Wochenbeilage fotografiert werden sollten.
Am Mittag saß sie mit Rona in der Küche vor einem Teller Suppe. »Da kann ich genauso gut ins Büro gehen«, sagte Allie. »Das ist die einzige Chance, Ruhe vor dem verdammten Telefon zu finden. Ich muss mich auf den neuesten Stand zu HIV und Aids bringen, bevor ich mich tiefer in die Edinburgh-Story einarbeite. Am besten versteck ich mich in der Bibliothek – da wird mich niemand suchen.«
»Ironisch, aber wahr. Wenn du schon mal da bist, kannst du mir dann einen Gefallen tun?«
»Jeden. Was brauchst du?« Als Freiberuflerin hatte Rona keinen Zugang zur Bibliothek des Globe, obwohl Allie dachte, das wäre das Mindeste, was das Ace-Lockhart-Imperium den Freelancern schuldete.
»Kannst du die alten Artikel nach Mord in TV-Schmonzetten durchsuchen? Es gibt das Gerücht, dass es bald einen Mord in Coronation Street geben wird, und ich möchte das Wichtigste zum Hintergrund wissen, wenn es so weit ist.« Rona warf Allie einen gespielt bettelnden Blick zu.
»Wer soll denn über die Klinge springen?«
Rona schüttelte den Kopf. »Das ist genau das, was ich herausfinden will und warum du recherchieren musst.«
Allie grinste. »Ich werde sehen, was ich für dich tun kann.«
»Aber nicht stehlen!«
Sie wussten beide, dass Rona einen Witz machte. Als sie nach Manchester gezogen waren, hatten sie sich darauf geeinigt, dass jede für sich arbeitete. Damals in Glasgow waren sie bei derselben Zeitung angestellt gewesen. Mitunter gab es Storys, die besser zum Ressort der anderen passten. Beide waren damit einverstanden gewesen, dass die andere dann das Thema übernahm. Jetzt aber konnte Allie es sich nicht leisten, dass ihr Boss in London sie verdächtigte, Storys an eine Freiberuflerin weiterzugeben, die diese dann womöglich an die Konkurrenz verkaufte. Darum waren sie übereingekommen, keine Storys mehr zu teilen – es sei denn, Allies Chef hatte den Beitrag abgelehnt. Nur wenige Dinge machten Allie mehr Freude, als zu sehen, wie eine der abgelehnten Storys als Seitenaufmacher bei einer anderen Zeitung oder als Reportage in einem Magazin erschien.
»Es steht dir immer frei, mir deinen Artikel zu verkaufen«, sagte Allie und stand auf, um ihren Teller in den Geschirrspüler zu stellen.
Rona gluckste. »Ihr zahlt nicht genug. Mir fallen mindestens drei Redaktionen ein, die mehr hinlegen.«
»Schon okay. Umso mehr Geld hast du dann ja, um mich groß auszuführen.«
Obwohl Ace Lockharts rigorose Personaleinsparungen die Redaktion bis auf die Knochen abgespeckt hatten, hatte er doch die Bibliothek beibehalten, weil jemand ihm erzählt hatte, diese wäre ein unverzichtbarer Aktivposten. Allerdings war sie derzeit nur von mittags bis acht Uhr abends besetzt. Bei einer Vollzeit- und einer Teilzeitstelle hatten die beiden Mitarbeiter alle Hände voll damit zu tun, die Zeitungsartikel auszuschneiden und zuzuordnen, aber zumindest gab es das Archiv. Noch.
Nachdem sie einen Nachmittag lang über den Berichten gebrütet hatte, verfügte Allie über einen Grundstock an Wissen darüber, was die britischen Medien über HIV