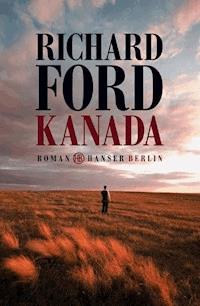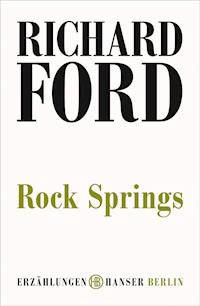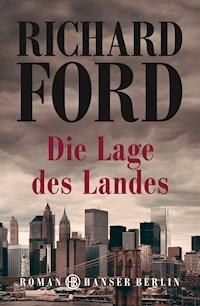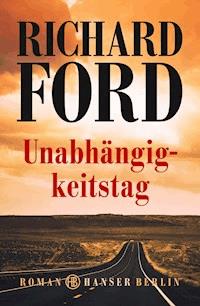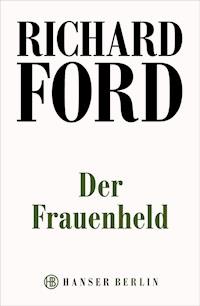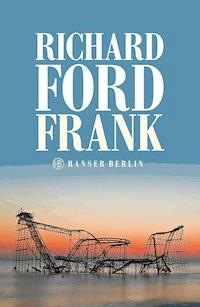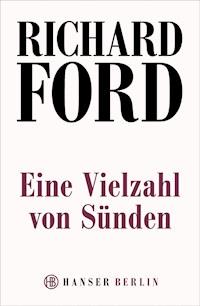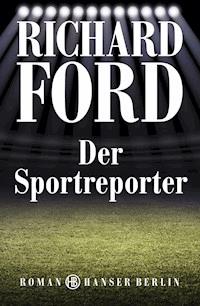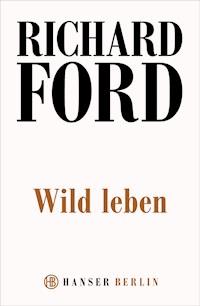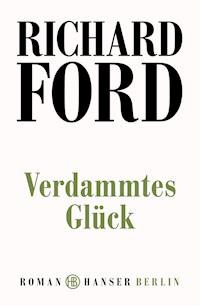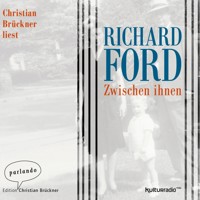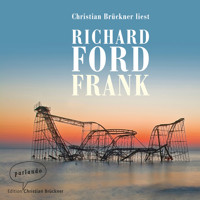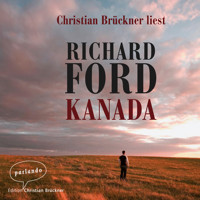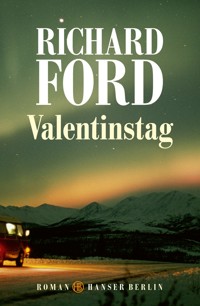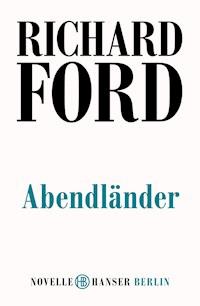
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Charley Matthews, ein erfolgloser Autor aus Ohio, reist mit seiner Freundin Helen Carmichael über Weihnachten nach Paris. Ihm ist die französische Übersetzung seines einzigen Buches versprochen worden, doch der Lektor versetzt ihn. Enttäuscht ziehen die beiden durch die Gassen. Während sich der Zustand der krebskranken Helen zunehmend verschlechtert, denkt Charley zurück an seine ehemalige Geliebte Margie und die Trennung von seiner Frau Penny. Als Charley schließlich Kontakt zu Margie aufnimmt, scheint eine Tragödie nicht mehr zu verhindern... Mit unerbittlich präziser Sprache erzählt Richard Ford, wie zwei Amerikaner in Paris nach der Liebe suchen und dabei der Hoffnungslosigkeit begegnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Charley Matthews, ein erfolgloser Autor aus Ohio, reist mit seiner Freundin Helen Carmichael über Weihnachten nach Paris. Ihm ist die französische Übersetzung seines einzigen Buches versprochen worden, doch der Lektor versetzt ihn. Enttäuscht ziehen die beiden durch die Gassen. Während sich der Zustand der krebskranken Helen zunehmend verschlechtert, denkt Charley zurück an seine ehemalige Geliebte Margie und die Trennung von seiner Frau Penny. Als Charley schließlich Kontakt zu Margie aufnimmt, scheint eine Tragödie nicht mehr zu verhindern… Mit unerbittlich präziser Sprache erzählt Richard Ford, wie zwei Amerikaner in Paris nach der Liebe suchen und dabei der Hoffnungslosigkeit begegnen.
Hanser E-Book
Richard Ford
Abendländer
Eine Novelle
Aus dem Amerikanischenvon Fredeke Arnim
Hanser Berlin
Die Originalausgabe erschien 1997 unter dem TitelOccidentalsin Women with Men: Three Stories bei Alfred A. Knopf, New York
ISBN 978-3-446-25525-8
© Richard Ford 1997
Alle Rechte der deutschen Ausgabe
© Hanser Berlin im Carl Hanser Verlag München 2016
Cover: Peter-Andreas Hassiepen, München
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de.
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
Kristina
Charley Matthews und Helen Carmichael waren in der Woche vor Weihnachten nach Paris gekommen. Damals, noch in Ohio, als sie aufgeregt Pläne für ihre Reise geschmiedet hatten, wollten sie nur zwei Tage bleiben – gerade lang genug, damit sich Charley (der seinen ersten Roman veröffentlicht hatte) mit seinem französischen Verleger zum Lunch verabreden konnte, sie beide noch ein Museum besuchen, ein paarmal unvergleichlich gut essen gehen konnten und vielleicht noch ins Ballett, bevor es dann nach England weiterging, wo Matthews Oxford besuchen wollte, jene Universität, zu der er vor fünfzehn Jahren beinahe zugelassen worden wäre. (Im letzten Augenblick hatte man ihn jedoch abgelehnt, und er hatte statt dessen an der Purdue seinen Doktor gemacht, einer Universität, für die er sich immer geschämt hatte.)
In Paris lief es allerdings etwas anders, als sie es sich vorgestellt hatten.
Erstens war das Wetter, das in der Zeitung in Ohio als kühl, aber trocken, nachmittags dann mild und sonnig angekündigt worden war – also ideal für lange Spaziergänge durch den Bois de Boulogne oder Bootsfahrten auf der Seine –, beinahe über Nacht umgeschlagen: es war nun kalt und elendig klamm, dazu dichter, öliger Nebel mit Regen und deshalb geradezu unangenehm, sich draußen aufzuhalten. Während der Taxifahrt vom Flughafen entdeckte Matthews im Fodor’s, daß Paris viel weiter nördlich lag, als er geglaubt hatte – in seiner Vorstellung hatte es näher an der Mitte Frankreichs gelegen. Tatsächlich befand es sich, wie er jetzt sah, auf demselben Breitengrad wie Gander in Neufundland, weshalb die Auskunft des Buches einleuchtend schien: daß es nämlich in Paris mehr regnete als in Seattle und daß der Winter in der Regel im November begann. »Kein Wunder, daß es kalt ist«, sagte er, während er die unbekannten, regenfinsteren Straßen vorbeiziehen sah. »Mit dem Auto ist man von hier aus in einem halben Tag in Kopenhagen.«
Unerwartet kam auch, daß François Blumberg, Matthews’ französischer Lektor, sie am ersten Nachmittag angerufen hatte, um zu fragen, wie es ihnen gehe, aber auch um zu sagen, daß sich seine Pläne geändert hätten. Noch am selben Nachmittag, so sagte er, fliege er mit seiner Frau und seinen vier Kindern irgendwohin an den Indischen Ozean und könne deswegen Matthews weder zum Lunch noch zu einem Besuch des Verlags – Editions des Châtaigniers – einladen, der über die Weihnachtsfeiertage geschlossen sei. Blumberg schien die Plötzlichkeit und Frechheit seiner Absage zu gefallen, obwohl er selbst die Reise überhaupt vorgeschlagen (»Wir werden dann richtig Freundschaft schließen«) und auch versprochen hatte, Matthews Paris zu zeigen, vor allem »besondere Dinge, die ein Tourist nie ausfindig machen würde« – geheime orientalische Gärten auf dem Montparnasse, private Anwesen von Blumbergs reichen adligen Freunden, Séparées in Fünf-Sterne-Restaurants, spezielle, für die Öffentlichkeit unzugängliche Ausstellungsräume des Louvre, vollgehängt mit Rembrandts und da Vincis.
»Wenn Sie nächstes Mal nach Paris kommen, werden wir natürlich viel, viel Zeit miteinander verbringen«, sagte Blumberg noch am Telephon. »Jetzt kennt Sie hier keiner. Aber das wird sich ändern. Wenn Ihr Buch erst mal erschienen ist, wird sich alles ändern. Sie werden schon sehen. Sie werden noch berühmt.« Blumberg ließ ein kleines keuchendes Geräusch vernehmen, ein kurzes, flaches Einatmen, das anzudeuten schien, daß er über das, was er gerade gesagt hatte, überrascht war. Alle Franzosen machen wohl dieses Geräusch, nahm Matthews an. Die eine Französin, die gemeinsam mit ihm am Wilmot College unterrichtet hatte, machte es jedenfalls die ganze Zeit. Er hatte nicht die geringste Ahnung, was es bedeuten sollte.
»Wenn Sie meinen«, sagte Matthews. Er lag im Bett, trug nur seine Pyjamajacke. Blumberg hatte ihn aus seinem Ankunftsnickerchen geweckt. Helen war entschlossen in das unwirtliche Wetter hinausgegangen, um irgendwo etwas Eßbares aufzutreiben, eine Dienstleistung, die ihr Hotel, das Nouvelle Métropole, offensichtlich anzubieten nicht imstande war. Draußen auf der kalten, regnerischen Rue Froidevaux heulten ein paar Motorräder mit knatterndem Auspuff auf, und Männerstimmen schrien wütend irgend etwas auf französisch, als ob es gleich eine Schlägerei geben würde. Von irgendwoher näherte sich eine schrille Polizeisirene. Matthews fragte sich, ob sie auf dem Weg zum Hotel waren.
»Sie würden mir allerdings persönlich einen großen Gefallen tun«, fuhr Blumberg fort, »wenn Sie noch ein wenig bleiben und sich mit ihrer Übersetzerin treffen könnten. Madame de Grenelle. Sie ist sehr, sehr berühmt und außerdem sehr schwer zu überzeugen, wenn es um amerikanische Romane geht. Aber Ihr Buch fand sie faszinierend, und sie würde Sie gerne sehen. Leider ist auch sie weg und wird erst in vier Tagen wieder in Paris sein.«
»Wir hatten eigentlich nicht vor, so lange zu bleiben«, sagte Matthews gereizt.
»Ja, natürlich, ganz wie Sie wollen«, sagte Blumberg. »Es würde der ganzen Sache aber sehr weiterhelfen. Beim Übersetzen geht es nicht lediglich darum, Ihr Buch ins Französische zu bringen; es geht darum, Ihr Buch in der französischen Imagination neu zu erfinden. Wir brauchen also eine absolut präzise Übersetzung, damit die Leser das Buch unverfälscht kennenlernen. Wir wollen nicht, daß Sie oder Ihr Buch mißverstanden werden. Wir wollen, daß Sie berühmt werden. Die Menschen verbringen ohnehin zuviel Zeit damit, einander mißzuverstehen.«
»Offensichtlich«, sagte Matthews.
Blumberg gab Matthews dann Madame de Grenelles Telephonnummer und Adresse und sagte noch einmal, daß sie auf seinen Anruf hoffe. Während ihrer Korrespondenz hatte Matthews sich François Blumberg immer als alten Mann vorgestellt, als gütigen Bewahrer einer uralten Flamme, als Hüter einer reichen, sagenumwobenen Kultur, an der nur wenige teilhaben durften: als einen, den er instinktiv mögen würde. Aber nun stellte er sich Blumberg jünger vor – vielleicht sogar in seinem eigenen Alter, siebenunddreißig –, klein, glatzköpfig, mit schlechter Haut, vielleicht ein zweitrangiger Akademiker, der sich mit der Arbeit im Verlag ein Auskommen sicherte, jemand in einem glänzenden schwarzen Anzug und billigen Schuhen. Matthews sah Blumberg eine schmale regenumwehte Metalltreppe hinaufstolpern, um in ein verrauchtes, überbuchtes Charterflugzeug zu gelangen, eine dünne Frau und vier Kinder im Schlepptau, die mit Koffern und Plastiktüten beladen waren und lauthals herumschrien.
»Also dann«, sagte Blumberg, als sei er unter Zeitdruck. »Jetzt ist natürlich die ideale Zeit, Paris zu besuchen. Wir verschwinden in die Wärme. Und Sie haben die ganze Stadt für sich, Sie und Ihre Freunde, die Deutschen. Wir nehmen’s uns dann wieder, wenn Sie damit durch sind.« Blumberg lachte. »Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal«, sagte er noch.
»Ja«, sagte Matthews. »Ich auch.« Er hatte eigentlich vor, Blumberg noch etwas zu sagen, um deutlich zu machen, wie diese Änderung alles durcheinanderbrachte. Aber Blumberg trompetete irgend etwas Unverständliches auf französisch ins Telephon, lachte noch einmal, machte wieder das kurze keuchende Geräusch und legte auf.
Natürlich war das eine Beleidigung, das war Matthews klar. Ohne Zweifel eine besonders kränkende französische Beleidigung (wobei er nicht wußte, was eine französische Beleidigung war). Aber eigentlich müßten sie jetzt auf der Stelle die Koffer packen, ein Taxi rufen, das Hotel räumen und mit der nächstbesten Möglichkeit die Stadt verlassen. Wohin, wußte er nicht. Bloß fiele über den Rest der Reise dann ein Schatten, ein Schatten der Enttäuschung, noch bevor sie überhaupt die Chance gehabt hätte, schön zu werden.
Matthews kroch aus dem Bett und ging barfuß in seinem Pyjamaoberteil zum Fenster. Draußen, vor den kalten Fensterscheiben, war die Luft schmutzig und trüb. Das Ganze hatte überhaupt nichts Weihnachtliches. Eigentlich auch nichts Pariserisches. Auf der anderen Seite der Rue Froidevaux erstreckte sich im Nebel ein großer Friedhof zwischen hohen Bäumen, weiter, als er sehen konnte, und rechts stand im Dunst eine riesige steinerne Löwenstatue in der Mitte eines stark befahrenen Kreisverkehrs. Jenseits davon sah er Häuserreihen und Autos, die eine breite Straße entlangfuhren und deren Scheinwerfer in der nachmittäglichen Dämmerung gelb leuchteten. Das also war Paris.
Ein Polizeiauto mit blinkendem Blaulicht hatte unten auf der Straße gehalten, und zwei uniformierte Beamte mit leuchtendweißen Helmen gestikulierten zu drei Motorradfahrern hin. In der Vergangenheit hatte er sich beim Gedanken an Paris immer Jazz vorgestellt oder Dom-Pérignon-Korken, die in die strahlende kalte Nachtluft flogen, breite leuchtende Straßen, Gelächter. Vergnügen. Jetzt wußte er nicht einmal, in welche Richtung er gerade blickte. Nach Osten? In welcher Richtung lag der Eiffelturm? Dies war das vierzehnte Arrondissement. Rive Gauche. Viele berühmte amerikanische Schriftsteller hatten hier in der Nähe gelebt, obwohl er sich im Moment weder an einen Namen noch an eine bestimmte Gegend erinnern konnte, bloß daran, daß die Franzosen sie ganz anders aufgenommen hatten, als sie es in ihrer Heimat gewohnt waren. Paris hatte ihn nie besonders interessiert. Er hatte es immer als Schwierigkeit empfunden, das, was man hier erlebt hatte, in etwas zu verwandeln, was dann dort, zu Hause, von Bedeutung sein könnte. Er dachte an all die Langweiler, die zurückkehrten und endlos ihre Pariser Erfahrungen herunterleierten und versuchten, ihnen eine Bedeutung zu geben. So etwas ergab sich nicht von selbst. Wenn man also mit ernsthaften Absichten nach Paris kam, hieß das, daß man bleiben mußte. Allerdings konnte man nicht an einen fremden Ort fahren und einfach annehmen, daß man bleiben würde. Das hatte mit Reisen nichts zu tun. Das war Flucht. Und bei ihm gab es nichts, wovor er fliehen mußte. Penny, seine Frau, die von ihm getrennt lebte, hatte immer mit ihm ins Ausland reisen wollen, was er aber abgelehnt hatte – womöglich ein Fehler.
Aber nun erschien ihm dieses Paris vor dem Fenster verwirrend. Es hätte genausogut Ostberlin sein können. Und dennoch wäre es jetzt schwierig abzureisen. Schließlich war er nun mal hier. Hatte für sie beide bezahlt. Abzureisen wäre eine einzige Verschwendung.
In Matthews’ Roman, Das Dilemma, hatte die Ehefrau der Hauptfigur, Greta (eine kaum verhüllte, nicht gerade schmeichelhafte Darstellung Pennys), plötzlich ihre gemütliche, aber auch stickige Akademikerehe in einem kleinen Collegestädtchen in Maine aufgekündigt, ihren Geliebten im Familienwagen abgeholt (einen sportlichen blonden katholischen Priester, der gerade dabei war, seinen Ornat an den Nagel zu hängen, nachdem Greta ihn gleich nach ihrer Konvertierung verführt hatte), war mit ihm nach Boston gefahren und dann nach Paris geflogen, wo sie beide ein unterschiedliches, aber gleichwohl schreckliches Ende ereilte (eine sehr ferne Variante der tatsächlichen Begebenheiten: Penny war in Kalifornien).
Matthews jedoch, der nie in Paris gewesen war, hatte sich einfach aus einer Laune heraus dafür entschieden, so, wie er jetzt irgendeine Stadt aussuchen wollte, um Paris zu verlassen. Einfach ein Wort wählen. Prag. Kairo. Gdansk. Für seinen Roman hatte er alles in Bibliotheksbüchern und Reiseführern und auf Metroplänen recherchiert und wichtige Ereignisse in der Nähe von berühmten Orten wie dem Eiffelturm, der Bastille und dem Jardin du Luxembourg stattfinden lassen oder aber an Orten, die er erfunden hatte, wobei er französische Wörter benutzte, deren Klang ihm gefiel. Rue Homard. Place de Rebouteux. Schließlich hatte er den Teil in Paris jedoch gekürzt, um die emotionale Bürde des verlassenen Erzählers deutlicher hervorzuheben und weniger das Schicksal Gretas, die auf der Rue de Rivoli von einem Auto überfahren wird – jener hübschen Straße, die entlang einer schönen Arkade führte (er hatte sie zufällig heute morgen aus dem Taxifenster bemerkt). Er hatte sich gefreut, die Straßenschilder mit dem Schriftzug »Rue de Rivoli« zu entdecken. Einen ganz kurzen Moment lang war ihm Paris beinahe bekannt vorgekommen. Im Augenblick allerdings konnte er nicht einmal ermitteln, wo Norden war.
Auf dem Friedhof, gerade jenseits der Mauer, die ihn von der Rue Froidevaux abgrenzte, standen einige Leute an einem offenen Grab. Sie alle trugen Jarmulkes und warfen mit einem winzigen Spaten, den sie einander weiterreichten, einige Brocken Erde in das Loch. Während sich die Trauernden abwendeten, öffneten sie schnell ihre Regenschirme und verschwanden dann zwischen den vielen Grabsteinen im Nebel. Er hatte gelesen, daß Juden auf französischen Friedhöfen eigene abgegrenzte Bereiche hatten, anders als in Amerika, wo sie eigene Friedhöfe hatten.
»Joyeux Noël! Parles-toi anglais ici?« sagte Helen, während sie in das kalte kleine Zimmer trat. Sie hatte eine Papiertüte mit etwas zum Essen dabei, und es tropfte von ihrem Regenmantel und ihren Haaren. »Hast du den Friedhof mit all den toten Franzosen auf der anderen Straßenseite gesehen? Auf der einen Seite das Leben, blind und ahnungslos. Auf der anderen Seite der Tod, allumfassend und unentrinnbar. Sie haben einander nichts zu sagen. Das gefällt mir. Wär vielleicht nicht schlecht, hier begraben zu sein.« Sie streckte die Zunge aus und blickte schielend zu ihm herüber. Helen war offensichtlich gut gelaunt.
»Blumberg hat angerufen«, sagte Matthews mißmutig. »Er kann mich diesmal nicht treffen. Er reist an den Indischen Ozean.«
»So ein Pech«, sagte Helen.
»Aber er will, daß ich hierbleibe und meine Übersetzerin kennenlerne.« Er merkte, daß er das alles so wiedergab, als müßte Helen diese Angelegenheit klären.
»Tja«, sagte Helen und legte den feuchten Papierbeutel auf den Nachttisch. »Gibt’s denn irgendeinen Grund, warum wir nicht hierbleiben können?«
»Sie ist im Moment nicht in Paris«, sagte Matthews. »Sie kommt erst in vier Tagen zurück.«
»Wir haben doch sonst nichts vor«, sagte Helen fröhlich, während sie ihren nassen Regenmantel auszog. »Uns wird schon was einfallen, hier in Paris. Wir sind ja schließlich nicht in Cleveland.«
»Ich wollte aber nach Oxford weiterfahren«, sagte Matthews.
»Die nehmen dich in Oxford sowieso nicht mehr auf«, sagte sie. »Aber in Paris hat man dich aufgenommen, wenn man so will. Und Übersetzer sind doch wichtig. Schicke Aufmachung übrigens.« Matthews stand ohne Schlafanzughose vor dem Fenster. Er befand sich in einem Zimmer im vierten Stock, in einem fremden Land, wo niemand ihn kannte. Daran hatte er nicht gedacht. Helen sah ihn mit aufreizend vorgeschobenen Lippen an. Sie war in letzter Zeit immer versessener auf Sex geworden, ein bißchen zu versessen, wie Matthews fand. Sie konnte gar nicht anders, als die Situation als eine Aufforderung zu verstehen.
»Ich muß mir mal überlegen, wie wir das Zimmer behalten können«, sagte er, während er vom Fenster wegging und anfing, seine Schlafanzughose zu suchen.
»Ich glaub nicht, daß es einen großen Ansturm auf diese Bude geben wird.« Helen sah sich in dem winzigen Zimmer um. Das Hotel war in Besitz von Arabern und wurde von Indern geführt. Ein paar arabisch anmutende Bilder hingen zur Dekoration an den Wänden: eine Oase mit einem klapprigen Kamel im Schatten; ein paar Männer, die Kapuzenmäntel trugen und neben einem weiteren Kamel in der Wüste im Kreis saßen.
»Trostlos hier«, sagte Matthews und ärgerte sich über den jammernden Tonfall seiner Stimme. Es lag wohl am Jetlag. »Eigentlich dachte ich, daß wir uns ein Taxi rufen und verschwinden. Einfach in irgendeinen Zug steigen.«
»In einen Zug wohin?« sagte Helen.
»Vielleicht an die Riviera. Ich hab gedacht, Paris sei näher an der Riviera.«
»Ich will nicht an die Riviera«, sagte sie. »Mir gefällt’s hier. Mein ganzes Leben lang wollte ich hierher. Wir sollten es einfach auf uns zukommen lassen. Das ist doch romantisch. Weihnachten in Paris, Charley. Gibt’s da nicht irgendein Lied drüber?«
Matthews kannte kein Lied über Weihnachten in Paris. »Hab ich noch nie was von gehört.«
»Na, dann müssen wir uns eben eins ausdenken«, sagte Helen. »Ich denk mir die Musik aus und du den Text. Du bist schließlich der Schriftsteller. Man muß ja nicht gerade Proust bemühen, um sich ein Lied über Weihnachten in Paris auszudenken.«
»Da hast du wahrscheinlich recht«, sagte Matthews.
»Siehst du, hab ich doch gesagt.« Helen lächelte. »Du bist ja schon viel fröhlicher. Ich hab dich sozusagen ins Fröhlichsein übersetzt. Noch ein Weilchen, und du singst uns was vor.«
Matthews kannte Helen Carmichael seit beinahe zwei Jahren. Sie hatte an dem Erwachsenenseminar teilgenommen, das er über den »Afroamerikanischen Roman« gehalten hatte – sein Schwerpunkt am Wilmot College (obwohl er gar nicht afrikanischer Abstammung war). Sie hatten einander sofort gemocht, sich regelmäßig nach den Seminarstunden auf einen Kaffee getroffen und dann, nachdem das Seminar zu Ende gegangen war, angefangen, miteinander zu schlafen. Es war ungefähr in jener trüben, dunklen Phase, nachdem Penny sich ihre gemeinsame Tochter Lelia geschnappt hatte und nach Kalifornien abgereist war, jener Phase, als Matthews feststellte, daß er das Unterrichten und alles, was dazugehörte, haßte, und beschloß, ein weniger geregeltes Leben zu führen, und einen Roman zu schreiben begann, um sich damit die Zeit bis zum Ende des Semesters zu vertreiben, wonach er kündigen wollte.
Helen war acht Jahre älter als er, eine hochgewachsene, knochige, nicht gerade zierliche aschblonde Frau mit der großbusigen Figur einer Revuetänzerin, einem breiten, sinnlichen Mund und großen gutmütigen Augen hinter einer Hornbrille. Matthews sah ihr gerne in die Augen. Dort fand er Trost. Alle Männer, so hatte er bemerkt, starrten Helen an. Sie hatte etwas Überlebensgroßes an sich, auch wenn das nicht unbedingt nur etwas Positives sein mußte. Helen nahm gerne von sich an, daß Männer es mit ihr »nicht leicht hatten« und daß die meisten Männer Angst vor ihr hatten, weil sie »die Kerle ganz schön in Atem hielt«, was bedeuten sollte, daß sie Köpfchen hatte und die Dinge oft ironisch nahm. Helen kam aus einer kleinen Bergarbeiterstadt in West Virginia und war schon dreimal verheiratet gewesen, zur Zeit aber ledig, und sie verspürte auch kein Verlangen, es noch einmal mit der Ehe zu versuchen. Sie arbeitete bei einer Werbefirma auf der anderen Seite des Ohio River in Parkersburg, nicht weit von dort, wo sie aufgewachsen war, und hatte Matthews erzählt, sie glaube, daß das Leben sie nicht mehr viel weiter führen werde, sondern hier wahrscheinlich Endstation sei – und daß sie mit fünfundvierzig einen Pakt mit ihrem Schicksal geschlossen habe und das Ganze nun realistisch sehen könne. Ihm gefiel ihre Unabhängigkeit.
Sie und Matthews genossen ein ungezwungenes, absolut befriedigendes sexuelles Verhältnis, verbrachten Nachmittage bei ihm zu Hause im Bett und unternahmen Wochenendfahrten ins nahe gelegene Pittsburgh, manchmal sogar bis nach Washington, D.C. Meist aber machten sie Ausflüge in der Abenddämmerung und aßen dann in einem der gemütlichen kleinen Gasthöfe oder einer restaurierten Mostkelterei, die hier und da an den Ufern des Ohio River standen, wobei der Abend dann häufig in irgendeinem wackligen Himmelbett in einer heißen kleinen Dachmansarde im dritten Stock endete, wo es ihnen fast nie gelang, sowenig Lärm wie möglich zu machen und sich trotzdem ausgiebig zu amüsieren.