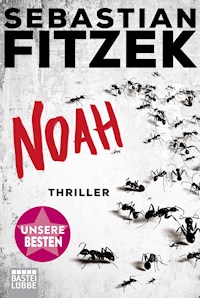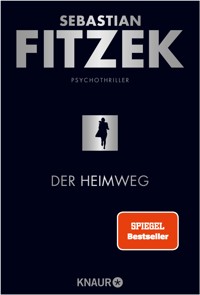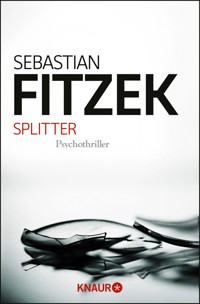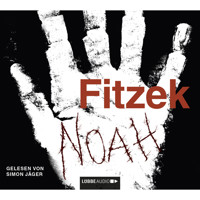9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Ein Thriller der Extraklasse - Abgeschnitten ist der sensationelle Gemeinschafts-Thriller der beiden SPIEGEL-Bestsellerautoren Sebastian Fitzek und Michael Tsokos. Rechtsmediziner Paul Herzfeld findet im Kopf einer monströs zugerichteten Leiche die Telefonnummer seiner Tochter. Hannah wurde entführt – und für Herzfeld beginnt eine perverse Schnitzeljagd: Der psychopathische Serienmörder hat eine weitere Leiche auf Helgoland mit Hinweisen präpariert. Herzfeld hat jedoch keine Chance, an die Informationen zu kommen. Die Hochseeinsel ist durch einen Orkan vom Festland Abgeschnitten, die Bevölkerung evakuiert. Seine einzige Chance ist die Comiczeichnerin Linda, die den Toten am Strand gefunden hat. Verzweifelt versucht Herzfeld sie zu überreden, die Obduktion nach seinen telefonischen Anweisungen durchzuführen. Doch Linda hat noch nie ein Skalpell berührt. Geschweige denn einen Menschen seziert … Der Thriller-Bestseller im Taschenbuch »Jeder für sich ist für Sujets bekannt, die unter die Haut gehen. Gemeinsam legen Thriller-Star Sebastian Fitzek (...) und Forensik-Star Michael Tsokos (...) einen Roman vor, der an Spannung und Dramatik keine Wünsche offen lässt.« Nordkurier »Hier geht es richtig zur Sache.« Stern "Abgeschnitten" von Sebastian Fitzek und Michael Tsokos ist ein eBook mit zahlreichen multimedialen Extras: Ein dramatischer Motion Comic lässt Sie gleich zu Beginn tief in die Welt von Abgeschnitten eintauchen. Viele Illustrationen im Stil dieses Motion Comics, die sich im Innenteil finden, verstärken dieses Erlebnis. Dazu erfahren Sie im Infotainmentbereich mehr über die Rechtsmedizin und Michael Tsokos: In einem Video lernen Sie die interessanten Facetten der Rechtsmedizin kennen und erfahren in einem fotografisch bebliederten Überblick spannende Fakten zu wichtigen Sektionsinstrumenten und deren Verwendung in der Rechtsmedizin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 454
Sammlungen
Ähnliche
Sebastian Fitzek / Michael Tsokos
Abgeschnitten
Thriller
Knaur eBooks
Über dieses Buch
Rechtsmediziner Paul Herzfeld findet im Kopf einer monströs zugerichteten Leiche die Telefonnummer seiner Tochter. Hannah wurde verschleppt – und für Herzfeld beginnt eine perverse Schnitzeljagd. Denn der psychopathische Entführer hat eine weitere Leiche auf Helgoland mit Hinweisen präpariert.
Herzfeld hat jedoch keine Chance, an die Informationen zu kommen. Die Hochseeinsel ist durch einen Orkan vom Festland abgeschnitten, die Bevölkerung bereits evakuiert. Unter den wenigen Menschen, die geblieben sind, ist die Comiczeichnerin Linda, die den Toten am Strand gefunden hat. Verzweifelt versucht Herzfeld sie zu überreden, die Obduktion nach seinen telefonischen Anweisungen durchzuführen. Doch Linda hat noch nie ein Skalpell berührt. Geschweige denn einen Menschen seziert …
Inhaltsübersicht
Ewig Mein
Vorbemerkung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
Vier Jahre zuvor.
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
Epilog
Nachbemerkung
Behind the Scenes
Facetten der Rechtsmedizin
Sektionsinstrumente der Rechtsmedizin
Bo∙gen∙sä∙ge, die\ Handsäge zum Zerteilen von Knochen
Darm∙sche∙re, die\ Instrument zum Schneiden von Gewebe
Flach∙mei∙ßel, der \ Instrument zum Trennen und Bearbeiten von Knochen
Kno∙chen∙fass∙zan∙ge, die \ Greifinstrument für Knochenteile
Knopf∙son∙de, die \ Instrument zum stumpfen Ertasten
Os∙zil∙lie∙ren∙de Au∙top∙sie∙sä∙ge, die \ Elektrische Säge zur gewebeschonenden Öffnung von Knochendecken
Pin∙zet∙te, die \ Instrument zum Greifen und Halten von Gewebe
Ra∙chio∙tom, das \ Instrument zur Eröffnung des Wirbelkanals
Schä∙del∙spal∙ter, der \ Meißel zum Trennen oder Bearbeiten von Knochen
Sek-tions-na-del, die \ Nadel zum Zunähen des Leichnams
Se-zier-mes-ser, das \ Instrument zur Präparation von Organen
Skal-pell, das \ Chirurgisches Instrument zum scharfen Durchtrennen von Gewebe
Dank
Leseprobe »ABGEFACKELT«
Ewig Mein
Das Landgericht hatte den 61-jährigen Mann, wie berichtet, zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt, nachdem er sexuellen Missbrauch seiner Tochter in 282 Fällen gestanden hatte. Der Täter profitierte davon, dass viele Jahre vergingen, ehe das Opfer über das Erlebte sprechen konnte. Außerdem lagen die Taten laut Gericht »13 bis 18 Jahre zurück«. Das Mädchen war 1992 sieben Jahre alt, als die Taten begannen.
Quelle: Der Tagesspiegel vom 16. April 2010
Das Landgericht Hamburg hat einen Börsenbetrüger zu einer Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt. Der Geschäftsmann hatte Millionen von Billigaktien (»Penny-Stocks«) gekauft, danach deren Kurse durch Falschinformationen in die Höhe getrieben – und dann die Anteile schnell verkauft, bevor deren Preis wieder abstürzte.
Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitungvom 17. April 2009
Prolog
Wo steckst du denn?«
Die Stimme ihrer Mutter passte zu den frostigen Temperaturen. Die Kopfhörer von Fionas Handy schienen die Kälte wie ein Magnet anzuziehen. Ihre Ohren waren schon so taub, dass sie die Stöpsel darin kaum noch spürte.
»Bin gleich zu Hause, Mama.«
Sie kam etwas ins Schlingern, als sie durch eine vereiste Bodensenke radelte. Ohne sich umzudrehen, prüfte sie, ob ihr Schulranzen noch sicher im Korb des Gepäckträgers verstaut war.
»Wann ist gleich, junge Frau?«
»In zehn Minuten.«
Ihr Hinterrad drehte durch, und sie überlegte, ob sie vor der Kurve besser absteigen sollte. Ihr flackerndes Vorderlicht warnte sie immer erst in letzter Sekunde vor Hindernissen auf dem kurvenreichen Pfad. Aber wenigstens war der Boden hier nicht so verschneit wie auf dem Fahrradweg entlang der Königsallee.
»Zehn Minuten? Du hättest schon vor einer Stunde zum Abendessen zurück sein sollen.«
»Ich hab Katrin noch Vokabeln abgefragt«, log Fiona. In Wahrheit hatte sie den Nachmittag bei Sandro verbracht. Aber das musste sie ihrer Mutter ja nicht auf die Nase binden. Die war ohnehin davon überzeugt, Sandro hätte einen schlechten Einfluss auf sie, nur weil er volljährig war und einen Stecker durch die Augenbraue trug.
Wenn die wüsste.
»Es piept, Mama. Mein Akku hat nur noch zwei Prozent.«
Diesmal sagte sie die Wahrheit. Ihre Mutter seufzte. »Beeil dich, aber nimm ja nicht die Abkürzung, hörst du?«
»Ja, Mama«, keuchte Fiona genervt und zog im Fahren den Lenker nach oben, um ihren Vorderreifen über eine Wurzel zu heben. Mann, ich bin dreizehn und kein Baby mehr! Wieso mussten ihre Eltern sie immer wie ein Kleinkind behandeln? Es gab kaum einen sichereren Ort auf der Welt als nachts im Wald, hatte Sandro ihr erklärt.
Logisch. Welcher Killer friert sich schon den Arsch ab in der Hoffnung, dass zufällig ein Opfer vorbeiradelt?
Statistisch gesehen geschahen weitaus mehr Straftaten bei Tageslicht oder in beleuchteten Innenräumen als im Dunkeln, und trotzdem glaubten alle, Gefahren würden vor allem in der Finsternis lauern. Das war genauso schwachsinnig wie diese ewigen Warnungen vor Fremden. Die meisten Sexualstraftäter waren Verwandte oder Bekannte, oft sogar die eigenen Eltern. Aber es warnte einen natürlich niemand davor, zu Mama und Papa ins Auto zu steigen.
»Beeil dich, Finchen«, waren die letzten Worte ihrer Mutter, dann verabschiedete sich der Akku endgültig mit einem letzten, langgezogenen Piepser.
Finchen. Wann hörte sie endlich mit diesem bescheuerten Kosenamen auf?
Oh Mann, wie ich meine blöde Familie hasse. Wenn ich doch nur schon von zu Hause ausziehen könnte.
Wütend trat sie in die Pedale.
Der Pfad vor ihr wurde schmaler, schlängelte sich in einer Fragezeichenkurve zwischen dicht stehenden Kiefern und mündete in einen Forstweg. Kaum hatte Fiona den Schutz der Bäume verlassen, erfasste sie ein schneidender Wind, und ihre Augen begannen zu tränen. Daher sah sie die Rücklichter des Wagens zuerst nur verschwommen.
Der Kombi war grün, schwarz oder blau. Irgendetwas Dunkles. Das große Auto stand mit laufendem Motor neben einem Stapel geschlagener Baumstämme. Die Heckklappe war offen, und Fiona konnte im schwachen Kofferraumlicht sehen, dass sich etwas auf der Ladefläche bewegte.
Ihr Herz begann zu rasen, wie immer, wenn sie aufgeregt war.
Komm schon, du bist doch keine Memme. Du warst schon oft in brenzligen Situationen. Weshalb nur hast du immer wieder Angst bei so was?
Sie fuhr wieder schneller und hielt sich am äußersten Rand des Weges. Als sie noch wenige Meter entfernt war, passierte es. Ein Arm fiel aus dem Kofferraum.
Zumindest hatte es in dem unnatürlichen Licht des Wagens auf den ersten Blick so ausgesehen. Tatsächlich baumelte der Arm über dem verschmutzten Nummernschild, der Rest des Körpers lag noch auf der Ladefläche.
»Hilf mir!«, hörte Fiona den Mann im Kofferraum krächzen. Er war alt, jedenfalls nach Fionas Maßstäben, für die alles über dreißig schon in die Kategorie Scheintod fiel. Er sprach so leise, dass die Geräusche des Dieselmotors seine Stimme fast vollständig verschluckten.
»Hilfe.«
Im ersten Impuls wollte Fiona einfach weiterfahren. Aber dann hob er den Kopf, den blutverschmierten Kopf, und streckte den Arm nach ihr aus. Fiona musste an ein Poster in Sandros Zimmer denken, auf dem die Klaue eines Zombies aus einem Grabhügel stach.
»Bitte nicht weggehen«, krächzte der Fremde, jetzt etwas lauter.
Sie hielt an, stieg vom Rad und betrachtete ihn zögernd aus einigem Abstand.
Die Augen waren zugeschwollen, Blut tropfte ihm aus dem Mund, und das rechte Bein wirkte unnatürlich verdreht.
»Was ist passiert?«, fragte Fiona. Ihre Stimme flatterte im gleichen Tempo wie ihr Puls.
»Ich wurde überfallen.«
Fiona trat näher. Im Licht der Kofferraumbeleuchtung konnte sie nicht viel erkennen, nur dass der Unbekannte einen Sportanzug und Laufschuhe trug.
Dann fiel ihr Blick auf den Kindersitz im Kofferraum, und das gab den Ausschlag. »Lass dich nicht täuschen. Die wahren Psychopathen sehen immer aus wie Opfer. Sie nutzen dein Mitleid aus«, hatte Sandro ihr eingeschärft. Und der verstand mehr vom Leben als ihre Mutter. Vielleicht war der Typ wirklich böse? Bestimmt hatte er es verdient, so zusammengeschlagen zu werden.
Und wenn schon, das ist nicht meine Angelegenheit. Das soll jemand anderes übernehmen.
Fiona setzte sich wieder auf den Sattel, da begann der Mann zu weinen. »Bitte, bleib. Ich tu dir doch nichts.«
»Das sagen sie alle.«
»Aber schau mich doch an! Siehst du denn nicht, dass ich Hilfe brauche? Ich fleh dich an, ruf einen Krankenwagen.«
»Der Akku von meinem Handy ist leer«, erwiderte Fiona. Sie zog sich die Stöpsel ihrer Kopfhörer aus den Ohren, die sie in der Aufregung ganz vergessen hatte.
Der Mann nickte erschöpft. »Ich hab eines.«
Fiona zeigte ihm einen Vogel. »Ich werd Sie nicht anfassen.«
»Musst du auch nicht. Es liegt vorne.«
Der Mann krümmte sich wie unter Magenkrämpfen. Er schien vor Schmerzen zu zittern.
Scheiße, was mach ich jetzt?
Fiona krallte die Finger um den Lenker. Sie trug dicke Lederhandschuhe, dennoch waren ihre Finger kalt.
Soll ich? Oder soll ich nicht?
Ihr Atem schlug dampfende Wolken.
Der Schwerverletzte versuchte sich aufzurichten, sank aber kraftlos auf die Ladefläche zurück.
»Bitte«, sagte er noch einmal. Fiona gab sich einen Ruck.
Ach, egal. Wird schon schiefgehen.
Die Stützen ihres Fahrrads fanden auf dem unebenen Weg keinen Halt, also legte sie es quer auf den Boden. Fiona achtete darauf, nicht in Reichweite des Mannes zu gelangen, als sie an seinem Wagen vorbeiging.
»Wo?«, fragte sie, als sie die Fahrertür geöffnet hatte.
Sie sah eine Halterung für die Freisprechanlage, aber kein Handy darin.
»Es liegt im Handschuhfach«, hörte sie ihn krächzen.
Sie überlegte kurz, ob sie einmal um den Wagen herumlaufen sollte, entschied sich dann aber dafür, über den Sitz auf die Beifahrerseite zu langen.
Fiona beugte sich tief in den Wagen hinein und öffnete das Handschuhfach.
Kein Handy.
Natürlich nicht.
Statt eines Mobiltelefons fiel ihr eine angebrochene Packung mit Latexhandschuhen entgegen und eine Rolle Paketklebeband. Ihr Puls ging in einen Stakkato-Rhythmus über.
»Hast du es gefunden?«, hörte sie die Stimme des Mannes, die auf einmal sehr viel näher klang. Sie drehte sich um und sah, dass er sich gedreht hatte und im Kofferraum direkt hinter den Rücksitzen kniete. Nur einen Sprung von ihr entfernt.
Von da ab ging alles sehr schnell.
Fiona ignorierte die Latexhandschuhe, ihre eigenen mussten ausreichen. Dann griff sie unter den Sitz. Die Waffe war genau dort, wo Sandro gesagt hatte. Geladen und entsichert.
Sie hob den Lauf, kniff das rechte Auge zusammen und schoss dem Mann ins Gesicht.
Dank dem Schalldämpfer hörte sich der Schuss an, als hätte sie einen Korken aus einer Weinflasche gezogen. Der Mann fiel zurück in den Kofferraum. Fiona warf die Waffe wie verabredet im hohen Bogen in den Wald. Dann hob sie ihr Fahrrad wieder auf.
Zu dumm, dass ihr Akku leer war, sonst hätte sie Sandro schnell eine SMS geschickt, dass alles geklappt hatte. Um ein Haar hätte sie das Ganze nicht durchgezogen, nur weil sie plötzlich Mitleid mit dem Arsch bekommen hatte. Aber versprochen war versprochen. Außerdem brauchte sie das Geld, wenn sie endlich von zu Hause abhauen wollte. »Der Scheißkerl hat es verdient«, hatte Sandro ihr mit auf den Weg gegeben. Und dass es das letzte Mal sein würde, dass sie so etwas für ihn erledigen müsste, was ja auch irgendwie logisch war. Immerhin werde ich nächste Woche vierzehn. Dann bin ich strafmündig und könnte für so was in den Bau wandern. Wenn sie mich heute erwischen, werde ich höchstens von irgendeinem Sozialarbeiter vollgelabert.
Geiles Rechtssystem, Sandro kannte sich echt gut aus mit Gesetzen, Jura und solchem Kram. Er verstand einfach mehr vom Leben als ihre Mutter.
Fiona lächelte bei dem Gedanken daran, ihm alles genau zu berichten, wenn sie ihn morgen wiedersah. Das Paketklebeband hatte sie gar nicht gebraucht, um den Loser vorher zu fesseln. Jetzt musste sie sich aber beeilen. Schließlich stand das Abendessen längst auf dem Tisch.
1. Kapitel
Das Blut gefällt mir nicht!
Linda betrachtete erschöpft das Opfer. Stunden schon mühte sie sich mit dem Mann ab. Mit dem Messer in seinem behaarten Bauch war sie zufrieden, auch mit den hervorquellenden Gedärmen und den glasigen Augen, in denen sich die Mörderin spiegelte.
Aber das Blut sieht nicht echt aus. Ich hab’s schon wieder versaut.
Wütend riss sie das Papier vom Zeichenblock, zerknüllte es und warf es auf den Boden neben ihren Schreibtisch zu den anderen misslungenen Versuchen. Sie zog sich die Stecker ihrer Kopfhörer aus den Ohren und tauschte die düstere Rockmusik gegen das Rauschen des Meeres. Dann schenkte sie sich heißen Kaffee aus der Thermoskanne nach. Sie wärmte die klammen Finger am Becher, bevor sie gedankenverloren den ersten Schluck nahm.
Verdammte Gewaltszenen.
Die Darstellung des Todes hatte ihr schon immer die größten Schwierigkeiten bereitet, dabei kam es genau darauf an. Ihre Comics wurden vor allem von weiblichen Teenagern gelesen, und aus irgendeinem Grund hatte ausgerechnet das schwache Geschlecht eine Vorliebe für explizite Gewaltdarstellungen.
Je härter, desto Frau, wie der Verlagsleiter nicht müde wurde zu betonen.
Sie selbst bevorzugte Naturszenen. Nicht die lieblichen Rosamunde-Pilcher-Motive, keine Blumenwiesen oder wogenden Kornfelder. Sie war von den Urgewalten des Planeten fasziniert. Von Vulkanen, Steilklippen und Wellenbergen, von Geysiren, Tsunamis und Zyklonen. Und in dieser Hinsicht bot sich ihr gerade eine atemberaubende Vorlage. Von dem kleinen Atelier unter dem Dach genoss sie einen großartigen Blick über die tosende Nordsee vor Helgoland. Das schmale, zweigeschossige Holzhaus war eines der wenigen freistehenden Gebäude oberhalb der Westküste der Insel. Es stand am Rand eines dieser unzähligen Krater, die die Bomben der Engländer nach dem Zweiten Weltkrieg ins Mittelland der Insel gerissen hatten.
Während Linda den blauen Bleistift spitzte, mit dem sie stets die ersten Konturen eines Bildes zeichnete, sah sie durch das Sprossenfenster zum Meer.
Wieso bezahlt mich niemand dafür, diese Aussicht festzuhalten?, fragte sie sich nicht zum ersten Mal, seitdem sie hierhergeflüchtet war.
Die schäumende See und die tiefhängenden Wolken erzeugten eine sogartige Wirkung. Es schien, als wäre die Insel in den letzten Tagen weiter ins Meer vorgerückt. Das Wellensturzbecken direkt neben dem Südhafen war vollgelaufen, und von den vierarmigen Betonpfeilern, die zum Schutz der Küste ins Meer geworfen worden waren, ragten nur noch die ufernahen Spitzen heraus. Trotz der Unwetterwarnung hätte Linda sich am liebsten ihre Gummistiefel und die Outdoorjacke übergezogen und sich bei einem Spaziergang zum Strand den kalten Regen ins Gesicht wehen lassen. Doch dafür war es zu früh. Noch.
Du musst den großen Sturm abwarten, bevor du hier rausdarfst, ermahnte sie sich in Gedanken.
Kein Tag verging, an dem der Katastrophenschutz nicht erneut im Radio dringend empfahl, Helgoland zu verlassen, bevor der Orkan mit dem harmlosen Namen »Anna« die Insel erreicht hatte. Und mittlerweile hatten die drastischen Vorhersagen Wirkung gezeigt. Dabei hatte zu Anfang kaum jemand den Meldungen Glauben geschenkt, die Insel könnte dieses Jahr vom Festland abgeschnitten werden. Doch dann riss ein Vorbote des Sturms das Dach über dem Südflügel des Krankenhauses ab. Auch wenn es in den anderen Gebäudeteilen nicht hereinregnete, war die medizinische Versorgung nicht mehr sichergestellt, denn Teile der Stromzufuhr waren gekappt, was beinahe zu einem Brand geführt hätte. Als schließlich nicht einmal mehr die Lebensmittellieferungen garantiert werden konnten, überdachten als Erstes die Alten ihre Entscheidung, auf der Insel zu bleiben.
Die wenigen Touristen wurden als Nächste evakuiert; ihnen schlossen sich die meisten einheimischen Familien mit Kindern an, und wenn heute Nachmittag die letzte Fähre ging, dürfte sich die Einwohnerzahl Helgolands auf knapp siebenhundert Menschen halbiert haben. Diese trotzten dem schlechten Wetter und den noch schlechteren Prognosen und hofften darauf, dass die Schäden schon nicht so dramatisch ausfielen, wie die Meteorologen es vorhersagten. Ihr harter Kern traf sich täglich im Bandrupp, dem Gasthaus des gleichnamigen Bürgermeisters, zur Lagebesprechung.
Während die Zurückgebliebenen ihr Haus und Gut nicht kampflos im Stich lassen wollten und sich verpflichtet sahen, auch in schlechten Zeiten die Stellung zu halten, hielt es Linda aus einem gänzlich anderen Grund auf der Insel. Vermutlich war sie die Einzige, die den Orkan mit all seinen Folgen sogar herbeisehnte, auch wenn das bedeutete, dass sie noch eine ganze Weile länger nur von Konservendosen und Leitungswasser würde leben müssen.
Denn war Helgoland erst einmal komplett von der Außenwelt abgeschnitten, konnte das Grauen, vor dem sie geflüchtet war, nicht mehr zu ihr auf die Insel gelangen. Und erst dann würde sie keine Angst mehr haben, ihr Versteck zu verlassen.
»Genug für heute«, sagte sie laut und stand von ihrem Zeichentisch auf. Seit dem frühen Morgen hatte sie an der Szene gearbeitet, dem Showdown, in dem sich die amazonenhafte Heldin an ihrem Widersacher rächt, und jetzt, sieben Stunden später, war ihr Nacken steif wie Beton.
Eigentlich gab es keine Veranlassung, weshalb sie die letzten Tage wie eine Besessene durchgearbeitet hatte.
Es gab keinen neuen Auftrag, der Verlag wusste nicht, dass sie erstmals an einer eigenen Geschichte arbeitete, nachdem sie bislang immer nur die Manuskripte anderer Autoren illustrieren durfte. Verdammt, der Verlag wusste nicht einmal, dass sie überhaupt noch existierte, nachdem sie von einem Tag auf den anderen wortlos von der Bildfläche verschwunden war, ohne ihr letztes Projekt vollendet zu haben. Vermutlich würde sie jetzt, da sie einen wichtigen Abgabetermin hatte verstreichen lassen, nie wieder einen Auftrag erhalten, weswegen es ihr eigentlich freigestanden hätte, nur noch das zu zeichnen, was sie wollte. Doch wann immer sie sich hingesetzt hatte, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen, waren es nicht die von ihr so geliebten Naturmotive gewesen, sondern das Bild des sterbenden Mannes, das sich vor ihrem geistigen Auge aufbaute. Und auch wenn sie mit dieser Gewaltdarstellung ihre gewohnten Schwierigkeiten hatte, so spürte sie tief in ihrem Innersten, dass es genau diese Szene war, die sie unbedingt zu Papier bringen musste, wenn sie endlich wieder einmal eine Nacht durchschlafen wollte.
Erst wenn ich das geschafft habe, werde ich das Meer zeichnen. Zuvor muss ich mir die Gewalt von der Seele malen.
Linda seufzte und ging ein Stockwerk tiefer ins Bad. Am Ende eines Arbeitstags fühlte sie sich stets wie nach einem Marathon. Müde, ausgelaugt und dreckig. Auch wenn sie sich kaum bewegt hatte, brauchte sie dringend eine Dusche.
Das Haus war noch nie renoviert worden, was in dem spartanisch eingerichteten Bad besonders augenfällig war: Die Fliesen an den Wänden waren von einem Dunkelgrün, das Linda das letzte Mal auf der Toilette einer Autobahnraststätte gesehen hatte, und der Duschvorhang war zu einer Zeit in Mode gewesen, als Telefone noch Wählscheiben hatten. Immerhin wurde das Wasser in wenigen Sekunden warm, und das war weitaus besser, als Linda es von der Dusche ihrer Wohnung in Berlin gewohnt war. Unter anderen Umständen hätte sie sich in dem kleinen Haus mit seinen schiefen Wänden, den verzogenen Fenstern und den niedrigen Decken sogar ganz wohl gefühlt. Linda legte keinen Wert auf Luxus, und der Ausblick aufs Meer entschädigte für Blümchentapeten, ockerfarbene Sesselbezüge und den ausgestopften Fisch über dem Kamin.
Aber leider nicht für die dunklen Träume, die mir den Schlaf rauben.
Sie zupfte die dunkle Bluse, mit der sie bei ihrem Einzug den Spiegelschrank verhängt hatte, wieder zurecht, dann zog sie sich aus. Sie wusste, die letzten Monate hatten tiefe Spuren hinterlassen, und die wollte sie nicht täglich im Spiegel sehen.
Unter der Dusche schäumte sie zuerst ihre braunen, schulterlangen Haare ein, dann verteilte sie den Rest des Schaums auf dem dünnen Körper. Früher hatte sie etwas zu viel auf den Rippen gehabt, heute ahnte man nur noch beim Anblick ihrer ausladenden Hüften, dass sie einst »gut im Futter gestanden« hatte, wie Danny einmal scherzhaft gesagt hatte. Sie erschauerte bei der Erinnerung und drehte das Wasser noch heißer. Wie immer versuchte sie, beim Waschen das Gesicht auszusparen.
Um meine Wunden nicht berühren zu müssen.
Aber heute hatte sie nicht schnell genug reagiert, und etwas Schaum war vom Haaransatz nach unten und damit über das poröse Narbengeflecht der Stirn gelaufen, das man zum Glück nur sah, wenn ihr dichter Pony ungünstig fiel.
Mist.
Widerwillig hielt sie das Gesicht unter den heißen Strahl der Dusche, was fast noch schlimmer war, als wenn sie die Spuren der Verätzungen mit den eigenen Fingern nachgezeichnet hätte.
Linda hatte viele Narben. Die meisten von ihnen waren größer als die auf der Stirn und schlechter verheilt, denn sie lagen an Stellen, an die keine Wundsalbe und kein Chirurg jemals herankommen würden: tief unten, verborgen im Seelengewebe ihrer Psyche.
Nachdem sie sich etwa zehn Minuten lang mit dem Duschstrahl den Nacken massiert hatte, spürte sie, dass die Verspannung sich zu lösen begann. Womöglich würde eine Ibuprofen den schlimmsten Kopfschmerz verhindern, wenn sie die Tablette rechtzeitig vor dem Einschlafen nahm. Vorgestern hatte sie es vergessen und war mitten in der Nacht mit einem Presslufthammer unter der Schädeldecke aufgewacht.
Sie drehte den Wasserhahn wieder zu, wartete, bis der verkalkte Duschkopf aufgehört hatte zu tropfen, und zog den Duschvorhang zur Seite. Dann erstarrte sie.
Im ersten Moment war es nur ein unbestimmtes Gefühl, das sie innehalten ließ. Noch begriff sie nicht, was sich in dem Badezimmer verändert hatte. Die Tür war geschlossen, die Bluse hing vor dem Spiegel, das Handtuch über der Heizung. Und doch, etwas war anders.
Vor einem Jahr noch hätte sie nichts gefühlt, aber nach all dem, was ihr seither widerfahren war, hatte sie so etwas wie einen sechsten Sinn für unsichtbare Bedrohungen entwickelt. Nicht nur die Videokassetten auf ihrem Nachttisch in ihrer Wohnung in Berlin hatten sie sensibilisiert. Bänder, auf denen sie selbst zu sehen war. Gefilmt von jemandem, der neben ihrem Bett gestanden haben musste. Während sie schlief!
Linda hielt den Atem an, horchte nach verdächtigen Geräuschen, doch alles, was sie wahrnahm, waren die Sturmböen, die am Haus nagten.
Falscher Alarm, dachte sie und atmete gleichmäßig, um ihren Puls wieder zu entschleunigen. Dann stieg sie fröstelnd aus der Dusche und griff nach dem Handtuch.
Und in dieser Sekunde traf sie die Erkenntnis wie ein elektrischer Schlag.
Sie schrie auf, begann am ganzen Körper zu zittern und drehte sich ruckartig um, als erwarte sie, jeden Moment von hinten angesprungen zu werden. Doch das Einzige, was ihr im Nacken saß, war die eigene Angst, und die ließ sich nicht so einfach abschütteln wie das Handtuch, das sie von sich geschleudert hatte.
Das Handtuch …, dessen Berührung ein Gefühl vollkommenen Ekels ausgelöst hatte.
Denn es war nass.
Jemand musste sich damit abgetrocknet haben, während sie unter der Dusche gestanden hatte.
2. Kapitel
Nein, ich habe es nicht angefasst, verdammt. Ich weiß noch genau, wie ich es heute Morgen über die Heizung gelegt habe.«
Linda fühlte, wie ihr das Blut zu Kopf stieg, und darüber ärgerte sie sich fast noch mehr als über die Beschwichtigungsversuche ihres Bruders am anderen Ende der Leitung. Auch wenn Clemens sie nicht sehen konnte, kannte er sie doch so gut, dass er allein an ihrem Tonfall merkte, wie sie rot anlief – wie immer, wenn sie aufgeregt war.
»Beruhig dich, Kleines«, sagte er, wobei er wie eine der Figuren aus den Filmen über die New Yorker Unterwelt klang, die er so sehr liebte. »Ich hab das geregelt. Es gibt nichts mehr, wovor du Angst haben müsstest.«
»Hah!« Sie atmete stoßweise. »Und wie erklärst du dir dann das nasse Handtuch? Mann, das ist doch exakt Dannys Handschrift.«
Danny. Scheiße, wieso nenne ich den Dreckskerl eigentlich immer noch bei seinem Kosenamen?
Mittlerweile wurde ihr allein bei dem Gedanken schlecht, dass sie mit diesem Widerling ins Bett gestiegen war, und das sogar mehrfach. Dabei konnte sie nicht behaupten, dass sie nicht gewarnt worden wäre. »So gut, wie er aussieht, so schlecht wird es enden«, hatte ihre Mutter geunkt. Und auch ihr Vater sollte mit seiner Bemerkung »Ich hab das Gefühl, er hat uns noch nicht sein wahres Ich gezeigt« den Nagel auf den Kopf treffen; so wie eigentlich immer, wenn es darum ging, andere Menschen einzuschätzen. So weltfremd ihre Eltern manchmal waren, deren gutbürgerliches Leben sich größtenteils zwischen Klassenarbeiten und Lehrerkonferenzen abspielte, so sehr hatten dreißig Jahre Unterricht vor Gymnasiasten ihre Menschenkenntnis geschult. Allerdings bedurfte es auch keiner hellseherischen Kräfte, um vorherzusagen, dass ihre Beziehung böse enden musste. Schließlich war Daniel Haag unter den Autoren, deren Geschichten sie illustrierte, der erfolgreichste und damit so etwas wie ihr Boss. Und Affären mit dem Boss endeten meistens böse. Wie böse allerdings, hatte niemand geahnt. Nicht einmal ihre Eltern.
Alles hatte harmlos begonnen. Das tat es in solchen Fällen vermutlich immer. Linda war Daniels aufbrausendes Temperament natürlich nicht entgangen, nur hatte sie seine Eifersüchteleien anfangs noch amüsiert belächelt, wenn er sich zum Beispiel über das bedeutungslose Kompliment eines Kellners ärgerte oder ihr vorwarf, nicht schnell genug auf eine SMS geantwortet zu haben.
Linda war sich bewusst, dass ihre direkte Art viele Kerle verunsicherte. Sie machte gern dreckige Witze, lachte gerne und laut und war sich nicht zu fein, im Bett die Initiative zu ergreifen. Auf der anderen Seite konnte es ihrer Eroberung passieren, nach einer durchtanzten Nacht im Club am nächsten Morgen in die Nationalgalerie geschleift zu werden, um hier zu erleben, wie wildfremde Menschen an Lindas Lippen hingen, während sie aus dem Stegreif über die ausgestellten Kunstwerke referierte. Viele ihrer Bekanntschaften waren schlicht überfordert und dachten, sie wäre ein durchgeknalltes Huhn, das mit zahlreichen Männern ins Bett stieg, was nicht der Wahrheit entsprach. Dass viele ihrer Beziehungen so rasch endeten, lag allein daran, dass sie es mit einem »herkömmlichen Exemplar« nicht lange aushielt; also mit einem Kerl, der ihren Humor nicht teilte. Aus diesem Grund hatte sie einen simplen Test entwickelt, mit dem sie noch in der ersten Nacht überprüfte, ob eine Beziehung aus ihrer Sicht überhaupt Zukunft haben konnte: Sobald ihre Eroberung sich schlafend zur Seite drehen wollte, schüttelte sie den Mann wieder wach und fragte scheinbar wütend: »Sag mal, wo hast du denn das Geld hingelegt?«
Bislang hatten nur zwei Männer gelacht, und mit dem ersten war sie fünf Jahre zusammengeblieben. Die Beziehung mit dem zweiten, Danny, hatte ein knappes Jahr gedauert, aber diese Zeit kam ihr heute wie eine Ewigkeit vor, denn die Monate mit ihm waren die schlimmsten ihres Lebens gewesen.
»Kleines, hab ich dir nicht versprochen, dass wir uns um ihn kümmern?«, hörte Linda ihren Bruder fragen, während sie nackt ins Schlafzimmer tapste und dabei eine Tropfspur und feuchte Fußabdrücke auf dem Parkett hinterließ. Ihr war kalt, aber sie ekelte sich davor, das feuchte Handtuch anzufassen.
Ja, hast du, dachte sie, den Hörer fest ans Ohr gepresst. Du hast mir versprochen, dafür zu sorgen, dass Danny damit aufhört, aber vielleicht war das diesmal eine Nummer zu groß für dich?
Linda wusste, es würde nichts bringen, diese Frage zu stellen. Wenn ihr großer Bruder eine Schwäche hatte, dann die, dass er sich für unbesiegbar hielt. Schon seine äußere Erscheinung schlug die meisten Widersacher in die Flucht. Die wenigen, die dumm genug waren, sich mit einem ein Meter neunzig großen Muskelberg anzulegen, der in seiner Freizeit Straßenkampf trainierte, hatten ihren Größenwahn mit einem Krankenhausaufenthalt bezahlen müssen. Nach zahlreichen Auseinandersetzungen stand Clemens die körperliche Gewalt ins Gesicht geschrieben, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Er hatte sich von einem Mitarbeiter seines Neuköllner Tattoostudios die Eintrittswunde einer Pistolenkugel mitten auf der Stirn tätowieren lassen …
»Was habt ihr mit Danny gemacht?«, fragte Linda, als sie vor ihrem Koffer mit ihren Habseligkeiten stand. Vierzehn Tage war sie nun schon hier, und noch immer hatte sie ihre Kleidung nicht in den Schrank geräumt. Sie griff sich eine Jeans und schlüpfte ohne Unterhose hinein. »Ich hab ein Recht, es zu wissen, Clemens.«
Linda war die Einzige, die ihren Bruder gefahrlos beim Vornamen nennen durfte. Alle anderen, selbst ihre Eltern, mussten ihn mit dem Nachnamen ansprechen, weil Kaminski Clemens’ Meinung nach sehr viel männlicher klang als der »Schwuppen-Vorname«, den seine Mutter für ihn ausgewählt hatte. Es war ein Wunder, dass sie überhaupt noch miteinander redeten, nachdem Clemens durch seinen Lebenswandel so ziemlich alle Ideale verraten hatte, für die seine Eltern sich ein Leben lang abgerackert hatten.
»Du brauchst nur zu wissen, dass Danny dir nie wieder etwas antun wird.«
»Ach ja? Habt ihr ihm etwa die Finger gebrochen, mit denen er meine Todesanzeige verfasst hat?« Linda schloss die Augen und erinnerte sich an die halbe Seite in der Sonntagszeitung; an den schwarzen Rand und das dezente Kreuz neben ihrem Namen. Als Todesdatum hatte Danny den Tag angegeben, an dem sie mit ihm Schluss gemacht hatte.
»Habt ihr ihm die Augen ausgestochen, mit denen er durch die Videokamera gestarrt hat?« Mit der er mich filmte, während ich mich mit meinen Freundinnen traf? Während ich einkaufen ging? Während ich schlief?
»Oder habt ihr ihm die Hände abgehackt, mit denen er mir die Säure in meine Hautcreme gemischt hat?« Nachdem ich gedroht hatte, ihn anzuzeigen, wenn seine Belästigungen nicht aufhören würden?
Unbewusst tastete sie nach den Narben auf ihrer Stirn.
»Nein«, sagte Clemens tonlos. »So leicht ist der Idiot uns nicht davongekommen.«
»Er ist kein Idiot.«
Ganz im Gegenteil. Danny Haag war weder dumm noch ein unkontrolliert aufbrausender Hitzkopf. Alles, was er tat, tat er erst nach gründlicher und intelligenter Planung, und immer so, dass keine seiner Handlungen zu ihm zurückverfolgt werden konnte. Zudem bereitete es ihm anscheinend keine Probleme, wochenlang abzuwarten, bevor er wieder zuschlug, weshalb die Polizei sich nicht veranlasst gesehen hatte, gezielt gegen Danny vorzugehen. Nach Meinung der Behörden sprachen die für einen Stalker untypisch langen Intervalle, in denen Linda in Ruhe gelassen worden war, gegen einen einzelnen Täter. Viel wahrscheinlicher sei es, dass Linda einfach nur Pech gehabt hatte und zufällig von verschiedenen Männern belästigt worden war (»Von fanatischen Lesern Ihrer Comics vielleicht?«), und genau diese Fehleinschätzung hatte Danny provozieren wollen. Zudem war er ein bekannter Autor, wohlhabend und gutaussehend, also einer, der »jede kriegen kann«, wie die Beamtin bei der Aufnahme ihrer Anzeige angemerkt hatte, so als wäre Linda die Nachstellungen Dannys gar nicht wert, über die sie sich hier beschwerte. Aber das hatte Clemens ja gleich gesagt: Die Gesetze waren ein Witz, ihre Hüter ein Lacher. »Solche Sachen muss man selbst in die Hand nehmen.« Und deshalb hatte ihr Bruder sie hier nach Helgoland gebracht, damit er sich während ihrer Abwesenheit in Berlin um Danny »kümmern« konnte.
»Du hast mir gesagt, hier wäre ich sicher«, sagte Linda vorwurfsvoll.
»Und das bist du auch, Kleines. Das Haus gehört Olli, du kennst meinen Kumpel. Bevor der irgendwas ausplaudert, verteilt der Papst Kondome.«
»Und wenn mich jemand auf der Fähre gesehen hat?«
»Dann hätte dieser Jemand keine Gelegenheit mehr gehabt, es Danny zu erzählen«, sagte Clemens mit seiner »Wie deutlich muss ich denn noch werden?«-Stimme.
Lindas Unterlippe bebte. Im Schlafzimmer zog es durch das verzogene Fenster, und sie fror von Minute zu Minute stärker. Mit einer Hand konnte sie sich keinen Pullover anziehen. Andererseits wollte sie unter keinen Umständen die Verbindung zu ihrem Bruder auch nur für eine Sekunde unterbrechen. Also trat sie ans Bett und schlug die Bettdecke zurück, mit der sie sich zudecken wollte.
»Sag mir, dass ich keine Angst zu haben brauche«, verlangte sie und ließ sich auf die Matratze sinken.
»Ich schwöre es dir«, versprach Clemens, doch das konnte Linda schon nicht mehr hören, denn kaum hatte sie den Kopf auf das Kissen gelegt, schrie sie aus voller Kehle.
3. Kapitel
Was zum Teufel ist da los bei dir?«, brüllte Clemens in den Hörer.
Linda sprang aus dem Bett, als hätte die Matratze sie gebissen.
»Komm schon, rede mit mir!«
Es dauerte eine Weile, bis sie sich so weit beruhigt hatte, dass sie ihrem Bruder antworten konnte. Diesmal war der Ekel noch schlimmer. Denn jetzt war der Beweis stichhaltiger als das feuchte Handtuch im Bad.
»Das Bett«, keuchte sie.
»Scheiße, was ist damit?«
»Ich wollte mich reinlegen.«
»Ja und?«
»Es ist warm. Verdammt, Clemens.«
Da hat jemand drin gelegen.
Sie wimmerte fast und musste sich auf die Zunge beißen, um zu verhindern, dass sie unkontrolliert losbrüllte.
»Und es riecht nach ihm.«
Nach seinem Aftershave.
»Okay, okay, okay, jetzt hör mir mal zu. Du bildest dir das ein.«
»Nein, das tue ich nicht. Er war hier«, sagte sie. Dann erkannte sie ihren Irrtum.
Er war nicht hier.
Das Bett ist warm. Der Geruch noch intensiv.
Er ist immer noch im Haus!
Mit diesem Gedanken stolperte sie rückwärts aus dem Zimmer, drehte sich hastig um und rannte die Treppe hinunter ins Erdgeschoss. Sie schlüpfte in die Gummistiefel an der Garderobe.
»Was hast du vor?«, fragte Clemens, der die Geräusche zu deuten versuchte, die Linda erzeugte, während sie sich anzog.
»Ich hau ab.«
»Wohin denn?«
»Keine Ahnung. Ich muss raus.«
»In den Sturm?«
»Mir scheißegal.«
Linda riss eine grüne Wetterjacke vom Haken, zog sie sich hastig über und stieß die Haustür auf. Es war das erste Mal, dass sie sich seit ihrer Ankunft auf Helgoland vor die Schwelle wagte, und damals war es hell und sonnig gewesen.
Und nicht so kalt.
Der Wind trieb ihr die Tränen in die Augen, während sie versuchte, den Reißverschluss der Jacke mit einer Hand zu schließen. Vergeblich.
Für einen Moment hatte sie die Orientierung verloren, in ihrer Aufregung hatte sie den Weg durch die Hintertür neben der Küche gewählt und blickte über den Steingarten auf das aufgewühlte Meer.
»Sei bitte vernünftig und warte kurz«, hörte sie Clemens sagen, aber sie achtete nicht auf ihn. Der schnellste Weg in den Ort führte über den Trampelpfad, der sich vom Kraterrand zum Meer Richtung Südhafen schlängelte.
»Ich ruf zurück, sobald ich unter Menschen bin, ich …«, sagte sie.
»Nein, nicht auflegen. Hör mir doch mal zu, verdammt!«
Linda hatte den Pfad erreicht und schaute in den wolkenverhangenen Himmel über der rauhen See. Sie fühlte sich keinen Deut besser als im Haus. Im Gegenteil: Der stürmische Wind schien das Gefühl der Bedrohung in ihr nur noch zu verstärken.
Auf Helgoland war auch in diesem Winter kaum Schnee gefallen, aber der grasgesäumte Erdboden war vereist. Atemlos und verängstigt, den Geruch des Aftershaves noch immer in der Nase, starrte sie von oben auf das Meer hinaus, das sich wie ein tollwütiges Tier mit weit aufgerissenem, schäumendem Maul auf die Tetrapoden der Küste stürzte.
Er ist hier. Ich spüre es. Er ist hier.
Sie sah zum Haus zurück.
Nichts. Kein Mann am Fenster. Kein Schatten hinter den Vorhängen. Nur das Licht, das sie im Atelier unter dem Dach hatte brennen lassen.
»Du musst mich hier wieder abholen, Clemens«, sagte sie und merkte selbst, wie hysterisch sie sich anhörte. Sie drehte sich zum Meer zurück.
»Du bist bekloppt, Linda. Niemand kommt mehr auf die Insel rauf. Weder ich noch dein Ex-Freund.«
Nenn ihn nicht Freund, dachte Linda, aber bevor sie es aussprechen konnte, wurde sie von einem Gegenstand abgelenkt, den die Wellen vor die Brandungsmauer geworfen hatten.
Bislang hatte sie reflexartig gehandelt und war vor einer Gefahr geflohen, die sie nicht sehen, dafür umso stärker spüren konnte. Jetzt aber hatte sie ein Ziel. Linda rannte, so schnell es ging, den Weg hinab nach unten, bis sie das Ufer erreicht hatte.
»Okay, Linda, hör mir zu. Entweder stehst du im Windkanal oder in einem Tornado. Beides ist gut. Lass dir ordentlich die Birne durchpusten. Ich hab dir gleich gesagt, du drehst irgendwann durch, wenn du nicht hin und wieder mal rausgehst.«
Wegen der immer lauter werdenden Windgeräusche war ihr Bruder kaum noch zu verstehen. Sie stand etwa fünfzehn Meter vom Wasser entfernt, nah genug, dass ihr der feuchte Atem der Wellen ins Gesicht schlug.
»Ich ruf später wieder an«, brüllte sie gegen das Tosen an.
»Ja, tu das. Schnapp etwas frische Luft, atme tief durch.«
Linda nickte, dabei hatte sie ihrem Bruder gar nicht mehr zugehört, während sie sich langsam, aber stetig der Brandungsmauer näherte. Irritiert starrte sie auf den dunklen Klumpen, der zwischen den Betonarmen der Wellenbrecher hing.
»Und vertrau mir: Der Scheißkerl kann dir nichts mehr tun. Verstehst du?«, hörte sie Clemens sagen.
»Er ist tot«, sagte sie tonlos.
»Nicht am Telefon«, antwortete er, ohne zu wissen, dass sie nicht mehr mit ihm gesprochen hatte.
Linda trat einen Schritt zurück, fing an zu würgen und wollte weglaufen, doch der schreckliche Anblick lähmte ihr die Glieder.
Ich werde nie so gut sein, dachte sie. Das Telefon war ihr zu diesem Zeitpunkt schon längst aus der Hand gefallen.
Später schämte sie sich für diesen Gedanken, aber das Erste, was ihr durch den Kopf schoss, als sie in das fratzenartige Gesicht starrte, war, dass sie den Tod niemals so perfekt würde zeichnen können, wie er sich ihr in dieser Sekunde offenbarte. Dann begann sie zu weinen. Teils aus Schock, doch, wenn sie ehrlich war, größtenteils aus Enttäuschung, weil sie auf den ersten Blick erkannte, dass es sich bei der Leiche am Wasser nicht um Danny Haag handelte.
4. Kapitel
Jetzt krieg ich gleich richtig auf die Fresse.
Paul Herzfeld verlangsamte seinen Schritt und überlegte, ob er die Straßenseite wechseln sollte. Noch wenige Meter trennten ihn von dem eingerüsteten Mietshaus und dem Teil des Bürgersteigs, der aus Sicherheitsgründen abgesperrt war. Vor dem Eingang des überdachten Übergangs, der die Fußgänger an der Baustelle vorbeileiten sollte, stand die Gruppe und wartete auf ihn.
Vier Männer, einer kräftiger als der andere. Der mit dem Hammer in der Hand lächelte.
Verdammt, warum arbeiten die heute überhaupt?
Herzfeld hätte nicht erwartet, dass man bei so einem Wetter tatsächlich Arbeiter auf die Gerüste schickte. Es gab Orte in der Antarktis, die gemütlicher waren als Berlin im Februar. Kaum Sonne, dafür so viel Schnee, dass den Baumärkten die Schneeschaufeln ausgegangen waren. Und hatte der Wetterbericht nicht Sturm vorhergesagt? Wieso also waren die Idioten dann schon wieder auf der Baustelle? Noch dazu so früh?
Die Sonne war noch nicht aufgegangen, wie so oft, wenn Herzfeld sich morgens auf den Weg zur Arbeit machte. In den vier Jahren, die er als leitender Rechtsmediziner am Bundeskriminalamt tätig war, war Herzfeld noch kein einziges Mal zu spät im Sektionssaal erschienen. Und das, obwohl die erste Frühbesprechung bereits um halb acht auf dem Plan stand, eine in seinen Augen völlig bescheuerte Zeit; zumal für einen Single, der sich seit seiner gescheiterten Ehe auch gern mal wieder länger ins Berliner Nachtleben gestürzt hätte.
Als ob die Leichen nicht warten könnten, hatte er sich schon oft gedacht, wenn er, wie heute, seinen Frühstückskaffee im Stehen hinunterkippte, bevor er zur U-Bahn hetzte. Andererseits, auch das war ihm klar, konnte die enorme Arbeitsbelastung beim BKA nur ein Frühaufsteher bewältigen. Allein heute warteten in den Kühlfächern sechs Leichen. Ein Blick in die Zeitung genügte, um zu wissen, dass die Welt da draußen immer gewalttätiger wurde. Dazu musste man nicht der Spezialeinheit »Extremdelikte« vorstehen, einer Sonderabteilung, die hinzugezogen wurde, wenn es um die rechtsmedizinische Untersuchung besonders brutaler Tötungsdelikte ging.
Und heute hab ich gute Chancen, auf meinem eigenen Sektionstisch zu landen, dachte Herzfeld, während er sich den Männern näherte. Er spürte, wie sich seine Waden verkrampften, und wäre beinahe ins Stolpern geraten. Nervös ballte er die Faust in der Manteltasche. Der Schmerz in den Fingerknöcheln verstärkte die Erinnerung an seinen gestrigen Aussetzer, den er sich selbst kaum erklären konnte. Normalerweise wahrte er immer die Beherrschung, eine Notwendigkeit, die sein Beruf einforderte. Selbst wenn man mit den grausamsten Verbrechen konfrontiert wurde, musste man kühlen Kopf bewahren. Eine Eigenschaft, die er sich stets zugutegehalten hatte. Bis gestern.
Es war auf dem Heimweg passiert, nach einem langen Vormittag am Sektionstisch und einem noch längeren Nachmittag am Schreibtisch, wo er den Papierkram erledigen musste, der mit der Öffnung von Leichen zwangsläufig einhergeht. Herzfeld war noch in Gedanken bei dem drei Monate alten Säugling – sie hatten ihm in der Frühschicht mit chirurgischer Präzision die Augen entfernt, um mittels der Einblutungen in die Netzhaut nachweisen zu können, dass der Kleine zu Tode geschüttelt worden war –, als ihm der Hund zwischen die Beine lief; eine trächtige Promenadenmischung, die Leine hinter sich herschleifend. Die Hündin hatte sich von den Fahrradständern am Supermarkt gegenüber losgerissen und wirkte desorientiert.
»Hey, Kleine«, rief Herzfeld und ging in die Knie, um sie zu sich zu locken. Er wollte unbedingt verhindern, dass das Tier wieder zurück über die belebte Straße lief. Zunächst schien er Erfolg zu haben. Die Hündin war stehen geblieben, genau auf der anderen Seite des Fußgängerüberwegs. Ihr schwarzes Fell glänzte im leichten Nieselregen, sie hechelte und blinzelte ängstlich, doch der Schwanz klemmte nicht mehr wie eingefroren zwischen den Hinterläufen, seitdem er begonnen hatte, ruhig auf sie einzureden. »Na komm. Komm her, meine Gute.«
Anfangs sah es ganz danach aus, als würde sie zu ihm Zutrauen fassen. Aber dann kam er. Der Arbeiter. Wie aus dem Nichts war er aufgetaucht, etwa genauso groß und schlank wie Herzfeld, aber allein die Leichtigkeit, mit der er die klobige Werkzeugkiste trug, signalisierte, dass er kräftemäßig in einer anderen Liga spielte.
»Verpiss dich«, sagte der Mann, der auf der Baustelle als Dachdecker arbeitete und auf den Spitznamen Rocco hörte, wie Herzfeld später erfahren sollte. Zuerst dachte er noch, der unflätige Befehl gälte ihm, doch dann geschah das Unfassbare: Der Prolet trat der hochschwangeren Hündin mit seinen schweren, eisenverstärkten Bauarbeiterstiefeln mit voller Wucht in den prallen Bauch.
Das Tier schrie auf. Entsetzlich laut und entsetzlich spitz, und mit dem Schmerzensschrei legte sich in Herzfelds Kopf ein Schalter um, der mit »blinde Wut« beschriftet war. Von einer Sekunde auf die andere befand sich der Herr Professor nicht länger in seinem schlanken, aber untrainierten dreiundvierzigjährigen Körper. Er stand neben sich und handelte wie ferngesteuert, ohne einen Gedanken an mögliche Konsequenzen zu verschwenden.
»Hey, du feiges Arschloch!«, hörte Herzfeld sich sagen, gerade im letzten Moment, bevor der Mann die in die Enge getriebene Hündin ein zweites Mal traktieren konnte.
»Was?« Rocco drehte sich um und starrte Herzfeld an, als stünde ihm ein Eimer Kotze im Weg. »Was hast du Schwuchtel gesagt?«
Mittlerweile trennte sie nur noch ein kleiner Schritt. Die schwere Werkzeugkiste wirkte in den Händen des Dachdeckers wie ein leerer Schuhkarton.
»Welches meiner vier Worte hast du nicht verstanden? Das feige oder das Arschloch?«
»Na warte, dir prügel ich die Scheiße aus dem Darm …«, hatte Rocco ansetzen wollen, doch alles, was ihm nach dem S-Wort über die Lippen kam, war für die umstehenden Schaulustigen nicht mehr verständlich. Herzfeld nutzte das Überraschungsmoment, schnellte wie eine Sprungfeder nach vorne und rammte seine Stirn in das quadratische Gesicht des Tierquälers.
Es knirschte, Blut schoss ihm aus der Nase, aber Rocco gab keinen Laut von sich. Er schien vor allem verblüfft.
Die Hündin, die glücklicherweise nicht ernsthaft verletzt zu sein schien, hatte sich aus der Gefahrenzone verkrochen und war zu ihrem Besitzer geflüchtet, der sich wieder eingefunden hatte und jetzt gemeinsam mit anderen Zuschauern den ungleichen Kampf beobachtete: Herzfeld gegen Goliath. Hirn gegen Muskeln. Wut gegen Kraft.
Am Ende siegte das Glück über das Gesetz der Stärke.
Herzfeld wehrte ein, zwei Schläge ab, musste aber einen schweren Treffer gegen den Brustkorb hinnehmen und geriet schon ins Wanken, als der Arbeiter auf einer vereisten Bodenplatte ausrutschte und mit dem Hinterkopf auf dem Gehweg aufschlug. Dadurch war sein Gegner zwar noch lange nicht ausgeschaltet, aber ein leichtes Ziel für Herzfelds Winterstiefel. Wieder und wieder trat er dem Tierquäler ins Gesicht, in den Magen, gegen die Brust. Wieder und wieder rappelte der Mann sich auf, doch wann immer er es geschafft hatte, sich abzustützen, ließ Herzfeld ihm erneut die Faust ins Gesicht krachen. Traktierte seinen Unter-, dann den Oberkiefer und ließ erst von dem Mann ab, als er sich nicht mehr rührte.
Später erfuhr Herzfeld von dem Polizisten, der seine Aussage aufnahm, dass Rocco nach Einschätzung der Ärzte einen Monat lang keine feste Nahrung mehr würde zu sich nehmen können und knapp an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma vorbeigeschlittert war. Herzfelds geschwollene Hand würde schneller verheilen, allerdings dürfte es etwas länger dauern, bis er mit den lädierten Fingern wieder schmerzfrei sezieren konnte. Daran hatte er während seines Ausrasters natürlich ebenso wenig gedacht wie daran, dass seine Behörde kaum erfreut darüber sein würde, einen Abteilungsleiter in ihren Reihen zu wissen, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde.
Aus diesem Grund hatte Herzfeld heute Nachmittag einen Termin in der Personalabteilung. Im Augenblick jedoch sah er noch deutlich größere Probleme auf sich zukommen als eine Beurlaubung.
Jetzt, da er vor ihnen stand, erkannte er die Kollegen des Mannes, den er am Tag zuvor krankenhausreif geprügelt hatte, und die ihm nun in geschlossener Front den Durchgang versperrten.
»Was?«, fragte er. Herzfelds Atem dampfte. Der Kragen war ihm mit einem Mal zu eng und scheuerte am Hals. Er spürte Adrenalin durch seine Adern jagen, allerdings viel zu wenig, um die Kräfte von gestern zu mobilisieren. Heute könnte er sich nicht einmal gegen einen der Kerle wehren, geschweige denn gegen vier auf einmal.
»Rocco hat starke Schmerzen«, begrüßte ihn der Kleinste der Gruppe, der den Hammer in der Hand hielt. Ein pockennarbiger, drahtiger Typ mit rasierter Glatze.
»Und?«
»Und ihm geht’s echt scheiße, Mann.«
»Tja, so kann’s gehen«, sagte Herzfeld und wollte sich vorbeidrängen, aber der Kerl stieß ihm grob vor die Brust und sagte: »Halt, nicht so schnell, Professor.«
Er sah sich zustimmungheischend nach seinen grinsenden Kollegen um.
Professor? Verdammt, die wissen, wer ich bin.
»Wir wollen Ihnen nur was geben«, sagte der Anführer. Das Nicken und Grinsen der Meute wurde ausgeprägter.
Herzfeld zog die Schultern hoch, spannte die Bauchmuskeln an und machte sich auf den ersten Schlag gefasst. Doch zu seiner Verblüffung drückte der Kerl ihm den Hammer in die Hand. Erst jetzt erkannte Herzfeld eine blaue Geschenkschleife am Stiel.
»Das nächste Mal nehmen Sie das Ding hier, wenn Sie dem Arsch den Schädel einschlagen wollen, ja?«
Die Gruppe lachte, einer nach dem anderen zog sich die Arbeitshandschuhe aus und begann zu klatschen, während Herzfeld, immer noch mit wild pochendem Herzen, aber mit einem erstaunten Lächeln im Gesicht an ihnen vorbeiging.
»Bravo!«
»Gut gemacht.«
»War mal Zeit, dass Rocco an den Falschen gerät«, riefen sie ihm hinterher.
Herzfeld war so aufgeregt, dass er vergaß, sich zu bedanken. Es fiel ihm erst ein, als er eine halbe Stunde später den Sektionssaal betrat, um mit dem schrecklichsten Fall seiner Karriere konfrontiert zu werden.
5. Kapitel
Der Unterkiefer war aus den Gelenken herausgetrennt worden, vermutlich mit derselben grobzahnigen Säge, mit der der Täter auch den Oberkiefer entfernt hatte. Ob vor oder nach ihrem Tod, würde Herzfeld erst sagen können, wenn er Luftröhre und Lunge der Unbekannten untersucht hatte.
»Bei der Toten handelt es sich um eine weibliche Mitteleuropäerin, geschätztes Alter aufgrund des Organstatus zwischen fünfzig und sechzig«, diktierte er in das Aufnahmegerät. »Die an die Umgebungstemperatur am Leichenfundort angenäherte Rektaltemperatur sowie die Ausprägung von Leichenstarre und Leichenflecken deuten auf einen Eintritt des Todes vor maximal achtundvierzig, mindestens sechsunddreißig Stunden hin.«
Eigentlich hatte Herzfeld eine tiefe und laute Stimme, mit der er auch den müdesten Studenten im Hörsaal wecken konnte, aber bei der Arbeit im Sektionssaal hatte er sich angewöhnt, leise zu sprechen. Schon aus Respekt vor den Toten, aber auch, um den Sekretärinnen, die später die Obduktionsprotokolle schrieben, die Arbeit zu erleichtern. Je lauter man hier unten sprach, desto stärker war das Echo, das von den gekachelten Wänden zurückschlug und die Verständlichkeit der Aufnahme erschwerte.
»Die beiden Unterkieferäste einschließlich der Kieferwinkel wurden offensichtlich nach Abschälen von Oberhaut- und Unterhautfettgewebe über den zuvor genannten Strukturen herausgelöst und …«, Herzfeld hielt kurz inne und beugte sich noch einmal prüfend über die Leiche auf dem Stahltisch, bevor er weiter den Bericht für die Staatsanwaltschaft diktierte, »… und der Blick auf die Stimmlippen liegt frei. Die Haut über Kinn und Mundboden hängt nur schlaff herunter, ist in Falten gezogen. Keinerlei Unterblutungen des Unterhautfettgewebes oder der freiliegenden Mundbodenmuskulatur. Auch im Bereich der Kieferwinkel keine Einblutungen in das umgebende, offenliegende Weichgewebe.«
Die brutal entstellte Frauenleiche war von einem Obdachlosen in einem Umzugskarton auf dem stillgelegten Freizeitgelände des Spreewaldparks entdeckt worden, als der arme Kerl dort gerade sein Nachtlager aufschlagen wollte.
»Der hat jemand die Luft aus dem Kopp gelassen«, hatte der Landstreicher den Polizisten gesagt. Und diese Beschreibung war erstaunlich zutreffend. Herzfeld erinnerte das Gesicht der Toten an eine leere Maske. Wegen der fehlenden Kiefer war es wie ein verschrumpelter Luftballon in sich zusammengesackt.
»Haben wir den Karton hier, in dem sie gefunden wurde?«, fragte er in die Runde.
»Der ist noch bei der Spurensicherung.«
Herzfeld öffnete die Mundhöhle, um sie nach eingeführten Fremdkörpern zu untersuchen. Allein diese Handbewegung ließ ihn vor Schmerz zusammenzucken, der ihn zum Glück aber nicht so sehr behinderte, wie er befürchtet hatte. Solange seine Finger in Bewegung blieben, war es auszuhalten.
»Puhh … Grundgütiger.«
Er runzelte die Nase unter seinem Mundschutz. Die Tote war erst vor wenigen Minuten aus dem Kühlfach geholt worden, trotzdem füllte sich die Luft hier unten bereits mit dem süßlichen Duft der beginnenden Leichenfäulnis.
Der Sektionssaal war mit vierundzwanzig Grad mal wieder völlig überhitzt. Es war der Hausverwaltung einfach nicht beizubringen, dass es einen Unterschied machte, ob man in den Büros in den oberen Stockwerken arbeitete oder tief unten in den Kellern der Treptowers, einem markanten Hochhausturmkomplex in Treptow direkt am Ufer der Spree. Sobald die Temperaturen nach unten sackten, bollerten im gesamten Gebäude des BKA die Heizkörper auf Hochtouren, was sich unweigerlich auf die Funktion der Klimaanlage im Sektionssaal auswirkte, die daraufhin ihren Betrieb einstellte.
»Beide Hände sind scharfrandig im Übergangsbereich zwischen unterem Ende von Elle und Speiche und den Handwurzelknochen abgetrennt«, diktierte Herzfeld weiter.
»Ungewöhnlich intelligent«, kommentierte Dr. Scherz den äußerlichen Befund, und damit sprach der grobschlächtige Assistenzarzt neben ihm das aus, was Herzfeld schon die ganze Zeit über dachte: Wer immer die Frau ermordet hat, war kein Dummkopf und wusste genau, was er tat.
Viele Täter bezogen ihr Wissen aus Krimis und Hollywoodfilmen und dachten, es genüge, einer Leiche sämtliche Zähne zu ziehen, wenn man die Identität des Opfers verschleiern wollte. Nur wenige wussten, dass diese Maßnahme eine zahnärztliche Identifizierung zwar erschwerte, aber nicht unmöglich machte. Die Entfernung von Ober- und Unterkiefer und beider Hände hingegen war eindeutig die Handschrift eines Profis.
»Bevor ich es vergesse«, sagte Scherz unvermittelt und verzog spöttisch die wulstigen Lippen. »Ich soll dir von der Neuen am Empfang ausrichten, dass sie ein großer Fan von dir ist.«
Herzfeld verdrehte die Augen.
Er hatte das große Pech, einem bekannten Schauspieler zum Verwechseln ähnlich zu sehen: das etwas kantige, aber symmetrisch geschnittene Gesicht, große dunkle Augen unter einer hohen, vom vielen Denken zerfurchten Stirn, leicht gelockte Haare, die einst pechschwarz gewesen waren, langsam aber graue Strähnen zeigten – die Ähnlichkeit war so frappierend, dass es ihm selbst für einen Moment die Sprache verschlagen hatte, als er per Zufall das Foto des TV-Stars in einer Illustrierten entdeckte. Die schlanke Statur, die leicht nach vorne abfallenden Schultern, das breite Lachen, selbst die bei Wikipedia angegebene Körpergröße von einem Meter achtzig bei neunundsiebzig Kilogramm stimmten überein. Von diesem Moment an verstand Herzfeld, weshalb er immer wieder von wildfremden Menschen nach einem Autogramm gefragt wurde. Einmal hatte er einem hartnäckigen weiblichen Fan sogar die geforderte Unterschrift in ihr Poesiealbum gekritzelt, einfach, um seine Ruhe zu haben. Zu allem Überfluss war sein »Doppelgänger« seit kurzem in einer Arztserie zu sehen und spielte – ausgerechnet! – den skurrilen Pathologen Dr. Starck, der beim Sezieren laute Rockmusik hörte und unanständige Witze riss, wenn er sich nicht gerade den Pizzaboten direkt in den Obduktionssaal bestellte. Völlig an den Haaren herbeigezogen, aber unglaublich erfolgreich, weshalb Herzfeld davon ausging, in Zukunft noch öfter Autogramme fälschen zu müssen. Als Erstes vermutlich für die Neue am Empfang.
»Was sagt das CT?«, fragte er Dr. Sabine Yao, die ihm gegenüber auf der anderen Seite des Tisches stand. Die Deutsche mit chinesischen Wurzeln war neben Dr. Scherz die Dritte im Team, das in dieser Woche Bereitschaft hatte, und die Kollegin, mit der Herzfeld am liebsten sezierte. Alles an ihr war dezent: die fein geschwungenen Augenbrauen, die durchsichtig lackierten Fingernägel, ihre helle Stimme, der unaufdringliche Perlenschmuck am Ohr. Er schätzte Yaos ruhige, besonnene Art und ihre Fähigkeit, immer einen Schritt vorauszudenken. Auch jetzt hatte sie die Aufnahmen der Computertomographie unaufgefordert hochgeladen und schob ihm den Schwenkarm mit dem Flachbildmonitor entgegen, damit er einen kurzen Blick darauf werfen konnte, ohne die Öffnung des Brustkorbs zu unterbrechen.
»Siehst du den Fremdkörper?«, fragte Yao. Mit knapp einem Meter sechzig Körperhöhe musste sie auf einem kleinen Podest am Sektionstisch stehen. Herzfeld nickte.
Der Gegenstand im Schädelinneren musste aus Eisen, Stahl, Aluminium oder einem anderen röntgendichten Material bestehen, sonst hätte ihn das Bild der Computertomographie nicht so deutlich erfasst. Er hatte die Form eines Zylinders und war nicht größer als eine Erdnuss. Vielleicht ein Teil eines Projektils, was ein Hinweis auf die Todesursache sein könnte.
Kopfschuss. Wäre nicht der erste in dieser Woche.
Scherz, der bereits das Herz entnommen hatte, entfernte nun mit geschickten Schnitten die Lunge aus dem Brustkorb und legte sie auf den Organtisch am Fußende des Seziertisches.
»Keine Blutaspiration. Weder in der Luftröhre noch in der Lunge«, stellte Herzfeld fest, nachdem er die Bronchien aufgeschnitten hatte. Er nickte seinen Kollegen zu.
»Postmortale Leichenzerstückelung.«
Die Frau war schon tot gewesen, als sie verstümmelt wurde. Wäre ihr der Kiefer bei lebendigem Leib herausgesägt worden, wäre ihr unweigerlich Blut in Rachen und Kehlkopf gelaufen, das sie dann eingeatmet hätte. Zumindest diese Qual war ihr also erspart geblieben.
Scherz quittierte diese Information mit einem gleichgültigen Grunzen. Der tägliche Umgang mit dem Tod hatte den Assistenzarzt abstumpfen lassen. Auch Herzfeld gelang es meistens, seine Gedanken bei der Arbeit in eine Art Trance zu versetzen, vergleichbar einem Autofahrer, der eine ihm bekannte Strecke nahezu automatisch fährt. Er konzentrierte sich auf den Körper und nicht auf die Seele der Person, die er obduzierte. Und er vermied jeden Kontakt mit den Angehörigen, sowohl vor als auch nach der Sektion, um emotional nicht beeinflusst zu werden. Er brauchte einen kühlen Kopf, wenn es darum ging, gerichtsfeste Beweise zu sammeln. Letzte Woche erst hatten die Eltern eines Mordopfers darum gebeten, mit dem Rechtsmediziner sprechen zu dürfen, der ihre missbrauchte elfjährige Tochter obduziert hatte. Herzfeld hatte abgelehnt, wie immer. Denn mit dem Bild einer weinenden Mutter im Hinterkopf lag die Versuchung nahe, zielstrebig auf die Verurteilung des mutmaßlichen Mörders hinzuarbeiten und dabei einen Fehler zu machen, der am Ende womöglich sogar einen Freispruch ermöglichte. Aus diesem Grund bemühte er sich, seine Gefühle bei der Arbeit so weit wie möglich zu unterdrücken. Dennoch verspürte er Erleichterung, dass die Unbekannte auf seinem Tisch nicht bei lebendigem Leib zerstückelt worden war.
»Kommen wir jetzt zum Mageninhalt …«, sagte er, als hinter ihm geräuschvoll die Schiebetür zum Sektionssaal aufgezogen wurde.
»Entschuldigen Sie bitte meine Verspätung.«
Herzfeld und seine Kollegen drehten sich zu der Stimme im Eingang und musterten einen jungen Mann, der eiligen Schrittes in den Raum stürmte. Er trug den gleichen blauen Funktionskittel wie alle anderen, nur dass ihm seiner etwas zu klein geraten war.