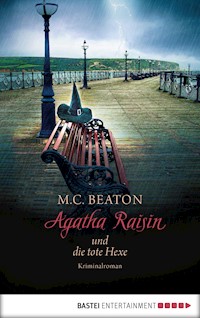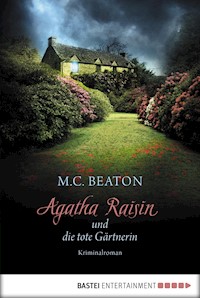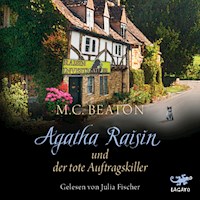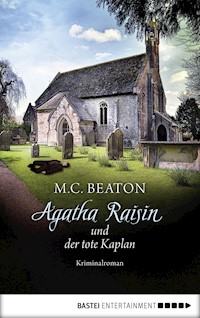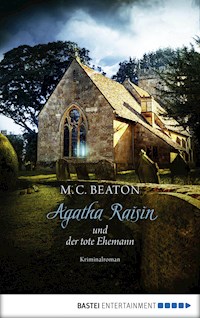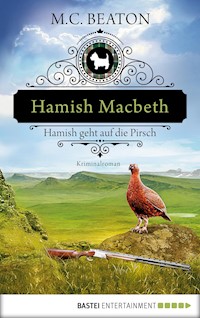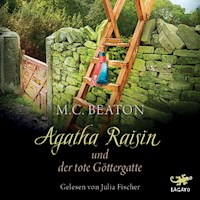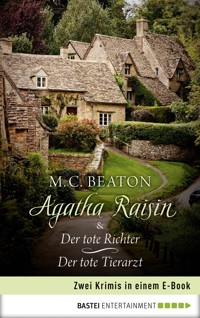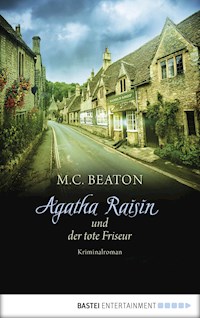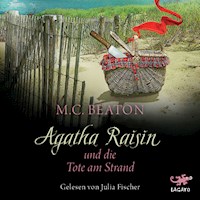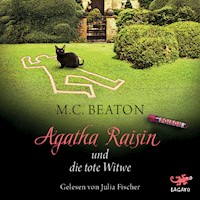
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lagato Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Agatha Raisin Mysteries
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Weihnachten steht vor der Tür und kommt Agatha wie gerufen. Denn sie will sich ein für alle Mal ihren Ex James Lacey aus dem Kopf schlagen. Sie stürzt sich so sehr in die festlichen Vorbereitungen, dass der Brief der Witwe Tamworthy völlig untergeht - obwohl diese behauptet, einer ihrer Verwandten wolle sie vor Jahresende tot sehen. Ein fataler Fehler. Wenig später ist die Dame tatsächlich mausetot. Und damit hat Agatha noch mehr Ablenkung als durch den ganzen Weihnachtstrubel: Ein Mörder muss gestellt werden!
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:5 Std. 10 min
Sprecher:Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Epilog
Über das Buch
Band 18 der Reihe »Agatha Raisin Mysteries«
Übersetzt von Sabine Schilasky
Weihnachten steht vor der Tür und kommt Agatha wie gerufen. Denn sie will sich ein für alle Mal ihren Ex James Lacey aus dem Kopf schlagen. Sie stürzt sich so sehr in die festlichen Vorbereitungen, dass der Brief der Witwe Tamworthy völlig untergeht – obwohl diese behauptet, einer ihrer Verwandten wolle sie vor Jahresende tot sehen. Ein fataler Fehler. Wenig später ist die Dame tatsächlich mausetot. Und damit hat Agatha noch mehr Ablenkung als durch den ganzen Weihnachtstrubel: Ein Mörder muss gestellt werden!
Über die Autorin
M. C. Beaton ist eines der zahlreichen Pseudonyme der schottischen Autorin Marion Chesney. Nachdem sie lange Zeit als Theaterkritikerin und Journalistin für verschiedene britische Zeitungen tätig war, beschloss sie, sich ganz der Schriftstellerei zu widmen. Mit ihren Krimi-Reihen um die englische Detektivin Agatha Raisin und den schottischen Dorfpolizisten Hamish Macbeth feierte sie große Erfolge in über 17 Ländern. Sie verstarb im Dezember 2019 im Alter von 83 Jahren.
M. C. BEATON
Agatha Raisin
und die tote Witwe
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Sabine Schilasky
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:Copyright © 2007 by Marion ChesneyPublished by Arrangement with M. C. BEATON LIMITEDTitel der englischen Originalausgabe: »Kissing Christmas Goodbye«Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Anke Pregler, RösrathUmschlaggestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung eines Motivs von © Arndt Drechsler, LeipzigeBook-Erstellung: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-0969-9
luebbe.delesejury.de
Eins
Agatha Raisin langweilte sich.
Ihre Detektei in den englischen Cotswolds florierte, doch es waren lauter kleine, enervierende und öde Fälle, die trotzdem eine Menge Zeit kosteten. Manchmal dachte sie, wenn sie noch eine vermisste Katze oder einen entlaufenen Hund auf den Tisch bekam, würde sie schreien.
Ihre Träume und Fantasien, die sie gewöhnlich als Puffer gegen die Lebenswirklichkeit hegte, waren zu ihrem Erstaunen vollkommen verschwunden. Sie hatte so lange von ihrem Nachbarn und Ex-Mann James Lacey geträumt, dass sie sich unmöglich eingestehen konnte, ihn nicht mehr zu lieben. Deshalb dachte sie nun wütend an ihn wie an ein Medikament, das nicht mehr wirkte.
Und obwohl es erst Anfang Oktober war, versuchte sie, für Weihnachten zu planen. Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen hatte Agatha die Idee von Weihnachten bisher nicht aufgegeben. Ein perfektes Fest war ihr Traum gewesen, als sie im Armenviertel von Birmingham aufwuchs. Glitzernde Stechpalmenzweige, sanft rieselnder Schnee draußen, und drinnen nichts als Dickens’sche Heiterkeit. Und in ihren Träumen küsste James Lacey sie unterm Mistelzweig, woraufhin sie ähnlich einem etwas älteren Dornröschen aufs Neue zu großer Leidenschaft erwachte.
Ihre Freundin, die Vikarsfrau Mrs. Bloxby, hatte sie einmal erinnert, dass an Weihnachten die Geburt Christi gefeiert wurde, doch das blendete Agatha geflissentlich aus. Für sie war Weihnachten eher Hollywood als Kirche.
Im Fernsehen lief bereits entsprechende Werbung, und in den Supermärkten gab es sämtliche Weihnachtsleckereien.
Aber dann geschah eines kühlen Morgens zu Monatsbeginn etwas, was Agathas Gedanken von Weihnachten ablenkte.
Sie saß in ihrem Büro in Mircester und ging mit ihrer Sekretärin Mrs. Freedman die Akten durch, um zu entscheiden, ob sie selbst noch einen lästigen Fall übernehmen oder ihn einem ihrer beiden Detektive, Phil Marshall und Patrick Mulligan, geben sollte. Der junge Harry Beam, der früher für sie gearbeitet hatte, studierte jetzt in Cambridge, und Agatha vermisste seine Energie.
»Das hätte ich fast vergessen«, sagte Mrs. Freedman. »Es ist ein Brief für Sie gekommen. Auf dem Umschlag steht ›persönlich‹, deshalb habe ich ihn nicht geöffnet.«
Agatha nahm ihn auf. Die Handschrift war krakelig, und es stand kein Absender auf dem Brief. Sie öffnete ihn und las:
Sehr geehrte Mrs. Raisin,
in der hiesigen Presse las ich von Ihrem detektivischen Können und frage mich, ob Sie eventuell Zeit hätten, mich einmal zu besuchen. Ich glaube, jemand aus meiner Familie versucht, mich umzubringen. Ist es nicht ungewöhnlich warm für Oktober?
Mit freundlichen Grüßen,
Phyllis Tamworthy
Es war teures Briefpapier. Und oben auf dem Bogen stand in erhabener Kursivschrift: The Manor House, Lower Tapor, Gloucestershire.
»Irre«, sagte Agatha. »Komplett gaga. Wie sieht es mit unserer Gewinnrechnung aus?«
»Gut«, antwortete Mrs. Freeman. »Es ist verblüffend, wie dankbar die Leute sind, ihre Haustiere zurückzubekommen.«
»Mir fehlt Harry.« Agatha seufzte. »Die Scheidungen machen Phil und Patrick nichts aus, aber sie hassen es, Tiere zu suchen. Offenbar halten sie es für unter ihrer Würde, und ich finde, es ist definitiv unter meiner.«
»Warum stellen Sie nicht jemand Jüngeres ein, der sich um die vermissten Tiere kümmert? Ein Mädchen vielleicht. Junge Frauen sind ganz verrückt nach Tieren.«
»Das ist eine glänzende Idee. Geben Sie eine Anzeige auf. Mal sehen, ob wir jemanden finden können. Schreiben Sie, dass wir eine Auszubildende suchen.«
Eine Woche später hatte Agatha nach einem langen Tag voller Vorstellungsgespräche das Gefühl, sie würde niemals die passende Person finden. Anscheinend hielten sich die dümmsten Mädchen in Mircester für Detektivinnen. Einige waren in schwarzem Leder und Stiefeln mit hohen Absätzen gekommen, weil sie glaubten, der Drei-Engel-für-Charlie-Look würde ihnen die Stelle sichern. Leider waren sie bis auf ein spargeldürres Mädchen alle übergewichtig mit großen Brüsten und breiten Hintern. Wobei das Gewicht natürlich keine Rolle gespielt hätte, wäre irgendeine von ihnen auch nur ansatzweise intelligent gewesen.
Agatha wollte Feierabend machen, als die Bürotür aufging und eine junge Frau hereinkam. Ihr blondes Haar sah natürlich aus, und ihre blassblauen Augen waren von dichten blonden Wimpern gerahmt. Sie war konservativ gekleidet in einem maßgeschneiderten Kostüm, weißer Bluse und flachen Schuhen.
»Ja bitte?«, fragte Agatha.
»Ich bin Toni Gilmour. Ich glaube, Sie suchen eine Auszubildende?«
»Man sollte sich schriftlich bewerben.«
»Weiß ich, aber es ist so, dass ich mir eben erst überlegt habe, mich zu bewerben.«
Tatsächlich hatte Toni einen Großteil des Tages draußen vor der Tür gestanden und sich die Mädchen angesehen, die nach ihren Vorstellungsgesprächen herauskamen, ihre Mienen studiert und sich angehört, was sie sagten. Daher wusste sie, dass keine von ihnen angenommen wurde. Und sie hatte sich gedacht, wenn sie als Letzte erschien, würde die verzweifelte Mrs. Raisin sie vielleicht direkt einstellen.
Doch Agatha wollte dringend nach Hause zu ihren Katern und ein entspanntes Wochenende einläuten.
»Gehen Sie und schicken Sie mir Ihre Bewerbung«, sagte sie. »Schicken Sie auch Kopien Ihrer Schulzeugnisse und eine kurze Erklärung, warum Sie glauben, sich für die Stelle zu eignen.«
Agatha stand halb auf, setzte sich aber wieder, als Toni sagte: »Ich habe meine Zeugnisse dabei. Ich war gut in der Schule. Ich bin fleißig. Die Leute mögen mich, was sicher praktisch ist, um an Informationen zu kommen.«
Agatha beäugte sie misstrauisch. Für gewöhnlich kam sie an ihre Fakten mittels Lügen, emotionaler Erpressung oder schlicht Drohungen.
»Es ist kein schillernder Job«, sagte sie. »Ihre Aufgabe wäre es, nach vermissten Hunden und Katzen zu suchen. Das ist anstrengend, und oft stellen Sie fest, dass das Tier überfahren oder wahrscheinlich gestohlen wurde. Wann haben Sie Ihren Schulabschluss gemacht?«
»Letzten Juni. Ich bin siebzehn.«
»Haben Sie momentan eine Stelle?«
»Ja, in der Apotheke von Shalbeys.« Shalbeys war ein großer Supermarkt im Ort. »Ich arbeite in der Spätschicht.«
»Das ist schwierig, denn ich brauche sofort jemanden.«
»Macht nichts«, antwortete Toni. »Ich kann mich feuern lassen.«
»Wollen Sie nicht studieren?«
»Nein, ich will nicht jahrelang einen großen Studienkredit abstottern müssen. Mrs. Raisin, es wäre doch nichts dabei, es mal mit mir zu versuchen.«
»Mir gefällt nicht, dass Sie sich feuern lassen wollen. Sie lassen Ihren Arbeitgeber hängen.«
»Es gibt reichlich Mädchen, die meine Stelle übernehmen würden. Ich finde, dass ich Initiative beweise. Sie werden keine Detektivin wollen, die sich immerzu an die Regeln hält.«
Agatha stellte fest, dass sie sehr müde war. Toni hatte eine klare, präzise Art zu sprechen, was dieser Tage bei Jugendlichen eine Seltenheit war, von denen die meisten das Artikulieren einzelner Wörter in einem Satz offenbar für lächerlich hielten.
»Na schön. Seien Sie am Montagmorgen um neun hier. Ziehen Sie lieber flache Schuhe und Sachen an, die auch mal schmutzig werden dürfen.«
»Wie viel verdiene ich?«, fragte Toni.
»Sechs Pfund die Stunde, und es gibt keine Überstunden, solange Sie in der Ausbildung sind. Wenn Sie sich gut machen, gebe ich Ihnen einen Bonus. Und Sie können Spesen geltend machen, wenn sie nachvollziehbar sind.«
Toni dankte ihr und ging.
»Komisches Mädchen«, murmelte Agatha.
»Ich fand sie nett«, sagte Mrs. Freedman. »Ziemlich altmodisch.«
Toni radelte nach Hause in eine der schlimmsten Sozialsiedlungen von Mircester. Sie schob ihr Fahrrad den von Unkraut überwucherten Gartenweg entlang und lehnte es an die Hausmauer. Dann holte sie tief Luft und schloss die Tür auf. Ihr Bruder Terry hing mit einer Flasche Bier in der einen und Fish & Chips in der anderen Hand vor dem Fernseher. »Wo ist Mum?«, fragte Toni.
»Pennt«, antwortete Terry. Im Gegensatz zu seiner schmalen Schwester war Terry ein Muskelpaket. Eine Narbe von einer Messerstecherei verschandelte seine rechte Wange.
Toni ging nach oben und linste ins Schlafzimmer. Mrs. Gilmour lag vollständig bekleidet auf ihrem Bett. Neben ihr auf dem Nachttisch lag eine leere Wodkaflasche, und es stank nach Schweiß und Alkohol.
Toni ging in ihr Zimmer und zog das Kostüm aus, das sie sich von einer Freundin geliehen hatte. Sie hängte es sorgfältig weg und schlüpfte in eine Jeans und ein sauberes T-Shirt.
Unten nahm sie eine Jeansjacke vom Wandhaken und zog sie an. Dann öffnete sie die Tür und griff nach ihrem Rad, um es zurück durch den Garten zu schieben.
Ihr Bruder erschien hinter ihr an der Haustür. »Wo willst du hin?«, rief er.
»Arbeit. Spätschicht«, brüllte Toni. »Weißt du noch, was das ist, Arbeit? Wie wäre es, wenn du dir mal einen Job besorgst, Wichser?«
Agatha wollte sich ein Fertigcurry zum Abendessen in der Mikrowelle wärmen, als es an der Tür läutete. Sie öffnete. Es war Mrs. Bloxby, die einen Karton Bücher trug.
»Die hier sind vom Kirchenbasar übrig geblieben«, sagte Mrs. Bloxby. »Es sind alte Penguin-Krimis, und ich dachte, Sie möchten die vielleicht haben.«
»Ja, prima. Kommen Sie rein, und stellen Sie sie auf den Küchentisch. Ich plane ein faules Wochenende, und Sie haben mir die Fahrt zur Buchhandlung erspart.«
Mrs. Bloxby setzte sich an den Küchentisch. Auf einmal machte Agatha sich Sorgen um ihre Freundin. Die Vikarsfrau wirkte erschöpft. Die Falten unter ihren sanftmütigen Augen schienen ausgeprägter als üblich, und aus ihrem im Nacken zusammengesteckten Haar hatten sich einige graue Strähnen gelöst.
»Ich hole Ihnen mal einen Sherry«, sagte Agatha. »Sie sehen geschafft aus.«
»Alf ist erkältet«, erklärte Mrs. Bloxby. Alf war der Vikar, auch wenn er Agathas Meinung nach einen ausgesprochen dummen Namen für einen Pfarrer trug. Peregrine, Clarence, Digby oder Ähnliches wäre passender gewesen. »Deshalb mache ich die Gemeindebesuche für ihn. Ehrlich, die Hälfte der Leute kommt nicht mal in die Kirche!«
Agatha stellte ihr ein Sherryglas hin. »Ich schätze, keiner fürchtet sich mehr vor Gott. Die Leute mögen ein bisschen Grusel.«
»Zynisch, aber wahr«, sagte Mrs. Bloxby. »Ökologie ist die neue Religion. Der Planet stirbt, die Polkappen schmelzen, und es ist alles eure Schuld, ihr Sünder. Haben Sie jemanden für Ihre Katzen und Hunde gefunden?«
»Ich probiere es mit einer jungen Frau. Sie ist gepflegt und etwas altmodisch in ihrem Auftreten und ihrer Ausdrucksweise. Ungewöhnlich heutzutage.«
»Dauernd versuchen Sie, meine Titten zu streifen, Sie alter Perversling«, sagte Toni zu dem Apotheker Basil Jones.
»Hier ist es eng«, konterte er erbost. »Ich wollte lediglich an Ihnen vorbeigehen.« Basils Wut wurde von der Tatsache befeuert, dass er sie durchaus absichtlich berührt hatte.
»Sie sind ein trauriger alter Sack.«
Basil bekam rote Flecken im Gesicht. »Und Sie sind gefeuert!«
»Okey-dokey«, sagte Toni fröhlich.
»Haben Sie von Mr. Lacey gehört?«, fragte Mrs. Bloxby.
»Nein, der ist irgendwohin verreist. Egal. Aber wenn er rechtzeitig zurück ist, lade ich ihn eventuell zu meinem Weihnachtsdinner ein.«
»Oh nein, Mrs. Raisin! Nicht schon wieder!«
Das Weihnachtsdinner im letzten Jahr war eine Katastrophe gewesen, weil Agatha einen riesigen Truthahn im Herd des Gemeindesaals zubereiten wollte und das Gas zu weit aufgedreht hatte. Der gesamte Saal war von beißend schwarzem Qualm vernebelt worden.
»Diesmal wird es perfekt, glauben Sie mir!« Agatha und Mrs. Bloxby siezten sich, wie es im altmodischen Frauenverein von Carsely Sitte war, dem beide angehörten.
»Es ist erst Oktober«, sagte die Vikarsfrau. »Keinem sollte erlaubt sein, vor dem ersten Dezember von Weihnachten zu reden.«
Agatha grinste. »Sie werden schon sehen. Ich veranstalte das Essen eine Woche vorher, dann durchkreuzt es keine familiären Pläne.«
Mrs. Bloxby trank ihren Sherry aus und richtete sich mühsam auf. »Ich fahre Sie nach Hause«, sagte Agatha.
»Unsinn. Ich kann zu Fuß gehen.«
»Doch, ich bestehe darauf.«
Der Vikar las ein Buch und hatte eine Schachtel Papiertaschentücher neben sich auf dem Tisch liegen. »Hallo, Liebes«, sagte er matt.
»Wie geht es Ihnen?«, fragte Agatha forsch.
»Ich bin immer noch sehr schwach.«
»Ihre Frau ist erschöpft, also kümmere ich mich jetzt um Sie, damit sie mal Pause machen kann.«
Entsetzt blickte er zu Agatha auf. »Nicht nötig. Ja wirklich, mir geht es minütlich besser.«
»Wir dürfen nicht riskieren, dass Ihre Frau vor Überarbeitung krank wird, nicht wahr?« Agatha lächelte ihn an, doch ihre kleinen Bärenaugen schauten bedrohlich. Der Vikar sah zu seiner Frau. »Geh und leg dich bitte hin, Liebling. Sicher kann ich uns ein leichtes Abendessen machen. Mrs. Raisin, Ihre Dienste werden nicht gebraucht!«
»Alf, du schreist«, ermahnte ihn Mrs. Bloxby. »Mrs. Raisin versucht nur zu helfen.«
Schmunzelnd fuhr Agatha zu ihrem Cottage zurück. Männer, dachte sie. Typisch. Frauen bekamen Schnupfen, Männer die Grippe.
Nach dem Essen nahm sie den Bücherkarton mit ins Wohnzimmer. Sie suchte sich einen Krimi von Margery Allingham aus und begann zu lesen. Am nächsten Tag wählte sie ein Buch von Edmund Crispin und danach eines von Freeman Wills Croft. Sie kramte in ihrer Handtasche nach ihren Zigaretten, als ihre Finger einen Umschlag ertasteten. Sie zog ihn heraus. Es war der eigenartige Brief von Mrs. Tamworthy. Und da ihr Kopf voller Krimis war, las Agatha das Geschriebene nun mit neuem Blick.
Was, wenn der Verdacht dieser Frau begründet war? Vielleicht würde sie Agatha einladen, eine Weile im Herrenhaus zu bleiben. Mrs. Tamworthy war gewiss eine elegante ältere Adlige mit silbergrauem Haar. Und sie hatte vermutlich einen plumpen, arroganten Sohn mit einer zickigen Ehefrau. Ihre Tochter dürfte mürrisch, jagdversessen und ledig sein. Es gäbe eine elfengleiche Enkelin, sehr schön und mit einem Schauspieler verlobt, sowie eine zweite, bodenständigere, die insgeheim in den Schauspieler verliebt war und …
Das schrille Telefonklingeln riss sie aus ihren Gedanken.
Es war Roy Silver, ein junger Mann, der früher für Agatha gearbeitet hatte, als sie eine eigene PR-Agentur besaß.
»Wie geht’s?«, fragte Roy.
»Bestens, und dir?« Roy war jetzt bei der PR-Agentur tätig, die Agatha engagiert hatte.
»Ich bewerbe gerade ein neues Parfum, Green Desire, von einer irischen Firma.«
»Taugt es was?«
»Ich bring es dir mit.« Er machte eine kurze Pause. »Genau genommen war ich so frei bereits herzukommen.«
»Wo bist du?«
»Um die Ecke.«
»Na, dann komm.«
Agatha öffnete die Haustür und wartete auf ihn. Es passte nicht zu Roy, sie unangekündigt zu besuchen. Und wenn, dann wollte er immer irgendetwas. Wahrscheinlich hatte er Schwierigkeiten mit diesem Green Desire.
Roy fuhr mit seinem Wagen vor, stieg aus und holte einen großen Koffer aus dem Kofferraum.
»Willst du verreisen?«, fragte Agatha.
»Ja, zu dir, wenn du mich aufnimmst, Schätzchen.«
»Moment mal. Das ist ein bisschen dreist, meinst du nicht?«
Zu ihrem Schrecken brach Roy in Tränen aus. Sein dünner Körper in dem Armani-Anzug erbebte unter seinem Schluchzen, und Tränen rannen über seinen sorgsam gepflegten Dreitagebart.
»Bring den Koffer rein«, befahl Agatha. »Und ich mache dir einen Drink.«
Sie sagte ihm, dass er den Koffer in der Diele lassen sollte, und ging voraus ins Wohnzimmer, wo sie ihm großzügig Brandy einschenkte. »Hier, trink das. Und wisch dir nicht die Nase am Ärmel ab. Da sind Papiertaschentücher auf dem Tisch.«
Roy sank aufs Sofa, putzte sich kräftig die Nase und trank einen Schluck von dem Brandy, bevor er elend ins Leere starrte.
Agatha setzte sich zu ihm. »Na, raus damit.«
»Es ist ein irischer Albtraum«, sagte Roy. »Ich bin vollkommen fertig. Ich habe es schon mit gemeinen, drogensüchtigen Popgruppen und eingebildeten Models zu tun gehabt, aber noch nie mit so etwas!«
»Wer macht das Zeug denn? Die IRA?«
»Nein, ein Dubliner Modehaus namens Colleen Donnelly steckt dahinter. Sie haben beschlossen, in den Parfummarkt einzusteigen und wollen das Ganze als ›Familienduft‹ vermarkten, die Art Duft, die man seiner alten Großmutter schenkt. Deshalb wurden die Werbeaufnahmen in diversen Wohnzimmern irgendwo in der Pampa gemacht, natürlich mit Großmutter, Mutter, Vater und Kindern. Das ging monatelang so. Vor lauter Tee und Langeweile bin ich halb wahnsinnig geworden. Und ich habe gedacht, wenn sich noch ein einziges Mal der Onkel von jemandem vor den Kamin stellt und Danny Boy singt, bringe ich mich um.«
»Müsste doch ein Kinderspiel sein«, sagte Agatha. »Und wie es klingt, stehen dir jetzt einige gute Fotos für die Hochglanzmagazine zur Verfügung.«
»Oh ja, die sind auf ihre Kosten gekommen. Das ist es nicht. Es ist Colleen Donnelly höchstpersönlich. Sie ist keine Irin, sondern aus Manchester. Und ihr richtiger Name ist Betty Clap.«
»Tja, den Namen hätte wohl jeder geändert.«
»Sie ist eine Furie. Die Schlimmste, für die ich je gearbeitet habe, und da schließe ich dich mit ein, Aggie.«
»Augenblick mal …«
»Entschuldige. Sie ist ständig aufgekreuzt, hat mich vor allen verhöhnt, mich einen Schlappschwanz und ein lächerliches Männchen genannt. Ich habe es dem Boss erzählt, Mr. Pedman, aber er meinte nur, dass es um einen großen Etat geht und ich durchhalten soll. Dann, kurz vor der großen Party zur Markteinführung, ruft sie in der Agentur an und sagt, sie will jemand anderen. Sie hat gesagt … sie hat gesagt, dass sie es leid ist, mit einem schnatternden Idioten zu arbeiten. Pedman hat Mary Hartley hingeschickt.«
»Wer ist das?«
»Eine Kuh, die neidisch auf mich ist und dauernd versucht, mir meine Kunden wegzunehmen. Ich bin ein Versager. Das ertrage ich nicht. Ich hatte noch Resturlaub, also bin ich einfach ins Auto gestiegen und wie von selbst hierhergefahren.«
»Hast du das Parfum dabei?«
Roy angelte einen grünen Flakon mit goldener Kappe aus seiner Tasche. Agatha nahm den Verschluss ab und sprüht sich ein wenig aufs Handgelenk.
»Das ist lausig, Roy.«
»Aber es bekommt eine tolle Publicity, dank mir, und Mary kassiert jetzt das Lob.«
Agatha reichte ihm die Fernbedienung für den Fernseher. »Du bleibst sitzen, trinkst aus und guckst dir irgendwas Albernes an. Ich sehe mal, was ich tun kann.«
Agatha ging in ihr Arbeitszimmer und loggte sich in ihren Computer ein. Dann öffnete sie die Datei mit ihren alten Journalistenkontakten, schaltete das Gerät wieder aus und griff zum Telefon. Sie rief Deirdre Dunn an, Chefredakteurin der Frauenseite beim Bugle. Zum Glück arbeitete Deirdre noch.
»Was gibt es, Agatha?«, fragte sie. »Ich dachte, Sie sind jetzt Privatdetektivin.«
»Bin ich auch. Aber ich möchte Sie bitten, mir einen Gefallen zu tun und ein Parfum namens Green Desire zu verreißen.«
»Warum sollte ich?«
»Weil ich zufällig weiß, dass Sie eine Affäre mit dem Außenminister Peter Branson hatten?«
»Müssen Sie das wieder ausgraben?«
»Nur, wenn es unbedingt nötig ist.«
»Na gut, Sie alte Hure. Was soll ich tun?«
»Schreiben Sie mit.«
Zwanzig Minuten später kehrte Agatha ins Wohnzimmer zurück. »Alles erledigt«, sagte sie munter.
»Was?«, fragte Roy.
»Deirdre Dunn bringt in der Sonntagsausgabe vom Bugle einen Artikel, dass Green Desire ein ganz mieses Parfum ist, trotz der genialen PR-Arbeit von Roy Silver, dem die undankbare Betty Clap, der es offensichtlich an Geschäftssinn mangelt, in den Rücken gefallen ist, indem sie ihn in letzter Minute gefeuert und gegen eine sehr viel unerfahrenere PR-Agentin ausgetauscht hat. Sie schickt auch ihre Assistentin raus auf die Straße, um Passanten das Parfum bewerten zu lassen, und natürlich druckt sie nur die schlechten Bewertungen. Deirdre ist sehr einflussreich. Das Zeug ist tot. Die Rache ist dein, mein Lieber.«
»Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll, Agatha. Wie konntest du Deirdre dazu überreden?«
»Ach, wir kennen uns schon ewig und sind gut befreundet.«
Roy sah Agatha skeptisch an. Deirdre, der Inbegriff von Eleganz und Gnadenlosigkeit, hatte ihm einmal gesagt, sollte Agatha jemals sterben, würde sie mit Freuden auf ihr Grab pinkeln.
»Wird es funktionieren?«, fragte er.
»Vertrau mir.«
»Danke, Aggie. Wie kann ich das wiedergutmachen?«
»Bleib einfach nicht zu lange.«
Am nächsten Morgen kam Agatha nach unten in die Küche, wo eine Schale mit frischen Croissants auf dem Tisch stand und Roy Zeitung las.
»Woher hast du die Croissants?«, fragte sie.
»Aus dem Dorfladen. Irgendeine Frau im Dorf backt sie anscheinend neuerdings. Ich habe Kaffee gekocht.«
Agatha ließ ihre Kater zum Spielen in den Garten. Anschließend nahm sie sich Kaffee, setzte sich an den Tisch und zündete sich eine Zigarette an.
»Muss das sein?« Roy wedelte mit den Händen.
»Ja, also sei still.« Agatha sah, dass sie Mrs. Tamworthys Brief auf dem Tisch liegen gelassen hatte. Sie reichte ihn Roy. »Lies das mal und sag mir, was du davon hältst.«
Roy studierte den Brief aufmerksam. »Sie klingt wahnsinnig.«
»Muss sie aber nicht sein. Ich könnte demnächst in der Zeitung lesen, dass sie gestorben ist, und dann hätte ich ein schlechtes Gewissen.«
»Es ist ein schöner Tag«, sagte Roy. Der Morgendunst lichtete sich. Agathas Kater, Hodge und Boswell, jagten sich über den Rasen. »Wir könnten zu ihr fahren und mit ihr reden.«
»Warum nicht? Auf die Weise finden wir schnell heraus, ob sie gaga ist oder nicht.«
Zwei
Nachdem sie sich mehrmals verfahren hatten, fanden sie Lower Tapor. Die Straßenschilder schienen die Existenz des Ortes zu ignorieren, und da weder Roy noch Agatha gut im Kartenlesen waren, war es purer Zufall, dass sie auf einmal vor dem Ortsschild landeten.
Langsam fuhren sie zwischen zwei Reihen kleiner roter Backsteincottages hindurch, hinter denen das Dorf auch schon endete.
»So ein Mist!«, murmelte Agatha und wendete umständlich, um wieder zurückzufahren. »Halt du Ausschau, ob irgendwo jemand ist, den wir fragen können.«
Doch die Straße war verlassen. »Da!«, sagte Roy. »Die kleine Straße da links muss irgendwohin führen.«
Agatha riss das Lenkrad herum und bog in die Straße ein. Sie gelangten zu einem dreieckigen Dorfanger, umgeben von Häusern und einem Pub – The Crazy Fox.
Vor dem Pub hielt Agatha an. Sie stiegen aus und blieben für einen Moment stehen, um das Pub-Schild zu betrachten. Es stellte einen Fuchs in roter Jagdkleidung und mit Gewehr in einer Pfote dar, aufrecht neben einem toten Mann, auf den der Fuchs ein Hinterbein stützte.
Der Pub befand sich in einem niedrigen Gebäude aus hellem Cotswolds-Stein. Das Dorf war sehr still, dabei war es ein herrlicher Tag und die Sonne schien warm.
Agatha öffnet die Tür und trat von Roy gefolgt ein. Direkt hinter der Schwelle blieb sie stehen und blinzelte verwundert. Der Pub war voller Menschen. An der Bar stand ein Mann mit einem Klemmbrett. Er hatte zu der Menge gesprochen, war jedoch verstummt, als sie eintraten, und blickte Agatha an.
»Was wollen Sie?«, fragte er.
»Ich suche den Weg zum Manor House«, antwortete Agatha.
Überall wurde mit Papieren geraschelt und geflüstert.
»Warum?«, fragte der Mann mit dem Klemmbrett. Er war ein großer, kräftiger Bauerntyp, und auf einmal wirkte sein Blick bedrohlich.
»Weil ich versuche, dorthin zu kommen«, antwortete Agatha.
»Biegen Sie draußen nach rechts und fahren Sie die Badger Lane hinunter. Die führt dorthin.«
»Kann man vielleicht etwas zu trinken bekommen?«, fragte Roy.
»Nein. Dies ist eine Privatversammlung. Raus hier.«
»Na, ich glaub’s ja wohl nicht!«, sagte Roy draußen.
»Ach, vergiss die Bauerntrampel. Suchen wir das Haus.«
Sie stiegen wieder in den Wagen und fanden die Badger Lane, die von einer Ecke des Dorfangers abging. Agatha fuhr langsam, denn die Straße verlief zwischen hohen Mauern und war so schmal, dass sie fürchtete, sich den Wagen zu zerkratzen.
»Da ist es«, sagte sie, denn an einem breiten Gatter hing ein kleines Schild mit der Aufschrift Manor House.
»Steig aus und mach das Gatter auf.«
»Warum ich?«, jammerte Roy.
»Weil ich fahre.«
Murrend stieg Roy aus, kam allerdings schnell wieder zurück. »Das ist mit einem Vorhängeschloss gesichert. Wir hätten anrufen sollen. Ruf sie jetzt an.«
»Nein, ich will sie überraschen«, erwiderte Agatha. »Ich will wissen, ob sie wirklich bekloppt ist. Wir lassen den Wagen hier und klettern über das Gatter.«
»Es könnte eine Farm sein«, sagte Roy unsicher und schaute zu den Weizenfeldern, die sich auf der anderen Seite zu beiden Seiten des Sandwegs erstreckten. »Wir könnten meilenweit laufen müssen.«
»Stell dich nicht so an. Los.«
Als Agatha über das Gatter stieg, schoss ihr ein unangenehmer Schmerz durch die Hüfte. Ihr war gesagt worden, dass sie in der rechten Hüfte Arthritis hätte und eine neue bräuchte. Um das zu verhindern, war sie Anfang des Jahres wieder zum Pilates gegangen, hatte es zuletzt aber schleifen lassen.
Zum Glück hatte sie einen Hosenanzug und flache Schuhe an. Sie marschierte los.
Nach zwei Meilen taten ihr die Füße weh, und in ihrer schlimmen Hüfte pochte es.
»Irgendwo hier muss es sein«, sagte sie erschöpft. »Da vorne sind einige Bäume. Das könnte es sein.«
Doch als sie die Bäume erreichten, fanden sie ein weiteres Schild, diesmal an einem Pfosten und mit der Aufschrift Manor House in goldenen Lettern. Vor ihnen lag ein Schotterweg.
Froh, im Schatten der Bäume zu sein, gingen sie weiter. Der Weg schlängelte sich durch dichten Wald.
»Wir laufen schon seit Stunden«, klagte Roy.
Nach einer gefühlten Ewigkeit kamen sie zu einem Pförtnerhäuschen, hinter dem ein Weg zwischen Schafweiden zu mehreren Gebäuden auf einem Hügel führte.
»Fast geschafft«, sagte Agatha. Nun wünschte sie auch, sie hätte angerufen. Ihr Leinenanzug begann, ihr am Rücken zu kleben, und sie wusste, dass ihr Gesicht glänzte.
»Das einzig Tröstliche ist der Gedanke an all die Pfunde, die ich gerade verliere«, sagte Roy.
Sie kamen an einigen sehr ordentlichen Ställen vorbei, bogen um eine Ecke und standen endlich vor dem Haus. Es war ein quadratischer georgianischer Bau mit einem überdachten Eingang und einem langen viktorianischen Flügel zur einen Seite.
»Es ist sehr ruhig«, sagte Roy. »Was ist, wenn sie unten bei der Versammlung im Pub ist?«
»Jetzt sind wir schon mal hier, da können wir auch klingeln.«
Sie läuteten und warteten. Nach einer Weile öffnete eine kleine, runde, mütterlich wirkende Frau, die eine Blümchenschürze über einem schwarzen Kleid trug.
»Wir möchten zur Dame des Hauses«, sagte Agatha überheblich.
»Und die wäre?«
»Mrs. Tamworthy natürlich.«
»Sie haben sie gefunden. Ich bin Mrs. Tamworthy.«
Agatha wurde feuerrot. Ein Schweißtropfen rann ihr über die Wange. »Oh, entschuldigen Sie bitte! Ich bin Agatha Raisin. Sie hatten mir geschrieben.«
»Stimmt, das habe ich. Kommen Sie rein.«
Sie folgten ihr durch eine Diele in ein großes luftiges Wohnzimmer mit Blick auf Rasen und einen Zierteich.
»Setzen Sie sich«, sagte Mrs. Tamworthy. »Kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?«
»Gern«, antwortete Agatha. »Gin Tonic, falls Sie haben.«
»Für mich bitte ein Bier«, sagte Roy, und Agatha sah ihn verwundert an. Sie hatte noch nie erlebt, dass Roy Bier trank.
Mrs. Tamworthy ging zu einer Hausbar in der Ecke. »Sie wohnen weit weg vom Dorf«, sagte Agatha. »Wir haben einen ganz schönen Marsch hinter uns. Das Gatter war abgeschlossen.«
»Oh, dann sind Sie den langen Weg gekommen! Sie hätte durch Upper Tapor kommen sollen. Auf der Seite ist das Tor immer offen, und es sind nur wenige hundert Meter von der Straße bis hierher.«
Die Hausbar verfügte über einen kleinen Kühlschrank, und bald vernahm Agatha das Klimpern von Eiswürfeln in einem Glas.
»Die Drinks sind bereit«, rief Mrs. Tamworthy. Beide standen auf, wobei Agatha das Gesicht vor Schmerz verzog.
Als sie alle wieder saßen, fragte Agatha: »Und wer versucht nun, Sie umzubringen?«
»Jemand aus der Familie, denke ich. Am nächsten Samstag kommen sie alle hierher, zu meinem Achtzigsten.«
»Achtzig! So sehen Sie nicht aus.«
»Das ist einer der Vorteile, wenn man fett ist, meine Gute. Es dehnt die Falten.«
Jetzt erst bemerkte Agatha, dass Mrs. Tamworthys zum Bauernzopf geflochtenes Haar braun gefärbt war und sie tiefe Falten in den Augenwinkeln hatte, während ihre Wangen glatt waren. Ihre Augen waren klein und sehr dunkel, perfekt, um Gefühle zu verbergen. Die Frau selbst war ebenfalls sehr klein und sehr rund, ihre Taille lediglich angedeutet. Und ihre Füße steckten in sehr flachen Hausschuhen, die den Boden nicht berührten, als sie saß.
Agatha nahm einen kräftigen Schluck Gin Tonic, öffnete ihre Handtasche und holte Notizblock und Stift hervor.
»Warum sollte jemand aus Ihrer Familie Sie umbringen wollen?«
»Weil ich hier alles verkaufe, so wie es ist, und das schließt das Dorf mit ein.«
»Und Ihre Familie ist dagegen, weil …?«
»Weil sie alle weiterhin die Gutsherren spielen wollen. Sehen Sie die Porträts meiner Vorfahren?«
Agatha schaute sich um. »Ja.«
»Alles unecht. Das war die Idee meiner Tochter Sadie. Sie hat sich ihrer Herkunft geschämt, weil sie mit Sir Henry Field verheiratet ist. Tja, mein verstorbener Mann hat sein Geld mit Ziegelsteinen verdient. Er hatte in einer Ziegelei gearbeitet, dann in der Lotterie gewonnen, und weil der Ziegelei die Pleite drohte, hat er sie gekauft. Dann kam der Bauboom, und er hat ein Vermögen verdient. Unsere vier Kinder – die beiden Söhne Bert und Jimmy und unsere Mädchen Sadie und Fran – sind alle auf guten Schulen gewesen. Sadie und Fran waren auf vornehmen Pensionaten in der Schweiz, und da haben sie ihnen diese Flausen in den Kopf gesetzt. Mein Mann Hugh hat alles für sie getan, und kurz nachdem sie ihn bearbeitet hatten, dieses Anwesen zu kaufen, starb er an Krebs. Ich übernahm das Geschäft, verdoppelte sein Vermögen und suchte mir einen guten Verwalter für das Anwesen, damit es Gewinn macht. Die Kinder haben mich sogar zu Aussprachekursen verdonnert. Aber jetzt will ich mein eigenes Leben führen. Ich habe das hier nie gemocht, will meine eigene kleine Wohnung.«
»Warum überlassen Sie das Anwesen dann nicht einfach Ihren Kindern?«
»Die würden es ruinieren. Mein Hugh hat nicht so hart gearbeitet, um zu sehen, wie alles verplempert wird.«
»Aber eines von ihnen will Sie umbringen?«, rief Agatha aus. »Sind Sie sich sicher?«
»Kommen Sie am besten zu meiner Geburtstagsfeier und sehen Sie es sich selbst an.«
»Ich komme aber nicht als Detektivin, oder?«
»Nein, sagen Sie, Sie sind eine Freundin von mir. Und Sie können auch Ihren Sohn mitbringen.«
»Er ist nicht mein Sohn«, entgegnete Agatha wütend. »Er hat früher für mich gearbeitet.«
»Bringen Sie ein paar Sachen mit und bleiben Sie übers Wochenende.«
»Ich lasse Ihnen von meiner Sekretärin den Vertrag schicken, in dem Honorar und Spesen aufgelistet sind«, sagte Agatha. »Was ist mit Ihrer Tochter Fran? Verheiratet?«
»War sie. Hat nicht gehalten. Jetzt ist sie geschieden.«
»Was ist schiefgelaufen?«
»Ihr Mann Larry war Börsenmakler. Eingebildeter Fatzke. Fran sagt, er hat sie für gewöhnlich gehalten, und das wäre allein meine Schuld. Sie gibt mir die Schuld an der Scheidung.«
»Sadie?«
»Verheiratet mit diesem Stockfisch, Sir Henry Field.«
»Und Ihre Söhne?«
»Bert ist ein Schatz, aber schwach. Er leitet die Ziegelei. Hat eine Farmertochter geheiratet … oder vielmehr sie ihn.«
»Der Name?«
»Alison.«
»Wie ist sie so?«
»Geländewagen, Tweed, klingt wie die Queen. Eine Tyrannin.«
»Und Jimmy?«
Phyllis Tamworthys Züge wurden weicher. »Ach, mein Jimmy! Er ist ein Süßer. Ruhig und anständig.«
»Wie alt sind Ihre Kinder?«
»Sadie ist achtundfünfzig, Fran sechsundfünfzig, Bert zweiundfünfzig und mein Jimmy vierzig. Ich hatte gedacht, ich wäre längst aus dem Alter, als er kam.«
»Gibt es Enkelkinder?«
»Nur zwei. Frans Tochter Annabelle, die ist siebenunddreißig, und Sadies Tochter Lucy ist zweiunddreißig.«
»Hat eine von ihnen Kinder?«
»Lucy. Ihre Tochter Jennifer ist acht.«
Agatha machte sich eifrig Notizen.
»Was glauben Sie, wer von ihnen Sie umbringen will?«, meldete sich Roy zu Wort.
»Weiß ich nicht. Es ist nur so ein Gefühl.«
Agatha blickte von ihrem Notizblock auf. »Sie erzählen uns nicht alles. Sie haben bestimmt eine klare Vorstellung, wer es sein könnte. Mir kommen Sie wie eine vernünftige Frau vor. Sie haben nicht einfach nur ein Gefühl, was Dinge betrifft.«
»Sie sind Detektivin. Ich heuere Sie an, das herauszufinden.«
Wieder schaltete Roy sich ein. »Wir waren im Dorfpub, um nach dem Weg zu fragen, und da schien eine Versammlung stattzufinden.«
»Ach, die beschweren sich dauernd über irgendwas. Mir gehört ja auch das Dorf. Bevor mein Mann das alles hier gekauft hat, war ein Sir Mark Riptor der Besitzer. Als ich übernahm, baten sie mich um eine Spende von dreißigtausend Pfund für den Erhalt des Cricketclubs, weil Sir Mark den immer unterstützt hat. Ich habe mich geweigert. Dann wollten sie, dass das Dorffest hier stattfindet. Weil das bei Sir Mark so war. Ich lehnte ab. Sie meinten, es hätte immer schon ein Dorffest beim Herrenhaus gegeben, solange sich irgendwer erinnern kann. ›Pech‹, habe ich gesagt. Also halten sie Versammlungen ab und meckern. ›Kommt mal im 21. Jahrhundert an‹, habe ich ihnen gesagt. ›Ich erwarte nicht von euch, dass ihr einen Kniefall macht und euch wie Bauern benehmt, also erwartet ihr nicht von mir, dass ich mich als Gutsherrin aufspiele.‹ Damit habe ich sie weggeschickt.«
Agatha starrte sie an. »Und Sie glauben nicht, dass es einer von denen auf Sie abgesehen hat?«
Sie lachte. »Nein. Die schimpfen nur gern.«
»Wie lange möchten Sie, dass ich an diesem Fall arbeite?«
»Das Wochenende sollte genügen. Ich habe gesagt, dass ich hier alles direkt nach meinem Geburtstag zum Verkauf anbiete.«
»Aber mal abgesehen davon, dass Ihre Kinder dieses Anwesen als Familienbesitz behalten wollen«, sagte Agatha, »werden sie nicht auch eine Menge Geld erben? Ich meine, das hier muss doch einiges wert sein.«