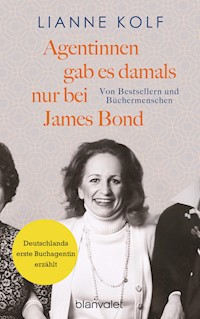
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Ein Leben für die Bücher – Fräulein Kolfs Gespür für Bestseller
Für die einen ist sie Gründerpersönlichkeit und Legende der Buchbranche, andere bezeichnen sie liebevoll als „Trüffelschwein“, sie selbst sieht sich als „Kupplerin“ zwischen Verlagen und Autor*innen. Lianne Kolf gründete 1982 die erste literarische Agentur für deutschsprachige Autor*innen und hat seitdem zahlreiche Bestseller auf den Weg gebracht. Jetzt erzählt sie aus ihrem Leben, das selbst wie ein Romanstoff ist: von der Kindheit in Starnberg als Tochter geflüchteter Eltern, die Rumänien noch lange als eigentliche Heimat begreifen, über die Zeit als Buchhändlerin und Vertriebsleitung im pulsierenden München der 1960er und 70er Jahre bis hin zu den Erfolgen und auch Tiefschlägen ihrer mehr als 40 Jahre unter Büchermenschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 244
Ähnliche
Buch
Für die einen ist sie Gründerpersönlichkeit und Legende der Buchbranche, andere bezeichnen sie liebevoll als »Trüffelschwein«, sie selbst sieht sich als »Kupplerin« zwischen Verlagen und Autor*innen. Lianne Kolf gründete 1982 die erste literarische Agentur für deutschsprachige Autor*innen in Deutschland und hat seitdem zahlreiche Bestseller auf den Weg gebracht. Jetzt erzählt sie aus ihrem Leben, das selbst wie ein Romanstoff ist: von der Kindheit in Starnberg als Tochter geflüchteter Eltern, die Rumänien noch lange als eigentliche Heimat begreifen, über die Zeit als Buchhändlerin und Vertriebsleitung im pulsierenden München der 1960er und 70er Jahre bis hin zu den Erfolgen und auch Tiefschlägen ihrer mehr als 40 Jahre unter Büchermenschen.
Autorin
Lianne Kolf gründete 1982 die erste deutsche Autorenagentur in München. Seitdem hat sie mehr als 4 000 Bücher vermittelt, ihre Autor*innen verkauften weltweit ca. 50 Millionen Bücher, und 80 Filme entstanden nach ihren Vorlagen. Begonnen hat Lianne Kolf ihre berufliche Karriere als Buchhändlerin in München, später war sie eine der ersten und jüngsten Vertriebsleiterinnen der Branche. Sie wurde in Starnberg bei München geboren und verbrachte einige Jahre in Hamburg und London, bevor sie sich wieder in der bayerischen Landeshauptstadt niederließ. Auch nach 40 Jahren geht Lianne Kolf immer noch mit großer Freude ihrem spannenden Beruf nach.
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet
LIANNE KOLF
Agentinnen gab es damals nur bei James Bond
Von Bestsellern und Büchermenschen
Das Zitat auf S. 113 stammt aus dem Lied »Aquarius« aus dem Musical Hair, Text Gerome Ragni und James Rado, Musik Galt MacDermot.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © 2022 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Heike Gronemeier
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
BSt· Herstellung: DiMo
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München
ISBN 978-3-6413-0187-3V001
www.blanvalet.de
»Veränderungen sind kein Schicksal, sondern eine Chance.«
INHALT
PROLOG: Das Füchslein
TEIL I
GASTLAND
KAPITEL 1: Heimatlos
KAPITEL 2: »Händler der vier Jahreszeiten«
KAPITEL 3: Palukes und Pralinen
KAPITEL 4: Anarchie in der Meierei
KAPITEL 5: Familienzusammenführung
KAPITEL 6: In bester Gesellschaft
TEIL II
MÜNCHNER FREIHEIT
KAPITEL 7: Lehrjahre bei Tante Ingeborg
KAPITEL 8: Die Kommunisten kommen
KAPITEL 9: Eine eigene Bude
KAPITEL 10: Summer of Love
KAPITEL 11: London Calling
TEIL III
BÜCHERMENSCHEN
KAPITEL 12: Die »Buchbox«
KAPITEL 13: Alles auf los
KAPITEL 14: Waidmannsheil
KAPITEL 15: Goldene Jahre
TEIL IV
DIE AGENTUR
KAPITEL 16: »Lianne, was machen wir jetzt?«
KAPITEL 17: Mit besten Grüßen
KAPITEL 18: Not macht erfinderisch
KAPITEL 19: Reiselust und Fitnesswelle
KAPITEL 20: Anne Frank und Hitlers Sekretärin
KAPITEL 21: Sex Sells
KAPITEL 22: Alles im Wandel
KAPITEL 23: Zurück ins Mittelalter
KAPITEL 24: Licht und Schatten
KAPITEL 25: Herzensangelegenheiten
Epilog
Danksagung
Autorenliste
PROLOGDas Füchslein
Fuschi.«
Solange ich denken kann und noch ein bisschen länger, habe ich diesen Spitznamen. Er klebt so fest an mir, dass ich ihn in diesem Leben wohl nicht mehr loswerde. Der Name wurde einfach über die Jahre immer so weitergereicht, von Familienmitgliedern, Freunden, Bekannten. Die meisten finden es lustig, mich Fuschi zu nennen, vor allem, wenn sie erfahren haben, was das Wort zu bedeuten hat.
Verpasst hat mir diesen Spitznamen mein Vater. Als er am 29. Mai 1948, einem herrlichen Frühlingstag, in seinem gebraucht gekauften grünen DKW Sport-Cabrio an der Frauenklinik Dr. Knorr in Niederpöcking am Starnberger See vorfuhr und sich auf der Entbindungsstation meldete, war er so aufgeregt, dass er sogar vergaß, mit den Krankenschwestern zu flirten, was er normalerweise nicht versäumt hätte. Wenig später streckte ihm seine Frau Lieselotte ihr Neugeborenes entgegen: mich. Und mein Vater sprach den denkwürdigen Satz: »Das ist ja eine Fuschi.«
Martin Kolf stammte – wie auch meine Mutter – aus Siebenbürgen. Damals, drei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, war er noch nicht besonders gut in Hochdeutsch, wohl aber im Erfinden von Wörtern und Begriffen. Das Baby, das er nun behutsam in den Arm nehmen durfte, hatte einen rötlichen Haarflaum und damit für immer seinen Kosenamen aus dem Tierreich weg: Fuschi, das Füchslein.
Die Klinik, in der ich das Licht der Welt erblickte, gibt es heute nicht mehr. Die ehemalige Villa Knorr, ein prachtvolles Anwesen im toskanischen Stil, inzwischen fast 170 Jahre alt, war Sommerresidenz, landwirtschaftlicher Betrieb, Mädchenpensionat und Frauenklinik. Heute beherbergt das Haus ein etwas verkitschtes Hotel mit Restaurant, eine begehrte Hochzeitslocation am Westufer des Starnberger Sees mit Blick auf die Gemeinde Berg am gegenüberliegenden Ufer (wo einst der bayerische Märchenkönig Ludwig II. den nassen Tod fand).
Auch wenn sich vieles verändert hat, die Villa ist immer noch ein magischer Ort für mich. Manchmal fahre ich noch nach Niederpöcking, rolle durch das schwere Eisentor unten an der Landstraße, parke oben auf der Anhöhe, schaue auf den See und denke an meine Eltern: An meinen Vater Martin, damals 24 Jahre alt, und an meine Mutter Lieselotte, zwei Jahre jünger als er. Ich sehe sie vor mir, wie sie mit mir auf dem Arm hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Mit mir, ganz neu auf dieser Welt, die auch für sie noch neu und ungewohnt war. Während zu Hause, in der schönen Villa Dorlei, Tante Hilde, die Schwester meines Vaters, ungeduldig auf die Rückkehr der kleinen Familie wartete. Hier hatten die drei durch den Krieg Entwurzelten eine neue Heimat gefunden: zwei Zimmer zur Miete. Dass nun ein Baby ihre Schicksalsgemeinschaft bereicherte, grenzte für meine Eltern und Tante Hilde noch Jahre später an ein »Wunder«. Nie und nimmer hätten sie sich das in der schlimmen Zeit, die hinter ihnen lag, auch nur vorstellen können. Es nötigt mir noch heute grenzenlose Bewunderung ab, wenn ich mir vor Augen halte, was für eine Lebenskraft diese drei blutjungen Menschen aus ihren Qualen gezogen haben. Am Ende der Geschichte ein doppeltes Happy End: Nicht nur, dass alle überlebt haben – auch ich durfte bei der Gelegenheit meinen Platz auf dieser Welt finden.
TEIL I GASTLAND
»Wo Kind und Hund Palukes würgen, ist unsre Heimat Siebenbürgen.«
KAPITEL 1 Heimatlos
Meine Eltern entstammten beide wohlhabenden Familien aus Siebenbürgen, einem Gebiet, das heute im Zentrum Rumäniens liegt. Die Kolfs hatten ihr Vermögen mit Finanzgeschäften und Ländereien gemacht, die Wagners im Viehhandel. Beide Familien lebten keine zehn Kilometer voneinander entfernt in der Nähe von Kronstadt. Vielleicht hatten die Eltern oder Großeltern schon mal miteinander zu tun gehabt, Martin und Lieselotte aber kannten sich nicht – bis zu ihrer schicksalhaften Begegnung in Frankfurt an der Oder im Dezember 1946.
Ich war vielleicht 13 oder 14, als ich meinen Tata zum ersten Mal nach seinen Erlebnissen in den Kriegsjahren fragte. Bei diesem wie auch meinen späteren Versuchen, ihm etwas zu entlocken, antwortete er immer mit dem gleichen Satz: »Fuschi, das war so schrecklich, darüber kann ich nicht sprechen.« Er, der sonst so redselige Vater, schwieg eisern.
Es war nicht so wie später bei den 68ern: Auch sie fragten ihre Eltern, vor allem die Väter, was sie im Krieg gemacht hatten. Aber deren Weigerung, darüber zu sprechen, ließ meistens auf den Typus Täter oder Mitläufer schließen, oder wenigstens auf eine Angehörigkeit zur Wehrmacht. Bei meinem Vater war es die Opferrolle, über die er nicht reden mochte. Er muss Furchtbares erlebt und gesehen haben.
Das Wenige, das ich in Erfahrung bringen konnte, ist Folgendes: Als alliierte Soldaten im April 1945 die »Reichswerke Hermann Göring« im niedersächsischen Salzgitter befreiten, war unter den tausenden ausgemergelten, ausgelaugten und bis auf die Knochen abgemagerten Zwangsarbeitern auch mein Vater. In dem Betrieb, in dem kriegswichtige Güter hergestellt wurden, vor allem Munition und Sprenggranaten, hatte er als Feinmechaniker gearbeitet – ein Arbeitssklave ohne Rechte, mit kaum mehr als einer wässrigen Suppe am Tag abgespeist. Die Ernährungslage der tausenden Elenden war so schlecht, dass selbst der NSDAP-Kreisleiter eine Beschwerde nach Berlin sandte.
Wann und wie mein Vater von Kronstadt nach Salzgitter gekommen war – die Orte liegen ja nicht gerade um die Ecke – , und was vorher gewesen war, sagte er nicht. Und irgendwann habe ich aufgehört zu fragen und seinen Wunsch respektiert, nicht über das Schreckliche zu reden, was er damals erlebt hat.
War Martin Kolf zunächst, wie so viele Siebenbürger Sachsen, begeistert zum Auslandsableger der Hitlerjugend gegangen? Und später, als der rumänische Diktator Ion Antonesco an Hitlers Seite gegen die Sowjetunion kämpfte, Soldat geworden? Und noch später, weil er es nicht mehr ausgehalten hat, desertiert? Haben sie ihn aufgegriffen, irgendwo eingelocht, windelweich geschlagen und schließlich nach Salzgitter abgeschoben? Oder war es ganz anders, und er hatte sich, obwohl Mitglied der »Deutschen Volksgruppe in Rumänien« einer Rekrutierung zur Waffen-SS widersetzt und war deshalb als Zwangsarbeiter ins »Reich« abgeschoben worden?
Ich werde es nie erfahren. Und auch nicht, warum meine Großmutter ihm zum Abschied in Kronstadt Goldstücke in den Mantel genäht hat. Wohin hatte er sich da verabschiedet? Wo und wie das Gold jemals zum Einsatz kam, ich weiß es nicht.
Ich weiß nur, dass sich mein Vater nach der Befreiung durch die Alliierten irgendwie nach Bayern durchschlug, wo er für kurze Zeit in einem Lager für »Displaced Persons« bei Wolfratshausen unterkam. Hier hatten die Nazis 1939 ein Lager für Zwangsarbeiter eingerichtet, die in zwei nahegelegenen Sprengstoff- und Munitionsfabriken schufteten, die man als Schokoladenfabrik getarnt hatte. Nach der Kapitulation wurde das Lager, das nun in der amerikanischen Besatzungszone lag, zu einem Camp für »Displaced Persons« umfunktioniert. Das Lager Föhrenwald, das erst 1957 aufgelöst wurde, war das größte seiner Art in der US-Besatzungszone. »DPs«, das waren Staatenlose, ehemalige KZ-Häftlinge, Fremdarbeiter, Verschleppte, Entwurzelte. Menschen, die nirgendwo richtig hingehörten, und die auch niemand wirklich haben wollte. Zu tausenden waren sie nach dem Krieg durch das verwüstete Land geirrt, bis sie in einem der Lager strandeten. Die Deutschen, mit ihren eigenen Problemen mehr als ausgelastet, wähnten sie dort gut aufgehoben.
Föhrenwald war so etwas wie das letzte »jüdische Schtetl« auf europäischem Boden. Die meisten, die hier ausharrten, konnten oder wollten nicht zurück in die alte Heimat. Viele Shoah-Überlebende setzten auf einen Neuanfang in Palästina, andere, wie die Familie meiner Freundin Rachel Salamander, blieben im Lager, bis es schließlich in eine Siedlung für Heimatvertriebene umgewandelt wurde.
Mein Vater jedenfalls hatte vom Lagerleben ein für alle Mal genug. Nach einer kurzen Übergangszeit zog er weiter, nach Starnberg. Das Städtchen am See erinnerte ihn an seine Heimat und schien ihm nicht der schlechteste Ort, um hier zumindest für einige Zeit zu leben. Dass er hier sogar Wurzeln schlagen würde, war vermutlich nicht geplant. Er hatte seinen Eltern einen Brief geschrieben, dass es ihm gutgehe und er hoffe, bald wieder nach Siebenbürgen zu kommen. Doch der Antwortbrief aus der Heimat machte seine Pläne zunichte.
Im August 1944 war es zu einem Sturz des faschistischen Regimes und einem Seitenwechsel Rumäniens gekommen. Die Rote Armee besetzte das Land, zehntausende, vor allem aus dem Banat und aus Siebenbürgen, flohen. Seit Kriegsende, so erfuhr mein Vater, führten die Besatzer ein Schreckensregiment, unter dem vor allem die Deutschstämmigen zu leiden hatten. Seine Mutter schrieb, dass so gut wie alle jungen Männer ab 16 und alle jungen Frauen ab 17 Jahren gefangen genommen und in die Sowjetunion verschleppt worden seien. Auch seine geliebte Schwester Hilde.
Die Siebenbürger Sachsen standen bei Stalin unter Generalverdacht. Und es stimmte ja auch: Viele von ihnen hatten im Krieg gemeinsame Sache mit den Nazis gemacht. Selbst Jahrzehnte später sprachen Siebenbürger noch vom »Reich«, wenn die Rede auf Deutschland kam. Für sie folgten Jahre der Diskriminierung und Verfolgung, der Deportation zu Zwangsarbeit in die Sowjetunion, der Enteignung, dem Entzug einiger staatsbürgerlicher Rechte sowie der Diffamierung als »Hitleristen« und »Faschisten«.
Da die Deutschen während des Krieges vor allem in der Sowjetunion so furchtbare Zerstörungen angerichtet hatten, sollten sie jetzt auch zum Wiederaufbau beitragen. Das war die Logik hinter den Verschleppungen, von denen rund 30.000 Siebenbürger Sachsen betroffen waren. Diese Art der Wiedergutmachung sah fünf Jahre schwere Zwangsarbeit vor, dann dürften die »Aufbauhelfer« wieder zurück in ihre Heimat.
Ich kann nur mutmaßen, wie groß der Schock für meinen Vater über diese Nachrichten gewesen sein muss. Denn geredet hat er darüber nicht. Und auch meine Tante schwieg über ihre damaligen Erfahrungen. Ich weiß nur, dass die Geschichte meiner Eltern anders verlaufen wäre, wenn es diese Verschleppung in die Tiefen der Sowjetunion nicht gegeben hätte. Denn Hilde lernte dort meine Mutter Lieselotte kennen.
*
Meine Mama war erst sehr spät – ich war schon über dreißig – in der Lage, mir überhaupt nur in einem Atlas zu zeigen, wo sie und Hilde damals hingekommen waren: nach Sibirien. Bis dahin hatte sie es wie mein Vater gehalten: Sie konnte und wollte über das, was sie durchgemacht hatte, nicht reden. Aber als ich noch ein Kind war, habe ich sie oft nachts schreien hören. Diese Schreie, von denen ich aufwachte, waren entsetzlich. Verängstigt tapste ich dann an ihr Bett, sie lag schweißgebadet da, mein Vater schlaftrunken und hilflos daneben. Wenn sie mich entdeckte, flüsterte sie nur: »Ist schon gut, meine kleine Fuschi, ich hab nur schlecht geträumt. Geh schnell wieder in dein Bett.«
Auf dem Transport nach Sibirien, eine Woche unter unwürdigsten und widerwärtigsten Bedingungen in einem Viehwaggon, lernten sich Lieselotte und Martins Schwester Hilde kennen. Beide waren kaum zwanzig Jahre alt. Das Schicksal meinte es gut mit ihnen, ein bisschen wenigstens, denn im Lager hausten sie mit unzähligen anderen Frauen zusammen in einer Baracke, und zusammen fuhren sie auch zum Schuften in den Bergwerksschacht oder die Ziegelei. Gemeinsam ertrugen sie Hunger, Schmach und Schmerz, Schande und Erniedrigung, Kummer und Verzweiflung. Sie schworen sich, bis an ihr Lebensende Freundinnen zu bleiben, wenn sie jemals lebend aus dieser Hölle rauskommen würden.
Nach etwas mehr als einem Jahr Sklavenarbeit bekamen Lieselotte und Hilde fast zeitgleich offene Tuberkulose. Damit waren sie beim tatkräftigen Wiederaufbau der Sowjetunion nicht länger erwünscht. Aber sie hatten Glück. Während unzählige Menschen in den Lagern starben, wurden sie ausgesondert und in einen Transport nach Westen gesetzt, mit dem auch Kriegsgefangene rückgeführt wurden. Der Zug hielt aber nicht in Siebenbürgen, wie sie das erhofft hatten, sondern in Frankfurt an der Oder.
Soll niemand sagen, die Russen hätten nichts von Bürokratie verstanden. Die vorzeitige Entlassung wurde fein säuberlich dokumentiert, amtliche Schreiben gingen hin und her, und irgendwann landete der Vorgang auch auf dem Schreibtisch einer Amtsstube in Siebenbürgen. Von dort gelangte die Nachricht von Hildes Verlegung in die sowjetische Besatzungszone schließlich auch zu meinen Großeltern.
Im Winter 1946 erhielt Martin Kolf in Starnberg die frohe Botschaft, dass seine Schwester demnächst in Frankfurt/Oder eintreffen würde. Und dann ging plötzlich alles ganz schnell: Mein Vater, der seine schlimmen Erfahrungen zumindest äußerlich abgeschüttelt und ordentlich zugenommen hatte, der zu einem schmucken Mannsbild geworden und fleißig dabei war, sich in Starnberg ein neues Leben aufzubauen, war entschlossen, seine Schwester zu sich nach Bayern zu holen. Er freute sich riesig, dass sie überlebt hatte, und er war bereit, sich über alle Widerstände hinwegzusetzen.
Der Wechsel von einer Besatzungszone zur anderen war damals nicht einfach. Für den legalen Weg brauchte man eine Zuzugsgenehmigung, ohne die es auch weder Arbeit noch Lebensmittelkarten gab. Weil Bayern allein schon wegen der vielen Flüchtlinge aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten aus allen Nähten platzte, war eine solche Genehmigung kaum zu kriegen. Was tat mein Vater also? Er ging aufs Landratsamt, nutzte einen unbeobachteten Moment und klaute das entsprechende Dokument. So hat er es uns jedenfalls später erzählt – bei solchen tollkühnen Gaunereien war er nicht so zugeknöpft wie bei seinen traumatischen Erlebnissen.
Die wertvolle Zuzugsgenehmigung in der Tasche, machte er sich auf den langen Weg durch das zerstörte Deutschland, von Bayern hinauf an die polnische Grenze. Er drängte sich in vollbesetzte Züge, hielt an Landstraßen den Daumen hoch, bat um Mitfahrgelegenheiten auf staubigen, zugigen Lastwagenpritschen. Nach anderthalb Wochen beschwerlicher Reise kam er in Frankfurt/Oder an.
Wie in so vielen Nachkriegsgeschichten spielen auch in der unseren Zufall und Glück eine große Rolle. Denn nach einigen erfolglosen Versuchen entdeckte mein Vater seine Schwester Hilde tatsächlich zwischen den vielen Menschen am Bahnhof. Weinend fielen sich die Geschwister in die Arme.
Nach der ersten Wiedersehensfreude deutete Hilde auf eine junge Frau, die etwas abseits stand. Wie oft hatten sich die beiden im Lager das erste Treffen mit ihren Familien ausgemalt, nun war es wenigstens bei Hilde so weit. Lieselotte hatte Tränen vor Rührung in den Augen. Martin stellte sich ihr vor, die beiden sahen sich an, und es traf sie, wie sie später immer wieder beteuerten, wie ein Donnerschlag: Liebe auf den ersten Blick.
Den beiden Freundinnen, die so viel gemeinsam durchlitten hatten, fiel der Abschied schwer. Aber Martin versprach, Lieselotte baldmöglichst nachzuholen. Und tatsächlich, wieder in Starnberg, steuerte er einmal mehr das Landratsamt an und »organisierte« noch eine weitere Zuzugsgenehmigung. Die wurde nach Berlin übersandt, wo Lieselotte inzwischen bei Bekannten Unterschlupf gefunden hatte und sich den Kopf zerbrach, wie sie wohl heim nach Siebenbürgen kommen könne, falls sie von Hilde und ihrem Bruder nichts mehr hören sollte.
Doch wie immer in seinem Leben: Martin Kolf hielt, was er versprochen hatte. Vier Wochen nachdem das Dokument in Berlin eingetroffen war, stand Lieselotte mit ihrem Köfferchen auf dem Münchner Hauptbahnhof, wo Martin schon voller Vorfreude auf sie wartete.
Am 6. Dezember 1947 heirateten die beiden in Starnberg. Und kein halbes Jahr später kam ich auf die Welt. Ich fand es als Kind erstaunlich, dass der Storch in der kurzen Zeit ein Wesen fabrizieren konnte, an dem schon alles dran war …
*
Es gibt auf dieser Welt ganz bestimmt unangenehmere Erfahrungen, als am Starnberger See aufzuwachsen. Auch wenn die Leute hier gern mit Leidenschaft »ihre« Seeseite verteidigen. Die vom Westufer sagen: »Wir schauen morgens in die aufgehende Sonne, außerdem gibt es bei uns eine Eisenbahnlinie bis Garmisch und für die Autos die Olympiastraße.« Die hatte Adolf Hitler zur Winterolympiade 1936 bauen lassen. Die Leute auf der anderen Seeseite halten dagegen: »Bei uns ist es viel ruhiger, und wir haben Nachmittags- und Abendsonne.« Einig sind sie sich allerdings in einem: Dass es kaum einen besseren Ort zum Leben gibt. Und das galt schon für die Zeit, als ich dort aufwuchs.
Im kaum dreißig Kilometer entfernten München spielten die Kinder noch lange in Bombenkratern und Ruinen. 73 Luftangriffe der Alliierten hatten rund fünfzig Prozent der Bausubstanz zerstört. Die Menschen hatten alle Mühe, ihren Kindern das Nötigste zu essen zu besorgen und sie im Winter warm genug anzuziehen.
In Starnberg hatte der Zweite Weltkrieg längst nicht so viele Spuren hinterlassen. Einige Phosphor- und Sprengbomben waren über der Stadt abgeworfen worden, neun Feuerwehrleute waren dabei ums Leben gekommen. Schlimm genug, aber doch eben kein Vergleich zu den tausenden Opfern, die es in der bayerischen Landeshauptstadt gegeben hatte. Und auch die Häuser standen noch, in Starnberg und in den anderen Ortschaften am See.
Starnberg hatte nach dem Krieg gut 8500 Einwohner, ein Viertel davon waren Flüchtlinge. Der Ort war klein und überschaubar, alles noch sehr ländlich. Es gab fünf Bauernhöfe, wo die Mama Eier, Kartoffeln und Fleisch kaufen konnte und die Milch in der Kanne holte. Es gab die Gärtnerei Marx mit ihren Blumenfeldern und Gewächshäusern. Es gab Handwerksbetriebe wie die Schlosserei Wörsching, die Schreinerei Benkert, dazu Glasereien, Spenglereien und die Metzgereien Houdek und Kandler.
Und im Hintergrund oder auch zum Greifen nah, je nachdem, wo man gerade war, immer war da dieser herrliche See, auf dem Boote mit weißen Segeln tanzten, oder, wenn es windig war, Wellen mit weißen Schaumkrönchen. Von der Seepromenade fuhren die Fischer hinaus, und wenn sie vom Fang zurückkamen, zappelten frische Renken im Netz. Gleich nebenan wurden Elektro- und Ruderboote verliehen, wovon nicht nur Besucher, sondern auch Einheimische begeistert Gebrauch machten. Ich weiß noch, wie aufgeregt ich war, als ich zum ersten Mal so ein kleines schaukelndes Schiffchen betrat. Und wenn wir wieder an Land waren, nahm meine Mama gleich frischen oder geräucherten Fisch fürs Abendessen mit heim.
Starnberg war damals ein eigentümlicher Mix aus kleinen Handwerkerhäusern, Bauernhöfen, beeindruckenden Gründerzeitvillen mit sorgsam gepflegten Gärten und traditionsreichen Pensionen, in denen die Leute vor dem Krieg zur Sommerfrische am See abgestiegen waren. Und dazwischen standen Baracken. Für mich waren diese Bretterbuden in den frühen Jahren nach dem Krieg etwas ganz Selbstverständliches; man kannte es gar nicht anders. Baracken, in denen Flüchtlinge untergebracht waren, standen zum Beispiel in der Nähe meines Kindergartens. Die Eltern, die ja ganz andere Erinnerungen mit solchen Behausungen verknüpften, sagten immer, wir Kinder sollten einen großen Bogen darum machen, es sei dort gefährlich.
Manchmal kurvten amerikanische Soldaten in ihren Jeeps am Ufer des Sees herum und beobachteten das Geschehen. Sie machten meistens einen ziemlich lässigen Eindruck, die Helme in den Nacken geschoben, eine Zigarette im Mundwinkel. Für uns Kinder gab es manchmal Schokolade und Kaugummi, den Jugendlichen schenkten sie hin und wieder Zigaretten, auf dem Schwarzmarkt ein begehrtes Tauschmittel. Warum diese Soldaten überhaupt da waren und wieso einige von ihnen eine dunkle Haut hatten, konnte ich als kleiner Stöpsel natürlich nicht begreifen. Diese netten Männer, so hieß es, hätten den Krieg gewonnen und seien jetzt unsere Freunde.
Sicher, die Menschen freuten sich, dass der Krieg zu Ende war, auch wenn sich nicht alle darüber freuten, dass er verloren gegangen war. Es gab den Marshall-Plan der Amerikaner, der mit Krediten, Rohstoffen, Industriegütern und Lebensmitteln den Wiederaufbau ermöglichte. Es gab wieder unabhängige Zeitungen, es gab Bücher in den Läden, auch solche, die unter Hitler noch verbrannt worden waren. Es gab wieder zu essen, auch wenn für den Grundbedarf anfangs noch Lebensmittelmarken zugeteilt wurden. Und es gab auch wieder Mode und schöne Frisuren.
Wenn ich mir heute alte Fotos ansehe, sieht zwar alles noch etwas ärmlich aus, die Spuren des Krieges noch spürbar, das Wirtschaftswunder noch ein paar Jahre entfernt. Aber als Kind stellt man keine Vergleiche an, wie auch? Man kennt nichts anderes als die Gegenwart, erst im Rückblick gewinnt das Vergangene und damit das eigene Leben an Kontur.
Ich hatte eine wunderbare Kindheit. Nie wieder habe ich mich so geborgen gefühlt wie in der Umarmung meiner Mama, die immer so wunderbar gerochen hat. Als sie und Tata eines Abends ausgingen, strich ich mir mit ihrem Lippenstift über die Zunge, um mir ihren Duft noch ein wenig zu bewahren. Dabei brach der Lippenstift ab. Ein kostbares Gut in diesen Tagen, meine Mutter war nicht gerade begeistert. Richtig geschimpft hat sie trotzdem nicht mit mir. Das geschah höchst selten, etwa, wenn sie herausbekam, dass ich den sündteuren Lebertran mal wieder in den Forellenbach geschüttet hatte.
Dass es mich gab, war für meine Eltern ein Geschenk, keine Bürde. Den Bonus von 40 Mark, die der Staat im Zuge der Währungsreform für jede Person im Haushalt ausspuckte, also auch für die neugeborene Fuschi, nahmen sie dabei natürlich gern mit. Sie verwöhnten mich nach Kräften und versuchten gemeinsam mit Tante Hilde, mir die schönen Dinge des Lebens beizubringen. Im Strandbad am See sprang ich mit drei Jahren unerschrocken ins Wasser, denn da konnte ich schon schwimmen. Dort entdeckte ich auch mein Lieblingsspielzeug: leere Patronenhülsen, die zu tausenden ans Seeufer geschwemmt wurden.
Mit vier lernte ich Skifahren, mit sechs war ich annähernd perfekt im Stemmbogenfahren. Ich hatte keine Angst auf den Brettern und liebte es, mit Karacho den Berg hinabzusausen. Mein Vater hatte als Jugendlicher in den Karpaten den Ruf eines tollen, draufgängerischen Skifahrers. Er war ein Sportfanatiker durch und durch, aber Skifahren war sein Ein und Alles. Nicht nur der Sport an sich, sondern auch das ganze Drumherum. Schon im Kindergartenalter konnte ich den Zungenbrecher »Après-Ski« fehlerfrei aussprechen und hatte eine vage Ahnung, was Flirten ist. Nachdem meine Eltern in Starnberg Fuß gefasst hatten und etwas Geld da war, fuhren wir zum Skifahren oft nach Sankt Johann und Kitzbühel, später kam das Engadin dazu, wo sie in Samedan bei St. Moritz eine wunderbare Wohnung mieteten.
*
In die Schweiz zu reisen oder von dort wieder zurück nach Bayern, war für meine Eltern nicht so einfach. Als Staatenlose brauchten sie ein Durchreisevisum für Österreich, erhältlich im Österreichischen Konsulat in München, das am Freitagvormittag pünktlich um elf Uhr schloss. Nur ein paar Minuten zu spät und es wurde kein Visum mehr ausgestellt. Wenn uns das passierte, empfand mein Vater das als persönlichen Affront. Dann drohte er scherzhaft: »Wenn das so weitergeht mit diesen Schikanen, werden wir doch noch Deutsche.«
Natürlich hatten meine Eltern und auch Tante Hilde nichts weniger im Sinn als Deutsche zu werden. Was sie wollten: wieder nach Hause, nach Rumänien, nach Siebenbürgen. Zu ihren Familien, in ihre vertraute, schmerzlich vermisste Heimat. Davon träumten sie, daran arbeiteten sie, darum drehten sich ihre Gespräche. Wenn sie Deutsche geworden wären, hätten sie diesen Traum gleich begraben können, dann wäre die rumänische Staatsangehörigkeit verloren gewesen.
Deutschland war unser Gastland, mehr nicht. Das wurde mir von klein auf eingebläut: »Benimm dich, Fuschi, wir sind hier nur zu Gast!« Der Satz kam immer wieder, eine ständige Ermahnung. Rumänien und Siebenbürgen, das blieb ein Dauerthema, nicht nur in der Familie. Auch mit siebenbürgischen Freunden und Bekannten, die bei uns zu Besuch waren, wurde ununterbrochen darüber diskutiert. Wie kommen wir wieder heim? Wer könnte noch etwas wissen, wo könnte man noch ansetzen?
Die Eltern informierten sich auf landsmannschaftlichen Treffen, sie fragten nach im Münchner Haus des Ostens, aber alle Mühe war vergeblich. Die Heimat blieb versperrt, der Eiserne Vorhang öffnete sich keinen Spalt. Die sozialistische Republik Rumänien wollte die Kolfs und all die anderen, die sich nichts sehnlicher wünschten, als möglichst bald die Koffer packen zu können, nicht zurückhaben.
Im Nachhinein denke ich: Auch wenn der Verlust der Heimat durch nichts aufzuwiegen ist, unser Leben wäre ganz anders verlaufen, und sicher nicht zum Besseren. In Rumänien wurden die Siebenbürger Sachsen diskriminiert, einen Minderheitenschutz gab es nicht, und als die Bundesrepublik und Rumänien Ende der Sechzigerjahre ein Abkommen unterzeichneten, führte das zu einem Exodus nach Westen, nicht aber zu einer Rückkehr. Über 200.000 Rumäniendeutsche wurden bis 1989 freigekauft.
Aber all das war Zukunftsmusik. Abgesehen von den sehnsuchtsvollen Geschichten, die ich von den Erwachsenen aufschnappte, war meine einzige Berührung mit Siebenbürgen und damit unserem Status in Deutschland lange Zeit nur die Sprache. Und weil meine Eltern zuhause nur Siebenbürger Sächsisch miteinander sprachen (was sich so ähnlich anhört wie luxemburgisch), bekam ich im Kindergarten schnell ein Gespür dafür, dass wir irgendwie anders waren. Die Flüchtlingskinder und ich waren die Einzigen, die nicht Bayerisch sprachen und auch nicht immer alles verstanden. Ein gefundenes Fressen für die anderen Kinder, die uns damit aufzogen.
Eine strenge Frau namens Tante Martha betreute uns. Bei der Essensausgabe muss sie mehr als einmal schier an mir verzweifelt sein – ich bekam meine Suppe einfach nicht herunter. Eine schreckliche dicke, mit Mehlschwitze zubereitete Gemüsepampe, bei der man gar nicht mehr erkennen konnte, welche Art von Gemüse da drin sein sollte. Tante Martha schalt mich undankbar, und ich heulte dicke Tränen in den Teller.
Nach dem Mittagessen kam für mich die nächste Tortur. Alle Kinder mussten sich schlafen legen, auf kleinen nebeneinander aufgereihten Pritschen, ob sie wollten oder nicht. Und ich wollte selten. Erst nach einer gefühlten Ewigkeit durften wir wieder aufstehen und spielen.
Das Schönste, oder besser gesagt: das einzig Schöne an diesem Kindergarten war immer der Moment, wenn meine Mutter kam, um mich abzuholen. Darauf freute ich mich schon morgens. Denn der Heimweg in den Forellenweg, wo wir inzwischen wohnten, führte an der Villa Dorlei vorbei. Wann immer es ging, statteten Mama und ich den Dorleis nach dem Kindergarten einen Besuch ab. Tante Grete, wie ich sie nannte, und ihr Bruder Jack hatten Tata gleich nach seiner Ankunft in Starnberg ein Zimmer vermietet. Und später ein zweites für seine Schwester Hilde. Die Dorleis hatten miterlebt, wie die kleine Familie wuchs, und uns alle ins Herz geschlossen. Grete war mindestens 15 Jahre älter als ihr Bruder, Jack war im Alter meines Vaters. Die beiden waren Freunde geworden. Der Dritte in ihrem Bunde war Falk Volkhardt, dessen Familie heute noch das Hotel Bayerischer Hof in München gehört.
Die Dorleis betrieben Varietés. Vor dem Krieg hatten sie Häuser in Berlin und Tanger geführt. Und varietémäßig sah es auch in der Villa aus, die ursprünglich nur der Ferienwohnsitz der Geschwister gewesen war: Auf dem Boden lag ein Fell mit Tigerkopf (ähnlich dem aus »Dinner for One«, über das der Butler immer stolpert), und zwischen den meisten Zimmern gab es keine Türen, sondern bunte Vorhänge aus Glasperlen. In den Regalen standen geheimnisvolle marokkanische Figuren. Es war eine faszinierende, exotische und farbenprächtige Welt, die mich magisch in ihren Bann zog.
Ich liebte Grete über alles, ihre Herzlichkeit, ihren Humor und ihren Berliner Dialekt. Als Jack später nach Amerika ging, um seine Varieté-Karriere noch einmal anzukurbeln (ob das geklappt hat, habe ich nie erfahren), blieb Grete in Starnberg. Später kam sie in ein Altersheim, und bis zu ihrem Tod haben wir sie dort regelmäßig besucht und uns um sie gekümmert.





























