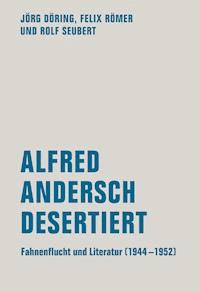
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Alfred Andersch ist Westdeutschlands berühmtester Deserteur. Sein autobiografischer Bericht "Die Kirschen der Freiheit" (1952) beschreibt die Umstände seiner Fahnenflucht aus Hitlers Wehrmacht am 6. Juni 1944 in Italien. Aber war er überhaupt ein Deserteur? Seit in seinem Nachlass ein Text auftauchte, den Andersch schon 1945 im Kriegsgefangenenlager geschrieben hatte und in dem die Gefangennahme gar nicht als Desertion geschildert wird ("Amerikaner - Erster Eindruck"), sind Zweifel daran laut geworden, ob Andersch zu Recht in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin als Deserteur geehrt wird. Niemals bislang ist der Versuch unternommen worden, Anderschs Selbstbeschreibung anhand militärhistorischer Quellen zu überprüfen. Das vorliegende Buch versammelt diese Dokumente und erzählt eine in Teilen andere Geschichte: "Die Kirschen der Freiheit" im Lichte der Akten. Eine Geschichte vom Überleben im Krieg, vom Heldenmut der Kampfesmüden und von den literarischen Verfahren der Selbstkonstruktion eines Autors.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jörg Döring, Felix Römer und Rolf Seubert
ALFRED ANDERSCH DESERTIERT
Fahnenflucht und Literatur (1944–1952)
1. Einleitung War Alfred Andersch ein Deserteur?
Und warum man das fragen darf
Der Schriftsteller Alfred Andersch ist Westdeutschlands berühmtester Deserteur.1Er war einer von wohl mehreren Hunderttausend deutschen Soldaten, die während des Zweiten Weltkriegs den Kriegsdienst eigenmächtig beendeten.2Sie brachen damit nicht nur mit dem Konformismus in der Wehrmacht, in der Fahnenflüchtige als »Feiglinge« verachtet wurden,3sie riskierten auch die Rache des Repressionsapparates. Denn die Wehrmachtsjustiz ging gegen Deserteure mit einer Härte vor, die in der Weltgeschichte kaum Parallelen hat. Sie fällte 35.000 Urteile wegen Fahnenflucht, davon mehr als 22.000 Todesurteile, von denen 15.000 auch vollstreckt wurden.4Gerade gegen Ende des Krieges setzte die deutsche Militärführung verstärkt auf die Abschreckungswirkung solcher Urteile, um die Truppen im Angesicht der Niederlage bei der Stange zu halten.
Großen Mut also erforderte die Tat selbst, ebenso wie sich nach dem Krieg in Westdeutschland zur Fahnenflucht zu bekennen – denn das Stigma, das sich aus dem Verstoß gegen den militärischen Wertekonsens der Wehrmacht ergab, wirkte in der Gesellschaft lange fort. Heute ist bekannt, dass manche der Deserteure schon früh die teilsabenteuerlichen Umstände ihrer Fahnenflucht in Erfahrungsberichten oder sogar in Romanform festzuhalten versuchten.5Die meisten dieser autobiografisch grundierten Texte aber blieben in den Schubladen. Teils aus Scham gegenüber den »Kameraden«, die man »verraten« und im Stich gelassen hatte – vorerst völlig ungeachtet der Frage, ob hier den Streitkräften eines Unrechtsregimes die Gefolgschaft versagt worden war, teils deshalb, weil der Buchmarkt der unmittelbaren Nachkriegszeit, dann derjenige der frühen Bundesrepublik, keinen Bedarf für Geschichten solcher Anti-Kriegshelden sah. Hier las und verbreitete man lieber apologetische Generalsmemoiren.6
Anders im Falle von Andersch. Ihm gelang es, für den Bericht seiner Desertion vom Juni 1944 an der italienischen Front einen Verlag zu finden. Obgleich ihm der Gutachter des Rowohlt-Verlages, dem der Text angeboten worden war – der ehemalige Kriegsberichter, dann Nachkriegs-Sachbuch-Bestseller-Autor von »Götter, Gräber und Gelehrte« (unter dem Pseudonym C. W. Ceram) Kurt Marek –, einen Absatz von »nicht mehr als siebzig Exemplaren« voraussagte.7Das Buch, das seine autobiografische Kennung (»Ein Bericht«) in den Untertitel verlegte, erschien dann bei der Frankfurter Verlagsanstalt 1952 unter dem Titel »Die Kirschen der Freiheit«8und erzeugte rasch eine heftige publizistische Kontroverse.9Äußerst lobenden Besprechungen – unter anderem von Anderschs Mitstreitern in der Gruppe 47 wie Hans Georg Brenner und Heinrich Böll10– stand eine Reihe sehr kritischer, teils ablehnend-polemischer Stellungnahmen gegenüber.
Im Jahr der politischen Diskussionen um die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik mochten manche ein Buch zur »Ehre des Deserteurs«11nicht hinnehmen. Denn Anderschs Bericht war weit mehr als die Apologie einer ganz persönlichen Fahnenflucht. Angereichert mit essayistischen Passagen zur Frage der Legitimität des militärischen Eides neben allerhand nachkriegstypischen Existentialismen wie Sartre’schem Freiheitspathos und Jünger’scher Waldgängerei strebt der Text erkennbar ins Allgemeine und Überpersönliche.
Einen Einstellungswandel in Westdeutschland, was die Reputation der Wehrmachtsdeserteure anging, aber vermochten »Die Kirschen der Freiheit« zunächst nicht zu bewirken. Das über die Desertion verhängte gesellschaftliche Tabu überdauerte sogar die antiautoritäre Revolte von 1968 und reichte bis weit in die 1980er-Jahre.12
Dennoch machten »Die Kirschen der Freiheit« ihren Autor auf doppelte Weise berühmt: als Schriftsteller wie – kraft des skandalösen autobiografischen Stoffes – auch als bekennenden Deserteur. Seit 1989 wird Andersch in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand im Berliner Bendler-Block geehrt – unter der Rubrik: »Widerstand im Kriegsalltag: Deserteure aus politischer Gegnerschaft«.13
Aber war Andersch überhaupt ein Deserteur? Zweifel daran kamen auf, als 1981 – ein Jahr nach Anderschs Tod – aus dem Nachlass der ebenfalls als »Bericht« etikettierte autobiografische Text »Amerikaner – Erster Eindruck« veröffentlicht wurde, den Andersch spätestens 1945 im amerikanischen Kriegsgefangenenlager geschrieben hatte und der die Umstände der Gefangennahme prägnant anders erzählt als in »Kirschen der Freiheit«.
»Kirschen der Freiheit« endet genau in dem Moment, als aus dem versprengten Radfahrsoldaten Andersch tatsächlich ein Deserteur wird. Laut diesem »Bericht« von 1952 habe er auf dem Vormarsch zunächst die Reifen seines Fahrrades mutwillig fahruntüchtig gemacht und die Schwadron vorausfahren lassen, um sich allein durch die Macchia der italienischen Provinz Latium zu schlagen – in der Hoffnung, eher die amerikanischen Linien zu erreichen als einem deutschen Feldgendarmen in die Hände zu fallen. Nach einer Nacht und einem Tag allein sei es schließlich so weit gewesen:
Am Spätnachmittag geriet ich an den Rand eines mächtigen Weizenfeldes, das sanft in ein Tal hinabfloß. Hinter den Bäumen am Talrand konnte ich Häuser sehen, und ich vernahm das Geräusch rollender Panzer, ein helleres, gleichmäßiges Geräusch, als ich es von den deutschen Panzern kannte. Ich hörte das klirrende Gejohl der Raupenketten. Die Töne klangen fern in der rötlichen Neigung des westlichen Lichtes. Darauf tat ich etwas kolossal Pathetisches – aber ich tat’s –, indem ich meinen Karabiner nahm und unter die hohe Flut des Getreides warf. Ich löste die Patronentaschen und das Seitengewehr vom Koppel und ergriff den Stahlhelm und warf alles dem Karabiner nach. Dann ging ich durch das Feld weiter.14
Entwaffnet und in Erwartung seiner baldigen Gefangennahme, habe er seine letzten – die titelgebenden – Kirschen in Freiheit gegessen. Hier enden die »Kirschen der Freiheit«. Dass die Fahnenflucht gelingt, weiß der Leser aus einer Prolepse am Anfang des Schlusskapitels »Die Wildnis«: »Ich greife meiner Erzählung einen Augenblick vor, indem ich berichte, wie […] ich, Teil einer langen Reihe Gefangener, auf eines der Lastautos stieg, die vor dem Lager auf uns warteten.«15Der eigentliche Moment der Gefangennahme bleibt ausgespart.
Der sieben Jahre früher, noch unter dem Eindruck der Erlebnisse, geschriebene Text »Amerikaner – Erster Eindruck« setzt nun fast exakt dort ein, wo die Handlungschronologie von »Die Kirschen der Freiheit« endet: beim Moment der Gefangennahme.
Am Spätnachmittag wurde das Wetter ganz rein und sonnig. Ich geriet auf einen guten Feldweg und sah von dort aus die Häuser von San Virginio, einige Dächer und Mauern im Grünen versteckt, hinter denen sich der Monte Elmo erhob. Der Weg war von Hecken begrenzt. In der Nähe hörte ich lebhaftes Sprechen, und als ich um eine Biegung schlenderte, erblickte ich eine Gruppe von etwa zwanzig Männern, italienische Zivilisten. Ich wunderte mich, denn sie trugen Gewehre und zwei Fahnen mit sich, die grün-weiß-roten Trikoloren Italiens, und sie schienen erregt zu sein, freudig erregt. Sie standen alle um einen Mann herum, der eine sandfarbene Uniform trug, aber keine Waffen außer einer Pistole mit sich führte. Ich brauchte einige Sekunden, um zu begreifen, daß San Virginio von den Amerikanern – oder waren es die Engländer? – besetzt war und daß die Italiener nun Befreiung feierten. Wie war das möglich? Vorgestern erst war Rom gefallen, und dieses Dorf lag etwa sechzig Kilometer nördlich von Rom. Man hatte mir gesagt, ich sollte nach Oriolo gehen, das lag in der Nähe von San Virginio; dort würde ich den Batallionsstab finden, der mich in die Stellungen meiner Schwadron einweisen würde. Und diese wiederum befanden sich bei Bracciano, am See, dreißig Kilometer von Rom entfernt. Machten die Alliierten denn jetzt einen Blitzkrieg? Hatten sie so wenig Widerstand gefunden?
Als die Italiener mich sahen, verstummten sie einen Augenblick. Dann gerieten sie in wildeste Aufregung und liefen mir entgegen. Ich trug immerhin ein Gewehr bei mir und Patronentaschen und eine große Packtasche und den Brotbeutel mit der Feldflasche. Sie wußten offensichtlich nicht recht, was sie mit mir anfangen sollten, und umringten mich, laut rufend und gestikulierend. Alles kam so überraschend für mich, daß ich einige Sekunden brauchte, bis ich mein Gewehr von der Schulter hängte, mein Koppel mit dem Bajonett und den Patronentaschen abnahm und es ihnen gab. Ich war recht froh, die schwere Last los zu sein.
Mittlerweile war der Khaki-Mann herangekommen, und ich redete ihn auf Englisch an, um herauszubekommen, ob er ein Engländer oder ein Amerikaner war. Er war Amerikaner. Er war sichtlich ein wenig angetrunken, aber wir hatten uns trotzdem rasch verständigt, und er sagte mir, ich sollte alles tun, was er sagte, sonst könnte er nicht für meine Sicherheit garantieren. Wir waren ein wenig wie zwei große Leute unter einem Haufen Kinder. Ich erinnere mich noch ganz deutlich seines Gesichts, seines sonnenverbrannten und vom Trinken geröteten Gesichts, mit dem etwas eitel wirkenden Douglas Fairbanks-Bärtchen darin. Die Italiener waren auf einmal begeistert darüber, daß wir so gut miteinander auskamen, und überschütteten uns mit Sympathie-Äußerungen. Sie meinten, ich müßte glücklich darüber sein, daß der Krieg für mich zu Ende und ich gefangen wäre, statt tot zu sein. Während wir ins Dorf hineingingen,ein immer größer werdender Zug, erzählte ich ihnen, was mir befohlen worden war, und fragte sie, ob in Oriolo oder Bracciano noch die Deutschen wären. Sie beteuerten, daß die Tedeschi bereits gestern abend diese beiden Orte geräumt hätten und daß die Amerikaner schon überall mit großen Kolonnen ständen. Das hatte sich also abgespielt, während ich in der Capanna gewesen und durch die Wildnis marschiert war. Mir war beklommen zu Mute, aber ich spürte den ganz leichten Atemzug neuer Möglichkeiten.
Auf dem Hauptplatz in San Virginio strömte die ganze Bevölkerung zusammen, als wir ankamen. Es waren nicht nur Italiener da, sondern auch Russen und Polen, die in der Nähe als Arbeiter an Befestigungen gearbeitet hatten – sie wurden übrigens später auch PWs [= Prisoner of War] –, und es war zehn Minuten lang eine kleine internationale Verbrüderung im Gange, in die sich die Frauen und Mädchen von San Virginio hübsch und glücklich lächelnd mischten. Ich entsinne mich noch, daß das Ganze mir schließlich peinlich wurde und ich froh war, als drei ruhige und nüchterne Amerikaner erschienen und mich aus dem Haufen herausnahmen. Mit ihnen verließ ich San Virginio, den Ort meiner Gefangennahme. Sie führten mich zu einem Jeep, einem ihrer gedrungenen viersitzigen Kübelwagen, und brachten mich nach Oriolo.16
»German prisoners file past jeering Italian girls« (14. Juni 1944)17 Quelle: NARA, RG 208-AA, Box 305.
Was sich zunächst wie eine Fortsetzung der in den »Kirschen der Freiheit« geschilderten Handlungschronologie ausnimmt, entbirgt rasch einen gravierenden Unterschied im Hinblick auf den Sachgehalt des Erzählten: Der Ich-Erzähler hier schildert sich dezidiert nicht als Deserteur, vielmehr als Versprengten – über die Gründe dafür, warum er den Kontakt zu seiner Einheit verlor, erfahren wir nichts –, der auf der Suche nach seiner Einheit den Amerikanern eher zufällig in die Hände fällt; der dann unverhofft Teil einer fast burlesk anmutenden Verbrüderungsszenerie wird, die sich zwischen Gefangenen, Partisanen und Zivilbevölkerung abspielt, bevor er von den Amerikanern in den Nachbarort zur ersten Vernehmung verbracht wird.
Im Kern also keine schlichte Fortsetzung der »Kirschen«, sondern zwei ganz verschiedene Geschichten: zum einen die der Selbstentwaffnung eines Soldaten, der auch äußerlich erkennbar den Schritt zum Deserteur vollziehen will, als der Moment der Gefangennahme sich anbahnt, zum anderen in »Amerikaner – Erster Eindruck« die Geschichte eines Soldaten, der auf der Suche nach seiner Einheit mit dem Gewehr über der Schulter vom Vormarsch des Kriegsgegners überrascht wird. Welche ist die »richtige« Geschichte? Darf man eine solche Frage überhaupt stellen? An einen literarischen Text?
In diesem Fall ist sie berechtigt, denn Andersch hat zeitlebens und mit Nachdruck den autobiografischen Pakt bekräftigt, den er mit seinen Lesern im Falle der »Kirschen« eingegangen war. Noch in einem seiner letzten Interviews im Januar 1980 bezeichnet er die »Kirschen« als
eine Art Bekenntnis, eine Konfession […], das typische Erstlingswerk eines Schriftstellers, der etwas ausspucken muß […]. Da ist ein autobiographischer Punkt, ich ärgere mich immer, wenn selbst gestandene Germanisten das heute noch unter meine Romane zählen, es ist kein Roman, das ist ein Bericht.18
Meistens ist es umgekehrt: Da verwehren sich die Schriftsteller gegen Lesarten, die ihre Literatur – in falsch verstandenem Positivismus – auf autobiografische Erfahrungen zurückführen wollen. Gewürdigt werden soll vor allem die Fiktionalisierungsleistung bei der künstlerischen Ausformung eines Stoffes, der sich – qua Ausformung – von den autobiografischen Schreibanlässen ausdrücklichemanzipiert habe. Reduktiv erscheinen den Autoren solche Lesarten, die die autobiografische Grundierung eines literarischen Stoffes wieder hervortreten lassen.
Bei Andersch verhält es sich in Bezug auf die »Kirschen« hier offenbar genau gegenteilig: Andersch verwahrt sich insbesondere gegen germanistische Lesarten, die solche Fiktionalisierungsleistungen seines Textes hervorheben, die ihn als gestandenen Roman und nicht in erster Linie als autobiografischen Bericht verstehen.19
Warum Andersch darauf so viel Wert legte,darüber kann man nur spekulieren. Es hat wahrscheinlich mit der Dignität der in den »Kirschen« geschilderten Erfahrungen bzw. Entscheidungen des Erzähler-Ichs zu tun, die der Autor sich auch als seine eigenen zurechnen lassen möchte. Auf das zusätzliche symbolische und moralische Kapital, auch in lebensgeschichtlichem Sinne als bekennender Deserteur zu gelten, wollte der Schriftsteller Andersch – bei allem literarischen Ruhm – offenbar keineswegs verzichten.
Die autobiografische Autorität der Darstellung seiner Desertion in den »Kirschen« wird auch dadurch bestätigt, dass Andersch ihr keinen weiteren Epitext an die Seite zu stellen gewillt war. Im jüngst erschienenen Briefwechsel zwischen Andersch und Max Frisch kann man jetzt die Reminiszenz seines Tessiner Nachbarn (und zeitweiligen Freundes) Frisch nachlesen, der Andersch im privaten Kreise dazu zu bewegen versuchte, auch gesprächsweise von seiner Desertion zu erzählen:
Einmal fragte ich ihn nach seinen Erlebnissen; ziemlich betreten verwies er auf seine Prosa, die ich selbstverständlich kenne, »Kirschen der Freiheit«, auch andere Texte, die Auskunft geben. Ich meinte in diesem Moment aber nicht den Schriftsteller Alfred Andersch, sondern ihn privat. Das war für ihn (wie ich nachträglich verstanden habe) eine ungehörige Frage. Schriftsteller ist man nicht unter anderem […].20
Diese Abstinenz erzeugt eine gewisse soziale Irritation. Der Gesprächspartner erwartet – nicht zuletzt als Vertrauensbeweis – eine mündlich mitgeteilte Bekräftigung des autobiografischen Textes. Andersch missversteht die Freundschaftspflicht und unterstreicht stattdessen die Gültigkeit der Selbstmitteilung im und durch den literarischen Text »Die Kirschen der Freiheit«.
Trotz dieser auktorialen Beteuerungen hat die Andersch-Forschung nach der Veröffentlichung von »Amerikaner – Erster Eindruck« – indigniert oder vorwurfsvoll – auf den Widerspruch zwischen »Kirschen der Freiheit« und »Amerikaner – Erster Eindruck« reagiert. Der Andersch-Biograf Stephan Reinhardt hält den früheren Text für »[e]twas genauer und vermutlich authentischer«.21Eine Begründung, warum er das für »Amerikaner – Erster Eindruck« postuliert, bleibt er freilich ebenso schuldig wie der holländische Germanist Ed Mather, der den früher geschriebenen Text nur deshalb, weil er »1944 oder 1945 unter dem unmittelbaren Eindruck der Ereignisse geschrieben« sei, für eine Widerlegung der »Kirschen« hält:
So hat die Desertion, in »Die Kirschen der Freiheit« zum Widerstandsakt und zu einem Moment existentieller Selbstbestimmung überhöht, in Wirklichkeit nicht einmal stattgefunden: Andersch wurde offensichtlich nur versprengt, anstatt sich in die Büsche zu schlagen, und geriet beim Versuch, sich seiner Truppe wieder anzuschließen, unversehens und völlig unbeabsichtigt in die Hände der Amerikaner […].22
So sehr erzürnt Mather der Widerspruch zwischen beiden Texten, dass er umstandslos die in den »Kirschen der Freiheit« erzählte Version als Widerstandslegende anzuprangern sich berechtigt glaubt:
So entstand auf der Grundlage des autobiografischen Paktes eine Legende, die deshalb so sicher war, weil der Gedanke, dass Andersch sich mit einer nur erfundenen Geschichte den voraussehbaren Schikanen der konservativen Kritik ausgesetzt hätte, so abwegig schien, dass er nicht einmal aufkommen konnte. Das Bild des Deserteurs und Außenseiters […] setzte sich in der Öffentlichkeit durch.23
Warum der früher geschriebene Text der in lebensgeschichtlicher Hinsicht authentischere oder verlässlichere sein muss, darauf gibt Mather keine Antwort.
Johannes Tuchel wiederum, der Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand und von der Andersch-Tochter Anette Korolnik-Andersch 2008 mit einem historiografischen Gutachten über »Alfred Andersch im Nationalsozialismus« betraut, zieht es vor, den Widerspruch zwischen den »Kirschen der Freiheit« und »Amerikaner – Erster Eindruck« stillschweigend zu übergehen: »Am 6. Juni 1944 machte Alfred Andersch sein Fahrrad absichtlich unbrauchbar und entfernte sich von der Truppe; kurz darauf stieß er auf Partisanen und US-Soldaten, denen er sich ergab.«24Als Beleg verweist Tuchel lediglich auf die Biografie von Reinhardt und den Kenntnisstand von 1990. Welche Quellen sind bislang eigentlich bekannt, die von Anderschs Selbstmitteilungen unabhängig sind? Stephan Reinhardt konnte für seine Biografie nur auf zwei solcher Quellen zurückgreifen:
1.) die amerikanische Kriegsgefangenakte, den »Basic Personnel Record« des Prisoner of War (POW) Alfred Andersch, die am 13. Juni 1944 angelegt wurde. Darin ist als »Day of Capture« – als Tag der Gefangennahme – der »7thjune 1944« angegeben, als Ort der Gefangennahme »Oriolo, Italy« und als gefangennehmende Einheit nur die Armeeebene (»5A. US«), jene 5thUS Army, die unter der Führung von Lieutenant General Mark W. Clark die amerikanischen Hauptkräfte an der Front in Mittelitalien stellte. Des Weiteren enthält die Akte eine englischsprachige Version von »Amerikaner – Erster Eindruck« (»Americans – First Impression«), angefertigt für die Zensur desPOW-Lagers Ruston, Louisiana, nebst einem undatierten Begleitschreiben Anderschs an den Herausgeber der Zeitung der deutschen Kriegsgefangenen in denUSA– Der Ruf – mit der Bitte, den Text für eine Veröffentlichung zu prüfen.Darin entschuldigt sich Andersch dafür, dass die Erzählung in literarischer Hinsicht mangelhaft durchgearbeitet sei: »From the standpoint of art, the work is still quite unformed – for I don’t find the neccessary calm here – and therefore it is to value only as an account given by an eye-witness; but possibly not quite worthless as such.«25Immerhin als Augenzeugenbericht sei der Text über seine Gefangennahme von Interesse, bescheidet sich der Autor. Damit wird »Amerikaner – Erster Eindruck« dokumentarische Qualität zugesprochen: eine für unsere Frage nach dem Widerspruch zwischen den »Kirschen«und diesem früheren Text nicht ganz unmaßgebliche Selbstbeschreibung des Autors. In der Akte enthalten ist auch der Antwortbrief der Schriftleitung des Ruf – in Person von George Neubauer –, derPOWAndersch am 11. April 194526für die (bereits erwartete) Einsendung dankt und ihm ankündigt, Auszüge aus »Amerikaner – Erster Eindruck« in der nächsten Nummer des Ruf zu veröffentlichen (unter dem Titel »Abschied von Rom« am 15. Mai 1945).27
Alfred Anderschs zweiter Text in der Kriegsgefangenenzeitung Der Ruf vom 15. Mai 1945. Darin enthalten ist ein Auszug seines postum unter dem Titel »Amerikaner – Erster Eindruck« veröffentlichten Berichtes über die Gefangennahme durch U.S.-amerikanische Truppen am 7. Juni 1944. Quelle: Der Ruf. Zeitung der deutschen Kriegsgefangenen in den USA vom 15. Mai 1945, S. 2.
2.)brieflicheAussagen von Anderschs Vorgesetztem, Leutnant Meske, Kompaniechef seiner Radfahrereinheit, der 3. Kompanie des Luftwaffen-Jäger-Regiments 39, der in den »Kirschen« mit Klarnamen erwähnt wird und der gegenüber dem Diogenes Verlagbrieflichdie Aussage zurückweist, die Andersch ihm in den Mund legte: »Für diejenigen, die vor dem Feind nicht spuren: In meiner Pistole sind sechs Schuß.«28
Ein Vernehmungsbericht aus der Akte Alfred Andersch im geheimen Vernehmungslager Fort Hunt vom 16. September 1944. Quelle: NARA, RG 165, Entry 179, Box 442.
Mittlerweile ist durch Felix Römer eine weitere zentrale Quelle bekannt geworden: das Andersch-Gefangenendossier aus dem geheimen amerikanischen Vernehmungslager Fort Hunt, das nicht lange nach Anderschs Ankunft als Kriegsgefangener in den Vereinigten Staaten in der Woche zwischen dem 11. und 19. September 1944 angelegt wurde, bevor Andersch in das Transitlager Fort Meade, Maryland, weiterverbracht wurde. Das Fort Hunt-Dossier enthält neben Befragungsprotokollen und einer Denkschrift aus der Feder desPOWAndersch auch die Protokolle abgehörter Zellengespräche, die Andersch mit seinen Mitgefangenen geführt hatte.29Leider gibt aber noch nicht einmal dieser Lauschangriff auf die informell plaudernden Kriegsgefangenen weiteren Aufschluss über die Frage, ob Andersch sich in amerikanischer Haft als Deserteur präsentierte. Auch enthält das Fort Hunt-Dossier keinen Hinweis darauf, dass Andersch dort als Deserteur geführt wurde. Deshalb blieb es nach der Entdeckung der Fort Hunt-Akten bei folgendem Forschungsstand:
Letztlich ist die Historizität von Anderschs Desertion auf der Grundlage der Akten von Fort Hunt nicht mit Gewissheit zu beurteilen. Um Anderschs Angaben über den Hergang seiner Fahnenflucht aus einer neuen Perspektive zu überprüfen, bietet es sich an, die erhaltenen deutschen und amerikanischen Militärakten und Lagekarten der am Schauplatz eingesetzten Feldverbände zu konsultieren, was bislang unterblieb.30
Das soll hier im Folgenden nachgeholt werden – soweit die Überlieferungslage dies noch zulässt.31Weil es bislang noch niemand gemacht hat, treten wir den Gang in die Archive an, um die umstrittene und widersprüchliche literarische Selbstdarstellung eines Autors mit autorunabhängigen Quellen zu konfrontieren. Ein solches Vorgehen gilt mindestens als altmodisch. Schlimmer noch: als Rückfall in den geistesgeschichtlichen Positivismus. Bei literarischen Texten habe niemand zu fragen – Ranke lässt grüßen –, wie es denn »eigentlich« gewesen sei. Wir hingegen fragen – so naiv wie nötig, so vorbehaltloswie möglich –, was sich gegebenenfalls heute noch herausfinden lässt über die Historizität der in den Andersch-Texten geschilderten Ereignisse. Nicht zuletzt deshalb erscheint dies hier gerechtfertigt, weil der Autor selbst beide in Rede stehenden, sich widersprechenden Texte dezidiert als autobiografische bezeichnet hat: die »Kirschen« als »Bericht« (im Unterschied zum Roman), »Amerikaner – Erster Eindruck« als »account given by an eye-witness« – für beide wird damit (in Grenzen) auch ein dokumentarischer Anspruch reklamiert.
Der Einwand, dem sich ein solches Vorgehen zwangsläufig aussetzt, lautet (wie immer): Wie aber steht es um den Konstruktionscharakter der autobiografischen Selbstmitteilung? Ja, klar, zugegeben: Wer sagt schon über sich selbst stets die historische Wahrheit? Bei der Autobiografie handelt es sich eben um »literarische Verfahren der Selbstkonstruktion« eines Autors.32Das ist lange bekannt und auch hier völlig unbestritten. Was bedeutet aber diese Einsicht für die Erforschung von autobiografischen Texten? Soll man sich mit dieser »Dichtung-und-Wahrheit«-Binse bescheiden? Oder doch einmal den Versuch unternehmen, unabhängiges Quellenmaterial zu eruieren, das geeignet wäre, den literarischen Konstruktionscharakter der autobiografischen Selbstmitteilung durchsichtig zu machen, um die Fiktionalisierungsleistung, die Literarizität eines autobiografischen Textes auf der Folie lebensgeschichtlich relevanten Kontextes nicht nur zu behaupten, sondern auch in seiner Differenzqualität und Erfindungsarbeit ermessen und würdigen zu können? Zugegeben: Werkbiografische Forschung gilt in der Germanistik als hoffnungslos »unhip«.33Aber man kann getrost darauf vertrauen, dass ihre Ergebnisse, wenn sie instruktiv sind, trotz des Positivismusvorbehaltes, der sich in diesem Einwand mitteilt, durchaus nicht uninteressiert zur Kenntnis genommen werden. Wollte man den hier angestrengten Gang in die Archive methodisch freundlicher qualifizieren, könnte man auch sagen: Hier geht es um Grundlagenforschung zu autobiografischen Texten. Nicht mehr und nicht weniger. Ranke hin oder her. Und wir behaupten, damit relevanten Kontext für weitere instruktive Andersch-Lektüren bereitzustellen, und wollen uns – auf der Basis dieser neuen Quellen – gleich selbst an einer solchen Re-Lektüre versuchen.
Der Gang in die Archive führt uns nach Freiburg ins Bundesarchiv-Militärarchiv, in dem die Wehrmachtsüberlieferung zu Anderschs Truppenteil gesammelt ist; in die Deutsche Dienstelle – ehemals Wehrmachtauskunftstelle (WASt) – nach Berlin, wo sich die personenbezogenen Daten zu Anderschs Fronteinheit befinden; nach Washington D. C., wo in den National Archives die Dokumente der 5thUS Army liegen, deren Truppen Andersch gefangen nahmen. Schließlich ins britische Nationalarchiv nach Kew in London, wo Lageberichte, Vernehmungsberichte und Abhörprotokolle der alliierten Nachrichtendienste aus dem Juni 1944 archiviert sind.
Unsere Darstellung einer fraglichen Desertion im Lichte der Militärakten führt tief in die Weltkriegsgeschichte des Jahres 1944 auf dem italienischen Kriegsschauplatz. Kapitel 2 wird Anderschs Weg nach Italien skizzieren – von der Infanterieausbildung in Siegen über die Radfahrerausbildung in Dänemark bis zur Verlegung an die Front – und den militärgeschichtlichen Kontext jener Ereignisse entfalten, die bei Andersch erzählt werden – als aus dem Stellungskrieg bei Monte Cassino, der sich über den halben Winter 1943/44 erstreckte, nach der alliierten Offensive vom Mai 1944 wieder ein Bewegungskrieg wurde, in dem die deutschen Truppen vor den amerikanischen und britischen Angreifern nach Norden zurückwichen, um eine neue Verteidigungslinie zu errichten. Im Rahmen dieser Defensivoperation der deutschen Heeresgruppe C unter dem Oberbefehlshaber Südwest Generalfeldmarschall Albert Kesselring wurdeschließlich auch Anderschs Radfahrereinheit Anfang Juni 1944 eingesetzt – der Kontext dieser Kämpfe ist wichtig, um die Ereignisgeschichte jener Tage zu verstehen, die zu Anderschs Gefangennahme führt (6./7. Juni 1944). Das Kapitel 3 rekonstruiert dann – soweit es die alliierte wie deutsche Überlieferungslage zulässt – diese Ereignisgeschichte, die in den »Kirschen der Freiheit« mit den Worten des Ich-Erzählers eingeläutet wird: »Ich hatte mich entschlossen,rüber zu gehen«.34Kapitel 4 wird sich Anderschs Kameraden zuwenden. Der Ich-Erzähler in den »Kirschen der Freiheit« beschreibt sie dezidiert und nicht ohne retrospektive Wertung. Die deutschen Verlustlisten ebenso wie die britischen und amerikanischen Militärakten jedoch bieten zu Stimmung und Moral unter Anderschs Kameraden neue Erkenntnisse, die seinen »Bericht« in einem partiell anderen Licht erscheinen lassen. Kapitel 5 ist ein Exkurs über die Routinen der Befragungen, denen die alliierten Intelligence-Einheiten die deutschen Kriegsgefangenen im Juni 1944 unterzogen – unmittelbar nach Gefangennahme, dann auch in denPOW-Camps. Der Exkurs soll dazu beitragen, die Befunde aus den amerikanischen und britischen »Interrogation Reports« besser einordnen zu können, insbesondere im Hinblick auf die Behandlung des Themas Fahnenflucht. Kapitel 6 widmet sich ausführlich der 20. Luftwaffen-Feld-Division, jener Einheit, der Andersch bis zu seiner Gefangennahme angehörte. Dabeisoll unter anderem geklärt werden, wie es um deren Kampfmoral bestellt war. Das ist wichtig, um ein Bild von Anderschs unmittelbarer sozialer Umgebung zu erhalten, in der sich das fraglicheDesertionsgeschehen abspielte. Kapitel 7 wird den Spuren folgen, die AnderschsKriegsgefangenschaft in Italien hinterlassen hat. Auf dasPOW-CampAversa, in dem Andersch die meiste Zeit seiner Gefangenschaft inItalien verbrachte, verweisen weitere der Fort Hunt-Dossiers, die insbesondere die Lage der bekennenden Deserteure in der Gefangenschaft zu erhellen vermögen. Kapitel 8 gilt einer wichtigen Station der autofiktionalen Selbstdarstellung Anderschs auf dem Weg zu den »Kirschen der Freiheit«: der Erzählung »Flucht in Etrurien«, erstabgedruckt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 1950.35Das Kapitel 9 wird dann Anderschs »Kirschen der Freiheit« mit einem weiteren autobiografisch grundierten Kriegsroman vergleichen: »Die Geschlagenen« von Hans Werner Richter (1949). Die These, die hier verfolgt wird, lautet, dass Anderschs Bericht zu dem sowohl kommerziell sehr erfolgreichen wie auch reputierlichen Roman seines Gruppe-47-Kollegen Richter in einem aufschlussreichen Spannungs- und Überbietungszusammenhang steht. Kapitel 10 wird eine knappe Skizze zur Bedeutung des Themas Desertion für die westdeutsche Nachkriegsliteratur bieten, während Kapitel 11 den Wandelder öffentlichen Meinung in derBRDzum Thema Desertion bishin zu den allerjüngsten Urteilen des deutschen Bundestags zur Frage des Kriegsverrats zusammenfasst. Kapitel 12 gibt abschließend eine kurze Zusammenfassung unserer Ergebnisse.36
Anmerkungen
1Andere bekannte Namen unter den bekennenden westdeutschen Deserteuren des Zweiten Weltkriegs sind u.a.: der Politologe Wolfgang Abendroth, der langjährige Gewerkschaftsvorsitzende Heinz Kluncker oder der Schriftsteller Gerhard Zwerenz.
2Über die genaue Zahl der Wehrmachtsdeserteure gerade gegen Ende des Zweiten Weltkriegs lässt sich lediglich spekulieren. Die hier zitierte Schätzung, die seit Wüllner in der Forschung kursiert, beruht auf Hochrechnungen, die sich auf die militärgerichtlich dokumentierten Fälle von Anklageerhebungen wegen des Vorwurfs der Desertion beziehen. Vgl. zu dieser Zahl und den Problemen ihrer Schätzung u.a.: Magnus Koch,Fahnenfluchten. Deserteure der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg – Lebenswege und Entscheidungen,Paderborn 2008, S. 7; Fritz Wüllner,Die NS-Militärjustiz und das Elend der Geschichtsschreibung. Ein grundlegender Forschungsbericht,Baden-Baden21996; Manfred Messerschmidt,Deserteure im Zweiten Weltkrieg,in: Wolfram Wette (Hg.),Deserteure der Wehrmacht. Feiglinge – Opfer – Hoffnungsträger? Dokumentation eines Meinungswandels,Essen 1995, S. 58–73, hier S. 62; Benjamin Ziemann,Fluchten aus dem Konsens zum Durchhalten. Ergebnisse, Probleme und Perspektiven der Erforschung soldatischer Verweigerungsformen in der Wehrmacht 1939–1945, in: Rolf-Dieter Müller u.a. (Hg.),Die Wehrmacht. Mythos und Realität, München 1999, S. 589–613.
3Vgl. Sönke Neitzel / Harald Welzer,Soldaten. Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben, Frankfurt a.M. 2011, S. 337–341; Felix Römer,Kameraden. Die Wehrmacht von innen,München 2012, S. 111–204.
4Diese Zahlen wiederum sind durch Aktenüberlieferung belegt. Vgl. Messerschmidt,Deserteure, S. 61. Zum Vergleich: In der US Army wurde während des Zweiten Weltkrieges insgesamt nur ein einziges von insgesamt 49 Todesurteilen vollstreckt. Dabei handelte es sich um dasjenige für den 24-jährigen Edward Donald »Eddie« Slovik, der am 31. Januar 1945 in Sainte-Marie-aux-Mines in Frankreich hingerichtet wurde. Seit dem Amerikanischen Bürgerkrieg (1861–1865) war er der erste wegen Fahnenflucht hingerichtete US-Soldat und ist bis heute der letzte geblieben.Vgl. William Bradford Huie,The Execution of Private Slovik,London 1954.
5Vgl. die in Koch,Fahnenfluchtendiskutieren Fälle des Berufsoffiziers Ludwig Metz und des Meldereiters Hermann Rombach, die beide bereits in den 1940er-Jahren ihre Desertionserfahrungen in Romanform verarbeiteten.
6Vgl. Helmut Peitsch,»Was geschieht, wenn […] neben den üblichenGenerals-Memoirenplötzlich das Buch eines Deserteurs erscheint?« Alfred AnderschsKirschen der Freiheitim Kontext, in: Lars Koch / Marianne Vogel (Hg.),Imaginäre Welten im Widerstreit. Krieg und Geschichte in der deutschsprachigen Literatur seit 1900,Würzburg 2007, S. 250–270.
7Vgl. den Wortlaut des Gutachtens in Winfried Stephan (Hg.),ÜberDie Kirschen der Freiheit, Frankfurt a.M. 1992, S. 37f. Zu Marek vgl. v.a. auch David Oels,Rowohlts Rotationsroutine. Markterfolge und Modernisierung eines Buchverlags vom Ende der Weimarer Republik bis in die fünfziger Jahre,Essen 2013, S. 259–354.
8Alfred Andersch,Die Kirschen der Freiheit. Ein Bericht,Frankfurt a.M. 1952. Im Folgenden zitiert nach Alfred Andersch:Die Kirschen der Freiheit[1952], in: Ders.,Gesammelte Werke in zehn Bänden. Kommentierte Ausgabe. Erzählungen 2. Autobiographische Berichte, Bd. 5, hg. v. Dieter Lamping, Zürich 2004, S. 327–413. Künftig abgekürzt mit: Andersch GW Band/Seite.
9Vollständig dokumentiert in Stephan,ÜberDie Kirschen.
10Ebd., S. 55–57 und S. 100f.
11Andersch GW 5/382.
12Vgl. Wolfram Wette,Deserteure der Wehrmacht rehabilitiert. Ein exemplarischer Meinungswandel in Deutschland (1980–2002),in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 52 (2004), S. 505–527.
13Vgl. dazu ebd., S. 510–513.
14Andersch GW 5/413.
15Andersch GW 5/408.
16Andersch GW 5/305–307.
17Zitiert (und nicht weiter kommentiert) werden hier, sofern nicht anders angegeben, die originalen Bildunterschriften, die von alliierten Propagandakompanien erstellt wurden.
18Vgl.Alfred Andersch im Gespräch mit Jürg Acklin, Berzona 19./20. Januar 1980, in: Stephan,ÜberDie Kirschen, S. 198–202.
19Vgl. dazu: Jörg Döring,Zur Textgenese von Alfred AnderschsKirschen der Freiheit. Eine Autopsie ausgewählter Passagen des handschriftlichen Befundes, in: Ders. / Markus Joch (Hg.),Alfred Anderschrevisited.Werkbiographische Studien im Zeichen der Sebald-Debatte, Berlin/Boston 2011, S. 13–45, hier S. 13.
20Jan Bürger (Hg.),Alfred Andersch – Max Frisch,Briefwechsel,Zürich 2014, S. 85. Frisch selbst hatte in einem seiner ersten Dramen »Nun singen sie wieder. Versuch eines Requiems«, entstanden noch vor Kriegsende 1945, die Figur eines Deserteurs auftreten lassen, der sich im Hause seines Vaters, eines Oberlehrers, zu verstecken versucht, während dieser ihn zur Rückkehr an die Front überreden will.
21Stephan Reinhardt,Alfred Andersch. Eine Biographie, Zürich 1996, S. 104.
22Ed Mather, »Vielleicht ist unter allen Masken, aus denen man wählen kann, das Ich die beste«. Über die Entstehung einer Legende auf der Grundlage einer Autobiografie: Alfred AnderschsKirschen der Freiheit, in: Neophilologus 84 (2000), S. 443–455, hier S. 449.
23Ebd., S. 453.
24Johannes Tuchel,Alfred Andersch im Nationalsozialismus, in: Marcel Korolnik / Anette Korolnik-Andersch (Hg.),Sansibar ist überall. Alfred Andersch. Seine Welt – in Texten, Bildern, Dokumenten,München 2008, S. 30–41, hier S. 40.
25Deutsche Dienststelle – Wehrmachtauskunftstelle (WASt) Berlin, Basic Personnel Record Prisoner of War Alfred Andersch.
26Aufgrund dieses datierten Antwortschreibens vom April 1945 wird in der Forschung als Entstehungszeit von »Amerikaner – Erster Eindruck« zumeist das Frühjahr 1945 angegeben, zumal auch der Eingangsvermerk der US-Kriegsgefangenenverwaltung (Office of the Provost Marshal General OMPG) für die eingesandte Erzählung vom Januar 1945 datiert. Zwingend ist eine solche Festlegung der Entstehungszeit aber keineswegs. Vielmehr könnte sich der POW Andersch die Notizen tatsächlich auch im engeren Umkreis zu dem erlebten Geschehen selber ab Juni 1944 gemacht und sie erst später beim Ruf eingereicht haben. Näheres zur Genese dieses Textes lässt sich bei gegenwärtiger Quellenlage nicht ermitteln.
27Die POW-Akte Andersch befindet sich heute in der Deutschen Dienststelle – Wehrmachtauskunftstelle, Berlin (WASt). Auszüge daraus sind in der Forschungsliteratur schon verschiedentlich faksimiliert wiedergegeben worden: z. B. bei Reinhardt,Andersch, S. 384ff.; bei W. G. Sebald,Der Schriftsteller Alfred Andersch,in: Ders.,Luftkrieg und Literatur,Frankfurt a. M. 2001, S. 111–147, hier S. 125f.
28Vgl. Andersch GW 5/377. Eine Zusammenfassung der brieflichen Äußerungen Meskes gegenüber dem Diogenes Verlag und gegenüber Biograf Reinhardt, getätigt zwischen 1987 und 1989, findet sich bei Reinhardt,Andersch, S. 97–103 und S. 650f.
29Vgl. dazu insbesondere Felix Römer,Alfred Andersch abgehört.Kriegsgefangene »Anti-Nazis« im amerikanischen Vernehmungslager Fort Hunt, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 4 (2010), S. 563–597 und Ders.,Literarische Vergangenheitsbewältigung. Alfred Andersch und seine Gesinnungsgenossen im amerikanischen Vernehmungslager Fort Hunt,in: Jörg Döring/Markus Joch (Hg.),Alfred Anderschrevisited.Werkbiographische Studien im Zeichen der Sebald-Debatte,Berlin/Boston 2011, S. 153–188.
30Römer,Literarische Vergangenheitsbewältigung, S. 167.
31Bei Stephan,ÜberDie Kirschen, S. 21–34 findet sich zwar ein Kapitel über die »Orte der Desertion und der Gefangennahme«, aber es beschränkt sich im Wesentlichen darauf, die Schauplätze des Geschehens in Italien in Augenschein zu nehmen und foto- und kartografisch zu illustrieren. Das überlieferte militärgeschichtliche Aktenmaterial hingegen bleibt unberücksichtigt.
32Vgl. zuletzt: Martina Wagner-Egelhaaf (Hg.),Auto(r)fiktion. Literarische Verfahren der Selbstkonstruktion, Bielefeld 2013.
33Vgl. Markus Joch,Der Biografist. Zu Alfred Anderschs ›Realismus‹ und den Bemühungen seiner Verehrer,in: literaturkritik.de Nr. 2, Februar 2014, online abrufbar unter:http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=19005[letzter Zugriff: 21.04.2014].
34Andersch GW 5/380.
35In: Frankfurter Allgemeine Zeitung zwischen dem 11. und 23. August 1950.
36Dieses Buch wurde von drei Autoren gemeinschaftlich erarbeitet. Wer dennoch Lust auf Provenienzforschung hat: Das einleitende Kapitel 1 ist von Jörg Döring geschrieben, das Kapitel 2 von allen Autoren gemeinsam, die Kapitel 3, 4 und 5 von Jörg Döring und Felix Römer, das Kapitel 6 von Felix Römer, das Kapitel 7 von Jörg Döring und Felix Römer, die Kapitel 8, 9 und 10 von Jörg Döring, das Kapitel 11 von Rolf Seubert und Felix Römer und das Schlusskapitel 12 von Jörg Döring und Felix Römer.
2. Als Radfahrsoldat auf dem Rückzug
Andersch auf dem italienischen Kriegsschauplatz 1944
Die unmittelbare Vorgeschichte von Anderschs mutmaßlicher Desertion begann mit seiner erneuten Einberufung: Am 2. Oktober 1943 wurde Alfred Andersch wieder zur Wehrmacht eingezogen, nachdem er am 12. März 1941 aufgrund seiner Ehe mit Angelika Albert, einem – im Jargon der Nürnberger Rassegesetze – »Jüdischen Mischling«, vorübergehend aus der Wehrmacht entlassen wordenwar.1Seine Ausbildung als Infanterist absolvierte er zunächst in Butzbach, ab Dezember dann bei der Infanterie-Pionier-Ersatz-Kompanie 9 in Siegen/Westfalen: »Moderne Kasernen, wundervoll gelegen in einer herrlichen Gebirgslandschaft […]«, schrieb er am 2. Dezember 1943 an seine Mutter.2
In dem Marschzug kriege ich die Ausbildung von Infanterie-Pionieren und bin unter alten Landsern, die sich auskennen. Wann ich von da dann zum Einsatz komme, ist noch gar nicht abzusehen, es kann wohl sehr lange dauern, denn erst muß man uns jahrelang abwesend Gewesene ja doch wieder waffenfähig machen.3
Im Februar 1944 war die Grundausbildung vorerst abgeschlossen, wobei die Soldaten im Unklaren darüber gelassen wurden, ob sie für die Ostfront oder für den Westen vorgesehen waren: »Wenn ich länger hier bleibe, ist die Aussicht Rußland immer stärker, wenn ich gleich wegkomme, komme ich wohl zuerst in den Westen.«4Wie Andersch die deutschen Kriegs-, und damit mittelbar auch seine ganz persönlichen Überlebens-Chancen einschätzte, davon gibt insbesondere ein Brief Aufschluss, der nicht in die Briefausgabe aufgenommen wurde: »In diesem Krieg gibt es keine Hoffnung und keine Begeisterung mehr. Ich selbst helfe mir damit, dass ich auch diese letzte Hoffnungslosigkeit bejahe. Denken des verlorenen ›Postens‹.«5Ob dieser Brief tatsächlich schon einen Einstellungswandel gegenüber Krieg und Eid indiziert, der eine spätere Desertion plausibel macht, wie Christian Ganseuer mutmaßt (dem das Verdienst zukommt, diesen Brief öffentlich gemacht zu haben), soll hier dahingestellt bleiben.
Belegt ist jedenfalls durch die Briefe an seine Mutter – die veröffentlichten wie die unveröffentlichten aus dem Marbacher Nachlass –, dass Andersch sich, wie viele andere Wehrmachtssoldaten auch, bis zuletzt darum bemühte, dem Frontschicksal zu entgehen. Hoffnungen auf einen Schreibtischposten im Berliner Reichsluftfahrtministerium zerschlugen sich ebenso wie der Versuch, als Kriegsreporter bei einer Propagandakompanie unterzukommen, was die Gefahr für Leib und Leben deutlich verringert hätte. Bei der Dienstreise nach Berlin, die allein dazu diente, solche Versetzungschancen auszuloten, geriet er in einen schweren Bombenangriff der britischen Royal Air Force auf die Reichshauptstadt.6Schon zuvor war seine Frankfurter Wohnung mitsamt Bibliothek bei einem Fliegerangriff zerstört worden. Bei Bombenangriffen auf Siegen wurde er im März 1944 zu Aufräumarbeiten abkommandiert und musste Leichen abtransportieren.7Paradoxerweise mag daher der Abstellungsbefehl in das besetzte, aber noch friedliche Dänemark Anfang April 1944 fast eine Erleichterung bedeutet haben. Er kam – gemeinsam mit 40 anderen Soldaten aus der Siegener Kompanie – zunächst noch nicht an die Front, stattdessen in ein vorerst sicheres Land, das sich auch durch eine spürbar bessere Versorgungslage auszeichnete. Entsprechend euphorisch fielen die erstenbrieflichenReaktionen aus: »Wie wunderbar ist der Frieden in diesem Land. Ich möchte wünschen, Du könntest hier leben«, schrieb er an die Mutter. »Seit 2 Tagen lebe ich phantastisch. Es gibt alles oder fast alles in den Geschäften. Und die Menschen – alles so intakt.«8Unmittelbar vor Abstellung war Andersch in Siegen noch rasch zum Obersoldaten befördert worden.
Die Siegener Ersatz-Infanteristen waren nach Dänemark abkommandiert, um Teil einer neu aufgestellten Division zu werden, der 20. Luftwaffen-Feld-Division. Die Division gehörte zu jenen Erdkampfverbänden der Luftwaffe, die ab 1943 aus mehrheitlich unerfahrenen Soldaten gebildet wurden, um den zunehmenden Bedarf an Bodentruppen zu decken – das Personal und die Stimmung in dieser Truppe werden weiter unten (im Kapitel 6) noch eingehend zu beschreiben sein. Der Aufbau dieser Division war im Januar 1944 abgeschlossen, und am 1. Februar übernahm ein Russland-Veteran, der Generalmajor Wilhelm Crisolli, das Kommando.9 Für die Front war die 20. Luftwaffen-Feld-Division als bewegliche Infanterietruppe vorgesehen. Sie setzte sich im Wesentlichen aus den Luftwaffen-Jäger-Regimentern 39 und 40 zusammen. Neben zwei Kompanien mit schweren Waffen bestanden ihre Bataillone vor allem aus jeweils drei Radfahrerkompanien.





























