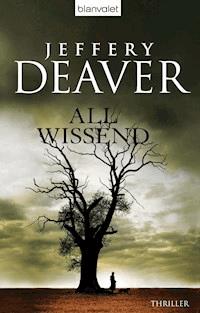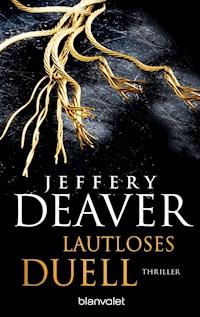Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel »Roadside Crosses« bei Simon & Schuster, New York.
© 2009 by Jeffery Deaver © der deutschsprachigen Ausgabe 2010 by Blanvalet Verlag,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München.ISBN : 978-3-641-04251-6V003
www.blanvalet.dewww.penguinrandomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
Anmerkung des Verfassers
MONTAG
Kapitel 1
DIENSTAG
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
MITTWOCH
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
DONNERSTAG
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
FREITAG
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Danksagung
Copyright
Anmerkung des Verfassers
Dieser Roman behandelt unter anderem das Verwischen der Grenze zwischen der »synthetischen Welt« – dem Online-Leben – und der wirklichen Welt. Wenn Sie im Verlauf der Geschichte also auf die eine oder andere Internetseite stoßen, könnte es sich lohnen, die Adresse in Ihrem Browser aufzurufen und sich dort mal umzusehen. Die im Netz vorhandenen Informationen sind für den Spaß an diesem Roman zwar keinesfalls nötig und zudem in englischer Sprache, aber sie können Ihnen womöglich zu ein paar zusätzlichen Anhaltspunkten bei der Entschlüsselung des Rätsels verhelfen. Vielleicht werden Sie das Dargebotene auch einfach nur als interessant – oder beunruhigend – empfinden.
Das Internet und die dort kultisch bewahrte Anonymität verleihen jedermann quasi die Generalvollmacht, ungestraft alles Mögliche über jede beliebige andere Person zu äußern. Ich kann mir kaum einen moralisch verwerflicheren Missbrauch des Gedankens der Redefreiheit vorstellen.
Richard Bernstein in der New York Times
MONTAG
Kapitel 1
Seltsam.
Der junge Beamte der California Highway Patrol mit hellblondem Bürstenschnitt unter dem steifen Uniformhut kniff die Augen zusammen und spähte durch die Windschutzscheibe seines Streifenwagens. Der Crown Victoria war in südlicher Richtung auf dem Highway 1 bei Monterey unterwegs. Rechts lagen Dünen, links ein schmuckloses Gewerbegebiet.
Irgendwas sah anders aus als sonst. Aber was?
Es war siebzehn Uhr, und der Beamte befand sich nach seinem Schichtende auf dem Heimweg. Er musterte die Straße. Für gewöhnlich verteilte er in dieser Gegend nur wenige Strafzettel und überließ das aus kollegialer Höflichkeit den County Deputys, doch hin und wieder, wenn ihm danach war, hielt er ein deutsches oder italienisches Auto an, und außerdem fuhr er oft um diese Tageszeit auf dieser Strecke nach Hause. Daher kannte er den Highway ziemlich gut.
Da … das war es. Vierhundert Meter voraus lag etwas Buntes am Fuß eines der Sandhügel, die den Blick auf die Monterey Bay versperrten.
Was konnte das sein?
Er schaltete vorschriftsgemäß die Signalleuchten ein und fuhr auf den rechten Seitenstreifen. Dann hielt er so an, dass die Haube des Ford ein Stück nach links in Richtung der Fahrspuren wies, damit ein eventuell auffahrender Wagen den Crown Victoria von ihm weg und nicht genau auf ihn zu stoßen würde. Der Beamte stieg aus. Dort im Sand gleich jenseits der Standspur steckte ein Kreuz zum Gedenken an einen tödlichen Unfall. Es war ungefähr fünfundvierzig Zentimeter hoch und handgemacht – aus dunklen, abgebrochenen Zweigen, die mit einem Draht zusammengebunden waren, wie Floristen ihn benutzen. Davor lag ein Strauß aus dunkelroten Rosen ausgebreitet, und an ihm hing ein Pappschild, auf dem in blauer Tinte das Datum des Unfalls geschrieben stand. Weder auf der Vorder- noch auf der Rückseite war irgendein Name vermerkt.
Die Behörden sahen solche Gedenkstätten nicht gern, denn es wurden gelegentlich Leute verletzt oder gar getötet, während sie damit beschäftigt waren, an der Straße ein Kreuz zu errichten oder Blumen und Stofftiere niederzulegen.
Orte wie dieser wirkten normalerweise geschmackvoll und ergreifend. Der hier war unheimlich.
Merkwürdig war auch, dass der Beamte sich an keine entsprechenden Unfälle in dieser Gegend erinnern konnte. Es handelte sich hier sogar um einen der sichersten Abschnitte des Highway 1 in ganz Kalifornien. Südlich von Carmel gab es viele riskante Stellen, zum Beispiel am Schauplatz jenes wirklich tragischen Unfalls, bei dem vor einigen Wochen zwei Mädchen auf dem Rückweg von einer Abschlussfeier ums Leben gekommen waren. Hier hingegen verlief der Highway dreispurig und im Wesentlichen gerade, abgesehen von vereinzelten leichten Biegungen vorbei am Gelände des alten Fort Ord, heutzutage ein Universitätscampus, und den Einkaufsvierteln.
Der Beamte überlegte kurz, ob er das Kreuz entfernen sollte, aber dann würden die Trauernden womöglich zurückkehren, um ein neues zu errichten, und sich so abermals in Gefahr bringen. Am besten ließ er einfach alles, wie es war. Er nahm sich vor, am nächsten Morgen seinen Sergeant danach zu fragen, was hier geschehen war. Dann kehrte er zu seinem Wagen zurück, warf den Hut auf den Beifahrersitz und strich sich über das kurz geschorene Haar. Als er sich wieder in den Verkehr einreihte, dachte er nicht länger über irgendwelche Unfälle nach, sondern darüber, was seine Frau wohl zum Abendessen kochen würde und ob er mit den Kindern nach dem Essen noch in den Pool springen sollte.
Und wann wollte sein Bruder doch gleich zu Besuch kommen? Er sah auf die Datumsanzeige seiner Armbanduhr und runzelte die Stirn. Konnte das sein? Ein Blick auf das Display seines Mobiltelefons bestätigte, dass, jawohl, heute der 25. Juni war.
Wie seltsam. Wer auch immer dieses Kreuz am Straßenrand hinterlassen hatte – ihm war ein Fehler unterlaufen. Der Beamte wusste genau, dass auf dem Pappschild in ungelenker Handschrift der 26. Juni gestanden hatte, der morgige Dienstag.
Vielleicht waren die armen Trauernden ja so durcheinander gewesen, dass sie sich beim Datum vertan hatten.
Dann wichen die Bilder des gespenstischen Kreuzes in den Hintergrund zurück, aber sie verschwanden nicht völlig. Auf dem Rest seines Heimwegs fuhr der Beamte etwas vorsichtiger als üblich.
DIENSTAG
Kapitel 2
Der schwache Lichtschein – blassgrün, wie von einem Geist – tanzte knapp außerhalb ihrer Reichweite.
Wenn sie ihn doch nur erreichen könnte.
Wenn sie den Geist erreichen könnte, wäre sie gerettet.
Der Schimmer, der in der Dunkelheit des Kofferraums schwebte, baumelte wie zum Hohn ein Stück oberhalb ihrer Füße, die genau wie ihre Hände mit Isolierband gefesselt waren.
Ein Geist …
Ein weiteres Stück Klebeband verschloss ihren Mund, und sie sog die schale Luft durch die Nase ein. Dabei hielt sie sich bewusst zurück, als könnte der Kofferraum ihres Camry nur ein gewisses Maß an Sauerstoff fassen.
Ein schmerzhafter Aufprall, als der Wagen durch ein Schlagloch fuhr. Sie stieß einen kurzen, gedämpften Schrei aus.
Von Zeit zu Zeit glommen andere schwache Lichter auf: ein mattes Rot, wenn er auf die Bremse trat, der Blinker. Draußen blieb es finster; es war kurz vor ein Uhr morgens.
Der leuchtende Geist schaukelte vor und zurück. Es handelte sich um die Notentriegelung des Kofferraums: ein Handgriff aus lumineszierendem Kunststoff, versehen mit dem komischen Abbild eines Mannes, der aus dem Wagen sprang.
Aber der Griff blieb knapp außerhalb der Reichweite ihrer Füße.
Tammy Foster hatte sich fest vorgenommen, nicht mehr zu weinen. Sie war in Tränen ausgebrochen, gleich nachdem der Angreifer sie auf dem düsteren Parkplatz des Clubs von hinten gepackt, ihr den Mund zugeklebt, die Hände auf den Rücken gebunden und sie in den Kofferraum gestoßen hatte, wo er ihr auch noch die Füße fesselte.
Starr vor Angst hatte die Siebzehnjährige gedacht: Er will nicht, dass ich ihn zu Gesicht bekomme. Das ist gut. Er will mich nicht töten.
Er will mich bloß einschüchtern.
Sie hatte sich im Kofferraum umgesehen, den baumelnden Geist entdeckt und versucht, ihn mit den Füßen packen zu können, aber er rutschte immer wieder zwischen ihren Schuhen hindurch. Tammy befand sich in guter körperlicher Verfassung, spielte Fußball und war Cheerleader. Doch aufgrund des ungünstigen Winkels konnte sie die Beine stets nur für ein paar Sekunden anheben.
Der Geist entzog sich ihr.
Das Auto fuhr weiter. Mit jedem Meter wuchs Tammy Fosters Verzweiflung. Sie fing wieder an zu weinen.
Nicht, nicht! Deine Nase wird verstopfen, und du erstickst.
Sie riss sich zusammen.
Eigentlich musste sie um Mitternacht zu Hause sein. Ihre Mutter würde sie vermissen – falls sie nicht betrunken auf der Couch lag, weil es mit ihrem aktuellen Freund irgendein Problem gab.
Ihre Schwester würde Tammys Abwesenheit bemerken müssen, sofern sie nicht im Internet oder am Telefon hing. Was natürlich der Fall war.
Pling.
Das gleiche Geräusch wie zuvor schon einmal: das Klirren von Metall, als er etwas auf die Rückbank geladen hatte.
Tammy dachte an einige Gruselfilme, die sie gesehen hatte. Brutale, abstoßende Streifen. Mit Folter und Mord. Wofür Werkzeuge benutzt wurden.
Denk an was anderes. Tammy konzentrierte sich auf den baumelnden grünen Geist der Notentriegelung.
Und vernahm ein neues Geräusch. Das Meer.
Schließlich hielten sie, und er schaltete den Motor aus.
Die Rückleuchten erloschen.
Das Auto schaukelte, als der Mann sich auf dem Fahrersitz umwandte. Was machte er da? Irgendwo in der Nähe ertönte der kehlige Ruf einer Robbe. Sie befanden sich an einem Strand, der zu dieser Nachtzeit vollkommen menschenleer sein würde.
Eine der Wagentüren ging auf und wieder zu. Eine zweite wurde geöffnet. Abermals das metallische Klirren von der Rückbank.
Folter … Werkzeuge.
Die Tür wurde lautstark zugeworfen.
Und Tammy Foster brach zusammen. Sie fing an zu schluchzen und schaffte es kaum noch, die schlechte Luft einzuatmen. »Nein, bitte, bitte!«, rief sie, obwohl die Worte durch das Klebeband erstickt wurden und wie eine Art Stöhnen klangen.
Tammy schickte ein Stoßgebet nach dem anderen zum Himmel, während sie auf das Klicken des Kofferraumdeckels wartete.
Die Wogen brachen sich. Die Robben schrien.
Sie würde sterben.
»Mama.«
Doch dann … nichts.
Der Kofferraum ging nicht auf, auch keine der Wagentüren, und es näherten sich keine Schritte. Nach drei Minuten bekam Tammy das Weinen in den Griff. Die Panik ließ nach.
Fünf Minuten vergingen, und er hatte den Kofferraum noch immer nicht geöffnet.
Zehn Minuten.
Tammy lachte leise und ungläubig auf.
Es war bloß blinder Alarm. Der Kerl würde sie nicht töten oder vergewaltigen. Jemand hatte sich einen üblen Scherz mit ihr erlaubt.
Sie verzog den Mund unter dem Klebeband sogar zu einem Lächeln, als der Wagen sich plötzlich ein winziges Stück bewegte. Das Lächeln verschwand. Der Camry schaukelte erneut in einer sanften Bewegung vor und zurück, allerdings etwas stärker als beim ersten Mal. Sie hörte ein Plätschern und erschauderte. Tammy wusste, dass eine Welle gegen das vordere Ende des Wagens geschlagen war.
O mein Gott, nein! Er hatte sie hier am Strand zurückgelassen, und nun kam die Flut!
Der Wagen sank in den Sand ein, weil das Wasser die Reifen unterspülte.
Nein! Sie hatte vor kaum etwas so viel Angst wie vor dem Ertrinken. Und davor, an einem engen Ort wie diesem festzustecken. Es war unvorstellbar. Tammy fing an, gegen den Kofferraumdeckel zu treten.
Doch natürlich war außer den Robben niemand da, der sie hätte hören können.
Das Wasser umspielte nun geräuschvoll die Seiten des Toyotas.
Der Geist …
Es musste ihr einfach irgendwie gelingen, den Entriegelungshebel zu ziehen. Tammy streifte sich mühsam die Schuhe ab und versuchte es von Neuem. Ihr Kopf drückte sich fest gegen den Teppich, und ihre Füße hoben sich quälend langsam dem schimmernden Handgriff entgegen. Sie bekam ihn zu beiden Seiten mit den Zehen zu fassen und presste die Beine so fest zusammen, dass ihre Bauchmuskeln zitterten.
Jetzt!
Mit Krämpfen in den Beinen zog sie den Geist nach unten.
Ein leises metallisches Geräusch.
Ja! Es funktionierte!
Aber dann stöhnte sie entsetzt auf. Sie hatte mit ihren Füßen den Handgriff herausgezogen, ohne den Kofferraum zu öffnen. Der grüne Geist lag nun neben ihr. Der Kerl musste das Kabel durchgeschnitten haben! Und zwar gleich nachdem er sie in den Kofferraum geworfen hatte. Der Griff hatte nur noch locker in der Öse gebaumelt, ohne weiterhin mit dem Entriegelungskabel verbunden zu sein.
Sie steckte fest.
Bitte, hilf mir doch jemand, betete Tammy erneut. Zu Gott, zu einem Passanten, sogar zu ihrem Entführer, der vielleicht doch noch etwas Mitleid mit ihr haben würde.
Aber die einzige Antwort war das ungerührte Gluckern des Salzwassers, das allmählich in den Kofferraum sickerte.
Das Peninsula Garden Hotel liegt versteckt in der Nähe des Highway 68 – jener ehrwürdigen Trasse, die ein mehr als dreißig Kilometer langes Diorama namens »Die vielen Gesichter von Monterey County« darstellt. Die Straße schlängelt sich von der Salatschüssel der Nation – Salinas – nach Westen und streift dabei das grüne Tal des Himmels, die dynamische Rennstrecke Laguna Seca, diverse Bürobauten und Firmengelände, dann das staubige Monterey und das von Kiefern und Hemlocktannen geprägte Pacific Grove. Am Ende entlässt der Highway die Fahrer – zumindest jene, die die abwechslungsreiche Strecke auf voller Länge befahren – am legendären Seventeen Mile Drive, der Heimat einer hier weitverbreiteten Spezies: Leute mit Geld.
»Nicht schlecht«, sagte Michael O’Neil zu Kathryn Dance, als sie aus seinem Wagen stiegen.
Der Blick der Frau wanderte durch eine schmale Brille mit grauem Gestell über das in einer Mischung aus spanischem und Art-déco-Stil gehaltene Haupthaus und das halbe Dutzend angrenzender Gebäude. Das Hotel besaß Klasse, wenngleich es ein wenig altmodisch und angestaubt wirkte. »Schick. Gefällt mir.«
Während sie dort standen und in der Ferne gerade so eben noch der Pazifische Ozean zu sehen war, versuchte Dance, eine Expertin für Kinesik – Körpersprache -, ihren Begleiter zu durchschauen, aber der Chief Deputy aus der Ermittlungsabteilung des Monterey County Sheriff’s Office erwies sich als harte Nuss. Der stämmige Mittvierziger mit dem grau melierten Haar war freundlich, aber still, solange er seinen Gesprächspartner nicht gut kannte. Und sogar dann blieb seine Mimik und Gestik eher sparsam. Aus kinesischer Sicht gab er nur wenig von sich preis.
Im Augenblick jedoch erkannte Dance, dass er kein bisschen nervös war, trotz des Anlasses für ihre Fahrt hierher.
Ganz im Gegensatz zu ihr selbst.
Kathryn Dance, eine schlanke Frau Mitte dreißig, hatte ihr dunkelblondes Haar heute wie so oft zu einem festen Zopf geflochten, der in einem leuchtend blauen Band endete. Ihre Tochter hatte es an jenem Morgen für sie ausgesucht und zu einer ordentlichen Schleife gebunden. Dance trug einen langen schwarzen Faltenrock sowie ein passendes Jackett über einer weißen Bluse, dazu schwarze Halbstiefel mit fünf Zentimeter hohen Absätzen. Sie hatte diese Schuhe monatelang bewundert, sich mit dem Kauf dann aber nur so lange zurückhalten können, bis sie im Preis herabgesetzt worden waren.
O’Neil hatte eine seiner drei oder vier Zivilmonturen angelegt: Stoffhose, blassblaues Hemd, keine Krawatte. Sein Sakko war dunkelblau, mit leichtem Karomuster.
Die Miene des livrierten Portiers, eines fröhlichen Latinos, schien zu besagen: Ihr seid aber ein hübsches Paar. »Willkommen. Ich hoffe, Sie werden Ihren Aufenthalt genießen.« Er öffnete ihnen die Tür.
Dance lächelte O’Neil verunsichert zu, und sie gingen durch die luftige Eingangshalle zur Rezeption.
Vom Hauptgebäude aus machten sie sich auf den Weg über das verschachtelte Hotelgelände und suchten nach dem Zimmer.
»Ich hätte nie gedacht, dass es dazu kommen würde«, sagte O’Neil zu ihr.
Dance lachte leise auf und ertappte sich belustigt dabei, dass ihr Blick sich immer wieder auf die umliegenden Türen und Fenster richtete. Es war eine kinesische Reaktion, die erkennen ließ, dass jemand unterbewusst nach einem Fluchtweg suchte, um sich einer Stresssituation zu entziehen.
»Sieh mal«, sagte sie und deutete auf einen weiteren Swimmingpool. Es schien hier insgesamt vier zu geben.
»Wie Disneyland für Erwachsene. Ich habe gehört, dass viele Rockmusiker gern hier absteigen.«
»Wirklich?« Sie runzelte die Stirn.
»Wieso denn nicht?«
»Die Häuser sind ebenerdig. Da macht es ja gar keinen Spaß, sich zuzudröhnen und Fernseher oder Möbel aus dem Fenster zu werfen.«
»Wir sind hier in Carmel«, rief O’Neil ihr ins Gedächtnis. »Hier gilt man schon als wild, wenn man den Müll nicht ordnungsgemäß trennt.«
Dance hatte eine schlagfertige Erwiderung auf der Zunge, sagte jedoch nichts. Diese Scherze machten sie nur noch nervöser.
Sie blieb neben einer Palme stehen, deren Blätter wie scharfe Klingen aussahen. »Wohin müssen wir?«
Der Deputy sah auf einen Zettel, orientierte sich und deutete auf eines der Häuser weiter hinten. »Dahin.«
Vor der Tür hielten O’Neil und Dance inne. Er atmete tief durch und zog eine Augenbraue hoch. »Ich glaube, wir sind da.«
Dance lachte. »Ich komme mir wie ein Teenager vor.«
Der Deputy klopfte an.
Es dauerte einen Moment, dann öffnete sich die Tür. Im Eingang stand ein schmaler Mann von ungefähr fünfzig Jahren mit dunkler Hose, weißem Hemd und gestreifter Krawatte.
»Michael, Kathryn. Pünktlich auf die Minute. Bitte treten Sie ein.«
Ernest Seybold, ein erfolgreicher leitender Staatsanwalt aus Los Angeles County, winkte sie herein. Im Zimmer saß eine Gerichtsstenografin neben ihrem dreibeinigen Arbeitsgerät. Eine zweite junge Frau erhob sich und begrüßte die Neuankömmlinge. Seybold stellte sie als seine Mitarbeiterin aus L. A. vor.
Dance und O’Neil hatten diesen Monat einen Fall in Monterey bearbeitet – der verurteilte Kultführer und Mörder Daniel Pell war aus der Haft entflohen und auf der Halbinsel geblieben, weil er es auf weitere Opfer abgesehen hatte. Im Zuge der Ermittlungen hatten Dance und ihre Kollegen erkennen müssen, dass es sich bei einem der Beteiligten um eine völlig andere Person handelte als anfänglich gedacht. Als Konsequenz daraus war es unter anderem zu einem weiteren Mord gekommen.
Dance wollte den Täter unbedingt zur Rechenschaft ziehen. Doch es wurde viel Druck ausgeübt, die Sache nicht weiter zu verfolgen – seitens einiger sehr mächtiger Organisationen. Dance hingegen ließ sich nicht beirren, und als die Staatsanwaltschaft von Monterey County es ablehnte, den Fall vor Gericht zu bringen, wandten sie und O’Neil sich an die Behörden in Los Angeles, denn sie hatten erfahren, dass der Täter dort früher schon gemordet hatte. Staatsanwalt Seybold, der nicht nur regelmäßig mit Dances Arbeitgeber, dem California Bureau of Investigation, zusammenarbeitete, sondern außerdem mit Dance befreundet war, willigte ein, in L. A. Anklage zu erheben.
Da manche der Zeugen sich jedoch in Monterey und Umgebung aufhielten, darunter auch Dance und O’Neil, war Seybold für einen Tag angereist, um ihre Aussagen zu Protokoll zu nehmen. Der konspirative Charakter dieses Treffens war den zahlreichen Beziehungen und dem guten Ruf des Täters geschuldet. Vorläufig wurde sogar nicht einmal der richtige Name des Mörders benutzt; intern lief der Fall als Das Volk gegen J. Doe.
»Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass es ein Problem geben könnte«, sagte Seybold, als sie sich setzten.
Das flaue Gefühl, das Dance zuvor empfunden hatte – dass etwas schiefgehen würde -, kehrte zurück.
»Die Verteidigung hat den Antrag gestellt, den Fall wegen angeblicher Immunität des Beklagten abzuweisen«, fuhr der Staatsanwalt fort. »Ich kann beim besten Willen nicht beurteilen, wie groß die Chancen dafür sind. Die Anhörung wurde für übermorgen anberaumt.«
Dance schloss die Augen. »Nein.« Neben ihr atmete O’Neil verärgert aus.
All die Mühe …
Sollte er davonkommen …, dachte Dance, bis ihr klar wurde, dass sie nichts hinzuzufügen hatte, außer: Sollte er davonkommen, dann habe ich verloren.
Sie spürte, dass ihr Unterkiefer bebte.
»Eines meiner Teams arbeitet bereits an unserer Erwiderung«, sagte Seybold dann. »Die Leute sind gut. Die besten der ganzen Behörde.«
»Strengt euch an, Ernie«, sagte Dance. »Ich will diesen Kerl. Ich will ihn um jeden Preis.«
»Das wollen viele, Kathryn. Wir tun alles, was in unserer Macht steht.«
Sollte er davonkommen …
»Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir gewinnen werden.« Er klang zuversichtlich, was Dance ein wenig beruhigte. Sie fingen an. Seybold stellte Dutzende von Fragen über das Verbrechen, sowohl über Dances und O’Neils persönliche Beobachtungen als auch über die Beweis- und Spurenlage.
Der drahtige Mann war ein erfahrener Anklagevertreter und wusste, was er tat. Nach einer Stunde gemeinschaftlicher Befragung lehnte er sich zurück und sagte, er habe fürs Erste genug gehört. Jeden Augenblick musste der nächste Zeuge eintreffen, ein hiesiger Staatspolizist, der sich ebenfalls zu einer Aussage bereitgefunden hatte.
Dance und O’Neil dankten Seybold, der versprach, ihnen das Ergebnis der Immunitätsanhörung umgehend mitzuteilen.
Auf dem Rückweg zur Lobby verlangsamte O’Neil plötzlich seinen Schritt und runzelte die Stirn.
»Was ist?«, fragte Dance.
»Lass uns schwänzen.«
»Wie meinst du das?«
Er wies auf ein wunderschönes Gartenrestaurant, von dem aus man einen Canyon und dahinter das Meer überblicken konnte. »Es ist noch früh. Wann zuletzt hat dir jemand in weißer Kellneruniform Eier Benedict serviert?«
Dance überlegte. »Welches Jahr haben wir doch gleich?«
Er lächelte. »Komm schon. Wir werden uns kaum verspäten.«
Sie sah auf die Uhr. »Ich weiß nicht.« Kathryn Dance hatte schon als Schülerin nie geschwänzt, geschweige denn als leitende Ermittlerin beim CBI.
Dann sagte sie sich: Was zögerst du? Du fühlst dich so wohl in Michaels Gesellschaft und verbringst außerhalb der Arbeit kaum Zeit mit ihm.
»Also gut.« Sie kam sich schon wieder wie ein Teenager vor, aber diesmal auf gute Weise.
Sie bekamen an einem langen Tisch am Rand der Terrasse zwei Plätze nebeneinander mit Blick auf die Hügel. Die Sonne stand niedrig am Himmel, und es war ein klarer, frischer Junimorgen.
Der Kellner – nicht in voller Uniform, aber in einem angemessen gestärkten weißen Hemd – schenkte Kaffee ein und brachte ihnen die Speisekarten. Dances Blick fiel auf die Seite, auf der das Restaurant seine berühmten Mimosas anpries, Sekt mit Orangensaft. Auf keinen Fall, dachte sie, hob den Kopf und sah, dass O’Neil soeben genau die gleiche Seite betrachtete.
Sie lachten.
»Wenn wir zur Anklageerhebung durch die Grand Jury oder zum Prozess nach Los Angeles fahren, dann gibt’s Champagner«, sagte er.
»Einverstanden.«
In dieser Sekunde klingelte O’Neils Telefon. Er las im Display die Kennung des Anrufers ab. Dance registrierte sofort, dass seine Körpersprache sich veränderte – die Schultern hoben sich leicht, die Arme rückten näher an den Körper heran, der Blick war auf einen Punkt unmittelbar hinter dem Telefon gerichtet.
Sie wusste, wer die Anruferin war, noch bevor O’Neil sie mit einem fröhlichen »Hallo, Liebling« begrüßte.
Dance entnahm dem Gespräch mit seiner Frau Anne, einer professionellen Fotografin, dass diese unerwartet bald zu einer Geschäftsreise würde aufbrechen müssen und sich bei ihrem Mann nach dessen Terminplan erkundigte.
Schließlich unterbrach O’Neil die Verbindung. Schweigend verharrten die beiden einen Moment, bis die ursprüngliche Stimmung sich wieder eingestellt hatte. Dann widmeten sie sich weiter ihren Speisekarten.
»Ja«, verkündete er. »Eier Benedict.«
Dance entschied sich für das gleiche Gericht und hielt nach dem Kellner Ausschau. Doch dann vibrierte ihr Telefon. Sie las die SMS, runzelte die Stirn, las die Nachricht erneut und merkte, dass nun ihre eigene Körpersprache eine rasche Veränderung durchlief. Ihr Herz schlug schneller, die Schultern hoben sich, ein Fuß wippte.
Sie seufzte, und anstatt den Kellner zur Bestellung heranzuwinken, bedeutete sie ihm, er möge bitte die Rechnung bringen.
Kapitel 3
Die Dienststelle des California Bureau of Investigation für den Westen von Zentralkalifornien war in einem unauffälligen modernen Gebäude untergebracht, das genauso aussah wie die der umliegenden Versicherungsgesellschaften und Software-Beratungsfirmen, allesamt sorgfältig hinter Hügeln versteckt und mit der reichhaltigen Vegetation dieses Landstrichs geschmückt.
Das Peninsula Garden Hotel lag nicht weit entfernt, sodass Dance und O’Neil nach weniger als zehn Minuten beim CBI eintrafen, wobei sie zwar auf den Verkehr, aber weder auf rote Ampeln noch auf Stoppschilder Rücksicht nahmen.
Dance stieg aus dem Wagen, hängte sich die Handtasche über die Schulter und nahm ihre zum Bersten gefüllte Computertasche – die von ihrer Tochter »Moms Handtaschen-Annex« getauft worden war, nachdem das Mädchen gelernt hatte, was Annex bedeutete. Dann gingen sie und O’Neil hinein.
Drinnen steuerten sie sofort Kathryns Büro an, wo – wie sie wusste – ihr Team sich bereits versammelt haben würde. Der Raum lag in dem Teil des Gebäudes, der allgemein als der »Mädchenflügel«, oder kurz: »MF«, bezeichnet wurde, weil hier ausschließlich Frauen untergebracht waren: Dance, ihre Kollegin Connie Ramirez, die gemeinsame Assistentin Maryellen Kresbach und Grace Yuan, die Büroleiterin des CBI, die den Laden mit der Präzision eines Uhrwerks am Laufen hielt. Der Name des Flurs ging auf den unglückseligen Kommentar eines gleichermaßen unglückseligen und inzwischen ehemaligen CBI-Agenten zurück, der versucht hatte, mit der vermeintlich schlauen Bemerkung Eindruck bei einer jungen Frau zu schinden, die er in der Zentrale herumführte.
Alle im MF waren sich bis heute unschlüssig, ob er – oder eine seiner Verabredungen – jemals sämtliche Produkte zur weiblichen Intimhygiene gefunden hatte, die von Dance und Ramirez in seinem Büro, Aktenkoffer und Wagen platziert worden waren.
Dance und O’Neil begrüßten nun Maryellen. Die fröhliche und unentbehrliche Frau schaffte es mühelos, gleichzeitig ihre Familie und das Berufsleben ihrer Schutzbefohlenen zu managen, ohne auch nur mit einer ihrer dunkel getuschten Wimpern zu zucken. Außerdem war sie die beste Bäckerin, die Dance je gekannt hatte. »Guten Morgen, Maryellen. Wie ist der Stand der Dinge?«
»Hallo, Kathryn. Bedienen Sie sich.«
Dance musterte die Schokoladenkekse in dem Glas auf dem Schreibtisch der Frau, wurde aber nicht schwach. Diese Dinger mussten eine biblische Sünde sein. O’Neil hingegen hielt sich nicht zurück. »Das beste Frühstück, das ich seit Wochen bekommen habe.«
Eier Benedict …
Maryellen lachte erfreut auf. »Okay, ich habe Charles ein weiteres Mal angerufen und noch eine Nachricht hinterlassen. Ehrlich.« Sie seufzte. »Er ist nicht ans Telefon gegangen. TJ und Rey sind drinnen. Ach, Deputy O’Neil, einer Ihrer Leute vom MCSO ist auch hier.«
»Danke. Sie sind ein Schatz.«
In Dances Büro saß der drahtige junge TJ Scanlon auf ihrem Platz. Der rothaarige Agent sprang auf. »Hallo, Boss. Wie war das Vorsingen?«
Er meinte die Zeugenaussage.
»Ich war ein Star.« Dann erzählte sie den Anwesenden von der bevorstehenden Immunitätsanhörung.
TJs Miene verfinsterte sich. Auch er hatte den Täter gekannt und war mit fast der gleichen Verbissenheit wie Dance auf einen Schuldspruch aus.
Scanlon beherrschte seinen Job, stellte aber den wohl unkonventionellsten Vertreter dieser Strafverfolgungsbehörde dar, die im Hinblick auf ihre Methoden und ihr Auftreten für gewöhnlich als überaus konservativ galt. Heute trug er Jeans, ein Polohemd und ein kariertes Sakko – Madras, ein Muster, das Dance ansonsten nur von einigen verblichenen Hemden in der Abstellkammer ihres Vaters kannte. Soweit sie wusste, besaß TJ eine einzige Krawatte, und zwar ein exotisches Jerry-Garcia-Modell. Der Mann litt an akuter Sechzigerjahre-Nostalgie. In seinem Büro blubberten zwei Lavalampen vergnügt vor sich hin.
Dance und er lagen nur wenige Jahre auseinander, aber zwischen ihnen klaffte ein Generationsunterschied. Dennoch passten sie beruflich gut zusammen, wobei ihr Verhältnis bisweilen dem zwischen einer Mentorin und ihrem Schützling ähnelte. Obwohl TJ normalerweise allein arbeitete, was beim CBI nicht gern gesehen wurde, war er vorübergehend für Dances eigentlichen Partner eingesprungen, der nach wie vor mit einem komplizierten Auslieferungsfall in Mexiko zu tun hatte.
Der stille Rey Carraneo, ein Neuzugang beim CBI, schien auf den ersten Blick das genaue Gegenteil von TJ Scanlon zu sein. Er war Ende zwanzig, schlank, mit dunklen, nachdenklichen Gesichtszügen, und trug heute einen grauen Anzug samt weißem Hemd. Im Herzen war er älter als an Jahren, denn er hatte als Streifenpolizist in der Cowboystadt Reno, Nevada, gearbeitet, bevor er wegen seiner kranken Mutter mit seiner Frau hergezogen war. Carraneo hielt einen Kaffeebecher in der Hand; in der Beuge zwischen Daumen und Zeigefinger hatte er eine winzige Narbe, wo vor nicht allzu vielen Jahren eine Bandentätowierung gewesen war. Dance hielt Carraneo für den ruhigsten und umsichtigsten der jungen Beamten der Behörde und fragte sich manchmal, ganz im Stillen, ob seine Erfahrungen aus der Bandenzeit wohl zu seiner Gelassenheit und seiner steten Aufmerksamkeit beitrugen.
Der Deputy vom Monterey County Sheriff’s Office – mit typischem Bürstenschnitt und militärischer Haltung – stellte sich vor und erläuterte, was geschehen war. Man hatte letzte Nacht eine einheimische Jugendliche von einem Parkplatz in der Innenstadt von Monterey unweit der Alvarado Street entführt. Tammy Foster war gefesselt und in den Kofferraum ihres eigenen Wagens geworfen worden. Dann hatte der Angreifer sie zu einem Strand außerhalb der Stadt gefahren und dort zurückgelassen, damit sie in der ansteigenden Flut ertrinken würde.
Dance erschauderte bei dem Gedanken, wie es sich angefühlt haben musste, verkrampft und frierend dazuliegen, während das Wasser in den engen Kofferraum eindrang.
»Es war ihr Auto?«, fragte O’Neil, der auf den Hinterbeinen seines Stuhls vor und zurück kippelte. Das Holz ächzte unter seinem Gewicht. (Dance hatte ihrem Sohn verboten, das zu tun. Sie vermutete, dass Wes sich diese Angewohnheit bei O’Neil abgeschaut hatte.)
»Ganz recht, Sir.«
»Welcher Strand?«
»Ein Stück die Küste hinunter, südlich der Highlands.«
»Abgelegen?«
»Ja, menschenleer. Keine Zeugen.«
»Gab es welche bei dem Club, wo sie entführt wurde?«, fragte Dance.
»Negativ. Und der Parkplatz hat keine Überwachungskameras.«
Dance und O’Neil überlegten.
»Er muss in der Nähe des Strandes ein anderes Fahrzeug gehabt haben«, sagte sie dann. »Oder es gab einen Komplizen.«
»Die Spurensicherung hat ein paar Fußabdrücke gefunden, die in Richtung des Highways verlaufen. Oberhalb der Flutzone. Der Sand war sehr locker, sodass man weder das Sohlenprofil noch die Schuhgröße feststellen konnte, aber es hat sich definitiv nur um eine einzige Person gehandelt.«
»Kein Hinweis auf einen Wagen, der von der Straße abgebogen sein könnte, um ihn aufzusammeln?«, fragte O’Neil. »Oder der irgendwo in der Nähe im Gebüsch versteckt war?«
»Nein, Sir. Unsere Leute haben Spuren eines Fahrrades gefunden, aber die waren auf dem Seitenstreifen. Vielleicht von letzter Nacht, vielleicht schon eine Woche alt. Das Reifenprofil lässt sich nicht näher zuordnen.« Er sah Dance an. »Eine Datenbank für Fahrräder haben wir nämlich nicht«, erklärte er.
In der fraglichen Gegend fuhren jeden Tag Hunderte von Leuten mit ihren Fahrrädern am Strand entlang.
»Das Motiv?«
»Weder Raub noch Vergewaltigung. Wie es aussieht, wollte er sie einfach nur umbringen. Langsam.«
Dance atmete geräuschvoll aus.
»Gibt es Verdächtige?«
»Nein.«
Sie schaute zu TJ. »Und was ist mit dem, was du mir bei meinem Anruf erzählt hast? Dem unheimlichen Teil? Gibt’s dazu schon was Neues?«
»Oh«, sagte der zappelige junge Agent. »Du meinst das Kreuz am Straßenrand.«
Das California Bureau of Investigation hat einen umfassenden Zuständigkeitsbereich, wird für gewöhnlich aber nur bei Kapitalverbrechen eingeschaltet, zum Beispiel in Fällen von Bandenkriminalität, Terrordrohungen und bedeutsamen Korruptions- oder Wirtschaftsstraftaten. Ein einzelner Mord in einer Gegend, in der pro Woche mindestens ein Gangmitglied erschossen wird, würde normalerweise keine besondere Aufmerksamkeit erregen.
Doch beim Überfall auf Tammy Foster war das anders.
Tags zuvor hatte ein Staatspolizist am Rand des Highway 1 ein Kreuz gefunden, wie zum Gedenken an ein Unfallopfer und versehen mit dem Datum des folgenden Tages.
Als der Beamte von der Entführung erfuhr, die unweit desselben Highways vonstattengegangen war, fragte er sich, ob das Kreuz wohl eine Art Vorankündigung der Absichten des Täters darstellte. Er kehrte zu der Fundstelle zurück und sammelte alles ein. Die Spurensicherung des Monterey County Sheriff’s Office fand in dem Kofferraum, in dem man Tammy zum Sterben zurückgelassen hatte, das winzige Fragment eines Rosenblütenblatts – das mit den Rosen übereinstimmte, die bei dem Kreuz gelegen hatten.
Da der Überfall nach jetzigem Stand der Erkenntnisse wahllos und ohne ersichtliches Motiv erfolgt zu sein schien, musste Dance die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass der Täter sich weitere Opfer suchen würde.
»Wurden an dem Kreuz irgendwelche Spuren gesichert?«, fragte O’Neil nun.
Sein Kollege verzog das Gesicht. »Ehrlich gesagt, der Trooper von der Highway Patrol hat das Kreuz und die Blumen einfach in seinen Kofferraum geworfen, Deputy O’Neil.«
»Das Material wurde verunreinigt?«
»Ich fürchte, ja. Deputy Bennington hat gesagt, er habe alles in seiner Macht Stehende getan.« Peter Bennington war der fähige und gewissenhafte Leiter des Kriminallabors von Monterey County. »Aber er hat nichts gefunden. Jedenfalls nicht laut seinem vorläufigen Bericht. Die einzigen Fingerabdrücke stammen von dem Trooper. Außer Sand und Erde gab es keinerlei Partikel. Das Kreuz wurde aus den Zweigen eines Baumes und Blumendraht gefertigt. Das Schild mit dem Datum darauf sieht so aus, als wäre es aus einem größeren Stück Pappe ausgeschnitten worden. Die Tinte ist handelsüblich, die Ziffern und Buchstaben in Blockschrift geschrieben. Das hilft uns nur weiter, falls wir es mit der Schriftprobe eines Verdächtigen vergleichen können. Hier ist übrigens ein Foto des Kreuzes. Das Ding sieht ganz schön unheimlich aus. Wie aus Blair Witch Project, Sie wissen schon.«
»Guter Film«, sagte TJ, und Dance wusste nicht, ob das als Scherz gemeint war oder nicht.
Sie sahen sich das Foto an. Das Kreuz wirkte tatsächlich unheimlich; die Äste erinnerten an verdrehte schwarze Knochen.
Die Spurensicherung konnte ihnen keinerlei Informationen liefern. Dance kannte einen Fachmann, mit dem sie vor nicht allzu langer Zeit zusammengearbeitet hatte, Lincoln Rhyme, ein privater forensischer Berater in New York City. Ungeachtet seiner Querschnittslähmung galt er als einer der besten Tatortspezialisten des Landes. Sie fragte sich, ob er anstelle von Bennington wohl etwas Hilfreiches gefunden hätte. Vermutlich ja. Doch die vielleicht grundlegendste Regel der Polizeiarbeit lautete: Du musst dich mit dem begnügen, was du hast.
Ihr fiel etwas auf dem Foto auf. »Die Rosen.«
O’Neil begriff, was sie meinte. »Die Stängel sind auf gleicher Länge abgeschnitten.«
»Richtig. Also stammen sie wahrscheinlich aus einem Geschäft, nicht aus irgendeinem Garten.«
»Aber, Boss«, wandte TJ ein, »man kann an ungefähr tausend Orten auf der Halbinsel Rosen kaufen.«
»Ich behaupte ja auch nicht, dass wir dadurch direkt zum Täter geführt werden«, sagte Dance. »Ich meine nur, dass diese Information eventuell noch nützlich sein könnte. Und zieh keine voreiligen Schlüsse. Womöglich wurden die Blumen ja gestohlen.« Sie war schlecht gelaunt und hoffte, dass man es ihr nicht anmerkte.
»Alles klar, Boss.«
»Wo genau hat dieses Kreuz gestanden?«
»Am Highway Eins. Unmittelbar südlich von Marina.« An der Wand hing eine Landkarte. Der Beamte zeigte auf die entsprechende Stelle.
»Hat jemand gesehen, wie das Kreuz aufgestellt wurde?«, fragte Dance den Deputy.
»Nein, Ma’am, jedenfalls nicht laut der CHP. Und auf diesem Teilstück des Highways gibt es keine Kameras. Wir suchen weiter.«
»Was ist mit den Läden?«, fragte O’Neil, als Dance Luft holte, um genau die gleiche Frage zu stellen.
»Den Läden?«
O’Neil schaute auf die Karte. »Auf der Ostseite der Fahrbahn. In diesen Einkaufspassagen. Manche der Geschäfte haben Überwachungskameras. Vielleicht war eine auf die fragliche Stelle gerichtet. Wir könnten zumindest die Marke und das Modell seines Wagens erfahren – falls er mit einem Wagen unterwegs war.«
»TJ«, sagte Dance. »Kümmere dich darum.«
»Mach ich, Boss. Da gibt es ein gutes Java House. Einer meiner Lieblingskaffeeläden.«
»Das freut mich für dich.«
Ein Schatten erschien im Eingang. »Ah. Ich wusste nicht, dass wir uns hier treffen wollten.«
Charles Overby, der kürzlich ernannte Leiter dieser CBI-Dienststelle, trat ein. Er war Mitte fünfzig und sonnengebräunt. Trotz seiner birnenförmigen Statur war er sportlich genug, um sich mehrmals wöchentlich auf Golf- oder Tennisplätze zu wagen, wenngleich jeder längere Ballwechsel ihm den Atem raubte.
»Ich bin schon seit … na ja, einer ganzen Weile in meinem Büro.«
Dance ignorierte TJs verstohlenen Blick auf die Uhr. Sie nahm an, dass Overby erst vor wenigen Minuten eingetroffen war.
»Charles«, sagte sie. »Guten Morgen. Ich habe womöglich vergessen, den Ort zu erwähnen. Entschuldigung.«
»Hallo, Michael.« Dann ein Nicken in TJs Richtung, den Overby mitunter neugierig musterte, als hätte er ihn noch nie zuvor gesehen – obwohl er damit vielleicht einfach nur sein Missfallen über TJs Modegeschmack zum Ausdruck bringen wollte.
Dance hatte Overby sehr wohl von der Besprechung in Kenntnis gesetzt. Auf der Fahrt vom Peninsula Garden Hotel zum CBI hatte sie ihm eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen, dabei die beunruhigende Neuigkeit erwähnt, dass es in Los Angeles eine Immunitätsanhörung geben würde, und ihm die Zusammenkunft in ihrem Büro angekündigt. Auch Maryellen hatte ihn wegen des Treffens angerufen. Aber der CBI-Chef war nicht ans Telefon gegangen. Dance hatte sich nicht die Mühe gemacht, es weiter zu versuchen, da Overby sich meistens kaum für die taktische Seite der Ermittlungen interessierte. Sie wäre nicht überrascht gewesen, wenn er die Teilnahme an der Besprechung sogar unumwunden abgelehnt hätte. Er wolle die Dinge lieber in ihrer »Gesamtheit« betrachten, so seine Lieblingsfloskel der letzten Zeit. (TJ hatte ihn deswegen mal als Charles Overview bezeichnet, woraufhin Dance lachen musste, bis ihr der Bauch wehtat.)
»Also gut. Diese Mädchen-im-Kofferraum-Sache … die Reporter rufen mich bereits an. Bislang habe ich Ausflüchte gemacht. Die hassen das. Was ist der letzte Stand?«
Ah, Reporter. Das erklärte sein Interesse.
Dance berichtete ihm, was sie zum jetzigen Zeitpunkt wussten und was sie vorhatten.
»Glauben Sie, er wird es noch mal versuchen? In den Nachrichten wenigstens geht man davon aus.«
»Man spekuliert dort«, korrigierte Dance vorsichtig.
»Da wir nicht wissen, aus welchem Grund er Tammy Foster überfallen hat, können wir dazu keine Einschätzung geben«, sagte O’Neil.
»Und das Kreuz hängt damit zusammen? Es war als Botschaft gedacht?«
»Die Blumen stimmen laut Spurensicherung überein, ja.«
»Autsch. Ich hoffe nur, das hier wird kein zweiter Summer of Sam.«
»Äh … was meinen Sie damit, Charles?«, fragte Dance.
»Diesen Kerl in New York. Der Nachrichten hinterlassen und Leute erschossen hat.«
»Oh, Summer of Sam hieß der Film. Von Spike Lee.« TJ war ein wandelndes Lexikon der populären Kultur. »Der Killer hieß Son of Sam.«
»Ich weiß«, versicherte Overby sogleich. »Es sollte eine Anspielung sein. Weil wir doch gerade Sommeranfang hatten.«
»Uns liegen zurzeit weder Hinweise auf das eine noch auf das andere vor. Genau genommen wissen wir noch überhaupt nichts.«
Overby nickte. Es gefiel ihm nicht, keine Antworten zu haben. Für die Presse, für seine Bosse in Sacramento. Er war dann immer gereizt, und das wiederum führte dazu, dass auch alle anderen gereizt waren. Der frühere Leiter Stan Fishburne hatte aus gesundheitlichen Gründen unerwartet schnell in den vorzeitigen Ruhestand gehen müssen. Als Overby zu seinem Nachfolger ernannt wurde, herrschte allgemeine Bestürzung. Fishburne hatte seinen Leuten stets den Rücken gestärkt und es zu ihrer Unterstützung mit jedem beliebigen Gegner aufgenommen. Overby war da anders. Ganz anders.
»Auch der AG hat sich schon bei mir gemeldet.« Ihr oberster Chef, der Generalstaatsanwalt. »Die Geschichte ist in Sacramento in den Nachrichten gelaufen. Genau wie bei CNN. Ich muss ihn zurückrufen. Wenn wir doch nur schon irgendetwas Genaueres sagen könnten.«
»Wir dürften bald mehr wissen.«
»Wie groß ist die Chance, dass es sich bloß um einen misslungenen Streich gehandelt hat? Vielleicht um das Aufnahmeritual einer Studentenverbindung? Das haben wir doch auf dem College alle mal mitgemacht, oder?«
Dance und O’Neil hatten keiner Verbindung angehört. Bei TJ hatte sie in dieser Hinsicht ebenfalls Zweifel, und Rey Carraneo hatte seinen Bachelor in Strafrecht durch Abendkurse erworben und tagsüber in zwei Jobs gearbeitet.
»Ziemlich heftig für einen Streich«, sagte O’Neil.
»Nun, lassen Sie es uns als eine Möglichkeit im Hinterkopf behalten. Ich möchte lediglich sichergehen, dass wir keine Panik schüren. Damit wäre niemandem geholfen. Wirken Sie Spekulationen über einen etwaigen Serientäter möglichst entgegen. Und erwähnen Sie das Kreuz nicht. Der Fall Pell hat uns diesen Monat schon genug zugesetzt.« Er sah Dance an. »Übrigens, wie ist denn Ihre Zeugenaussage gelaufen?«
»Der Fall verzögert sich.« Hatte er ihrer Nachricht denn überhaupt nicht zugehört?
»Das ist gut.«
»Gut?« Dance war immer noch wütend über den Abweisungsantrag.
Overby blinzelte nervös. »Ich meine, es verschafft Ihnen Luft, um diesen Kreuz-Fall zu bearbeiten.«
Sie dachte an ihren alten Chef. So also fühlte echte Sehnsucht sich an.
»Was sind die nächsten Schritte?«, fragte Overby.
»TJ kontrolliert die Überwachungskameras der Geschäfte und Autohändler in der Nähe der Fundstelle des Kreuzes.« Sie wandte sich an Carraneo. »Und Rey, könnten Sie sich in der Gegend des Parkplatzes umsehen, auf dem Tammy entführt wurde?«
»Ja, Ma’am.«
»Michael, woran arbeiten Sie beim MCSO gerade?«, fragte Overby.
»Ich leite die Ermittlungen in einem Bandenmord. Und dann ist da noch der Container-Fall.«
»Ach, der.«
Die Halbinsel war von Terrordrohungen bisher weitgehend verschont geblieben. Es gab hier keine großen See-, sondern nur Fischereihäfen, und der Flughafen war klein und gut gesichert. Vor etwa einem Monat hatte man jedoch einen Container von Bord eines in Oakland ankernden indonesischen Frachtschiffes geschmuggelt und ihn per Lastwagen nach Süden in Richtung Los Angeles geschickt. Es deutete manches darauf hin, dass die Fracht in Salinas ausgeladen, versteckt und dann zum Weitertransport auf andere Laster verteilt worden war.
Bei dieser Fracht konnte es sich um reguläre Schmuggelware wie Drogen oder Waffen gehandelt haben … oder, wie ein anderer glaubwürdiger Geheimdienstbericht nahelegte, um Personen, die auf diese Weise unbemerkt ins Land gelangt waren. In Indonesien lebte die größte islamische Bevölkerung der Welt, und es gab dort eine Reihe gefährlicher radikaler Gruppierungen. Die amerikanische Heimatschutzbehörde war daher verständlicherweise beunruhigt.
»Aber ich kann das für ein oder zwei Tage zurückstellen«, fügte O’Neil hinzu.
»Gut«, sagte Overby erleichtert, weil der Kreuz-Fall damit von zwei Behörden bearbeitet wurde. Er war stets darauf bedacht, das Risiko eines Fehlschlags der Ermittlungen möglichst breit zu verteilen, auch wenn das hieß, den eventuellen Ruhm ebenfalls teilen zu müssen.
Dance war einfach nur froh, dass sie und O’Neil zusammenarbeiten würden.
»Ich besorge uns von Peter Bennington den Abschlussbericht der Spurensicherung«, sagte O’Neil.
Der gründliche, beharrliche Cop war nicht als Kriminaltechniker ausgebildet, aber er verließ sich bei seiner Arbeit am liebsten auf traditionelle Verfahren: Nachforschungen, Befragungen und Tatortuntersuchungen. Gelegentlich auch mit robusten Mitteln. Dessen ungeachtet leistete er einfach gute Arbeit. Er konnte eine der höchsten Verhaftungs- und – noch wichtiger – Verurteilungsquoten in der Geschichte des MCSO vorweisen.
Dance sah auf die Uhr. »Und ich vernehme die Zeugin.«
Overby benötigte einen Moment. »Zeugin? Ich wusste gar nicht, dass es eine gibt.«
Dance verriet ihm nicht, dass sie ihm auch diese Information in ihrer Nachricht hinterlassen hatte. »Doch, es gibt eine«, sagte sie, schwang sich die Handtasche über die Schulter und verließ das Büro.
Kapitel 4
»Oh, wie traurig«, sagte die Frau.
Ihr Mann am Steuer des Geländewagens, den er soeben für siebzig Dollar vollgetankt hatte, schaute zu ihr hinüber. Er war sauer. Wegen der Benzinpreise und weil er gerade erst einen quälend langen Blick auf den Golfplatz von Pebble Beach geworfen hatte, auf dem zu spielen er sich nicht leisten konnte, selbst wenn seine Frau es ihm erlaubt hätte.
Wenn er jetzt eines ganz gewiss nicht hören wollte, dann etwas Trauriges.
Dennoch, sie waren seit zwanzig Jahren verheiratet … Also fragte er: »Was denn?« Vielleicht ein wenig barscher als beabsichtigt.
Sie bemerkte den Tonfall nicht oder störte sich nicht daran. »Das da.«
Er sah nach vorn, aber sie schien lediglich die leere Straße zu betrachten, die sich durch den Wald schlängelte. Ihr ausgestreckter Finger zeigte auf nichts Bestimmtes. Das ärgerte ihn nur noch mehr.
»Was da wohl geschehen ist?«
»Wovon redest du bloß?«, wollte er sie anfahren, aber dann sah er, was sie meinte.
Und bekam sofort ein schlechtes Gewissen.
Dort im Sand etwa dreißig Meter voraus befand sich eine dieser Gedenkstätten am Ort eines Verkehrsunfalls. Es war ein Kreuz, ein ziemlich primitives Ding, und vor ihm lagen ein paar Blumen. Dunkelrote Rosen.
»Ja, das ist traurig«, bestätigte er und musste an ihre Kinder denken – zwei Teenager, um die er sich immer noch schreckliche Sorgen machte, sobald sie sich ins Auto setzten. Er wusste, wie er sich fühlen würde, falls ihnen bei einem Unfall etwas zustoßen sollte. Seine anfängliche Schroffheit tat ihm leid.
Er schüttelte den Kopf und warf einen Blick auf die bekümmerte Miene seiner Frau. Sie fuhren an dem handgefertigten Kreuz vorbei. »Mein Gott«, flüsterte sie. »Es ist eben erst passiert.«
»Wirklich?«
»Ja. Auf dem Schild steht das Datum von heute.«
Er erschauderte und fuhr weiter. Sie wollten zu einem nahen Strand, den ihnen jemand wegen seiner Spazierwege empfohlen hatte. »Irgendwie seltsam«, sagte er.
»Was denn, Liebling?«
»Hier darf man nur fünfzig fahren. Man sollte doch meinen, dass das für einen tödlichen Unfall nicht ausreicht.«
Seine Frau zuckte die Achseln. »Es waren wahrscheinlich junge Leute. Vielleicht betrunken.«
Das Kreuz rückte alles wieder ins rechte Licht. Komm schon, Kumpel, du könntest jetzt in Portland über deinen Verkaufszahlen schwitzen und dich fragen, welchen Wahnsinn Leo sich als nächste Zielvorgabe ausgedacht hat. Stattdessen bist du hier im schönsten Teil von Kalifornien und hast noch fünf Tage Urlaub vor dir. Das Par von Pebble Beach würdest du in einer Million Jahren nicht schaffen, bei keinem einzigen Loch. Also hör auf zu jammern.
Er legte seiner Frau die Hand auf das Knie und setzte den Weg zum Strand fort. Es störte ihn nicht mal mehr, dass ein Nebel den Morgen plötzlich in einen grauen Schleier gehüllt hatte.
Dance fuhr den Highway 68 entlang, den Holman Highway, und rief ihre Kinder an, die von Kathryns Vater Stuart derzeit ins Tennis- beziehungsweise Musiklager gebracht wurden. Wegen des frühen Treffens im Hotel hatte Dance dafür gesorgt, dass Wes und Maggie – zwölf und zehn – bei ihren Großeltern übernachteten.
»Hallo, Mom!«, sagte Maggie. »Können wir heute Abend bei Rosie’s essen?«
»Mal sehen. Ich habe einen wichtigen Fall.«
»Oma und ich haben gestern Abend Spaghetti selbst gemacht. Aus Mehl, Eiern und Wasser. Opa hat gesagt, wir sind echte Pastabäcker. Wieso?«
»Weil ihr eure Nudeln selbst herstellt und sie nicht fertig in der Schachtel kauft.«
»Quatsch, das weiß ich doch. Aber gebacken haben wir sie nicht.«
»Sag nicht ›quatsch‹. Und ich weiß es nicht. Vielleicht wollte er auf Pizzabäcker anspielen. Frag ihn doch selbst.«
»Okay.«
»Bis bald, mein Schatz. Ich hab dich lieb. Und jetzt gib mir bitte deinen Bruder.«
»He, Mom.« Wes hielt ihr einen Monolog über das für heute geplante Tennismatch.
Dance nahm an, dass ihr Sohn unmittelbar an der Schwelle zur Pubertät stand. Manchmal war er noch ihr kleiner Junge, manchmal schon ein distanzierter Teenager. Sein Vater war vor zwei Jahren ums Leben gekommen, und erst jetzt schien Wes die Last dieses Kummers abstreifen zu können. Maggie war zwar jünger, aber belastbarer als er.
»Hat Michael immer noch vor, am Wochenende mit seinem Boot rauszufahren?«
»Bestimmt.«
»Super!« O’Neil hatte den Jungen für nächsten Samstag zum Angeln eingeladen, gemeinsam mit Michaels Sohn Tyler. Seine Frau Anne fuhr so gut wie nie auf dem Boot mit, und wenngleich Dance sich gelegentlich dazu durchrang, machte die Seekrankheit ihr jedes Mal schwer zu schaffen.
Sie sprach nun zum Abschluss noch kurz mit ihrem Vater, bedankte sich für die Betreuung der Kinder und erwähnte, dass der neue Fall recht zeitaufwendig zu werden drohte. Stuart Dance war der perfekte Großvater – der pensionierte Meeresbiologe konnte sich die Zeit frei einteilen und verbrachte sie liebend gern in Gesellschaft seiner Enkel. Und es störte ihn auch nicht, den Chauffeur zu spielen. Er hatte heute zwar ein Treffen im Monterey Bay Aquarium, versicherte seiner Tochter aber, er werde die Kinder am Nachmittag zu ihrer Großmutter bringen. Dance würde sie später von dort abholen.
Wie jeden Tag dankte Kathryn auch heute wieder dem Schicksal oder den Göttern, dass sie von ihrer Familie so liebevoll unterstützt wurde. Sie empfand tiefes Mitgefühl mit allen alleinerziehenden Müttern, die nicht so viel Glück hatten.
Nun wurde sie langsamer, bog an der Ampel ab und fuhr auf den Parkplatz des Monterey Bay Hospital. Hinter einer Reihe hölzerner blauer Absperrungen stand eine Gruppe von Menschen.
Es waren mehr Demonstranten als gestern.
Und gestern waren es bereits mehr als vorgestern gewesen.
Das MBH war eine berühmte Einrichtung, eines der besten medizinischen Zentren der Region und zudem eines der idyllischsten, denn es lag in einem Kiefernwald. Dance kannte das Krankenhaus gut. Sie hatte hier ihre Kinder zur Welt gebracht. Sie hatte hier am Bett ihres Vaters gesessen, als der sich von einer schweren Operation erholen musste. Und sie hatte hier in der Leichenhalle ihren toten Ehemann identifiziert.
Kürzlich war sie hier von jemandem angegriffen worden. Die Protestaktion, die Dance nun sah, stand mit diesem Zwischenfall in Zusammenhang.
Im Zuge des Falls Daniel Pell hatte Dance im Bezirksgericht von Salinas einen jungen Deputy des Sheriff’s Office zur Bewachung des Gefangenen geschickt. Pell war es dennoch gelungen, gewaltsam die Flucht zu ergreifen. Der Deputy namens Juan Millar hatte dabei großflächige Brandwunden erlitten und war auf die hiesige Intensivstation gebracht worden. Es folgte eine unglaublich schwere Zeit – für seine verwirrte, besorgte Familie, für Michael O’Neil und für seine Kollegen beim MCSO. Auch für Dance.
Zwei Tage später war Juan tot, und sein verstörter Bruder Julio, der Dance die Schuld daran gab, ging auf sie los. Dance trug durch den Angriff eher einen Schreck als wirkliche Verletzungen davon und beschloss, keine Anzeige zu erstatten.
Zunächst nahmen alle an, Juan sei an seinen schweren Verbrennungen gestorben. Dann jedoch wurde festgestellt, dass jemand ihn von seinem Leid erlöst hatte – durch aktive Sterbehilfe.
Juans Tod machte Dance traurig, aber die Verletzungen des Mannes waren so gravierend gewesen, dass sein restliches Leben aus nichts als Schmerz und endlosen medizinischen Behandlungen bestanden hätte. Auch Dances Mutter Edie, die hier als Krankenschwester arbeitete, war der Fall zu Herzen gegangen. Kathryn wusste noch, wie sie im Wohnzimmer neben ihrer Mutter gestanden und Edie sich ihr anvertraut hatte: Als sie neben Juans Bett stand, war der Mann kurz zu Bewusstsein gekommen und hatte sie flehentlich angestarrt.
Dann hatte er geflüstert: »Tötet mich.«
Wahrscheinlich hatte er diese Bitte gegenüber jeder Person geäußert, die ihn besuchte oder nach ihm sah.
Wenig später hatte jemand ihm den Wunsch erfüllt.
Niemand wusste, wer die Medikamente in die Infusionslösung gemischt hatte, um Juans Leben zu beenden. Der Todesfall galt nun offiziell als Straftat, und das Monterey County Sheriff’s Office leitete die Ermittlungen. Allerdings ging man dort nicht besonders hartnäckig zu Werke; mehrere Ärzte hatten ausgesagt, die Lebenserwartung des Deputy habe höchstens noch ein oder zwei Monate betragen. Sein Tod war eindeutig ein Akt der Menschlichkeit, wenn auch gesetzwidrig.
Aber er erwies sich als gefundenes Fressen für alle Gegner der Sterbehilfe. Die Demonstranten, die Dance nun auf dem Parkplatz beobachtete, hielten Bilder von Kreuzen, von Jesus und von Terri Schiavo hoch, der Komapatientin aus Florida, mit deren Fall sogar der amerikanische Kongress befasst gewesen war.
Die Transparente vor dem Monterey Bay Hospital beschworen die Schrecken von Euthanasie und – offenbar weil alle sowieso gerade hier und in der passenden Stimmung waren – Abtreibung. Die meisten der Demonstranten gehörten Life First an, einer Organisation aus Phoenix. Sie waren wenige Tage nach dem Tod des jungen Beamten angereist.
Dance fragte sich, ob auch nur einem von ihnen die Ironie der Situation bewusst war, dass jemand ausgerechnet vor einem Krankenhaus gegen den Tod protestierte. Vermutlich nicht. Diese Leute wirkten nicht so, als hätten sie einen Sinn für Humor.
Dance begrüßte den Leiter des Sicherheitsdienstes, einen hochgewachsenen Afroamerikaner, der vor dem Haupteingang stand. »Guten Morgen, Henry. Wie es aussieht, werden es immer mehr.«
»Guten Morgen, Agent Dance.« Henry Bascomb, ein ehemaliger Cop, mochte es, die Leute mit ihrem Dienstrang anzusprechen. Er lächelte gequält und wies auf die Demonstranten. »Wie die Karnickel.«
»Wer ist der Anführer?«
Inmitten der Menge befand sich ein hagerer Mann mit schütterem Haar und Kehllappen unter dem spitzen Kinn. Er trug das Gewand eines Geistlichen.
»Der Pfarrer, das ist der Chef«, sagte Bascomb. »Reverend R. Samuel Fisk. Er ist ziemlich bekannt. Ist den ganzen weiten Weg aus Arizona hergekommen.«
»R. Samuel Fisk. Ein klangvoller Name für einen Gottesmann«, merkte sie an.
Neben dem Reverend stand ein stämmiger Mann mit lockigem rotem Haar und dunklem Anzug. Ein Leibwächter, schätzte Dance.
»Das Leben ist heilig!«, schrie jemand in Richtung eines der Übertragungswagen, die in der Nähe geparkt waren.
»Heilig!«, wiederholte die Menge.
»Mörder«, rief Fisk mit einer für eine solche Vogelscheuche überraschend volltönenden Stimme.
Obwohl die Bemerkung nicht an sie gerichtet war, verspürte Dance ein Frösteln und musste an den Zwischenfall auf der Intensivstation denken, als der vor Wut schäumende Julio Millar sie von hinten gepackt hatte, sodass Michael O’Neil und ein anderer Begleiter eingreifen mussten.
»Mörder!«
Die Demonstranten griffen die Parole auf. »Mör-der, Mör-der!« Dance nahm an, dass sie alle im Laufe des Tages heiser werden würden.
»Viel Glück«, wünschte sie dem Sicherheitschef, der zweifelnd die Augen verdrehte.
Drinnen ließ Dance den Blick in die Runde schweifen und rechnete halb damit, ihre Mutter zu sehen. Dann erkundigte sie sich am Empfang nach der Zimmernummer und eilte einen Flur entlang zu dem Raum, in dem sie die Zeugin des Kreuz-Falls antreffen würde.
Als sie eintrat, hob das blonde Mädchen, das in dem komplizierten Krankenhausbett lag, den Kopf.
»Hallo, Tammy. Ich bin Kathryn Dance.« Sie lächelte. »Darf ich Sie kurz stören?«
Kapitel 5
Tammy Foster hätte in dem Kofferraum ertrinken sollen, doch ihrem Angreifer war ein Fehler unterlaufen.
Hätte er den Wagen ein Stück weiter vorn geparkt, wäre das Meer hoch genug gestiegen, um das komplette Fahrzeug zu fluten und das arme Mädchen zu einem schrecklichen Tod zu verdammen. Doch wie es sich zufällig ergab, blieb der Camry an Ort und Stelle im losen Sand stecken, und das Wasser füllte den Kofferraum nur fünfzehn Zentimeter hoch.
Gegen vier Uhr morgens sah ein Fluglinienangestellter auf dem Weg zur Arbeit das Schimmern des Wagens. Rettungssanitäter bargen die junge Frau, die vor Entkräftung halb bewusstlos und stark unterkühlt war, und fuhren sie schnellstens ins Krankenhaus.
»Wie geht es Ihnen?«, fragte Dance nun.
»Ganz okay, würde ich sagen.«
Sie war von sportlicher Statur und hübsch, aber blass. Tammy hatte ein schmales, langes Gesicht, glattes, perfekt getöntes blondes Haar und eine vorwitzige Nase, die nach Kathryns Einschätzung nicht immer so gerade gewesen war. Ihr schneller Blick zu einer kleinen Kosmetiktasche verriet Dance, dass das Mädchen sich kaum jemals ungeschminkt in der Öffentlichkeit zeigen würde.
Dance zeigte ihren Dienstausweis vor.
Tammy schaute flüchtig hin.
»In Anbetracht der Umstände sehen Sie ziemlich gut aus.«
»Es war so kalt«, sagte Tammy. »Ich habe noch nie im Leben so gefroren. Ich bin noch immer völlig durcheinander.«
»Das kann ich mir denken.«
Die Aufmerksamkeit des Mädchens richtete sich auf den Fernseher. Es lief eine Seifenoper. Dance und Maggie sahen sie sich gelegentlich an, meistens dann, wenn die Tochter krank war und nicht zur Schule gehen konnte. Auch wenn man monatelang aussetzte, verstand man die Handlung trotzdem sofort wieder.
Dance setzte sich, musterte die Ballons und Blumen auf einem nahen Tisch und hielt unwillkürlich Ausschau nach roten Rosen, religiösen Gegenständen oder Karten mit Kreuzen darauf. Da waren keine.
»Wie lange müssen Sie im Krankenhaus bleiben?«
»Ich komme wahrscheinlich heute schon raus. Vielleicht auch erst morgen, heißt es.«
»Wie sind die Ärzte? Niedlich?«
Ein Lachen.
»Auf welche Schule gehen Sie?«
»Robert Louis Stevenson.«
»Im Abschlussjahrgang?«
»Ab nächsten Herbst, ja.«
Damit Tammy sich wohlfühlte, plauderte Dance ein wenig mit ihr, erkundigte sich danach, ob sie Ferienkurse besuchte, auf welches College sie später gehen wollte, wie es ihrer Familie ging, welchen Sport sie trieb. »Haben Sie irgendwelche Urlaubspläne?«
»Jetzt ja«, sagte sie. »Nach diesem Vorfall. Meine Mutter, meine Schwester und ich werden nächste Woche meine Großmutter in Florida besuchen.« In ihrer Stimme schwang Verärgerung mit. Dance konnte erkennen, dass das Mädchen derzeit alles andere lieber wollte, als mit der Familie nach Florida zu fliegen.
»Tammy, wie Sie sich vorstellen können, wollen wir unbedingt herausfinden, wer Ihnen das angetan hat.«
»Dieses Arschloch.«
Dance nickte zustimmend. »Erzählen Sie mir, was passiert ist.«
Tammy sagte, sie sei in einem Club gewesen und kurz nach Mitternacht gegangen. Auf dem Parkplatz habe jemand sie von hinten gepackt, ihr den Mund zugeklebt, Hände und Füße gefesselt, sie in den Kofferraum geworfen und dann zum Strand gefahren.
»Und da hat er mich einfach zurückgelassen, damit ich, na ja, ertrinken würde.« Der Blick des Mädchens war leer. Dance, die von Natur aus Einfühlungsvermögen besaß – ein Erbe ihrer Mutter -, konnte das Grauen am eigenen Leib spüren, ein Schauder, der ihr über den Rücken wanderte.
»Haben Sie den Angreifer gekannt?«
Das Mädchen schüttelte den Kopf. »Aber ich weiß, was los war.«
»Und zwar?«
»Banden.«
»Er war in einer Gang?«
»Ja, davon hat doch jeder schon gehört. Um in eine Bande aufgenommen zu werden, muss man jemanden umbringen. Und wenn es sich um eine Latino-Gang handelt, muss das Opfer ein weißes Mädchen sein. So sind die Regeln.«
»Sie glauben, der Täter war ein Latino?«
»Ja, da bin ich mir sicher. Ich habe zwar sein Gesicht nicht gesehen, aber seine Hand. Sie war dunkler, Sie wissen schon. Nicht schwarz. Aber er war eindeutig kein Weißer.«
»Wie groß war er?«
»Nicht besonders. Höchstens eins siebzig. Aber unheimlich kräftig. Ach, noch etwas. Ich glaube, letzte Nacht habe ich gesagt, es sei nur ein Täter gewesen. Aber heute Morgen ist es mir wieder eingefallen. Es waren zwei.«
»Sie haben zwei gesehen?«
»Nein, ich konnte eher spüren, dass da noch jemand war. Wissen Sie, wie das ist?«
»Könnte es eine Frau gewesen sein?«
»Oh, ja, möglicherweise. Keine Ahnung. Wie ich schon sagte, ich war ziemlich durcheinander.«
»Hat jemand Sie angefasst?«
»Nein, jedenfalls nicht auf diese Weise. Nur um mich zu fesseln und in den Kofferraum zu werfen.« Ihre Augen blitzten zornig auf.
»Erinnern Sie sich noch an Einzelheiten der Fahrt?«
»Nein, ich hatte zu viel Angst. Ich glaube, ich habe etwas klirren gehört, vorne im Wagen.«
»Nicht im Kofferraum?«
»Nein. Wie Metall oder so. Dachte ich zumindest. Er hat es in den Wagen gelegt, nachdem er mich in den Kofferraum gesperrt hatte. Ich hab diesen Film gesehen, einen der Saw-Filme. Und ich dachte, vielleicht würde er was auch immer das war benutzen, um mich zu foltern.«
Das Fahrrad, dachte Dance, denn ihr fielen die Spuren am Strand wieder ein. Er hatte sich ein Fahrrad für die Flucht mitgenommen. Sie fragte Tammy danach, aber die verneinte; ein Fahrrad hätte auf keinen Fall auf die Rückbank gepasst. »Und es hat sich auch nicht nach einem Fahrrad angehört«, fügte sie ernst hinzu.
»Okay, Tammy.« Dance rückte sich die Brille zurecht und sah unverwandt das Mädchen an, das einen kurzen Blick auf die Blumen, Karten und Stofftiere warf. »Schauen Sie nur, all die Geschenke«, sagte Tammy. »Dieser Bär da, ist der nicht klasse?«
»Ja, er ist niedlich … Sie glauben also, es waren irgendwelche Latinos aus einer Bande.«
»Ja. Aber … na ja, Sie wissen schon, nun ist ja zum Glück alles vorbei.«
»Vorbei?«
»Ich meine, ich bin nicht ermordet worden. Nur ein wenig durchgeweicht.« Sie lachte auf und wich Dances Blick aus. »Die Kerle haben jetzt bestimmt eine Heidenangst. Die Nachrichten sind ja voll von dem Fall. Ich wette, die sind untergetaucht. Womöglich sogar aus der Stadt verschwunden.«
Es traf durchaus zu, dass Banden Aufnahmerituale hatten. Und bisweilen ging es dabei um Mord. Aber die Opfer gehörten nur selten nicht der Rasse oder Volksgruppe des Täters an und waren fast immer Mitglieder einer rivalisierenden Gang oder Informanten. Überdies war das Verbrechen an Tammy viel zu umständlich. Kathryn wusste aus früheren Fällen, dass bei Bandenverbrechen Effizienz an oberster Stelle stand; Zeit ist Geld, und je weniger davon für außerplanmäßige Aktivitäten verwendet wurde, desto besser.
Dance war bereits zu dem Schluss gekommen, dass das Mädchen seinen Angreifer keineswegs für den Angehörigen einer Latino-Gang hielt. Genauso wenig glaubte Tammy, dass es zwei Täter gegeben hatte.
Sie wusste eindeutig mehr, als sie sagte.
Es war an der Zeit, zur Wahrheit vorzudringen.
Zur kinesischen Analyse eines Gesprächspartners oder Verdächtigen ist es zunächst erforderlich, sich einen grundlegenden Eindruck davon zu verschaffen, welches Verhalten die betreffende Person bei wahrheitsgemäßen Aussagen an den Tag legt: Wo behält sie ihre Hände, wohin schaut sie wie oft, räuspert sie sich oder schluckt sie häufig, sind ihre Äußerungen von lauter »Ähs« durchsetzt, wippt sie mit dem Fuß, sitzt sie schief oder vornübergebeugt da, zögert sie vor einer Antwort?
Sobald der Kinesik-Experte auf diese Weise eine Norm festgelegt hat, wird es ihm auffallen, wenn sein Gegenüber bei der Antwort auf eine potenziell heikle Frage vom üblichen Verhalten abweicht. Wenn Leute lügen, verspüren sie Stress und Angst und versuchen, diese unangenehmen Empfindungen mit Gesten oder Sprachmustern zu lindern, die sich vom herkömmlichen Standard unterscheiden. Eines von Dances Lieblingszitaten stammte von einem Mann, der hundert Jahre vor der Prägung des Begriffs »Kinesik« gelebt hatte: Charles Darwin. Er hatte gesagt: »Unterdrückte Gefühle kommen fast immer in Form irgendeiner Körperbewegung an die Oberfläche.«
Als es um die Identität des Angreifers gegangen war, hatte Dance beobachtet, dass die Körpersprache des Mädchens von der Norm abwich: Tammy verlagerte unbehaglich ihre Hüften, und ein Fuß zuckte. Die Arme und Hände hat ein Lügner noch recht mühelos unter Kontrolle, aber der Rest unseres Körpers ist uns weitaus weniger bewusst, vor allem die Füße und Zehen.
Darüber hinaus registrierte Dance noch weitere Veränderungen: Die Höhe von Tammys Stimme variierte, sie fuhr sich mit den Fingern durch das Haar, und sie vollführte abblockende Gesten, berührte sich an Mund und Nase. Außerdem schweifte sie unnötig ab, redete einfach drauflos und äußerte Gemeinplätze (»Davon hat doch jeder schon gehört«) – alles typisch für jemanden, der lügt.