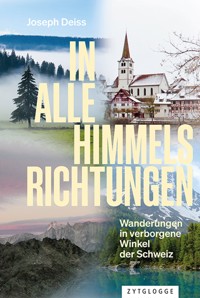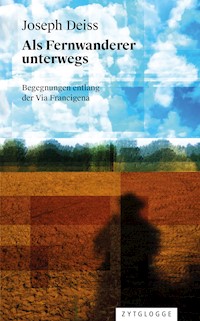
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Der Weg von Freiburg (CH) nach Canterbury (GB) entspricht dem Rückweg der vor tausend Jahren von Erzbischof Sigerich begründeten Via Francigena. Sich dem Unerwarteten des Zufalls und dem Drang der Neugier hingebend, folgt der Autor dieser ältesten beschriebenen Route durch Europa. Von seiner Heimatstadt aus wandert er durch Regionen des Juras, der Bourgogne-Franche-Comté, des Grand Est, der Hauts-de-France und des Kents. Entlang von Flüssen und Kanälen durchquert er idyllische Landschaften, geniesst Delikatessen Frankreichs und hält inne auf Schlachtfeldern. Von seiner 900 Kilometer langen Fernwanderung schildert er den sanften Zwang des Alltäglichen wie die Verlockung des Aussergewöhnlichen, die Stunden des Glücks wie der Einsamkeit, des Sinnierens und der Entbehrung, bis zur Erlangung der Gelassenheit, sich mit seinen Zweifeln abzufinden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Titel
Der Pilger und die alltäglichen Dinge
I. Das Bewusstsein meiner Wurzeln
Freiburg (CH) – Besançon (F), 181 km
Oppidum der Helvetier und Schlacht bei Murten
1. Etappe: Barberêche (FR) – Ins (BE), 27 km
Festival der Natur und der Urbanität am Fuße des Jura
2. Etappe: Ins (BE) – Chambrelien (NE), 26 km
Willkommen im Sibirien der Schweiz
3. Etappe: Chambrelien (NE) – La Brévine (NE), 26 km
L’Helvetia, historischer Grenzstein zu Frankreich
4. Etappe: La Brévine (NE) – Pontarlier (F), 28 km
Die Grüne Fee in der Loue
5. Etappe: Pontarlier – Mouthier-Haute-Pierre, 26 km
Ein Wanderweg in einem Eisenbahntunnel
6. Etappe: Mouthier-Haute-Pierre – Foucherans, 26 km
Welterbe in einem Mäander des Doubs
7. Etappe: Foucherans – Besançon, 22 km
II. Entzückendes Frankreich mit verblichenem Glanz
Besançon – Vitry-le-François, 261 km
Vom Ognon in den Salon
8. Etappe: Besançon – Gy, 36 km
Aber wo ist denn nur der Kanal verschwunden?
9. Etappe: Gy – Dampierre-sur-Salon, 26 km
«Heute sind es die Frauen, welche die Beerdigungen verrichten»
10. Etappe: Dampierre-sur-Salon – Champlitte, 19 km
Vakuum im Westen des Grand Est
11. Etappe: Champlitte – Chalindrey, 26 km
Im Wassergang von Balesmes-sur-Marne trennen sich die Gewässer
12. Etappe: Chalindrey – Rolampont, 23 km
Wie traurig ist doch ein Kanal ohne Kähne
13. Etappe: Rolampont – Chaumont, 26 km
Der Bridge-Tisch des Generals
14. Etappe: Chaumont – Colombey-les-Deux-Eglises, 31 km
Ein grünes, atomares Venedig
15. Etappe: Colombey-les-Deux-Eglises – Soulaines-Dhuys, 22 km
Treffpunkt der Gewässer und der Kraniche
16. Etappe: Soulaines-Dhuys – Giffaumont-Champaubert, 22 km
Kuckuck und Schnepfen verkünden den 1. Mai
17. Etappe: Giffaumont-Champaubert – Vitry-le-François, 30 km
III. Die Tragweite der Geschichte, das Frohlocken der Gotik, die Verwurzelung in der Tradition
Vitry-le-François – Laon, 141 km
Der Kanal ist romantischer als sein Name
18. Etappe: Vitry-le-François – Saint-Germain-la-Ville, 22 km
Perfektes Gleichgewicht der kleinen Wehwehchen und der Frivolitäten der Seele des Pilgers
19. Etappe: Saint-Germain-la-Ville – Condé-sur-Marne, 28 km
Die Champagne, Heimat des Elixiers der Könige
20. Etappe: Condé-sur-Marne – Reims, 34 km
Auf, in die Picardie, Wiege der gotischen Kathedralen!
21. Etappe: Reims – Pontavert, 28 km
Ein großer Schweizer Dichter und gotische Kühe
22. Etappe: Pontavert – Laon, 29 km
IV. Nie wieder Krieg!
Laon – Arras, 150 km
Es wird 100 Jahre lang regnen, im Land der Rätsel und der Legenden
23. Etappe: Laon – Fargniers (Tergnier), 31 km
Ein europäischer Fahrradweg
24. Etappe: Fargniers (Tergnier) – Saint-Quentin, 32 km
Fürs Überleben gedemütigt Obstkerne zu sammeln und Brennnesseln zu trocknen
25. Etappe: Saint-Quentin – Holnon – Péronne, 35 km
Mit den Handflächen klatschen
26. Etappe: Péronne – Bapaume, 26 km
Biertrinker und Andouillette-Liebhaber
27. Etappe: Bapaume – Arras, 26 km
V. Am Ziel trotz ungeahntem Comeback der «Pest»
Arras – Canterbury, 171 km
Endloses ungeduldiges Trampeln
Derricks als mahnende Wahrzeichen, Schutthalden als einzige Berge
28. Etappe: Arras – Acq – Bruay-la-Buissière, 39 km
Aber in welche Richtung fließt die Lys eigentlich?
29. Etappe: Bruay-la-Buissière – Aire-sur-la-Lys, 28 km
Ein Schiffshebewerk (Lift) mit betonierten Kolben
30. Etappe: Aire-sur-la-Lys – Saint-Omer – Tilques, 28 km
Weiterhin tiefe Himmel mit Wolken als Skulpturen
31. Etappe: Tilques – Guînes, 34 km
Treffen mit Rodin in Calais
32. Etappe: Guînes – Calais, 12 km
Abenteuerliche Rückkehr nach Canterbury, 1000 Jahre nach Sigerich
33. Etappe: Dover – Canterbury, 30 km
Über den Autor
Über das Buch
JOSEPH DEISS
ALS FERNWANDERER UNTERWEGS
Der Autor und der Verlag danken für die Unterstützung:
Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.
© 2022 Zytglogge Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, BaselAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Angelia SchwallerKorrektorat: Tobias Weskamp
Joseph Deiss
ALS FERNWANDERER UNTERWEGS
Begegnungen entlang der Via Francigena
Der Pilger und die alltäglichen Dinge
Seit mehr als einem Jahrtausend geleitet die Via Francigena Pilger von Canterbury nach Rom. Die Vaterschaft der gut 2000 Kilometer langen Strecke wird Sigerich dem Ernsten, Erzbischof von Canterbury von 990 bis 994, zugeschrieben. Sie verläuft, wie der Name es verdeutlicht, durch Frankreich, dann durch Italien, nicht ohne einen kurzen Abstecher in die Schweiz, dies vor allem, um den Großen Sankt Bernhard zu überqueren.
Da ich die 1200 Kilometer der Strecke von Freiburg nach Rom bereits zurückgelegt habe (siehe Joseph Deiss, Nouvelles Lettres d’Italie, Fribourg-Rome à pied, Editions de l’Aire, 2019), mache ich mich auf den Weg nach England. In der ewigen Stadt angekommen, ohne über meine Berufung als Wanderer, frommer Reisender oder Pilger im Klaren zu sein, sehne ich mich nach weiteren Abenteuern. Vielleicht wird meine Meinung betreffend das Wallfahren einleuchtender, wenn ich den verbleibenden Teil der Via Francigena bewältige, also die 900 Kilometer von Freiburg nach Canterbury.
– Aber das ist doch die falsche Richtung!
– Na und? Im Mittelalter hatten die «Romgänger», als sie am Grab des heiligen Petrus angekommen waren, keine andere Wahl, als zu Fuß nach Hause zu gehen. Sich für die Rückkehr auf easyJet oder Frecciarossa zu verlassen war damals kein Thema. Ich habe also keine Gewissensbisse und werde mich, wenn nötig, getrost der Haltung von Georges Brassens anschließen (La mauvaise réputation, 1952):
Je ne fais pourtant de tort à personne,
En suivant les ch’mins qui n’mèn’nt pas à Rome.
(«Ich tue doch niemandem Unrecht an,
wenn ich Wege beschreite, die nicht nach Rom führen.»)
Ganz zu schweigen, dass Canterbury im Mittelalter ebenfalls ein vielbesuchter Wallfahrtsort war, wie die wunderschönen Buntglasfenster seiner Kathedrale bezeugen. Sie ist eine Hochburg der christlichen Welt, seit Papst Gregor der Große den Benediktinermönch Augustin – nicht zu verwechseln mit Augustinus von Hippone – dorthin schickte, um die Angelsachsen zu bekehren. Der «Apostel der Engländer», wie Sankt-Augustinus auch genannt wird, war von 597 bis 604 erster Erzbischof von Canterbury.
Mein Geist ist umso sorgenfreier, als ich mich durch die Wahl der nördlichen Richtung in die Folge der Etappen einordne, wie sie Sigerich der Ernste aufgezeichnet hat. Während seiner Rückkehr aus Rom hatte er die Idee, in einem Dokument die Namen der achtzig Etappen seiner Reiseroute aufzuschreiben, beginnend mit Rom und La Storta und endend in Wissant an der Opalküste. Sein Bericht ist in einer Handschrift aus der Mitte des 11. Jahrhunderts enthalten (Blätter 34 und 35 des Manuskripts Cotton Tiberius B. v.), die in der British Library aufbewahrt wird. Die heutigen Markierungen der Via Francigena haben sich weitgehend daran orientiert.
– Übrigens, was wissen wir eigentlich über Sigerichs Absichten? War er ein Pilger? Sehnte er sich nach Gott? War er auf der Suche seiner selbst? Brauchte er persönliche Verinnerlichung? Schließlich, war er sich überhaupt bewusst, nach Jerusalem, aber noch vor Compostela, eine der drei großen mittelalterlichen Routen des Wallfahrens zu begründen?
– Das ist schwer zu sagen, nach über tausend Jahren! Vor allem, wenn man bedenkt, dass sich die Historiker nicht einmal über sein Geburtsdatum einig sind. Tatsache ist, dass Sigerich nicht der Urheber der Pilgerreisen nach Rom ist. Diese bestanden zu seiner Zeit bereits seit einem halben Jahrtausend, lange vor dem Beginn des Kultes des Heiligen Jakob im 11. Jahrhundert. Sie waren damals das Hauptziel für Reisende mit spirituellen Antrieben.
Auf der Grundlage der historischen Fakten ist es wahrscheinlich, dass seine Beweggründe eher beruflicher Natur und mit seinem Status als Bischof verbunden waren. Sigerich der Ernste (Sigeric the Serious, 950(?)–994) wurde Anfang 990 zum Erzbischof von Canterbury gewählt. Als 27. Nachfolger des Augustinus von Canterbury ging er nach Rom, um von Papst Johannes XV. das Pallium zu empfangen, das priesterliche Ornament, das dem Papst, den Primates und den Erzbischöfen vorbehalten war. Seine Motive waren somit auf den ersten Blick fromm und utilitaristisch zugleich. Er brauchte den Segen des Papstes, um sein neues Amt als Erzbischof von Canterbury ausüben zu können. Dies war eine sehr begehrte und einflussreiche Position.
Als Sigerich sich im Vorfeld der Jahrtausendwende auf den Weg machte, um Europa zu durchqueren, befand sich der Kontinent im Übergang vom Frühmittelalter zum Hochmittelalter oder klassischen Mittelalter. Ostfranken (Germanien) erlebte die Entstehung der Ottonischen Dynastie. Doch 990 war Otto III. erst zehn Jahre alt und stand unter der Regentschaft seiner Mutter. Deshalb konnte er die Macht erst ab 995 ausüben, ab 996 dann aber als römisch-deutscher Kaiser. In Westfranken (Frankreich) hatte Hugues I. gerade die Herrschaft der Kapetianer eröffnet und ab 987 Louis V., den letzten der Karolinger, abgelöst. Das Papsttum war ebenso geschwächt wie die Königshäuser. Es war für alle schwierig, ihre Macht in einem Europa der Fürsten und Bischöfe zu festigen, welche gierig kirchliche Territorien, Titel oder Ämter begehrten, anstatt sich um die Sicherheit ihrer Bauern, Leibeigenen und Untertanen im Allgemeinen zu kümmern.
In Rom war Papst Johannes XV. seit 985 im Amt. In der umfangreichen Umverteilung der Gewalten und Privilegien hatte er unter anderem den Streit um das Erzbistum Reims zu bewältigen. Er war auch Urheber der sogenannten «Waffenruhe Gottes», des ersten institutionalisierten Versuchs, Kriege mit gewaltfreien Mitteln beizulegen.
Für den neuen Erzbischof von Canterbury war Reims, als bedeutendster erzbischöflicher Sitz Frankreichs, sicherlich einer der wichtigsten Etappenorte. Er besuchte dieses prestigeträchtige Zentrum wohl zu Zeiten, als Gerbert d'Aurillac noch Sekretär des Erzbischofs Arnoul war, dessen Nachfolge er 991 antreten wird. Gerbert galt als kultiviertester Geist seiner Epoche, förderte die Einführung der arabischen Zahlen in der westlichen Welt, war Tutor des zukünftigen französischen Königs Robert le Pieux – der Sohn von Hugues Capet – wie auch von Otto III. – dem zukünftigen Kaiser des Heiligen Germanischen Reiches – und galt allgemein als einer der scharfsinnigsten Strategen. Da er sowohl auf der Seite der Ottoner als auch jener der Kapetianer Netzwerke hatte, wurde er 999 unter dem Namen Sylvester II. ins Pontifikat erhoben und sollte als Papst des Jahres 1000 in die Geschichte eingehen.
Als Sigerich Erzbischof von Canterbury wurde, war die Lage in England ebenso verwirrt wie auf dem ganzen Kontinent. 937 von Athelstan, ihrem ersten König, vereint, erlebten die Engländer den Aufstieg der Wessex mit deren Hauptstadt Winchester. Das war nach der Übernahme des Königreichs Kent, dessen Hauptort Canterbury war. Die ständigen Angriffe und Überfälle der Wikinger dauerten an und endeten im Jahr 1016 mit dem Sieg von Knut dem Großen und der vorübergehenden Integration Englands in das Königreich Dänemark.
All dies hinderte Canterbury, eine der ältesten Städte des Landes, nicht daran, Sitz des Primats zu bleiben, als Sigerich nach einem kurzen Interregnum von Erzbischof Athelgar die Nachfolge von Dunstan von Canterbury übernahm. Letzterer war ein ehemaliger Hufschmied. Er hatte den Sitz des Archbishops von 959 bis 988 inne und war Antrieb der englischen Benediktiner-Reform. Ihm schreibt die Legende zu, den Teufel übertölpelt zu haben, sodass dieser geschworen hätte, niemals in Häuser einzudringen, deren Eingangstür mit einem Hufeisen geschmückt wäre. Ein Accessoire, das mit der Zeit seine Funktion als Talisman in jene des Türklopfers verwandelt sah. Erzbischof Sigerich verteidigte bis zu seinem Tod im Jahr 994 die Stellung der religiösen Hochburg in der ehemaligen Hauptstadt des Königreichs Kent. Seine politische Rolle veranlasste ihn, König Athelred zu unterstützen, als dieser den Wikingern ein Lösegeld von 10 000 Pfund zahlte. Er ging sogar so weit, selbst den Dänen Geld zu geben, damit diese ihre Angriffe gegen die Kathedrale von Canterbury einstellten und sie nicht in Brand setzten.
Es ist nicht bekannt, ob Sigerichs Spitzname der Ernste auf Grundlage seines Handelns aufkam oder ob es nur das Ergebnis der Transliteration seines lateinischen Namens war und dem lateinischen Serio entspricht. Wie dem auch sei, dieser Begriff zeugt von einer gewissen Beharrlichkeit und Strenge, die ihm auf diese Weise zuerkannt wurde. Es ist jedenfalls daraus zu schließen, dass er seine lange Reise nicht leichtfertig unternommen hat. Die Tatsache, dass er alle Etappen aufgezeichnet hat, ist ein weiterer greifbarer Beweis, der bis heute in der British Library eingesehen werden kann. Aber man darf nicht völlig ausschließen, dass auch dokumentarische oder touristische Zwecke vorlagen, da der Gründungsvater des ältesten Pilgerwegs uns in den oben genannten Dokumenten auch eine Liste der Kirchen und Sehenswürdigkeiten, die er in Rom besuchte, hinterlässt.
Aufgrund dieser rein sachlichen Elemente ist es nicht möglich, Schlussfolgerungen über den Gemütszustand des reiselustigen Erzbischofs zu ziehen. Andererseits kann man annehmen, dass mindestens drei Sachverhalte die beschwerliche Wanderschaft markierten, für die er sich aufmachte:
– die großen politischen Wirren in den durchquerten Regionen;
– die sehr enge Verflechtung zwischen dem Weltlichen und dem Religiösen: Als Erzbischof war Sigerich zugleich kirchlicher Würdenträger und Politiker;
– die allgegenwärtige Unsicherheit: Vor dem Hintergrund des Elends, der Hungersnöte, der Plünderungen, der Verbrechen, deren Folgen durch die Schnelljustiz noch verschärft wurden, war die Gefahr auf den Straßen, wo Diebe, Räuber und andere Wegelagerer lauern, allgegenwärtig.
Zweifellos unterscheiden sich die heutigen Gegebenheiten der großen Pilgerfahrten an der Schwelle zum dritten Jahrtausend von jenen des Mittelalters, sowohl durch die materiellen Voraussetzungen als auch durch die Beweggründe. Ich werde ausgiebig Gelegenheit haben, dies auf der ganzen Strecke zu beobachten. Im Moment vor dem Start fühle ich mich weder als Wanderer noch als Tourist oder als Bummler. Und ich bin auch kein Bittgänger. Aber worum geht es mir dann?
Da ich seit meiner Ankunft in Rom in dieser Frage nicht weiter vorangekommen bin, freue ich mich, von der Ausflucht Canterbury profitieren zu können. Sie befreit mich von einer abschließenden Aussage über den Geist, der mich beim Start beseelt. Unter diesem Gesichtspunkt war Rom keineswegs ein Misserfolg. Aber es war nur ein Schritt auf meinem inneren Weg, und ich möchte diese geistige Entfaltung fortsetzen. Mit dem Vorteil, dass mit dem Bevorstehen neuer Erlebnisse die Details der praktischen Vorbereitung zusehends die Oberhand gewinnen und die metaphysischen Skrupel in den Hintergrund drängen.
Das ist genau das, was mich am Fernwandern fasziniert. Die Chance, sich aus dem gewöhnlichen Berufs- und Privatleben zu befreien und nur mit den alltäglichen Anforderungen des Überlebens konfrontiert zu sein. Als Ökonom habe ich immer die Definition meines Fachs von Alfred Marshall (1842–1924) bevorzugt:
– Die Volkswirtschaftslehre ist die Studie der Menschheit in den gewöhnlichen Geschäften des Lebens.
Was den Ökonomen nicht davon entbindet, «sich um die höchsten Ziele des Menschen zu kümmern». Dieses Bestreben darf Zärtlichkeit, Liebe und Humor als wesentliche Zutaten für ein glückliches Leben nicht auslassen, wohl wissend, dass Selbstironie die wirksamste Waffe ist, um die vielen schwierigen Umstände des Lebens zu meistern. Aber dabei will er nicht moralistisch sein, sondern sich einfach daran erinnern, dass sich der Mensch, um zu leben, unter anderem ernähren, kleiden, unterbringen und pflegen muss.
Und das Gleiche gilt für den Pilger und den Fernwanderer im Allgemeinen. Bevor er sich philosophischen oder religiösen Gedanken widmen kann, braucht er gute Schuhe, Kleidung, die ihn vor dem Wetter schützt, Wasser und Nahrung, ein Dach über dem Kopf und einen Weg. Nur wenn diese lebensnotwendigen Bedürfnisse erfüllt sind, ist es möglich, sich mit seinem höheren Schicksal auseinanderzusetzen. Das Alltägliche kommt vor dem Außergewöhnlichen.
Die Erfahrung sagt mir, dass es viele Schwierigkeiten geben wird und dass mein Gang nach Canterbury nicht immer einfach und sogar nicht einmal garantiert ist. Es ist dieses alltägliche Leben, um das es in dieser Schilderung gehen wird. Ohne sie vorhersagen zu können, werden die zahlreichen Überraschungen, Hürden und Erfolge, aber auch die beeindruckenden Errungenschaften und die schönen Entdeckungen, die mir diese Reise bringen wird, spannend sein. Und all dies wird in der vom Zufall diktierten Abwechslung über mich ergehen.
Auf der Ebene der Symbolik wird sich auch ein anderer Ansatz ergeben. Nachdem ich bisher vor allem auf die Geografie geachtet habe, richtet sich nun mein Interesse zusätzlich vermehrt auf das Geschichtliche. Denn der unaufhaltbare Wandel der Zeit wird uns auf Schritt und Tritt begleiten. Was beispielsweise der Heilige Stuhl für die Katholiken immer darstellte, ist Canterbury heute für die Anglikaner. Denn das Jahrtausend, das uns von Sigerich trennt, hat die Reformation erlebt wie auch das Schisma des Königs von England gegenüber Rom im Jahre 1534. Ursprünglich begründet durch die Weigerung von Papst Clemens VII., die Ehe von Heinrich VIII. mit Katharina von Aragon zu annullieren – was es dem König von England ermöglicht hätte, Anne Boleyn zu heiraten –, ist der anglikanische Bruch eigentlich Teil der allgemeinen Unrast. Dies in einer Zeit, die vom Aufstieg des Nationalismus, dem Niedergang der Feudalität und der Erfindung des Buchdruckes geprägt war.
Heute ist der britische Monarch gleichzeitig Oberhaupt der Kirche von England, und der Archbishop of Canterbury ist deren Vorsteher und gleichzeitig Primat der anglikanischen Gemeinde in der Welt. Glücklicherweise sind die Beziehungen zwischen den christlichen Kirchen derzeit eher ökumenisch als feindlich. Ich kann meine Ungeduld nicht verbergen, wie auch die Neugier, zu erfahren, wohin die Pilgerfahrt eines Katholiken nach Canterbury führen wird, einem beliebten Ziel damaliger Bittgänger, der Hochburg des anglikanischen Protestantismus heute.
Denn man darf nicht vergessen, dass nach dem brutalen Mord an Erzbischof Thomas Becket am 29. Dezember 1170, in der Nähe des Altars seiner Kathedrale, durch vier dem König Heinrich II. von England zugetane Ritter, Canterbury zu einem der beliebtesten Wallfahrtsorte in England und Europa wurde. Die Schandtat schockierte ganz England und das katholische Europa überhaupt. Der Heilige Thomas von Canterbury, der in einer Rekordzeit von weniger als drei Jahren nach seinem Tod durch Papst Alexander III. heiliggesprochen wurde, war der Ursprung einer wahren Verehrung, die bis zur Zerstörung seines Grabes dauerte, als die Klöster unter König Heinrich VIII., ab 1534 und weit darüber hinaus, aufgelöst wurden. Das macht eine Pilgerreise nach Canterbury zu einem weniger absurden Akt, als er auf den ersten Blick erscheinen könnte.
Inzwischen ist der Vatikan ein Staat geworden. Zwischen Rom und London wurden sogar diplomatische Beziehungen aufgebaut. Königin Elisabeth II. hatte sieben Mal Begegnungen mit fünf verschiedenen Päpsten, die während ihrer Regierungszeit im Amt waren: Pius XII., Johannes XXIII., Johannes Paul II., Benedikt XVI. und Franziskus. Ich habe mich immer gewundert, wie wichtig es für viele Staatsoberhäupter ist, sich mit dem Papst zu zeigen, ob sie nun an der Spitze eines säkularen Staates stehen, wie Frankreich, oder ob sie selbst das Oberhaupt einer Kirche sind, wie es in Großbritannien der Fall ist. So schwer es heute ist, den irdischen Status der katholischen Kirche im vatikanischen Staat zu verstehen, der aus den Lateranabkommen von 1929 hervorgegangen ist, so merkwürdig ist es, dass ein säkularer Staatschef das Oberhaupt einer Kirche christlichen Glaubens sein kann. Ohne Zweifel werden mir diese Fragen während der Stunden der Stille und der körperlichen Anstrengung, die den Weg nach Canterbury prägen werden, noch einiges Kopfzerbrechen bescheren.
Dank meiner Erfahrung bereitet mir die materielle Organisation weniger Sorgen als das vorherige Mal. Sinnvollerweise beginnt die Übung mit der Wahl der Route. Nach den fünfzig Etappen von Freiburg nach Rom will die Arithmetik, dass es gut deren dreißig von Freiburg nach Canterbury sein können. Wir verfügen zwar über die von Sigerich erstellte Liste. Aber in tausend Jahren hat sich viel verändert. Da der größte Teil der Strecke in Frankreich liegt, werde ich keine sprachlichen Probleme haben. Darüber hinaus ist die Kartografie in Frankreich besser entwickelt als in Italien. Kein Wunder, denn in Italien sind die besten Karten diejenigen von Michelin! Daraus lässt sich folgern, dass Frankreich mindestens so gut versorgt sein muss wie Italien. Es scheint jedoch, dass die gallische Markierung fehlerhaft oder gar nicht vorhanden ist. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass im Norden das Klima rauer ist als im Süden der Alpen.
Um die Etappenorte festzulegen, muss man sich daran erinnern, dass nicht alle Orte der von Sigerich erstellten Liste dasselbe Schicksal erlebt haben. Während Reims und Laon in den Dokumenten und Plänen fest verankert sind, haben andere nicht vom gleichen Aufschwung profitiert. Die Schwierigkeit wird darin bestehen, Unterkünfte an den heute weniger bekannten oder weniger entwickelten Orten zu finden. Andere Standorte, wie zum Beispiel Vitry-le-François, existierten in der Zeit von Sigerich einfach noch nicht. Dies gilt auch für das ausgedehnte Netz an Kanälen mit ihren Wanderwegen, welches der fortschrittliche Erzbischof und Pilger sicherlich mit Vorteil beschritten hätte. Das alles veranlasst mich, in groben Zügen dem historischen Trassee zu folgen, den Weglauf der einzelnen Etappen aber den aktuellen Begebenheiten anzupassen.
Die in Italien gewonnenen praktischen Erfahrungen werden mir sehr wertvoll sein. Es lohnt sich daher, eine Bestandesaufnahme der technischen Aspekte zu machen. Ich strebe keine wissenschaftliche Praxis der Wanderübung an, bin aber nach wie vor davon überzeugt, dass eine gute Vorbereitung die Reise erheblich erleichtert. Die Begrenzung des Risikos und des Leidens steht im umgekehrten Verhältnis zur Intensität des Vergnügens, hätte mein Mathematiklehrer gesagt. Aber machen wir uns nun auf in Richtung unseres Zieles Canterbury und besinnen wir uns in fünf Schritten unserer Wurzeln, der Douce France, seiner bewegten Geschichte mit seinen prestigeträchtigen Kathedralen, aber auch seiner schrecklichen Kriege sowie der verheerenden Pandemien.
I. Das Bewusstsein meiner Wurzeln
Freiburg (CH) – Besançon (F), 181 km
Der eigentliche Ausgangspunkt ist für einmal das Dorf Barberêche. Obwohl sechs oder sieben Kilometer von Freiburg entfernt, ist es aus historischer Sicht ein Ort voller Symbole für meine neue Reise. Er liegt näher an den Murten- und Neuenburgerseen, ist aber auch mein sentimentaler Brennpunkt. Der Hauptgrund dafür ist, dass ich den Großteil meines Erwachsenen- und Familienlebens dort verbracht habe. Man wird es mir also nicht verübeln, wenn ich die wenigen Kilometer, die mich von der Stadt Freiburg trennen, ausblende.
Die so weggeknabberten Meilen sind bedeutender, als es den Anschein hat. Zum Zeitpunkt, da ich mich ins Unbekannte der Entdeckung stürze, habe ich das Bedürfnis, mich an meine Wurzeln zu erinnern. Ich nutze die ersten Etappen, um meiner geografischen, historischen und spirituellen Herkunft bewusst zu sein. Für alle drei Dimensionen stehen Freiburg und die Schweiz im Kontext des europäischen Kontinents, dessen bewegte Geschichte von den Höhen und Tiefen des Christentums geprägt ist.
Anno 990 bestand nämlich die Stadt Freiburg noch nicht, da sie ja erst 1157 von Herzog Bertold von Zaehringen gegründet wurde. Doch gab es schon während der Zeit von Hallstatt Kelten, welche die Hügel um Barberêche herum besetzten, auf den Höhen über der Saane. Ein Dutzend Grabhügel aus dieser Zeit wurden in unseren Wäldern gefunden. Zu Sigerichs Zeiten wäre somit eine Pilgerreise von Freiburg nach Canterbury nicht denkbar gewesen. Eine Wanderschaft von Barberêche nach Canterbury, auf der anderen Seite, hätte möglicherweise für den pilgernden Bischof Sinn gemacht. Zugegebenermaßen sind solche Schlauheiten nicht von großer Bedeutung. Die Tatsache ist, dass ich für mein neues Abenteuer von einem mir vertrauten Ort aus starte, dem Dorf Barberêche, im Seebezirk, das sich im Großraum Freiburg (CH) befindet.
Oppidum der Helvetier und Schlacht bei Murten
1. Etappe: Barberêche (FR) – Ins (BE), 27 km
28. August 2018
Kaum jemand erahnt den historischen Inhalt dieser ersten Etappe. Durch die Verbindung von zwei Dörfern mit den harmlosen Namen Barberêche und Ins werden wir zwei Orte berühren, die für das Schicksal der Schweiz und des Kantons Freiburg von wesentlicher Bedeutung waren.
Der Ursprung des Dorfes Barberêche liegt vor der Zeit Sigerichs dem Ernsten. In der Nähe des Bauernhofs, der heute noch im Volksmund Die Jagd (La Chasse) genannt wird, erinnert eine Mauer an eine römische Einrichtung und bezeugt, dass dieser Ort eine frühe Besiedlung gekannt hat. Etymologisch soll sich der Name Barberêche auf den «Hof von Barbarus» beziehen, die Villa Barbarisca. Verwirrend ist, dass der deutsche Name des Dorfes, «Bärfischen», scheinbar nichts damit zu tun hat, sondern an den Korb erinnert – die Bäre –, den wohl die Fischer an der naheliegenden Saane (Sarine) verwendeten, um ihren Fang aufzubewahren.
In den Wäldern in der Nähe des Mont Breilles, dem höchsten Punkt des Seebezirks, auf einer Höhe von etwas mehr als 670 m, findet man ein Dutzend Tumuli. Es waren Grabstätten, die zur Zeit der Kelten von Hallstatt (1200 bis 500 v. Chr.) oder zum Zeitpunkt ihrer Nachkommen, die uns als keltischer Volksstamm der Helvetier bekannt sind (von 400 v. Chr. bis 400 n. Chr.), errichtet worden waren. Im Chor der Kirche Saint-Maurice von Barberêche, die inmitten der Felder gebaut wurde, fanden die Arbeiter bei verschiedenen Renovierungen ein Grab, das auf die Zeit Karls des Großen zurückgeht (742–814 n. Chr.). In den Archivdokumenten erscheint die erste Erwähnung 1154, also drei Jahre vor der Gründung der Stadt Freiburg.
Das Gebiet der Gemeinde grenzt heute an den Stausee von Schiffenen, der das frühere Flussbett der Saane füllt. Die Gemeinde ist zweisprachig, mit komplett französischsprachigen Weilern und anderen, wo die deutsche Sprache vorherrscht. Sie befindet sich entlang der Begegnungslinie dieser beiden Landessprachen. Manche sprechen gerne von «Sprachgrenzen» oder sogar vom «Röstigraben». Ich persönlich habe stets die positiven Ansätze der Zweisprachigkeit bevorzugt, die nach meiner Meinung Quelle der gegenseitigen Bereicherung beider Kulturen und auch der Individuen ist, die sie pflegen:
– «Wer keine fremde Sprache spricht, kennt seine eigene nicht» (Johann Wolfgang von Goethe, ein berühmter Rom-Reisender, zitiert von Walter Henzen, im Vorwort für Jean Humbert, Le français vivant, Editions du Panorama, Bienne, 1962).
Heute geziemt es sich, über die «ehemalige» Gemeinde Barberêche zu sprechen, da diese am 1. Januar 2017 mit der Gemeinde Courtepin zusammengelegt wurde. Dieser so entstandene Schwerpunkt des französischsprachigen Haut-Lac, der aus mehreren Gruppierungen mit anderen Einheiten der Region hervorgegangen ist, befindet sich im Seebezirk. Früher gehörte dieser südliche Teil des Bezirks zu den Anciennes Terres, die damals administrativ den weiten Raum um die Stadt Freiburg ausmachten.
Barberêche, und erst recht Courtepin, werden von der Strecke des berühmten Murtenlaufs kurz vor dem mörderischen Aufstieg von La Sonnaz durchquert. Dieser jährliche Straßenwettlauf erinnert an die Schlacht von Murten (22. Juni 1476), in der die Eidgenossen Karl den Kühnen besiegten. Das geschah fünf Jahre vor dem Beitritt Freiburgs zum Bund der alten Schweizer Kantone.
Indem ich als Ausgangspunkt den Raum der Stadt Freiburg wähle, verlagere ich mich etwas abseits der Klassischen Via Francigena, deren Strecke auf Schweizer Boden mit dem Col de Jougne beginnt und der Route 70 entspricht, mit den grünen Markierungen auf gelbem Pfeilgrund. Die 215 Kilometer der Schweizer Strecke führen über Vallorbe, Romainmôtier, Orbe, Lausanne, Vevey, Montreux, Saint-Maurice, Martigny, Orsières, Bourg-Saint-Pierre und den Großen Sankt Bernhard (cf. Micheline Cosinschi, Ne pas marcher idiot. Un nouveau regard sur le paysage. Sentiers intelligents).
Der Abstecher durch Freiburg ist also kein abtrünniger Umweg. Von Pontarlier an werde ich ohnehin auf die «klassische» Route zurückkommen. Wenn es in der Zeit von Sigerich Freiburg gegeben hätte, wäre er angesichts der späteren Rolle, die die Stadt im Uechtland als Hochburg des Schweizer Katholizismus gespielt hat, sicherlich dort vorbeigekommen.
Um den kürzesten Weg zu nehmen, verleitet mich der Freiburger Abstecher, das östliche Ufer des Neuenburgersees anzupeilen. So berühre ich die Städte Murten und Neuenburg (Neuchâtel), nicht aber Yverdon-les-Bains, das mich rascher auf die Via zurückführen würde als die Wanderung durch das Val de Travers und über La Brévine. Eine Variante wäre Avenches, westlich des Murtensees, dann entlang der Nordwestseite des Mont Vully, zwischen den beiden Seen von Murten und Neuenburg, über Salavaux und Cudrefin. Das größte Defizit all dieser Trassen: Man lässt Romainmôtier, clunisianische Abtei, Meisterwerk der romanischen und gotischen Baukunst, errichtet zwischen dem 10. und 12. Jahrhundert, abseits liegen. Es ist eine der ältesten Kirchen der Schweiz, mit ursprünglichen Fundamenten aus dem 5. Jahrhundert.
Um sechs Uhr morgens also, an diesem 28. August 2018, als ein herrliches, aber erblassendes Mondlicht vergeblich mit dem ersten Schimmer der Morgendämmerung kämpft, nehme ich den holprigen Weg hinter dem Bauernhof Angéloz in Angriff. Barberêche ist immer noch verträumt und genießt es, dass der Tag Mühe hat, die Dunkelheit der schwindenden Nacht zu verdrängen.
Ich habe es jedoch nicht für notwendig gehalten, mich mit meiner Stirnlampe auszurüsten, weil ich mich nämlich noch in vertrautem Gelände befinde. Zunächst einmal begehe ich diese Strecke jeden Morgen und kenne sie wie meine Hosentasche. Ich weiß sogar, auf welchen Weiden sich die Frühaufsteher unter den Rehen tummeln. Mein Gedächtnis erinnert sich auch an alle Schlaglöcher und ich verstehe es, selbst im Dunkeln, die hartnäckigsten Lachen zu vermeiden. Ich bin bereits über die meisten der herausragenden Stoppel gestolpert oder in die nassen Tümpel getreten und nehme mich an den kritischen Stellen in Acht. Wie auch immer, aufgrund der extremen Dürre in diesem Sommer haben selbst die trotzigsten Pfützen schließlich den Verdunstungszustand angezeigt. Was die herausgequollenen Wurzeln betrifft, so können sie unachtsame Fussgänger blitzschnell hinlegen, vor allem jedoch bei nassem Wetter.
Aus welchem Grund sind meine Empfindungen heute anders als üblich? Ach ja, es ist das erste Mal, dass ich den traditionellen Weg meines täglichen Marsches mit einem Rucksack und zwei Trekking-Stöcken beschreite. Gut, dass die Rehe nicht da sind. Das hätte sie erschreckt. Mit Stöcken wird der Mensch wieder Vierbeiner! Ich entdecke dabei den Wandel, von dem Michel Gallet spricht:
– «L’on ne marche pas de la même manière avec et sans sac à dos» («Mit oder ohne Rucksack marschiert man nicht auf dieselbe Weise», Gaële de la Brosse, Le petit livre de la marche, Editions Salvator, 2019, S. 111).
So oder so sind meine Gefühle heute ganz anders als meine alltäglichen Routinen auf diesem hohlen Pfad, der mich auf die Höhen des Weilers Breilles führt:
– Heute bin ich auf dem Weg nach Canterbury!
Ich bin ganz ergriffen. Nicht aus den gleichen Gründen wie bei der Abreise nach Rom, wo mir die lange Strecke wie ein unüberwindbarer Berg erschien. Dieses Mal ist die Stimmung festlich. Ich kenne das Glück, das auf mich zukommt. Nach einigen Monaten der Entwöhnung habe ich ein leichtes Herz und einen rüstigen Schritt, indessen ich mich in dieser Erwartung des Reisenden, des Pilgers, wiederfinde. Warten wir ab. Aber meine fröhliche Seele erinnert sich an all die schönen Momente, die mit diesen ersten Hektometern verbunden sind, die vom blassen Licht des Mondes erhellt werden:
– Ist es nicht so, dass wir auf diesen Hängen hinter dem Hof mit unseren Kindern Ski gefahren sind, als die Winter noch schneereich waren? Und als wir in den Wald gingen, war das nicht der Ort, an dem wir heruntergefallenes Holz sammelten, entlang der «schnurgeraden Strecke», welche die Waldarbeiter geschaffen hatten? Wir nannten sie Nationale 7 und neckten damit die beiden Förster und Brüder Pierre und Maurice Pauchard, die so stolz darauf waren.
Ich überquere ganz in Gedanken versunken den Ort, den ich für den Höhepunkt des Seebezirks halte. Ich beharre darauf, denn die meisten Leute sind ahnungslos und überzeugt, dass der höchste Fleck der Region auf dem Gipfel des Wistenlachs (Mont-Vully) liegt. Sie wissen nicht, dass letzterer 653 Meter hoch ist, während der Mont Breilles knapp 670 Meter übertrifft!
Und schon bin ich auf dem leichten Abstieg zum Dorf Cordast. Kurz vor 7 Uhr. Gerade recht für die erste Pause. Wenige oder gar keine Anpassungen sind erforderlich. Ich bin auch kein Anfänger mehr, wie bei meiner Abreise nach Italien. Ich bin zuversichtlich, vor allem aufgrund der Tatsache, dass ich mich auf einen Tagesausflug beschränke, was die Ausrüstung erheblich vereinfacht.
Großguschelmuth, Kleinguschelmuth, Cressier-sur-Morat, Münchenwiler (Villars-les-Moines) erinnern zur Genüge daran, dass hier Deutsch und Französisch Verstecken spielen, sich überschneiden, sich gegenüberstehen und sich Stirne bieten. In Cressier halte ich einen Moment vor der Gedenktafel von Gonzague de Reynold an. Als Schriftsteller, Historiker und Denker war er der Ursprung der Neuen Helvetischen Gesellschaft. Von der Terrasse seines Schlosses aus genießt man einen herrlichen Blick auf die Berner Alpen, den Eiger, den Mönch und die Jungfrau.
Ich fotografiere den Grenzstein, der vor Münchenwiler daran erinnert, dass man vorübergehend bernischen Boden betritt. Sobald wir in der Enklave unseres achtbaren Nachbarn mit dem Wappen des Bären angekommen sind, befinden wir uns nur noch einen Steinwurf von Murten entfernt, das seit zweihundert Jahren komplett freiburgisch ist.
Ich gehe unter dem Bodemünzi vorbei, die Erhöhung, von der aus Karl der Kühne, damals 43 Jahre alt, seine Truppen vor der berühmten Schlacht von Murten im Jahre 1476 versammelte. Dieser Kriegsvorfall ist einer der beiden wichtigen historischen Momente für unser Land, die zu Beginn dieses Kapitels angekündigt worden sind. Die Schlacht von Murten war nicht nur entscheidend für die Prägung der Einheit und Solidarität der Eidgenossen, sie war auch maßgebend für den Beitritt Freiburgs in die Eidgenossenschaft fünf Jahre später, anno 1481. Ein historischer Moment für Freiburg, aber auch für die ganze Schweiz, da es der erste mehrheitlich französischsprachige Kanton war, welcher der jungen Konföderation beitrat. Mit ihm entstand eines der Grundmerkmale unserer Identität, die Schweizer Mehrsprachigkeit.
Von diesen patriotischen Emotionen angespornt, durchquere ich den neuen und wunderschönen Schulkomplex von Prehl. Eine meiner Enkelinnen, Amandine, muss gerade in ihrem Klassenzimmer sein, ohne zu wissen, dass ich vorbeigehe.
Um 8:30 Uhr bin ich bereits am Murtensee. Ich trinke einen Kaffee im «Schiff». Der Weg führt jetzt am Seeufer entlang und zieht sich weiter nach Muntelier. An diesem Ort lebten unsere Vorfahren, die Pfahlbauer. Dann kommt die Durchquerung des Chablais, innerhalb eines Waldes, der weitgehend dem freien Lauf der Natur überlassen bleibt. Wenn man bedenkt, dass dieses ganze Gebiet der Drei Seen in der Vergangenheit ein riesiges Sumpfgebiet war, mit den damit verbundenen Plagen: Mücken, Malaria, Armut. Erst durch die sukzessiven Korrekturen der Gewässer am Fusse des Jura wurde die Region saniert und für die Landwirtschaft zurückgewonnen. Heute wird im Großen Moos ein erheblicher Teil des von den Schweizern konsumierten Gemüses produziert.
In Sugiez mache ich eine lange Pause am Broye-Kanal. Ich habe einen herrlichen Blick auf den Wistenlacher Berg (Mont Vully) und seine Weinberge. Es ist ein Gebiet, das eine der frühesten permanenten Siedlungen der Schweiz beherbergte. Der richtige Moment, um von der zweiten historischen Tatsache zu sprechen, die mir die Etappe des Tages inspiriert. Denn an den Hängen dieses großen Hügels – oder kleinen Berges – wurde das Modell eines Oppidums, das heißt eine befestigte Siedlung der Kelten, rekonstruiert. Von dort aus, glaubt man, seien die Helvetier nach Gallien aufgebrochen, um von den sechs römischen Legionen in der Nähe von Bibracte, im heutigen französischen Morvan, 58 v. Chr., gestoppt zu werden, wie Julius Cäsar selbst in seiner Schilderung Der Gallische Krieg berichtet. Es ist das erste Mal, dass unser Land und seine Vorfahren in die Schlagzeilen der Geschichte des Kontinents gelangen. Man kann sich fragen, ob Divico, ihr Anführer, sich nicht im Sinne einer Weisheit des französischen Philosophen Helvetius blenden liess (lateinischer Name für Claude-Adrien Schweitzer):
– «Man muss nur wollen, das war das Prinzip des Helvetius» (zitiert von Georg Christoph Lichtenberg, Aphorismes, éditions de l’Aire, no 133, S. 144).
Divico fehlte es jedenfalls nicht an Mut. In den Verhandlungen mit den Römern soll er die Formel verwendet haben:
– «Die Helvetier liefern keine Geiseln, aber sie sind es gewohnt, Geiseln zu nehmen» (cf. Historisches Lexikon der Schweiz).
Das hat sie nicht davor verschont, gezwungen zu werden, in ihre Heimat zwischen dem Genfersee und dem Jura zurückzukehren. Es ist erstaunlich, dass unsere keltischen Vorfahren weniger bekannt und verehrt werden als die drei Eidgenossen des Rütlischwurs. Dennoch sind wir tatsächlich Nachkommen dieser Völker, und Divico, ihr Anführer in Bibracte, ist der erste unserer Nationalhelden, wie Conrad Ferdinand Meyer es festhielt, ebenso wie Wilhelm Tell oder General Guisan.
Heutzutage ist Sugiez von zwei Strafvollzugsanstalten umgeben, dem Freiburger Bellechasse und dem Berner Witzwil. Der Weg entlang des Broye-Kanals, der sie über mehrere Kilometer trennt, ist prachtvoll. Man geht wie auf einem Teppich und sieht von Zeit zu Zeit ein Boot oder ein Motorboot, das vom Neuenburger- zum Murtensee oder in umgekehrter Richtung fährt. Ich habe Glück, denn bei meiner Ankunft auf der Rotary-Brücke ist es genau das Schiff Stadt Neuenburg, welches darunter vorbeigleitet und mir das perfekte Klischee anbietet. Dies erinnert daran, dass dieser Kanal sehr breit und tief ist, damit Schiffe mit stattlicher Tonnage dort vorbeifahren können. Nebenbei bemerkt, der Pegel der beiden Seen – 429 Meter über dem Meer – ist der Tiefpunkt der beiden Kantone Freiburg und Neuenburg.
Die «Rotary-Brücke», die den Fußgängern und Radfahrern erlaubt, den Kanal zu überqueren, wurde mit langen Rampen hoch genug konzipiert, damit stattliche Boote noch darunter durchschlüpfen können. Dieser obligatorische Punkt der Überquerung liegt auch am Anschluss des Abschnitts Basel–Jura–Drei Seen an den Jakobsweg. Gemäß dem Schild, das dort steht, hätte ich noch 2193 Kilometer bis Compostela zurückzulegen.
Tatsächlich sind es noch vier Kilometer, um zur Tagesetappe nach Ins zu gelangen. Man kann den Namen Ins nicht aussprechen, ohne an den bedeutenden Maler des Berner Landlebens und der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, Albert Anker, zu denken. Die Szenen aus dem täglichen Leben der Bauern, ihrer Dörfer und ihrer Familien sind sehr aussagekräftig und anschaulich. Schade, dass Christoph Blocher die schönsten seiner Werke zusammengerafft hat, um sie zu seiner Sammlung zu machen. Als Kind mochte ich die sehr beliebten Themen, die in Form vieler Reproduktionen in der Werkstatt und im Laden meiner Eltern hingen. Ich befürchte, dass diese Kunst durch diese Beschlagnahmung vom Volkstümlichen zum Gegenstand einer populistischen Instrumentalisierung wird.
Mittags bin ich bereits im Zug, der von Ins über Murten und Freiburg bis nach Bulle fährt. Der Konvoi hält auch in meiner Gemeinde an. Heutzutage zweimal sogar, denn nach der Fusion gibt es jetzt zwei Bahnhöfe auf ihrem Territorium: Courtepin und Pensier. Das bietet die Gelegenheit, die an diesen beiden Stationen durchgeführten Modernisierungen zu bewundern.
Festival der Natur und der Urbanität am Fuße des Jura
2. Etappe: Ins (BE) – Chambrelien (NE), 26 km
8. September 2018
Es ist frappant. Heute habe ich manchmal das Gefühl, zum zweiten Mal die Strecke der ersten Etappe zu begehen. Besonders zu Beginn des Abschnitts, der wie ein Zwilling an den vorigen Ausflug erinnert. Als ich kurz nach 7 Uhr morgens in Ins aus dem Zug steige, überquere ich zuerst die letzten Felder des Großen Mooses. Dann geht es entlang des Sees auf seiner ganzen Breite durch dicht bewaldete Gebiete, mit in den Himmel ragenden Bäumen. Ich muss mich konzentrieren, um die Überquerung des breiten Kanals nicht zu verpassen. Zwar gehören die endlosen Gemüsefelder zur gleichen weiten, ebenen Fläche des Seelands, das sich zwischen den drei Jura-Seen erstreckt. Aber mit dem Unterschied, dass es diesmal der Neuenburgersee ist – mit 218 km2 der größte sich ganz in der Schweiz befindende See, zehnmal so ausgedehnt wie der Murtensee – und dass der Wald, den ich durchquere, nicht jener des Chablais ist, sondern des Fanel- und Cudrefin-Reservats, und dass der Wasserweg nicht Broye-, sondern Zihlkanal (Thièle) heißt.
In Ins, nachdem ich den Ort ja bereits bei der Ankunft der vorherigen Etappe ausgekundschaftet habe, kann ich mich ganz dem Spektakel der aufgehenden Sonne widmen und mich im Kontakt mit der morgendlichen Frische aufheitern. Ich kenne mein erstes Ziel, den Tannenhof, friedlich, etwas abseits vom See und auch vom Berner Gefängnis Witzwil angelegt. Hier erfahre ich von der Tannenhof-Stiftung, deren Ziel die Wiedereingliederung von Männern und Frauen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen ist. Sie wurde bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts gegründet, um in einem landwirtschaftlichen Umfeld den Pensionären einen belebenden und familiären Rahmen zu bieten. Ich mache meine erste Pause und der gesamte Komplex gibt mir einen erholsamen Eindruck der Nähe zur Natur, der Ausübung einer verantwortungsbewussten Landwirtschaft und einer geordneten und angenehmen Umgebung.
Wie der Ortsname verrät, ist der Wald nicht weit entfernt. Also betrete ich das Gehölz der beiden bedeutenden Reservate von Fanel und Cudrefin. Der Weg zeichnet, wie beim Chablais, eine lange gerade Linie, von der man kaum das Nadelöhr am anderen Ende erraten kann, durch welches man sich schlängeln sollte, um wieder herauszukommen.
Ich habe zwei Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Orientierung. Die erste liegt an den Landkarten. Seit dem Start von Barberêche und bis hierher befindet sich die gesamte Strecke auf dem gleichen Blatt Nr. 242 Avenches der Wanderkarte Schweiz 1:50 000. Der Tannenhof befindet sich ganz in der Nähe des oberen Randes des Blattes, während die nordöstliche Spitze des Neuenburgersees, einschließlich der Brücke über die Zihl, sich bereits auf dem benachbarten Blatt Nr. 232 Vallon de Saint-Imier befindet. Also muss ich die Karten für eine kurze Zeit austauschen, denn schon in Neuenburg werde ich wieder zurück auf meinem ursprünglichen Plan sein. Da das Aufteilen zwischen den verschiedenen Blättern bündig erfolgt, das heißt ohne Überschneidung, ist es nicht einfach, die Anschlusspunkte von einer Karte zur anderen zu finden. Glücklicherweise wird in Zukunft die vom Bundesamt für Landestopografie zur Verfügung gestellte interaktive digitale Karte swisstopo dieses Nahtproblem lösen.
Die zweite Klippe ist, dass auf meinem Blatt Nr. 232, Vallon de Saint-Imier, die Fußwege nicht vermerkt sind. Ich bin mir nicht im Klaren, ob der Übergang der Eisenbahnbrücke über den Zihlkanal für Fußgänger begehbar ist. Ich könnte die SchweizMobil-Karte auf meinem Handy einsehen. Aber es verbleiben immer noch Zweifel. Um es herauszufinden, frage ich eine Passantin, die einzige Person, die ich hier treffe und die ihre beiden Hunde spazieren führt:
– Entschuldigen Sie, Madame, sind Sie mit der Gegend vertraut? Können Sie mir sagen, ob dieser Weg zur Brücke über die Zihl führt? Und ist letztere für Fußgänger zugänglich?
– Ja, das ist so. Am Ende des Waldes biegt der Weg leicht nach links ab und führt Sie zum Durchgang unter der Bahnstrecke. Von dort ziehen Sie noch leicht nach links und erreichen die Zihlbrücke, die auf Ihrer Karte angezeigt ist. Sie können sie nicht verpassen. Wenn Ihnen FKK-Anhänger begegnen – sie benutzt den Mundartbegriff Blüttler – heißt das, dass sie zu weit nach Osten und Norden geraten sind, wo sich diese nackten Camper aufhalten.
Mit all diesen Anhaltspunkten bleiben keine Zweifel mehr offen. Ich trete aus dem Wald und schlüpfe unter der Bahnstrecke durch den schmalen Fußgängertunnel. Angesichts des erhöhten Gitters, das als Trittbrett dient, muss sich der Ort bei Unwetter mit Wasser füllen. Heute gibt es kein Problem dieser Art, und ich komme ohne Schwierigkeiten zum Kanal und zur berühmten Brücke. Ich habe mich nicht verirrt. Beweis dafür ist, dass ich keine FKK-Leute getroffen habe. Aber es ist auch ziemlich kühl, heute Morgen.
Von der Bahnstation, die sich unmittelbar vor der Brücke befindet, ermöglicht ein Steg, der am Bauwerk der Eisenbahn befestigt ist, dem Wanderer sicheren Schrittes auf die andere Seite zu gelangen. Dabei kann ich ermessen, wie viel breiter der Zihlkanal als jener der Broye ist. Vor allem aber bin ich mir des ungewöhnlichen Charakters dieses Übergangs bewusst: Es gibt nur wenige Brücken, die gleichzeitig und ausschließlich Zügen und Fußgängern vorbehalten sind! Es gibt jene von Grandfey, in der Nähe von Freiburg, jene von Vallorbe über die Orbe und auch das gewaltige Bauwerk von Chaumont in Frankreich. Aber in diesen drei Fällen erfolgt dies auf zwei verschiedenen Ebenen und in einem größeren Maßstab.
Dieser Flusslauf geht auf die erste Korrektur der Juragewässer (1868–1878) zurück. Der Kanal ersetzte damals das alte, mäanderreiche Flussbett der Zihl und verband die Seen von Neuenburg und Biel mit einer Wasserstraße. Bei diesen ersten hydraulischen Anlagen wurde der Pegel der drei Seen von Biel, Neuenburg und Murten um 2,5 Meter gesenkt. Um Hochwasser in der Aare, die in die Zihl mündete, zu vermeiden, führt der Hagneck-Kanal nun den bedeutendsten Fluss des Schweizer Mittellandes direkt in den Bielersee. Die Vollendung dieser Arbeiten erfolgte im Zuge der zweiten Korrektur (1962–1973). All diese Neuerungen ermöglichten es, ein ausgedehntes Sumpfgebiet zu sanieren, das von den Überschwemmungen der Aare bedroht war, wertvolles Ackerland zurückzugewinnen und die archäologischen Schätze zu entdecken, die die Vergangenheit dieser früh besiedelten Region veranschaulichen.
Sobald die Zihlbrücke überquert ist, ergibt sich der weitere Verlauf problemlos. Man folgt einfach dem Ufer des Neuenburgersees, entlang den Stränden von Tène, Epagnier, Marin, Saint-Blaise und Hauterive. Der aufziehende Morgen ist kühl, die Sonne glitzernd und der Himmel in ein zartes und makelloses Blau gekleidet. Ich befinde mich auf dem Sentier du Lac, der mich bis nach Auvernier führen wird. Ein wahres Vergnügen für den Wanderer, aber auch für die Bewohner dieses geräumigen urbanisierten Gebiets. Hier findet sich alles, was man für Freizeit und Sport braucht, natürlich in erster Linie wassersportlich.
In Tène erfreue ich mich der Sonne, die über dem Abfluss des Zihlkanals und der friedlichen und festlichen Landschaft am Samstagmorgen aufgeht. Einige Hütten – wovon gewisse mit Ehrgeiz beanspruchen, echte Häuser zu sein – verraten die Glückspilze, denen es gelang, diese ruhigen Orte für ihre Zweitwohnungen zu entdecken. Auf den Sockeln, die von massiven Steinen oder einigen behelfsmäßigen Anlegestegen gebildet werden, beenden Schwäne, Reiher, Enten und andere Wasservögel ihre Dehnungen nach dem Erwachen und verrichten ihre morgendliche Toilette. Die Gestaltung und die Markierung dieses langen Weges sind fast lückenlos.
Am Anfang verläuft der Sentier du Lac gelegentlich im Innern der Dickichte und Böschungen. Es gibt auch einige widerspenstige Eigentümer, die den Spaziergängern die Bereitstellung der Ufer des Sees verweigern, wie es das Gesetz eigentlich vorsieht. Zeitweise weicht der Seeweg ab und muss Umwege außerhalb der Siedlungen machen, manchmal sogar entlang der Hauptstraße, die das Stadtzentrum verbindet. Ich befürchte, dass ich mich in der Lage der Tyrrhenischen Küste in Italien wiederfinde, die mich analog zu der Frage inspiriert:
– Aber wo ist denn der See?
– Ach! Leider ist in diesem Rechtsstaat, den wir so sehr rühmen, die Justiz noch nicht für alle Anlieger die gleiche!
Im Laufe des Vorankommens muss ich jedoch feststellen, dass dieser erste Eindruck irreführend ist und dass Verstöße gegen die Barrierefreiheit die Ausnahme sind. Alles in allem entsteht allmählich ein Gefühl der Begeisterung, das mich schließlich vom «Festival der Natur und der Urbanität am Fuße des Jura» sprechen lässt.
Es gibt zahlreiche Faktoren, die die belebende Atmosphäre dieses göttlichen Morgens erklären. Das schöne Wetter, zweifellos, hilft mit, gelegentliche Hässlichkeiten und Regelbrüche zu übertuschen. Die glücklichen Einflüsse und Spuren der Expo 2000 können nicht abgestritten werden. Dies war zweifellos ein Anreiz für die Verschönerung des Areals. Im archäologischen Museum des Laténium von Hauterive, das sich über 2 500 m2 erstreckt, wird uns das Alter der menschlichen Anwesenheit in dieser Region bewusst. 50 000 Jahre Geschichte, heißt es! Ich frage mich jedoch, ob diese Annahme nicht etwas übertrieben ist, wenn man bedenkt, dass die Menschheit erst seit 160 000 Jahren existiert und sich mindestens die Hälfte dieser Zeit in Afrika konzentriert hat. Zugegeben, selbst die viel weiter entfernte Besiedlung Australiens ist von Historikern auf 50 000 bis 100 000 Jahre geschätzt worden.
Ich treffe viele Leute, die die Gnade der Stunde genießen. Einige Jugendliche üben sich beim Windsurfen, andere machen ihre Liegestütze im Rasen, es hat Radfahrer, Roller, Jogger, und sogar Wanderer werden entlang der Ufer aktiv. Hunde sind an der Leine gehalten. Und das aus gutem Grund. Fast alle 100 Meter weisen Schilder darauf hin, dass die Geldstrafe für freigelassene Hunde 150 Franken beträgt.
Mit der Sonne, die bis gegen Mittag steigt, verdrängen die Mühen des Gehens nach und nach die harmonischen Auswirkungen dieser städtischen Idylle. Die Sonne wird brennender, es gibt viel Teer oder monumentale Eingriffe, wie die Einrichtungen aus Beton, die die Autobahn verbergen. Das sollte uns aber nicht daran hindern, die Erbauer dieser Verkehrsachse zu beglückwünschen, denn an der Oberfläche ist dieses gewaltige Werk über seine gesamte Länge fast unsichtbar. Ein weiterer Schönheitsfehler sind meiner Meinung nach die endlosen Gitter entlang des riesigen Gebäudes von Philip Morris und dieser ganzen Industriezone, die mich an die Zäune denken lassen, die Präsident Orban um sein Land, Ungarn, errichtet hat. Glücklicherweise kommt jenseits von Serrières der Pfad im Gras entlang des Sees dem Wanderer, der die Müdigkeit spürt – und den Ärger –, zugute.
Ich mache mehrere Pausen auf diesem Weg: Tène, Laténium, Maladière, Place Pury und Aubonne. So habe ich Zeit, an die vielen Persönlichkeiten zu denken, die ich in der Region kannte. Dies ist der Fall entlang des Quai Max Petitpierre, der nach Serrières führt. Ich hatte zwar nicht das Glück, diesen geachteten Außenminister der Nachkriegszeit persönlich zu kennen, der sich so sehr unserer Neutralität verpflichtet fühlte. Ich spüre mich aber der Politik, die er vertreten hat, verbunden. Das erinnert mich auch daran, dass bei der Abstimmung über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), am 6. Dezember 1992, der Kanton Neuenburg mit einer Mehrheit von 80 Prozent einer der Vorkämpfer für das Ja war! Hätte Petitpierre das auch so gewollt?
Und da ist auch die Universität von Neuenburg, wo ich zusammen mit Professor Gaston Gaudard häufig mit zwei führenden Spezialisten für regionale Wirtschaft und politische Ökonomie zusammengearbeitet habe, den Professoren Denis Maillat und Claude Jeanrenaud. Letzterer war auch ein begeisterter Weltenbummler. Ich kannte auch Milad Zarin, der meine Vertretung an der Universität Freiburg für den Mikroökonomiekurs während meines Sabbaticals und nach meiner Wahl in den Bundesrat übernahm. Schließlich, als Schüler der Handelsschule am Kollegium Sankt Michael in Freiburg, mussten wir das Lehrbuch «Einführung in die Volkswirtschaftslehre» von Richard Meuli büffeln. Für die Matura im Jahr 1964 mussten wir das Werk praktisch auswendig kennen.
– Du solltest nun lieber mit dem Sinnieren über vergangene Zeiten aufhören. Das macht dich nur melancholisch.
– Keine Sorge, es dauert nie sehr lange.
Wie versprochen bin ich rasch wieder bei den Realitäten der Straße. Vor allem, weil sich die Topografie ab Auvernier verändert. Hier wird das Jura-Massiv in Angriff genommen. Es ist die zweitgrößte Bergkette der Schweiz und gleichzeitig eine der drei wichtigen topografischen Regionen des Landes. Da ich mich entschieden habe, bis Pontarlier abseits der Via Francigena zu wandern, werde ich schnell wieder von Begriffen eingeholt, die man uns bereits in der Primarschule beigebracht hat:
– Ich erreiche den Faltenjura. Das fällt mir wieder ein, denn es ist wirklich nicht einfach, die besten Übergänge zu finden, um die parallel verlaufenden Wellen und Furchen zu durchqueren, die sich dem Kurs, den ich in Richtung Besançon einschlagen muss, widersetzen.