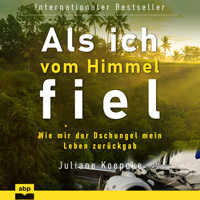3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
»Für mich war der Dschungel nie eine grüne Hölle, sondern ein Ort, der mich am Leben hielt.« Die Geschichte der Juliane Koepcke, die als 17-Jährige nach einem Flugzeugabsturz elf Tage lang allein im Dschungel überlebte In »Als ich vom Himmel fiel« schildert Juliane Koepcke ihren beeindruckenden Überlebenskampf im peruanischen Regenwald und erzählt, wieso sie der »Grünen Hölle« ihr Leben verdankt. Was Juliane Koepcke passierte, als sie gerade einmal 17 Jahre alt war, grenzt an ein Wunder: Bei einem Flugzeugabsturz über dem peruanischen Regenwald fiel sie 3000 Meter in die Tiefe. Das dichte Blätterdach des Dschungels federte den Sturz ab. Sie war die einzige Überlebende des Crashs – das Flugzeug riss 91 Menschen in den Tod, unter ihnen auch Juliane Koepckes Mutter. Doch damit begann ein Überlebenskampf, der elf Tage dauern sollte – fernab jeglicher Zivilisation und ohne Versorgung, ganz allein mitten im tropischen Dschungel. Am Ende, sagt Koepcke, war es trotz allem der Regenwald, der ihr das Leben rettete. Viel ist über die beeindruckende junge Frau seit dem Flugzeugabsturz im Jahr 1971 bisher berichtet worden. In ihrem Buch erzählt Juliane Koepcke Jahrzehnte später selbst die unfassbare Geschichte ihres Unfalls, wie die Autorin den Absturz nennt, und ihres Kampfs zurück ins Leben. Denn erst nach ihrer Rückkehr konnte sie anfangen, den Verlust ihrer Mutter zu verarbeiten. Medienstar wider Willen: Jetzt erzählt Juliane Koepcke ihre Lebensgeschichte selbst In den ersten Jahren rissen sich die Medien um die junge Frau, die als einzige den furchtbaren Absturz überlebte und sich elf Tage lang allein in der Wildnis durchschlug. Gemeinsam mit Koepcke verfilmte der prämierte Regisseur Werner Herzog die Geschichte unter dem Titel »Julianes Sturz in den Dschungel« (1998). Flammendes Plädoyer für die Bewahrung des Regenwaldes Man könnte meinen, nach ihrem Überlebenskampf hätte Juliane Koepcke dem unwirtlichen Dschungel für immer den Rücken gekehrt. Doch ganz im Gegenteil: Die Tochter zweier Biologen studierte selbst Biologie und wurde später stellvertretende Direktorin der Zoologischen Staatssammlung München und engagierte Umweltschützerin. »Als ich vom Himmel fiel« ist eine berührende Liebeserklärung an die Lebenskraft der Urwälder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Titelei
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de Für meine Mutter,die ihr kurzes Leben der Vogelwelt Perus widmete und viel zu früh von meiner Seite gerissen wurde Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe 1.Auflage 2011 ISBN 978-3-492-95282-8 © Piper Verlag GmbH, München 2011 Textfassung: Juliane Koepcke in Zusammenarbeit mit Beate Rygiert Konzeption und Realisation: Ariadne-Buch, Christine Proske, München Redaktion: Gabriele Ernst, Icking Umschlag: Birgit Kohlhaas, Egling Umschlagmotive: Remi Benali/Corbis (oben); Erich Diller (unten)
1 Mein neu geschenktes Leben
Kapitelanfang
Viele Menschen wundern sich, wie ich es schaffe, noch immer in Flugzeuge zu steigen. Denn ich gehöre zu den wenigen, die einen Flugzeugabsturz aus großer Höhe überlebt haben. Eine Katastrophe, die sich 3000Meter über dem peruanischen Regenwald ereignete. Doch damit nicht genug: Danach schlug ich mich elf Tage lang auf mich allein gestellt durch den Dschungel. Damals, als ich vom Himmel fiel, war ich gerade mal 17Jahre alt.
Heute bin ich 56. Ein gutes Alter, um sich zu erinnern. Ein guter Zeitpunkt, um sich alten, nie verheilten Wunden zu stellen und die Erinnerungen, die nach all den Jahren genauso frisch und lebendig sind, mit anderen Menschen zu teilen. Der Absturz, den ich als Einzige überlebte, hat mein weiteres Leben geprägt, ihm eine neue Richtung gewiesen und mich dahin geführt, wo ich heute bin. Damals waren die Zeitungen in aller Welt voll mit meiner Geschichte. Darunter waren aber auch viele Halbwahrheiten und Berichte, die mit den tatsächlichen Begebenheiten wenig zu tun hatten. Sie sorgten dafür, dass mich auch heute noch ständig Menschen auf den Absturz ansprechen. Jeder scheint meine Geschichte zu kennen, und doch hat kaum jemand eine echte Vorstellung davon, was damals wirklich geschah.
Natürlich ist es nicht so einfach zu verstehen, dass ich nach elf Tagen Überlebenskampf in der »Grünen Hölle des Dschungels« den Regenwald immer noch liebe. Die Wahrheit ist: Für mich war er niemals eine »Grüne Hölle«. Damals, als ich aus so großer Höhe auf die Erde stürzte, rettete mir der Wald das Leben. Ohne die abmildernde Wirkung der Blätter von Bäumen und Büschen hätte ich den Aufprall auf den Boden niemals überleben können. Während meiner Ohnmacht hat er mich vor der tropischen Sonne beschirmt. Und später half er mir, aus der unberührten Wildnis meinen Weg zurück in die Zivilisation zu finden.
Wäre ich ein reines Stadtkind gewesen, die Rückkehr ins Leben wäre mir nicht gelungen. Mein Glück war es, dass ich bereits einige Jahre meines jungen Lebens im Urwald verbracht hatte. Meine Eltern hatten 1968 ihren Traum in die Tat umgesetzt und mitten im peruanischen Regenwald eine biologische Forschungsstation gegründet. Damals war ich 14Jahre alt und nicht sonderlich begeistert davon, meine Freundinnen in Lima zurückzulassen und mit Eltern, Sack und Pack und Hund und Wellensittich in die »Einöde« zu ziehen. Jedenfalls stellte ich es mir damals so vor, obwohl mich meine Eltern schon von Kindesbeinen an auf ihre Expeditionen mitgenommen hatten.
Der Umzug in den Urwald war ein echtes Abenteuer. Dort angekommen, verliebte ich mich sofort in dieses Leben, so einfach und bescheiden es auch sein mochte. Fast zwei Jahre lang lebte ich in Panguana, wie meine Eltern die Forschungsstation nach einem einheimischen Vogel getauft hatten. Ich wurde von ihnen unterrichtet und ging ansonsten in die Schule des Urwalds. Dort lernte ich seine Regeln, seine Gesetze und Bewohner kennen. Ich machte mich mit der Pflanzenwelt vertraut, erschloss mir die Welt der Tiere. Nicht umsonst war ich die Tochter zweier bekannter Zoologen: Meine Mutter, Maria Koepcke, war die führende Ornithologin Perus. Und mein Vater, Hans-Wilhelm Koepcke, ist der Verfasser eines wichtigen Gesamtwerks über die Lebensformen der Tier- und Pflanzenwelt. In Panguana wurde der Urwald zu meinem Zuhause, und dort lernte ich, welche Gefahren in ihm drohen und welche nicht. Ich war vertraut mit den Verhaltensregeln, mit denen ein Mensch in dieser extremen Umgebung überleben kann. Bereits als kleines Kind wurden meine Sinne geschärft für die unglaublichen Wunder, die dieser Lebensraum in sich birgt, der im Hinblick auf die biologische Vielfalt, die Biodiversität, weltweit eine Spitzenposition einnimmt. Ja, schon damals lernte ich, den Urwald zu lieben.
Jene elf Tage fernab von Siedlungen mitten im Tropischen Regenwald, elf Tage, während deren ich keine menschliche Stimme hörte und nicht wusste, wo ich mich befand, jene ganz besonderen Tage haben meine Verbundenheit noch vertieft. Damals bildete sich ein Band zwischen mir und dem Urwald, das mein späteres Leben entscheidend beeinflusst hat und es auch heute noch tut. Früh lernte ich, dass man nur vor Dingen Angst hat, die man nicht kennt. Der Mensch hat die Tendenz, alles zu vernichten, wovor er sich fürchtet, selbst wenn er dessen Wert noch gar nicht ermessen kann. Während meines einsamen Wegs zurück in die Zivilisation habe ich mich oft gefürchtet, aber niemals vor dem Urwald. Er konnte nichts dafür, dass ich in ihm gelandet war. Die Natur ist immer gleich, ob wir da sind oder nicht, es kümmert sie nicht. Wir aber– auch das habe ich während jener elf Tage am eigenen Leib erfahren– können ohne sie nicht überleben.
Das alles ist für mich Grund genug, die Erhaltung dieses einzigartigen Ökosystems zu meiner zentralen Lebensaufgabe zu machen. Meine Eltern hinterließen mir mit Panguana ein Erbe, das ich aus ganzem Herzen angenommen habe. Und heute führe ich dort ihr Werk in eine entscheidende Phase: Panguana, größer denn je, soll zum Naturschutzgebiet erklärt werden. Damit erfüllt sich nicht nur der Lebenstraum meines Vaters, für den er jahrzehntelang gekämpft hat, sondern wir leisten so auch einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung des Amazonas-Regenwalds, nicht zuletzt, um der globalen Klimakatastrophe entgegenzuwirken. Der Regenwald steckt nicht nur voller Wunder, von denen wir die meisten noch nicht einmal kennen. Seine Erhaltung als grüne Lunge der Erde ist auch entscheidend für den Fortbestand einer äußerst jungen Spezies auf diesem Planeten: des Menschen.
2011 jährt sich die Flugzeugkatastrophe von 1971 zum vierzigsten Mal. In all diesen Jahren wurde viel über meinen »Unfall«, wie ich den Absturz nenne, geschrieben. Unzählige Zeitungsseiten wurden mit dem gefüllt, was die Menschen für »Julianes Geschichte« halten. Darunter waren mitunter gute Beiträge, aber leider auch viele, die wenig mit der Wahrheit zu tun hatten. Es gab eine Zeit, als mich die Aufmerksamkeit der Medien fast erdrückte. Um mich zu schützen, habe ich jahrelang geschwiegen, habe ich jedes Interview abgelehnt und mich ganz zurückgezogen. Nun aber ist es an der Zeit, mein Schweigen zu brechen und zu erzählen, wie es wirklich war. Deshalb sitze ich jetzt am Flughafen München auf gepackten Koffern, um eine Reise anzutreten, die für mich aus zwei Gründen wichtig sein wird: um das Ziel zu erreichen, das Naturschutzgebiet Panguana zu errichten. Und um mich meiner Vergangenheit zu stellen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden so sinnvoll zusammengeführt. Das, was mir damals zustieß, und die Frage, warum ausgerechnet ich als Einzige die Katastrophe der LANSA überleben durfte– all das erhält nun endlich eine tiefere Bedeutung.
Und dann sitze ich im Flugzeug. Ja, die Menschen wundern sich sehr, wie ich es schaffe, immer wieder in Flugzeuge zu steigen. Ich schaffe es durch Willenskraft und Disziplin. Ich schaffe es, weil ich es schaffen muss, will ich in den Dschungel zurückkehren. Doch es ist schwer. Das Flugzeug rollt an, wir heben ab, wir steigen auf, wir tauchen tief ein in die dichte Wolkendecke am Himmel über München. Ich sehe aus dem Fenster, und auf einmal sehe ich…
2 Eine Kindheit unter Tieren
Kapitelanfang
…diese schwarzen, undurchdringlichen Wolken und zuckende Blitze. Wir sind in ein schweres Gewitter geraten, und der Pilot fliegt geradewegs in diesen Hexenkessel hinein. Das Flugzeug wird zum Spielball des Orkans. Aus Ablagen fallen Gepäckstücke und weihnachtlich verpackte Geschenke auf uns herab, Blumen und Spielsachen. Das Flugzeug stürzt unvermittelt in tiefe Luftlöcher und steigt dann rasant wieder an. Die Menschen kreischen vor Angst. Und plötzlich ist da dieser grelle Blitz über dem rechten Flugzeugflügel…
Ich atme tief durch. Über mir erlischt das Zeichen, ich kann meinen Gurt lösen. Wir sind kurz hinter München, und unser Flugzeug hat seine reguläre Flughöhe erreicht. Nach einer Zwischenlandung in Madrid werden mein Mann und ich die Maschine nach Lima besteigen. Zwölf Stunden liegen dann noch vor mir, zwölf Stunden höchster Anspannung rund zehn Kilometer über der Erde. Über Portugal werden wir dann das Festland hinter uns lassen und den Atlantik überqueren.
Will ich zurück in das Land, in dem ich geboren wurde, bleibt mir keine andere Wahl. Auch im Zeitalter des Billigflugs ist eine Reise um den halben Globus kein Kinderspiel. Ich wechsle nicht nur den Kontinent, ich wechsle auch die Zeitzone, das Klima und die Jahreszeit. Ist bei uns Frühling, bricht in Peru der Herbst an. Und selbst innerhalb Perus erlebe ich zwei verschiedene Klimazonen: die gemäßigte in Lima und die tropische im Regenwald. Vor allem aber ist es jedes Mal für mich eine Reise in die Vergangenheit, denn in Peru kam ich zur Welt, in Peru wuchs ich auf, und in Peru geschah jenes Ereignis, das mein Leben von Grund auf ändern sollte: Ich stürzte mit einem Flugzeug ab, überlebte wie durch ein Wunder sogar noch viele Tage ganz allein auf mich gestellt inmitten des Dschungels und fand den Weg zurück zu den Menschen. Damals wurde mir mein Leben ein zweites Mal geschenkt, es war wie eine zweite Geburt. Nur dass diesmal meine Mutter ihr Leben verlor.
Meine Mutter erzählte mir oft, wie glücklich sie war, damals, als sie mit mir schwanger wurde. Meine Eltern betrieben ihre intensiven Forschungen gemeinsam und liebten ihre Arbeit über alles. Sie hatten sich in Kiel während des Studiums kennengelernt, und da es im Nachkriegsdeutschland für promovierte und leidenschaftliche Biologen schwierig war, eine angemessene Stelle zu finden, hatte mein Vater sich dazu entschlossen, in ein Land mit einer hohen, noch nicht erforschten Biodiversität auszuwandern. Seine damalige Verlobte, Maria von Mikulicz-Radecki, war begeistert von dem Plan und kam nach ihrer Promotion nach, was damals ein unerhörtes Unterfangen für eine unverheiratete junge Dame war. Meinem Großvater war es gar nicht recht, dass meine Mutter die weite Reise ganz allein antrat. Doch wenn sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hatte, dann konnte man es ihr nicht mehr ausreden. Mein Mann behauptet übrigens, das hätte ich von ihr geerbt.
In der Kathedrale des Stadtteils Miraflores in Lima heirateten sie bald nach ihrer Ankunft in der Neuen Welt. Enttäuscht war meine Mutter darüber, dass sie als Katholikin meinem Vater, der evangelisch war, nicht am Hauptaltar, sondern in einer kleinen Nebenkapelle angetraut wurde. Damals waren ökumenische Heiraten in der Minderzahl, und der katholische Pfarrer versuchte in der Folge, sehr auf meine Mutter einzuwirken, dass sie meinen Vater »zum rechten Glauben führen möge«. Dieses Insistieren verärgerte meine Mutter derart, dass sie aufhörte, den katholischen Gottesdienst zu besuchen, und sich nach meiner Geburt auch entschloss, mich nicht katholisch, sondern evangelisch taufen zu lassen.
Damals, als meine Eltern getraut wurden, sprach meine Mutter noch kein Spanisch, und darum konnte sie der Trauungszeremonie nicht folgen. Irgendwann wurde es seltsam still in der Kirche, und dann sagte der Priester: »Señora, Sie müssen jetzt sí sagen.«
Und »Sí«– also »Ja«– haben beide aus vollem Herzen gesagt. Nicht nur zueinander, sondern auch zu der Art von Leben, das sie gemeinsam führen wollten. Aus ihrer kleinen Wohnung zogen sie bald in ein größeres Haus, das Freunden gehörte, und hier kam ich zur Welt. Später gründeten sie ein paar Straßen weiter das damals in Forscherkreisen bekannte »Humboldt-Haus«, in dem sie Zimmer an durchreisende Wissenschaftler aus aller Welt untervermieteten. Ihren privaten Teil trennten sie einfach mit Vorhängen ab. Das »Humboldt-Haus« in Miraflores sollte als Treffpunkt und Basisstation namhafter Wissenschaftler in die Geschichte eingehen.
Obwohl also beide mit Leib und Seele an ihrer Arbeit hingen, war ich ein absolutes Wunschkind. Mein Vater freute sich auf ein Mädchen, und als ich an einem Sonntag im Jahr 1954 abends um sieben in der Clínica Delgado im Stadtteil Miraflores von Lima zur Welt kam, ging sein Wunsch in Erfüllung. Ich war ein Achtmonatskind, kam viel zu früh und musste erst in den Brutkasten. Vielleicht war es ein gutes Omen, dass meine Eltern beschlossen, mir den Namen Juliane zu geben. Es bedeutet »die Heitere«– ich finde, der Name passt gut zu mir.
Zu jener Zeit lebten auch die Mutter meines Vaters und seine Schwester Cordula bei uns in Peru. Meine Großmutter wollte einige Jahre in jenem Land verbringen, in das zwei ihrer Söhne ausgewandert waren. Denn nachdem mein Vater hier Fuß gefasst hatte, entschied sich auch sein jüngerer Bruder Joachim im Jahr 1951 dafür, sich hier eine Existenz aufzubauen. Er arbeitete als Verwalter auf verschiedenen großen Haciendas im Norden des Landes, eine war sogar so groß wie ganz Belgien. Meine Eltern besuchten Onkel Joachim mehrere Male dort in Taulís, das für sie als Zoologen ein ungemein interessantes Gebiet war. Da nämlich hier die Anden mit 2000Metern Höhe relativ niedrig sind, findet ein ungewöhnlicher Floren- und Faunen-Austausch zwischen der Ost- und Westseite dieses Gebirges statt, und meine Eltern entdeckten dort einige neue Tierarten. Doch völlig unerwartet und während der Abreiseplanungen meiner Großmutter und Tante in Deutschland verunglückte mein Onkel Joachim in Taulís tödlich. Eben noch kerngesund, verstarb er innerhalb von weniger als zwei Stunden unter Krämpfen, und bis heute ist nicht geklärt, ob er an Tetanus erkrankte oder möglicherweise einer Vergiftung durch Schlafmohnbauern, denen er auf die Schliche gekommen war, zum Opfer fiel.
Mutter und Schwester hatten aber zuhause bereits alles aufgelöst und beschlossen nun, trotzdem zu kommen. So hatte ich das Glück, in den ersten Jahren meiner Kindheit nicht nur Vater und Mutter, sondern auch Großmutter und Tante um mich zu haben. Die beiden blieben sechs Jahre in Peru, meine Tante arbeitete zeitweise als Chefredakteurin der »Peruanischen Post«, einer deutschen Zeitung in Lima. Dann kehrten sie wieder in ihre Heimat zurück, meine Tante wegen besserer beruflicher Möglichkeiten und meine Großmutter aus gesundheitlichen Gründen und wohl auch, weil sie Heimweh nach Deutschland hatte.
Ich wuchs mit beiden Sprachen auf, mit Spanisch und Deutsch. Letzteres sprach man zuhause, und meine Eltern legten großen Wert darauf, dass ich ihre Muttersprache perfekt lernte. Das war gar nicht selbstverständlich, einige meiner deutschstämmigen Schulfreundinnen beherrschten die Sprache ihrer Vorväter nur fehlerhaft. Spanisch sprach ich mit meinen peruanischen Freundinnen, mit unserem Hausmädchen und später auch in der Schule. Meine Eltern hatten diese Sprache erst richtig in Peru gelernt, und obwohl sie geschickt damit umgingen, schlichen sich immer wieder ein paar Fehler ein. Doch die Peruaner sind höfliche Menschen. Als meine Mutter einmal erzählen wollte, wie ein Auto »mit Karacho um die Ecke bog«, und es ziemlich wörtlich übersetzte, da wurde sie sanft darauf hingewiesen: »NatürlichkönnenSie das so sagen, Señora, aber vielleichtsolltenSie es nicht«, denn »carajo« ist im Spanischen ein ziemlich vulgärer Ausdruck, den eine Dame eigentlich nicht in den Mund nehmen darf. Eines Tages, da war ich schon fast erwachsen, fiel mir auf, dass mich mein Vater auf Spanisch siezte. Da sagte ich zu ihm: »Das kannst du doch nicht machen, ich bin doch deine Tochter!« Er aber wurde ganz verlegen und gestand mir, dass er die »Du-Form« nie richtig gelernt habe. Er war ein sehr förmlicher Mensch, hatte wenige Duzfreunde und gebrauchte daher ausnahmslos die Höflichkeitsform.
In Lima besuchte ich die deutsch-peruanische Alexander-von-Humboldt-Schule. Eigentlich fand der Unterricht meist auf Deutsch statt, doch die damalige Militärregierung legte Wert darauf, dass Fächer wie Geschichte und Länderkunde auf Spanisch gehalten wurden. Ich habe meine Schulzeit als sehr angenehm in Erinnerung, auch wenn die peruanischen Mitschüler aus sehr viel besseren Kreisen stammten. Kein Wunder, denn man musste eine Schulgebühr bezahlen, die sich ärmere Familien nicht leisten konnten. Am Ende der Schulzeit schloss sich eine obligatorische Reise an, die in Peru »Viaje de Promoción« genannt wird. Die machte ich mit, doch das Abitur fiel für mich aus. Dabei wäre extra eine deutsche Abordnung angereist, um uns darin zu prüfen. Doch ein Flug über die Anden sollte alles ändern.
Kam ich von der Schule nach Hause, war ich umgeben von Tieren. Meine Mutter brachte als Ornithologin ständig Vögel ins Haus, die sich verletzt hatten oder angeschossen worden waren und die wir wieder aufpäppelten. Eine Zeit lang waren Steißhühner, auch Tinamus genannt, ihr hauptsächliches Studienobjekt. Das ist eine Vogelordnung, die äußerlich Ähnlichkeiten mit Rebhühnern aufweist, mit diesen aber nicht näher verwandt ist und nur in Süd- und Mittelamerika vorkommt. Lustig ist, wenn man ihr Gebaren mit dem südamerikanischen Machismo vergleicht. Bei den Steißhühnern haben nämlich die Weibchen das Sagen: Sie haben gleich mehrere Männchen, und die müssen ganz schön ran. Sie bauen das Nest, haben die Eier auszubrüten und die Jungen aufzuziehen, während das Weibchen das Revier verteidigt. Das brachte Probleme in der Zucht mit sich: Wollte ein Männchen vom Nest, um etwas zu fressen, wurde es vom Weibchen prompt wieder auf die Eier gejagt. Die waren übrigens braun wie Schokolade und glänzend wie Porzellan. Manchmal zogen wir auch geschlüpfte Küken auf. Wir fütterten sie vorsichtig mit der Pipette. Am liebsten mochten sie eine Mischung aus hart gekochtem Ei, Hackfleisch und Vitaminpräparaten. Meine Mutter hatte dafür ein echtes Händchen: Kein einziges Mal ist ihr ein Küken bei der Aufzucht gestorben. Ich war damals für die Namensgebung zuständig. Da fielen mir die tollsten Sachen ein: Eine große Eidechse taufte ich Krokodeckchen, und meine drei Steißhühner nannte ich Piups, Polsterchen und Kastanienäuglein. Ursprünglich stammen diese Tiere aus einer magischen Landschaft. Sie heißt Lomas de Lachay und ist ein Feuchtluftwüstengebiet an der Pazifikküste. Durch Teile von Peru zieht sich eine äußerst trockene Wüste, die Atacama. Weil draußen im Meer der kalte Humboldtstrom vorbeifließt, bildet sich eine dichte Nebeldecke, Garúa genannt, die an bestimmten Stellen, an denen sie an die Andenabhänge stößt, für eine erstaunlich üppige Vegetation sorgt. Mitten in der Wüste trifft man deshalb an diesen Orten auf farbenprächtige Pflanzeninseln. Meine Eltern haben mich ein paar Mal dorthin mitgenommen. Diese blühende Oase mitten im Einerlei der braunen Wüste erschien mir bei jedem Besuch als ein echtes Wunder. Und dort kamen unsere Steißhühner her.
Außerdem lebte ein bunter Papagei namens Tobias bei uns, den ich, noch ehe ich sprechen lernte, »Bio« nannte. Bio war schon vor meiner Geburt im Haus und konnte mich anfangs nicht leiden, denn er war eifersüchtig. Näherte ich mich ihm als Kleinkind, voller Begeisterung »Bio, Bio« rufend, dann hackte er nach mir, bis er mich schließlich notgedrungen akzeptierte. Tobias war ein sehr kluger Papagei, der es gar nicht mochte, wenn sein Käfig verschmutzt war. Musste er mal, gab er ein bestimmtes Geräusch von sich. Das war für uns das Zeichen, Tobias aus dem Käfig zu nehmen und zur Toilette zu bringen. Ja, zur richtigen Menschentoilette! Wir hielten ihn über die Schüssel, und– plumps– machte er sein Geschäft. Als Tobias eines Tages einen Herzanfall erlitt, kurierte ihn meine Mutter mit italienischem Cinzano. Der kurbelte seinen Kreislauf an, und wen wundert’s: Von diesem Tag an war er Fan dieses Aperitifs. Wann immer Gäste kamen, watschelte Tobias daher und wollte ebenfalls sein Schlückchen haben.
In einem Brief an eine Freundin in Deutschland schrieb meine Mutter von meiner großen Begeisterung für den Urwald, als sie mich zum ersten Mal an den Río Pachitea, der später für mein Leben so wichtig werden sollte, mitnahmen. Damals war ich erst fünf Jahre alt:
»Sie findet sich erstaunlich gut mit jeder Situation zurecht, zum Beispiel im Zelt oder im Schlafsack auf der Gummimatratze am Strand oder auf einem Boot schlafen, das sind für sie alles interessante Dinge. Und Du musst Dir die Stimmung auf dem Río Pachitea vorstellen: der dämmerige Morgen oder Abend mit dichtem Nebel, mit den Rufen der Brüllaffen, der Fluss silbrig-grün, dicht am Boot die hohe Mauer des dunklen Urwalds, aus dem das vielstimmige Konzert der Grillen und Zikaden heraustönt, man hat das Gefühl, sich wirklich noch in der Urnatur zu befinden. Juliane war wohl am meisten von den blühenden Bäumen begeistert und von der Vielfalt und Formenschönheit der Blätter, sie hat sich schon ein Herbar angelegt…«
Als ich neun Jahre alt war, besuchte uns der belgische Tierfänger Charles Cordier mit Frau und Menagerie. Cordier wurde von bekannten zoologischen Gärten auf der ganzen Welt beauftragt, Exemplare bestimmter Tierarten einzufangen. Er besaß einen überaus intelligenten Graupapagei namens Kazuco, der konnte so hervorragend sprechen, wie ich es danach nie wieder bei einem Papagei erlebte. Es gab auch noch die Boxerhündin Böcki und die Eule Skadi, die nachts im Badezimmer herumfliegen durfte. Monsieur Cordier ließ dafür extra Mäuse frei, damit die Eule sie fangen konnte. Manchmal schlug sie auch Papis Rasierpinsel, weil der so ähnlich aussah. Kazuco, der Graupapagei aus dem Kongo, begrüßte einen morgens mit »Good morning« und abends mit »Good evening«. Ich war überaus fasziniert von dem schlauen Kerlchen, der auch »Böcki, sitz!« sagen konnte, worauf sich die Boxerhündin tatsächlich hinsetzte. Kazuco fasste Geräusche und Sätze unglaublich schnell auf, und während der Tage im Humboldt-Haus lernte er zu sagen: »Lima has two million people.« Ich streichelte so gerne sein prächtiges grau schattiertes Federkleid, da biss er mich einmal kräftig in den Finger– ich habe noch heute eine Narbe davon. Leider starb unser Tobias im selben Jahr an einer Lungenentzündung.
Ich selbst wurde im Jahr darauf schwer krank– und das ausgerechnet in den großen Ferien! Ich bekam Scharlach, was meine Eltern sehr alarmierte, denn die jüngste Schwester meines Vaters war im selben Alter an dieser Krankheit gestorben. Ich war ja immer so klein, dünn und schwächlich, und darum atmete die ganze Familie auf, als ich nach vielen Wochen wieder auf den Beinen war und mich um meine Tiere kümmern konnte.
Auch von Hunden war ich von klein auf restlos begeistert. Bereits im Alter von drei Jahren bekam ich einen Wachtelhund. Ich liebte Ajax heiß und innig. Leider mussten wir ihn wieder weggeben, weil er mehr Auslauf brauchte, als es in der Großstadt möglich war, und er ständig unseren Garten verwüstete. Was war ich da traurig!
Umso seliger war ich, als sich mir im Alter von neun Jahren endlich ein lange gehegter Wunsch erfüllte: Wir gingen ins Tierheim, wo schon Lobo auf mich wartete. Lobo war ein wunderschöner Schäferhundmischling, der später auch den Umzug von Lima in den Dschungel nach Panguana mitmachte und stolze 18Jahre alt wurde.
Manche Vögel kamen sogar ganz von selbst zu uns, gerade so, als hätte es sich herumgesprochen, dass es ihnen bei uns gut gehen würde. Eines Tages flatterte eine riesige Andenamsel herein, und natürlich blieb auch sie. Meine Eltern hatten gerade Besuch von amerikanischen Ornithologen der Universität Berkeley, die ihr gleich den richtigen Namen verpassten. Sie nannten die Amsel »Professor«, wegen ihrer gelb umrandeten Augen, die ihr einen bebrillten, intelligenten Touch gaben. Neben dem Professor– den ich allerdings Franziska nannte– hatten wir noch eine Gelbstirn-Amazone sowie eine Sonnenralle. Das sind unbeschreiblich schöne Vögel, breiten sie ihre Flügel aus, entfaltet sich ein bunter Fächer im Spektrum leuchtender Erdfarben. Später, im Urwald von Panguana, profitierte ich von meinen frühen Erfahrungen. Als mir Indianer Zwergpapageien brachten, die sie ganz klein aus den Nestern geholt hatten, gelang es mir, sie aufzuziehen. Nach Ureinwohnerart kaute ich Bananen vor und steckte ihnen den Brei in den Schnabel. Auf diese Weise wurden sie erstaunlich zahm.
Seltene Vögel gab es auch in der Nähe von Lima, in einer unzugänglichen Bucht direkt am Meer. Dort fuhren meine Eltern gerne hin, und während sie ihren Beobachtungen nachgingen, spielte ich am Strand und holte mir dabei häufig einen Sonnenbrand. Was kein Wunder ist, schließlich liegt Lima nur wenige Breitengrade vom Äquator entfernt. Mein Hautarzt sagt jedenfalls heute noch: »Also Ihr Rücken, der hat wirklich schon zu viel Sonne gesehen.« Wie recht er damit hat! Damals war man noch sorglos beim Sonnenbaden. Ähnlich war es auch mit Flöhen. Wir führten immer eine Druckdose mit DDT mit– an so etwas wäre heute nicht mehr zu denken!
An diesem Strand lebten winzige Krebse, die Muymuy heißen. »Muy« ist das spanische Wort für viele– die Wortdoppelung sagt einiges über die Art ihres Auftretens aus. Manchmal bedeckten sie den ganzen Strand am Wellensaum entlang, und wenn man ins Wasser wollte, musste man barfuß über sie drüberlaufen. Das fühlte sich wirklich komisch an! Doch ich war ein Mädchen, das keine Furcht und keinen Ekel vor den Auswüchsen der Natur kannte, und rannte so schnell ich konnte über sie hinweg und stürzte mich dann ins Wasser.
Mein Vater hatte damals, als er nach jahrelanger Odyssee endlich nach Lima kam, ein Empfehlungsschreiben an die Tochter eines Admirals, der mit meinem Großvater mütterlicherseits bekannt war, in der Tasche. Als er völlig abgerissen vor jener Haustür auftauchte, da wollte man ihn zunächst nicht einmal hereinlassen. Das Empfehlungsschreiben allerdings öffnete ihm nicht nur die Tür, sondern auch die Herzen dieser Menschen, die später meine Paten wurden. So kam es, dass neben unserem Zuhause– dem Humboldt-Haus– das Haus meines Patenonkels einer meiner liebsten Aufenthaltsorte in Lima wurde. Mein Patenonkel und seine Familie waren ebenfalls Deutsche und machten in Peru ein Vermögen durch den Handel mit Baumwolle und Papier. Als meine Mutter nach Lima kam, richteten diese treuen Freunde sogar die Hochzeit meiner Eltern aus. Bis zu meinem 14.Lebensjahr verbrachte ich oft die Ferien dort. Ich liebte das Haus, im Bauhausstil errichtet, mit seinem zauberhaften Garten, Swimmingpool und Goldfischteich, in dem ich schwimmen lernte. In diesem Garten ließ ich auch manchmal meine Steißhühner frei herumlaufen, die ich stets in einem Käfig mitbrachte. Noch heute sehe ich mich die Straße vom Humboldt-Haus hinunter zur Küste entlanggehen, in der einen Hand den Käfig mit Polsterchen und Kastanienäuglein, in der anderen meine Tasche. Das Haus steht in bevorzugter Lage an der Steilküste, die von der Stadt zum Pazifik hin abfällt. Damals standen in dieser Gegend lauter solche Villen. Wer dort wohnte, konnte sich viel Personal leisten. Meine Eltern aber lebten viel einfacher und wollten es auch so haben, für sie war es wichtig, »dass man bodenständig« blieb. Doch viele meiner Schulkameradinnen wuchsen mit Dienstboten auf. Mussten sie mal niesen, riefen manche gleich nach ihrem Mädchen, damit es ihnen ein Taschentuch und ein Glas Wasser brachte.
Was war das für ein Schock, als ich bei einem meiner späteren Besuche einmal wieder in die Gegend kam und rund um das Haus meines Paten lauter Hochhäuser wie Riesenpilze aus dem Boden geschossen waren! Wie winzig duckt sich jetzt das eigentlich großzügige und geräumige Haus in den Schatten dieser architektonischen Giganten! Alle anderen Villen sind inzwischen abgerissen worden, ihre früheren Besitzer verkauften sie für teures Geld. Nur die Tochter meines Paten weigert sich standhaft, es ihnen gleichzutun. Sie änderte nicht einmal ihre Meinung, als in unmittelbarer Nachbarschaft ein Vergnügungspark errichtet wurde. Und so ist ihr Haus ein beständiger Zeuge aus den Jahren meiner Kindheit, ein Kontinuum im Wandel der Zeiten.
Auch das Haus meiner Eltern, das Humboldt-Haus, steht heute nicht mehr. Wie in jeder Metropole dieser Welt verändern sich die Viertel auch in Lima schneller, als man es sich manchmal wünscht. Die Straßen meiner Kindheit sind zwar heute noch ruhig und sicher– doch als ich das erste Mal entdeckte, dass das Haus verschwunden war, überkam mich eine große Traurigkeit. Wenn zur Gewissheit wird, dass einem ab jetzt nur noch die Erinnerung bleibt: wie das Humboldt-Haus häufig bis unters Dach mit Wissenschaftlern wie Ornithologen, Geologen und Kakteenforschern angefüllt war. Sie kamen von überall her, aus der Schweiz, aus Deutschland, Amerika, Australien. Jedes der drei Gästezimmer hatte ein eigenes Bad, und für alle Gastforscher zusammen gab es ein riesiges Arbeitszimmer, eine Bibliothek und eine Gemeinschaftsküche. Unterstützung erhielten die Forschungsreisenden durch das Deutsche Auswärtige Amt und die 1955 gegründete Deutsche Ibero-Amerika-Stiftung, und mein Vater vermittelte in der Regel eine Art Stipendium durch das peruanische Ackerbauministerium für die Kosten vor Ort. Gingen die Wissenschaftler dann auf ihre Expeditionen, konnten sie ihre Sachen bei uns einlagern. Kamen sie zurück, hatten sie immer viel zu erzählen und zu zeigen. Für mich war das eine herrliche Zeit.
Wie zerbrechlich dieses Glück jedoch war, das erlebten meine Eltern, als sie kein halbes Jahr nach meiner Geburt bereits eine zweimonatige Reise in den Urwald planten. Ich blieb wohlversorgt bei Tante und Großmutter zurück. Doch bereits acht Tage nach ihrer Abreise ereignete sich ein Unglück im Bergregenwald am östlichen Andenabhang. Ein LKW schleuderte ein abgerissenes Überlandtelefonkabel mit rasender Geschwindigkeit durch die Luft, und unglücklicherweise riss es meine beiden Eltern um und verletzte sie schwer. Mein Vater erlitt zahlreiche Schnittwunden und eine Gehirnerschütterung, brach sich außerdem ein Schlüsselbein und eine Rippe. Meine Mutter lag zunächst bewusstlos da und blutete stark. Es stellte sich heraus, dass sie eine Schädelfraktur erlitten hatte. Sie musste viele Wochen lang liegen und erholte sich nur langsam. An den Unfall und die Zeit danach hatte sie später keine Erinnerung mehr, auch hatte sie ihren Geruchs- und teilweise den Geschmackssinn eingebüßt. Ihr Leben lang plagte sie häufiges Kopfweh. Das hielt sie aber nicht davon ab, einmal genesen, ihren Forschungsarbeiten wieder nachzugehen. »Viel schlimmer wäre«, pflegte sie zu sagen, »wenn ich nichts mehr sehen könnte.«
Sobald es möglich war, nahmen mich meine Eltern mit auf ihre Expeditionen. Oft fuhren wir in den lichten Bergwald von Zárate auf der Westseite der Anden, das war ein sehr abgelegener, noch vollkommen unerforschter Wald mit zahlreichen neuen Tierarten. Hier entdeckte meine Mutter eine völlig neue Vogelgattung und nannte sie »Zaratornis«. Da es sich um eine bislang unbekannte Vegetationszone handelte, fanden meine Eltern hier auch eine Menge neuer Pflanzen und sogar Bäume, die in Fachkreisen großes Aufsehen erregten. Ich kann mich noch gut an diese Ausflüge erinnern: Zunächst fuhr man weit mit dem Auto, dann ging es zu Fuß den Berg hinauf– ich fühle heute noch das Gewicht meines kleinen Rucksacks. Den Aufstieg schaffte man nicht in einem Tag, wir mussten eine Nacht am Berghang unter freiem Himmel verbringen. Oben im Wald angekommen, zelteten wir dann meistens ungefähr eine Woche lang. Meine Eltern hielten den Einstieg in diesen Wald geheim, um ihn vor Plünderern zu schützen. Ich liebte diese Ausflüge und konnte mich stundenlang in der Natur beschäftigen, so klein ich auch noch war.
Ich war gerade mal zwei Jahre alt, da brach mein Vater auf eine noch viel weitere Reise auf: Er musste zurück nach Kiel, um sich zu habilitieren und einige Pflichtvorlesungen zu halten. Er reiste am 27.Dezember 1956 mit dem Schiff »Bärenstein« ab und erreichte Bremen am 25.Januar 1957. Wegen formaler Schwierigkeiten in Kiel– vor allem weil er nicht in Deutschland lebte– hielt er seinen Habilitationsvortrag schließlich im Juli an der Universität in Hamburg, wurde hier sofort für einige Jahre beurlaubt mit der Auflage, nach seiner Rückkehr dort Vorlesungen zu halten. Seine Habilitationsschrift hatte er über die Ökologie und Biogeografie der Wälder auf der Westseite der peruanischen Anden verfasst.
Als wollte ihn Europa auch dieses Mal nicht aus seinen Fängen lassen, gestaltete sich seine Rückreise nach Peru äußerst schwierig: Zunächst wollte er von La Rochelle mit der »Reina del Pacífico« reisen, die sich allerdings verspätete. Nach längerer Wartezeit erfuhr er, dass das Schiff auf ein Korallenriff gelaufen war und in England repariert werden musste. Also reiste er zurück nach Paris, um eine neue Schiffspassage zu buchen, nur um zu seinem Schrecken zu erfahren, dass bis zum Ende des Jahres alle Schiffe bereits ausgebucht waren. Durch Zufall konnte er gerade noch einen Platz auf der »Lucania« ergattern, die von Cannes ablegte. Doch die »Lucania« kam nur bis zu den Kanaren, sie hatte unterwegs einen schweren Maschinenschaden erlitten. Also musste er nach einer neuen Passage Ausschau halten und fand sie auf einem Schiff namens »Ascania«, das ihn bis Venezuela brachte, wo er erst am 7.September ankam. Und von dort musste er die restlichen 5000Kilometer nach Lima auf dem Landweg über Bogotá und Quito bewältigen. Meinem Vater muss diese Odyssee wie ein Déjà-vu seiner ersten Reise nach Peru erschienen sein! Doch davon später.
Ich hatte meinen Vater neun Monate nicht gesehen– kein Wunder sagte ich nach seiner Rückkehr anfangs »Onkel Papi« zu ihm!
Wer außerdem noch untrennbar mit meiner Kindheit verbunden ist, das ist unser ehemaliges Mädchen Alida. Sie gehört zu der schwarzen Minderheit in Peru und war 18Jahre alt, als sie zu uns kam, ich zählte damals fünf Jahre. Zu jener Zeit war ich sehr dünn und wollte nie essen. Noch spät am Nachmittag konnte man mich mit irgendetwas im Mund durch den Garten spazieren sehen, und das war dann meistens der Rest vom Mittagessen. Heute geht Alida auf die 70 zu, und wann immer ich in Lima bin, sehen wir uns. Wir haben jedes Mal viel miteinander zu reden, tauschen Kochrezepte aus, und irgendwann kommen wir dann auf die Vergangenheit zu sprechen.
»Weißt du noch«, frage ich sie, »als diesem deutschen Forscher eine giftige Schlange ausbüchste? Du wusstest zum Glück nicht, dass die giftig war.«
»Ja«, antwortet sie und rollt die Augen, »aber ich war es, die ihre Spuren im Garten entdeckt hat! Im letzten Moment hat dein Vater sie eingefangen und dem verrückten Kerl noch aufs Schiff bringen lassen.«
Wir erinnern uns, wie sie erlaubte, dass ich mit meinen Mitschülerinnen Marshmallows über Kerzenflammen röstete, und wie mich niemand anderes als der Freund unserer Familie Alwin Rahmel im Restaurant dazu überredete, ein Quadril zu bestellen.
»Du hattest keine Ahnung, dass es sich um ein Riesensteak handelt«, lacht Alida, »dann wurde es gebracht, und es war größer als du selbst.«
Wenn ich nicht schlafen konnte, weil ich mich vor dem Tunshi fürchtete, einem peruanischen Sagenvogel aus dem Urwald, dann tröstete mich Alida.
»Tunshis leben nur im Dschungel«, sagte sie. »Hier in Lima gibt’s weit und breit keinen Tunshi.«
Sie konnte ja nicht ahnen, dass wir ein paar Jahre später tatsächlich in diesen Urwald ziehen würden. Tunshis habe ich aber niemals gesehen, dafür, und da war ich noch keine fünf Jahre alt, einen wütenden Stier.
Damals unternahmen wir mal wieder eine Exkursion in den Regenwald. Dort lebte Peter Wyrwich, ein deutscher Viehzüchter, der meinen Eltern zur Hand ging und im Auftrag des Naturhistorischen Museums hin und wieder gezielt Vögel und Säugetiere fing. Waren wir zu Besuch, dann machte ich gemeinsam mit seinem Sohn Peter jr. die Gegend unsicher. Wir mussten unsere kleinen Nasen überall hineinstecken, ob es nun Maschinen waren oder die Tiere in ihren Ställen. Mit Puppen spielte ich ohnehin nie, alles Technische fand ich schon immer viel interessanter.
»Komm«, sagte Peter eines Tages selbstbewusst und zog mich in den Stall, »jetzt zeig ich dir, wie man die Kuh melkt.«
Bei dieser »Kuh« handelte es sich allerdings um einen Jungstier, aber weder Peter noch ich hatten eine Ahnung davon, dass es einen kleinen, aber wichtigen Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Tieren gibt. Als Peter den Stier kräftig an dem Ding zog, das er für das Euter hielt, reagierte der äußerst empört, schlug aus und traf mich so am Kopf, dass ich quer durch den Stall segelte. So ist das eben: Wer mit Tieren aufwächst, muss manchmal auch was einstecken können.
Hat man Zoologen als Eltern, dann ist es auch besser, man gruselt sich nicht zu schnell: Einmal kauften meine Eltern auf dem Markt einen riesigen Hai, in dessen Magen sich eine Menschenhand befand! Möglicherweise stammte die von einem Opfer der Gefangeneninsel draußen im Meer, die ähnlich wie Alcatraz vor San Francisco für ihre Ausbruchsicherheit berüchtigt war. Wer es dennoch versuchte, geriet in eine starke Strömung, die ihn unaufhaltsam ins offene Meer hinauszog; es hieß, noch nie habe es jemand ans Festland geschafft. Dieser Hai ist allerdings kein Menschenfresser, und die Hand war sicher erst nach dem Tode des Mannes verspeist worden. Später konnte der Hai– ohne seinen Inhalt– im Museum bewundert werden.
Solange ich noch nicht zur Schule ging, nahmen mich meine Eltern nachmittags meistens mit ins Museum. Dort, in den riesigen Hallen mit ihren hohen Flügeltüren und den vielen Präparaten peruanischer Tiere und Pflanzen, wanderte ich umher, fürchtete mich manchmal ein bisschen, vor allem vor den ausgestellten Mumien, bis diese seltsamen Dinge zu meinem Leben gehörten wie alles andere auch.
Doch dann hieß es auf einmal: Wir fahren nach Deutschland. Das war im Sommer 1960, ich war fünf Jahre alt, und nun sollte ich zum ersten Mal ins Land meiner Vorfahren. Eigentlich wollten wir alle drei über den Atlantik reisen, doch jemand musste sich um das Humboldt-Haus und seine Gäste kümmern. Meine Mutter wollte bekannte Forscherkollegen in Europa treffen und sich mit ihnen über ihre Ergebnisse austauschen, und da ich nicht fünf Monate mit meinem Vater allein bleiben konnte, nahm sie mich einfach mit. Ich war sehr aufgeregt, denn die Reise versprach spannend zu werden. Zuerst ging es in einer dröhnenden Propellermaschine nach Guayaquil in Ecuador. Von dort auf einem Bananenfrachter namens »Penthelicon« durch den Panamakanal Richtung Hamburg. Ich sah zu, wie im Hafen die Bananen eingeladen wurden– riesige, noch grüne Stauden. Hatte eine von ihnen auch nur die kleinste gelbe Stelle, wurden sie einfach ins Wasser geworfen und von Einheimischen, die mit ihren Einbäumen um den Dampfer kreisten, wieder herausgefischt. Mich hat das sehr beeindruckt, denn bei uns zuhause wurden Lebensmittel nie einfach so weggeworfen. Mit den Früchten kamen auch Tiere an Bord: Eidechsen, gewaltige Spinnen und Schlangen. Ich glaube, ich war die Einzige, die das so richtig toll fand. Die Mannschaft war davon gar nicht begeistert! Während meine Mutter in der Kabine noch an ihrem Vortrag feilte, erkundete ich das Schiff und fiel so manchem Seemann auf die Nerven. Im Atlantik sahen wir Wale und fliegende Fische, und ich stand an der Reling und war sehr beeindruckt. Allerdings auch später, nach unserer Ankunft in Berlin. Da lebten meine Großeltern mütterlicherseits und meine Tanten und Onkel. Und dort gab es Schnee! Und doppelstöckige Busse! Und Krähen, von denen ich, zur Belustigung unserer Mitreisenden sagte: »Mami, schau nur, die Geier! Die sind hier aber klein!« All diese Dinge waren neu für mich, und ich war fasziniert.
Meine Mutter unternahm in jenen Wochen Fahrten nach Paris, Basel und nach Warschau, um sich mit den Kollegen zu treffen und an den dortigen berühmten Museen zu arbeiten, denn die besaßen einige interessante Vogelbälge– also präparierte, ausgestopfte Vögel– aus Peru in ihren Sammlungen. Während dieser Ausflüge ließ sie mich bei den Verwandten. Und dann stand Weihnachten vor der Tür, und zu meinem großen Schrecken musste ich in einem Singspiel als Engel mitwirken, obwohl ich mich mit Händen und Füßen dagegen wehrte. Ich war ein schüchternes Kind, und dann stand ich auf einmal mit goldenen Flügeln auf einer Bühne, und alle fanden mich »süß«!
Ich sah meine Tante Cordula wieder, die inzwischen als Schriftstellerin in Kiel arbeitete– und die entsetzt darüber war, dass ich alle Tiere nur mit lateinischem Namen kannte. Sah ich eine Eule in einem Bilderbuch, sagte ich: »Oh, ein Otus«, sodass sich meine Tante entrüstet zu meiner Mutter wandte und sagte: »Also wirklich, Maria. Das könnt ihr mit der Kleinen doch nicht machen.« Aber das waren die Zeiten, bevor die Tiere deutsche Namen erhielten, von denen meine Eltern die meisten ohnehin nicht mochten, weil sie sie unpassend oder irreführend fanden.
Dies war für meine Mutter das letzte Mal, dass sie ihren Vater sah. Er verstarb völlig überraschend sechs Jahre später, da war ich gerade elf Jahre alt. Ich werde niemals vergessen, wie aufgewühlt ich war, als sich meine Mutter stundenlang in ihr Zimmer einschloss und herzzerreißend weinte. Erst als sie mir erklärte, warum sie so traurig war, beruhigte ich mich wieder. In meinem jungen Leben gab es nichts Schlimmeres, als meine Mutter weinen zu sehen.
Sie war ein liebenswürdiger und sanfter Mensch und musste häufig den aufbrausenden Charakter meines Vaters ausgleichen. Obwohl sie nicht nur mit ihm, sondern auch mit der Wissenschaft verheiratet war, interessierte sie sich für viele andere Themen. Sie gehörte, wie bereits erwähnt, zu den führenden Ornithologen in Südamerika, und um das zu werden, braucht es viel Einsatz und eine gewisse Opferbereitschaft. Meine Mutter brachte das mit. Einmal erlebte ich etwas mit ihr zusammen, was ich nie vergessen habe. Wir waren im Urwald und beobachteten eine Sonnenralle an ihrem Nest, während uns Myriaden von Moskitos umschwärmten. Ich wollte nach ihnen schlagen, aber dann wäre dieser so seltene und scheue Vogel sicher weggeflogen. Da flüsterte meine Mutter mir ganz leise zu: »Du darfst dich jetzt nicht rühren, auch wenn du gestochen wirst.« Und so verharrten wir in der Wolke von Stechmücken mucksmäuschenstill eine Viertelstunde lang. Meine Mutter sagte auch: »Wenn du Biologin sein willst, muss du verzichten lernen.« Dieser Satz fasst sehr gut zusammen, was unsere Forschungsarbeit ausmacht. Sie und mein Vater ergänzten sich perfekt– als sie starb, war er nicht mehr derselbe. Da war er nur noch halb. Auch für mich war es unsagbar schwer. Weil meine Mutter einfach viel zu früh von uns gerissen wurde. Weil wir noch so viele Gespräche zu führen hatten, zu denen es dann nicht mehr kam.
Unversehens geraten wir in Turbulenzen. Das ist nicht gut für mich, überhaupt nicht gut. Denn obwohl ich meine Angst vor einem erneuten Flugzeugunglück ziemlich im Griff habe, das Schütteln und Rütteln, das unser Flugzeug jetzt, hoch über dem Atlantik, erfasst, ruft sofort wieder jene Erinnerungen in mir wach. Der Alptraum jedes Flugzeuginsassen: das Dröhnen der Turbinen, das ich heute noch in meinen Träumen höre. Und dieses grelle Licht über einem der Flügel. Die Stimme meiner Mutter, die sagt…
3 Was ich von meinem Vater fürs Leben lernte
Kapitelanfang
…»Jetzt ist alles aus!« Meine Mutter sagt das ganz ruhig, fast tonlos.
Ich taste nach der Hand meines Mannes neben mir und zwinge mich, in die Gegenwart zurückzukehren. Das ist nie leicht, wenn die Erinnerung mich überfällt. Ist es tatsächlich die Hand meines Mannes, die ich halte? Oder ist es doch noch die Hand meiner Mutter?
»Reg dich nicht auf«, sage ich zu meinem Mann. »Das sind nur ein paar Turbulenzen, weiter nichts.«
Dann sehen wir uns an und müssen beide lachen. Denn uns ist natürlich klar: Ich bin es, die sich mehr fürchtet als er. Aber es fällt mir leichter, ihm den Mut zuzusprechen, der mir für einen Moment lang abhandengekommen ist. »Gut, dass du mich tröstest«, sagt mein Mann und drückt meine Hand. Von allem, was ich an ihm so sehr liebe, ist sein wunderbarer Humor manchmal das Wichtigste.
Und dann beruhigen sich die Turbulenzen, das Flugzeug bewegt sich ganz friedlich durch die Lüfte, und ich atme mehrmals tief durch.
Puh, diese Berg- und Talfahrt fuhr mir ganz schön in die Eingeweide.
»Schau mal«, sagt mein Mann und deutet aus dem Fenster. »Die Küste Brasiliens! Wir erreichen den südamerikanischen Kontinent!«
Und schon bin ich abgelenkt, blicke hinaus, immer will ich am Fenster sitzen, daran hat sich auch durch den Absturz nichts geändert. Im Gegenteil, wenn ich sehen kann, was unter mir liegt, dann bin ich etwas ruhiger. Und jetzt komme ich aus dem Staunen nicht mehr heraus, obwohl ich diesen Flug schon so oft erlebte. Die scheinbare Unendlichkeit des Atlantiks macht derselben scheinbaren Unendlichkeit des Amazonas-Waldgebietes Platz. Und heute ist die Sicht so klar, dass man deutlich verschiedene Flussmäander in der Sonne glitzern sehen kann. Ansonsten gleicht das Einerlei des Urwalds dem Einerlei der Wellen, sogar die Farbe ist fast dieselbe, ein verwaschenes Grün aus dieser Höhe. Damals, als ich vom Himmel fiel, da sahen die sich nähernden Baumkronen aus wie Brokkoliköpfe, einer dicht neben dem anderen. Doch daran will ich jetzt nicht denken, stattdessen erzähle ich meinem Mann, wie viel Mühen es meinen Vater nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kostete, nach Peru zu gelangen. Wenn wir nämlich stöhnen, weil uns nach zwölf Stunden Flug der Rücken wehtut und die Beine schwer werden, so ist das rein gar nichts im Vergleich damit, was mein Vater damals auf sich nahm. Und wäre er damals nicht aufgebrochen in eine neue Welt, dann wäre auch mein Leben mit Sicherheit völlig anders verlaufen.
Alles begann im Jahr 1947. Mein Vater war ein junger, ehrgeiziger Biologe, wollte Pionierarbeit auf dem Feld der Ökologie und Tiergeografie leisten, und deshalb interessierte er sich für Länder mit einer möglichst hohen Biodiversität. Da kam Südamerika infrage, aber auch Sri Lanka. Praktisch veranlagt, wie er war, schrieb er einen Brief an die Universität in Lima. Auf Deutsch, denn Spanisch beherrschte er noch nicht. Ob man Verwendung habe für einen jungen, promovierten Zoologen? Einen ähnlichen Brief schrieb er auch nach Ecuador. Das war zwei Jahre nach Kriegsende. Ein geschlagenes Jahr später erhielt er tatsächlich Antwort vom Naturhistorischen Museum in Lima, wohin sein Brief weitergeleitet worden war. Die Antwort war so einfach, wie es seine Frage gewesen war: Ja, er könne kommen. Man habe eine Stelle für ihn.
Es war ein Brief mit Folgen. Das Reisen im Nachkriegseuropa war eine schwierige Sache, vor allem für Deutsche. Es gab keine Pässe, also war es unmöglich, ein Visum zu erhalten. Mein Vater hatte zwar die ersehnte Stelle in Lima, aber keine Ahnung, wie er dort hinkommen sollte. Seine Studienfreundin Maria, die später meine Mutter werden sollte, teilte seine Begeisterung für die Forschung und wollte ihn auf jeden Fall begleiten. Zu meiner Großmutter sagte sie entschlossen: »Diesen Mann heirate ich. Diesen oder keinen!« Zur Jahreswende 1947/48 verlobten sich die beiden. Als mein Vater die Einladung nach Peru erhielt, war es für beide ausgemachte Sache, dass er das Angebot annehmen sollte. Maria würde einfach nachkommen, sobald sie ihre Promotion abgeschlossen hatte.
Ende der Leseprobe