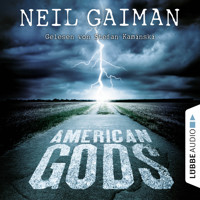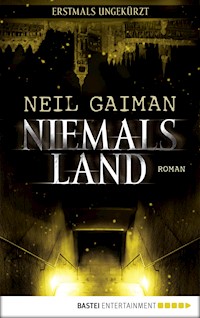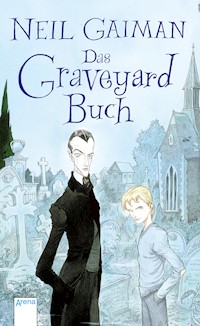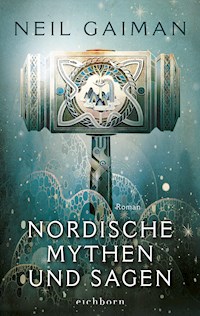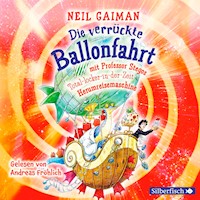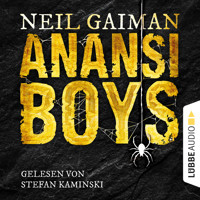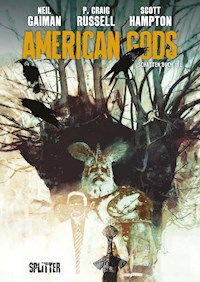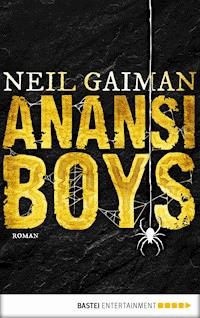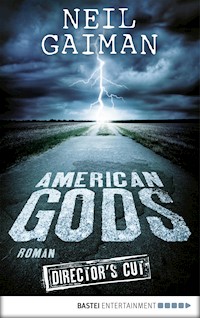
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Ein Meisterwerk der Gegenwartsliteratur
Als Shadow aus dem Gefängnis entlassen wird, ist nichts mehr wie zuvor. Seine Frau wurde getötet, und ein mysteriöser Fremder bietet ihm einen Job an. Er nennt sich Mr. Wednesday und weiß ungewöhnlich viel über Shadow. Er behauptet, ein Sturm ziehe auf, eine gewaltige Schlacht um die Seele Amerikas. Eine Schlacht, in der Shadow eine wichtige Rolle spielen wird ...
Eines der meistbeachteten Bücher des letzten Jahrzehnts: eine kaleidoskopische Reise durch die Mythologie und durch ein Amerika, das zugleich unheimlich vertraut und völlig fremd wirkt. Erstmals ungekürzt auf Deutsch und komplett neu übersetzt.
Neil Gaimans American Gods ist die literarische Grundlage für die erfolgreiche, gleichnamige Serie. Die deutschsprachige Fassung ist seit 2017 bei Amazon zu sehen.
"Originell, fesselnd und unendlich einfallsreich."
George R. R. Martin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 995
Ähnliche
Inhalt
CoverInhaltÜber das BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmungAmerican Gods Einleitung zur deutschen NeuausgabeEinleitung zur zehnjährigen JubiläumsausgabeEinleitung zur vorliegenden TextfassungVorbehalt und Warnung an ReisendeTEIL IErstes KapitelIrgendwo in AmerikaZweites KapitelDrittes KapitelUnterwegs nach AmerikaViertes KapitelUnterwegs nach AmerikaFünftes KapitelSechstes KapitelSiebtes KapitelIrgendwo in AmerikaAchtes KapitelTEIL IINeuntes KapitelUnterdessen. Ein Gespräch.Zehntes KapitelElftes KapitelUnterwegs nach AmerikaZwölftes KapitelZwischenspielZwischenspiel 2Zwischenspiel 3Dreizehntes KapitelUnterwegs nach AmerikaTEIL IIIVierzehntes KapitelFünfzehntes KapitelSechzehntes KapitelSiebzehntes KapitelAchtzehntes KapitelTEIL IVNeunzehntes KapitelZwanzigstes KapitelNachsatzDanksagungBonustrackEin Interview mit Neil GaimanWie können Sie es wagen?Leseprobe – Der Ozean am Ende der StraßeUnsere EmpfehlungenÜber das Buch
Als Shadow aus dem Gefängnis entlassen wird, ist nichts mehr wie zuvor. Seine Frau wurde getötet, und ein mysteriöser Fremder namens Mr. Wednesday bietet ihm einen Job an. Doch woher weiß der Fremde so viel über Shadow? Während Shadow im Auftrag Wednesdays durch die USA reist, wird ihm langsam klar: Ein Sturm zieht auf, eine gewaltige Schlacht um die Seele Amerikas kündigt sich an, und Shadow wird darin eine wichtige Rolle spielen.
Eines der meistbeachteten Bücher des letzten Jahrzehnts, eine kaleidoskopische Reise durch die Mythologie und durch ein Amerika, das zugleich unheimlich vertraut und völlig fremd wirkt. Erstmals erhältlich als ungekürzter »Author´s Cut«.
Über den Autor
Der Engländer Neil Gaiman, 1960 geboren, arbeitete zunächst in London als Journalist und wurde durch seine Comic-Serie SANDMAN bekannt. Neben den Romanen NIEMALSLAND und DER STERNWANDERER schrieb er zusammen mit Terry Pratchett EIN GUTES OMEN und verfasste über seinen Kollegen und Freund Douglas Adams die Biographie KEINE PANIK!. Mittlerweile ist er mit jedem großen Preis ausgezeichnet worden, der in der englischen und amerikanischen Buch- und Comicszene existiert. Er lebt seit einigen Jahren in den USA. Sein gefeierter Roman DER OZEAN AM ENDE DER STRASSE erschien 2014 bei Eichborn.
NEILGAIMAN
AMERICAN
GODS
Aus dem Englischenvon Hannes Riffel
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Der Übersetzer dankt André Taggeselle für die tatkräftige Unterstützung.
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»American Gods«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2001 by Neil GaimanPublished by Arrangement with Neil Gaiman
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Ruggero Leò
Textredaktion: Hanka Jobke
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München
Einband-/Umschlagmotiv: © Elm Haßfurth/www.elmstreet.org
E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-0744-3
Sie finden uns im Internet unter www.eichborn.de
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für abwesende Freunde –
Kathy Acker und
Roger Zelazny,
und alle dazwischen …
American Gods Einleitung zur deutschen Neuausgabe
Ich habe American Gods vor fünfzehn Jahren geschrieben. Der Roman war ursprünglich länger als das Buch, das schließlich veröffentlicht wurde, denn der Verlag wollte ein kürzeres, schnelleres Buch haben als das längere, gemächlichere, das ich geschrieben hatte. 2003 kam ich nach Deutschland, um Werbung für diese Ausgabe des Buches zu machen.
Es war eine wirklich seltsame Tour. Ich besuchte, sagen wir, eine Buchhandlung und las auf Englisch, und dann las ein deutscher Schauspieler die Abschnitte noch mal, die ich bereits gelesen hatte, aber dieses Mal auf Deutsch. Dann signierte ich Bücher.
Dieser Schauspieler, der ein verwegenes Grinsen hatte, war ein ebenso witziger wie sympathischer Zeitgenosse. Er, seine Frau und ihr polnischer Schäferhund – Crazy – reisten mit ihrem eigenen Wagen. Das ging schneller als im Zug oder im Flugzeug, und sie fühlten sich in dem Wagen wohler. Es ging vor allem deshalb schneller, weil der Schauspieler wirklich sehr schnell fuhr. Er hatte keinen Führerschein mehr, was zur Folge hatte, dass er nur nachts unterwegs war, denn er war berühmt, und in Deutschland schien jeder zu wissen, dass er keinen Führerschein mehr hatte.
Als wir einander das erste Mal vorgestellt wurden, erklärte er mir, wie man Ärger vermeidet, wenn man schnell durch Amerika fährt. Man brauche einen Radardetektor, sagte er, und wenn die Polizei einen erwische, müsse man behaupten, dass man aus Deutschland käme und deshalb den Tachometer missverstanden hätte, weil man dachte, er würde Stundenkilometer anzeigen und nicht Meilen. Natürlich, erzählte er, sagten die Polizisten einander hin und wieder über Funk Bescheid, dass da ein Typ in einem roten Mustang mit 200 Stundenkilometern unterwegs sei, oder ein Trucker verpfeife einen, und dann verbringe man eine Nacht im Gefängnis.
Er konnte einfach nicht begreifen, warum ich nicht mit ihm im Wagen fahren wollte, anstatt das Flugzeug zu nehmen.
Seither ist über ein Jahrzehnt vergangen. American Gods ist wiederhergestellt worden – dies ist die Fassung, die ich ursprünglich geschrieben habe. Sie ist länger, und sie ist neu übersetzt. Der Roman ist der Versuch, mir Amerika zu erklären und es zu verstehen, und viele der Schlüssel, die ich verwendet habe, um Amerika aufzuschließen, sind germanischen Ursprungs.
Dabei sollte man daran denken, dass der Tag nach dem Dienstag und vor dem Donnerstag zwar vernünftigerweise Mittwoch heißt, einst aber mal der »Wutenstag« war. Allerdings ist es selbst in den besten Zeiten gefährlich, Odin in seinem Kalender umherschweifen zu lassen.
Es war sehr klug von euch, ihn daraus zu entfernen.
Neil GaimanMai2015
Einleitung zur zehnjährigen Jubiläumsausgabe
Ich weiß nicht, wie es ist, dieses Buch zu lesen. Ich weiß nur, wie es war, es zu schreiben.
1992 zog ich nach Amerika. In meinem Hinterkopf nahm etwas Gestalt an. Da waren unzusammenhängende Ideen, von denen ich wusste, dass sie wichtig waren, die aber noch wie Fremdkörper nebeneinanderstanden: zwei Männer, die sich in einem Flugzeug treffen; das Auto auf dem Eis; die Bedeutung von Münztricks; und, mehr als alles andere, Amerika: dieser seltsame, weitläufige Kontinent, auf dem ich nun lebte und von dem ich wusste, dass ich ihn nicht verstand. Aber ich wollte ihn verstehen. Mehr noch, ich wollte ihn beschreiben.
Das erste Kapitel verfasste ich auf einer Zugfahrt von Chicago nach San Diego. Dann reiste ich immer weiter, und ich schrieb immer weiter. Ich fuhr auf Nebenstraßen von Minneapolis nach Florida, schlug Routen ein, von denen ich glaubte, dass Shadow sie im Buch nehmen würde. Ich schrieb, und wenn ich festhing, zog ich weiter. Ich aß im Norden von Michigan Pasteten, ich aß in Cairo gebackene Maisbällchen. Ich tat mein Bestes, nicht über Orte zu schreiben, die ich nicht selbst besucht hatte.
Ich habe mein Buch an vielen Orten geschrieben – in Häusern in Florida, in einer Hütte an einem See in Wisconsin, in einem Hotelzimmer in Las Vegas.
Ich folgte Shadow auf seiner Reise, und wenn ich mit ihm nicht weiterwusste, schrieb ich eine der Unterwegs-nach-Amerika-Geschichten, die mich stets zum Ende hin wieder auf Kurs brachten, zurück zu Shadow. Ich wollte jeden Tag zweitausend Wörter schreiben und war froh, wenn ich tausend schaffte. Als ich mit der Rohfassung fertig war, erzählte ich Gene Wolfe – dem klügsten Schriftsteller, den ich kenne und der mehr gute Romane geschrieben hat als jeder andere Mensch –, dass ich nun endlich gelernt zu haben glaubte, wie man einen Roman schreibt. Gene sah mich mit einem höflichen Lächeln an. »Du wirst niemals lernen, wie man einen Roman schreibt«, sagte er zu mir. »Du lernst immer nur, den Roman zu schreiben, an dem du gerade arbeitest.«
Er hatte recht. Ich lernte, den Roman zu schreiben, den ich schrieb, und nichts weiter. Dennoch war es ein schönes, seltsames Buch, das ich zu schreiben gelernt hatte. Mir war immer bewusst, wie weit es hinter dem wunderbaren, goldglänzenden, perfekten Buch zurückblieb, das ich mir in Gedanken ausgemalt hatte, aber es machte mich trotzdem glücklich.
Ich ließ mir, während ich an dem Buch arbeitete, einen Bart stehen und die Haare wachsen, und viele Leute hielten mich bestimmt für ein klein wenig merkwürdig (außer die Schweden, die mir anerkennend versicherten, einer ihrer Könige habe einmal etwas ganz Ähnliches getan, jedoch nicht bei einem Roman). Als die erste Fassung fertig war, rasierte ich mir den Bart ab und trennte mich kurz darauf auch von meiner unpraktischen langen Mähne.
Die zweite Fassung veranlasste mich in erster Linie, Passagen zu vertiefen und zu präzisieren. Stellen, die wachsen wollten, wuchsen, und Stellen, die gekürzt werden wollten, kürzte ich.
Mir schwebte dabei eine Menge vor. Ich wollte ein dickes, merkwürdiges, ausschweifendes Buch schreiben, und das tat ich auch. Ich wollte ein Buch schreiben, das jene Seiten von Amerika zeigte, die mich begeisterten und von denen ich besessen war – zufällig genau die Seiten, die in Filmen und Fernsehserien niemals auftauchten.
Schließlich habe ich das Buch beendet und abgegeben, wobei ich mich von dem alten Sprichwort trösten ließ, dass ein Roman bestenfalls als ein langes Stück Prosa mit Schwachstellen definiert werden kann, und ich war mir ziemlich sicher, dass ich genau so eines geschrieben hatte.
Meine Lektorin befürchtete, das Buch sei etwas zu dick und zu abschweifend (sie machte sich nichts daraus, dass es zu merkwürdig war), und bat mich, es zu kürzen, was ich tat. Ihr Instinkt erwies sich als richtig, nehme ich an, denn der Roman wurde ziemlich erfolgreich – er verkaufte sich gut und erhielt eine Reihe von Auszeichnungen, darunter den Nebula und den Hugo Award (in erster Linie SF-Preise), den Bram Stoker Award (eher Horror) und den Locus Award (eher Fantasy), was beweist, dass es sich in der Tat um ein ziemlich merkwürdiges Buch handelte, von dem trotz seiner Popularität niemand so recht wusste, in welche Schublade es gehörte.
Aber all das lag noch in der Zukunft: Erst einmal musste das Buch veröffentlicht werden. Dieser Prozess faszinierte mich, und ich begleitete ihn mit einem Weblog, das ich eigens dafür ins Leben rief (und das unabhängig davon bis zum heutigen Tag fortgeführt wird).
Pünktlich zur Veröffentlichung ging ich auf Lesereise quer durch die USA, danach durch England und Kanada, bevor ich wieder nach Hause fuhr. Die erste Signierstunde fand im Juni 2001 im Buchladen Borders Books im World Trade Center statt. Ein paar Tage nach meiner Heimkehr, am elften September 2001, existierten der Buchladen und das World Trade Center nicht mehr.
Mich überraschte, wie das Buch aufgenommen wurde.
Ich war es gewohnt, Geschichten zu erzählen, die entweder den Leuten gefielen oder nicht gelesen wurden. Ich hatte nie zuvor etwas Umstrittenes geschrieben. Doch dieses Buch wurde von den Leuten geliebt oder gehasst. Diejenigen, die es hassten, selbst wenn sie meine anderen Bücher mochten, verabscheuten es regelrecht. Manche klagten darüber, es sei zu unamerikanisch; andere fanden, dass es zu amerikanisch sei; dass sie Shadow unsympathisch fänden; dass ich nicht verstanden hätte, dass die wahre Religion Amerikas der Sport sei, und so weiter. Zweifellos sind das alles berechtigte Kritikpunkte, doch letzten Endes fand das Buch sein Publikum. Es ist wohl nicht übertrieben zu sagen, dass der überwiegende Teil der Leserschaft es liebte und weiterhin lieben wird.
Eines Tages, so hoffe ich, werde ich zu dieser Geschichte zurückkehren. Immerhin ist Shadow mittlerweile zehn Jahre älter geworden. Genau wie Amerika. Und die Götter warten.
Neil GaimanSeptember 2010
Einleitung zur vorliegenden Textfassung
Das Buch, das Sie in Händen halten, ist anders als die Version, die bislang veröffentlicht wurde.
Kurz nach seiner Erstveröffentlichung trafen Pete Atkins und Peter Schneider, die Inhaber des (leider inzwischen nicht mehr existierenden) Kleinverlags Hill House Publishers, mit dem US-Verlag des Buches die Absprache, eine Sonderausgabe von American Gods zu produzieren. Als sie mir von den wundervollen Besonderheiten für die limitierte Auflage erzählten – aus der sie ein wahres Wunder der Buchkunst machen wollten –, fühlte ich mich mit dem Text zunehmend unwohl.
Schüchtern erkundigte ich mich bei ihnen, ob sie damit einverstanden wären, meine ursprüngliche, ungekürzte Fassung zu verwenden.
Wie sich herausstellte, waren sie das.
Danach begannen die Dinge, kompliziert zu werden. Mir fiel ein, dass ich an der gekürzten Version von American Gods weitere Korrekturen und Änderungen vorgenommen hatte, die meisten davon Verbesserungen. Die einzige Möglichkeit, eine endgültige Fassung von American Gods zu erstellen, bestand also darin, meine unbearbeitete Fassung mit meiner korrigierten Fassung abzugleichen. Diese Version müsste danach mit der Druckfassung verglichen werden, denn ich hatte fröhlich in den Druckfahnen herumgekritzelt und ebenso fröhlich ignoriert, dass man die Änderungen möglicherweise zurückverfolgen wollte. Und schließlich müsste eine Reihe von Entscheidungen nach persönlichem Ermessen getroffen werden.
Das bedeutete einen enormen Arbeitsaufwand. Und ich tat das einzig Vernünftige: Ich schickte mehrere riesige Computerdateien und zwei Exemplare des Buches (die englische und die amerikanische Version) an Pete Atkins, zusammen mit meiner Liste von Druck- und Rechtschreibfehlern, die mir seit Veröffentlichung des Buches aufgefallen waren, und bat ihn, alles zusammenzubringen. Genau das tat er auch, und zwar mit großer Sorgfalt. Dann nahm ich mir das Manuskript vor, das Pete vorbereitet hatte, ging es selbst durch, besserte aus, schaffte Ordnung und fügte Stellen wieder ein, die ich nicht aus Gründen des bloßen Kürzens gestrichen hatte. Schließlich hatte ich eine endgültige Fassung vor mir, mit der ich glücklich war – wenn man bedenkt, dass ein Roman, zumindest für den Autor, immer ein langes Stück Prosa mit Schwachstellen bleibt.
Hill House veröffentlichte sie in einer sehr schönen – und sehr teuren – limitierten Sonderausgabe von rund 750 Exemplaren (die als »ein Wunder der Buchkunst« beschrieben wurde – dieses Mal nicht von ihnen selbst). Ich bin dankbar, dass meine Verlage bereit waren, diese erweiterte Fassung des Buchs zum zehnten Jahrestag seines ersten Erscheinens in einer weit größeren Auflage als 750 Exemplare zu veröffentlichen – und für weit weniger Geld. Die Fassung von American Gods, die Sie nun in Händen halten, ist etwa zwölftausend Wörter länger als diejenige, die die ganzen Preise gewonnen hat, und das ist die Fassung, auf die ich am meisten stolz bin.
Ich möchte Jennifer Hershey danken, der ursprünglichen Lektorin des Buches, Jennifer Brehl, die als Geburtshelferin dieser Ausgabe fungierte, und vor allem Pete Atkins dafür, dass er das Manuskript erarbeitet hat.
Vorbehalt und Warnung an Reisende
Dies ist kein Reiseführer, sondern ein Roman. Obwohl die Geografie der Vereinigten Staaten von Amerika in dieser Geschichte nicht gänzlich erfunden ist – viele Sehenswürdigkeiten in dem Buch können besichtigt, viele Pfade eingeschlagen, die Wege auf der Karte nachverfolgt werden –, habe ich mir Freiheiten erlaubt. Weniger Freiheiten, als Sie sich vorstellen mögen, aber dennoch Freiheiten.
Weder habe ich um die Erlaubnis gebeten, die realen Schauplätze in dieser Geschichte verwenden zu dürfen, noch wurde sie mir erteilt: Die Eigentümer von Rock City oder dem House on the Rock und die Jäger, denen das Motel in der Mitte Amerikas gehört, würden wohl ebenso erstaunt darüber sein, ihren Grundstücken hier zu begegnen, wie jeder andere auch.
Etliche Orte in dem Buch habe ich verfremdet: das Städtchen Lakeside, zum Beispiel, und die Farm mit der Esche eine Stunde südlich von Blacksburg. Sie dürfen gern danach suchen, wenn Sie möchten. Vielleicht finden Sie sie sogar.
Darüber hinaus versteht es sich von selbst, dass alle lebenden, toten und sonstigen Personen in dieser Geschichte erfunden sind oder in einem erfundenen Zusammenhang auftreten. Nur die Götter sind echt.
Eine Frage, die mich immer fasziniert hat, lautet: Was geschieht mit dämonischen Geschöpfen, wenn Immigranten ihre Heimat verlassen? Irische Amerikaner erinnern sich an die Feen, die Amerikaner aus Norwegen an die Nisser, die griechischstämmigen Amerikaner an die Wrykólakas – aber nur in Bezug auf ihr Herkunftsland. Als ich einmal fragte, warum solche Dämonen nicht in Amerika auftauchen, kicherte mein Informant verwirrt und sagte: »Sie haben Angst, den Ozean zu überqueren, er ist zu groß.« Er wies mich außerdem darauf hin, dass auch Christus und die Apostel nie nach Amerika gekommen sind.
Richard Dorson, »A Theory for American Folklore«
in: American Folklore and the Historian
(University of Chicago Press, 1971)
TEIL I
Schatten
Erstes Kapitel
Die Grenzen unseres Landes, Sir? Nun, Sir, im Norden grenzen wir an das Polarlicht, im Osten an die aufgehende Sonne, im Süden grenzen wir an die Wanderung der Äquinoktialpunkte und im Westen an den Tag des Jüngsten Gerichts.
JOE MILLERS WITZBUCH(Amerikanische Ausgabe)
Shadow hatte drei Jahre im Gefängnis gesessen. Weil er recht groß war und auch sonst ziemlich furchteinflößend wirkte, bestand sein ärgstes Problem darin, die Zeit totzuschlagen. Also hielt er sich in Form, brachte sich ein paar Tricks mit Münzen bei und dachte oft darüber nach, wie sehr er seine Frau liebte.
Das Beste an seinem Gefängnisaufenthalt – Shadows Meinung nach vielleicht das einzig Gute – war ein Gefühl der Erleichterung. Ein Gefühl, dass er so tief gefallen war wie nur irgend möglich und dass er die Talsohle erreicht hatte. Er machte sich keine Sorgen mehr, dass die Bullen ihn erwischen könnten, denn die Bullen hatten ihn erwischt. Wenn er im Gefängnis aufwachte, hatte er keine Angst; er fürchtete sich nicht mehr vor dem, was das Morgen bringen mochte, denn das Gestern hatte es bereits gebracht.
Shadow war zu der Feststellung gelangt, dass es keine Rolle spielte, ob man das, weswegen man verurteilt worden war, nun getan hatte oder nicht. Seiner Erfahrung nach fühlte sich jeder, dem er im Gefängnis begegnete, aus irgendeinem Grund ungerecht behandelt: Irgendetwas hatten die Behörden immer falsch verstanden, irgendetwas unterstellten sie einem, obwohl man es nicht getan hatte – oder man hatte es jedenfalls nicht ganz so getan, wie sie das behaupteten.
Von Bedeutung war aber allein, dass sie einen erwischt hatten. Dies war Shadow bereits während der ersten Tage aufgefallen, als alles, vom Slang bis zum schlechten Essen, noch neu gewesen war. Obwohl er sich elend fühlte und ihn das nackte Grauen packte, wenn er sich vor Augen führte, dass er hier eingesperrt war, ließ ihn diese Beobachtung leichter atmen.
Shadow bemühte sich, möglichst wenig zu reden. Doch irgendwann in der Mitte seines zweiten Jahres erklärte er seinem Zellengenossen Low Key Lyesmith seine Theorie.
Low Key, ein Trickbetrüger aus Minnesota, verzog seinen von Narben gezeichneten Mund zu einem Lächeln. »Yeah«, sagte er. »Das ist wahr. Noch besser ist es, wenn du zum Tode verurteilt wurdest. Dann fallen dir die Witze über die Typen ein, die ihre Stiefel abstreifen, während sich die Schlinge um ihren Hals legt, weil ihnen ihre Freunde immer erzählt haben, sie würden in ihren Stiefeln sterben.«
»Ist das ein Witz?«, fragte Shadow.
»Klar doch. Galgenhumor. Einen besseren gibt’s nicht – krawumm, das Schlimmste ist passiert. Dir bleiben ein paar Tage, bis du’s begriffen hast, und schon bist du mit dem Karren unterwegs, um auf dem Nichts zu tanzen.«
»Wann haben sie in diesem Bundesstaat zum letzten Mal jemanden aufgehängt?«, fragte Shadow.
»Verdammte Scheiße, woher soll ich das wissen?« Lyesmith rasierte sich seine orangeblonden Haare immer fast ganz ab. Die Linien, die über seinen Schädel verliefen, waren deutlich sichtbar. »Aber ich sag dir was. Mit diesem Land ging’s den Bach runter, als sie aufhörten, die Leute aufzuknüpfen. Ohne Galgen kann man den Kopf auch nicht mehr aus der Schlinge ziehen.«
Shadow zuckte die Schultern. Zum Tode verurteilt zu sein hatte für ihn nichts Romantisches.
Wenn man allerdings nicht zum Tode verurteilt war, dann war das Gefängnis bestenfalls eine Gnadenfrist, die einem vergönnt war, bevor das Leben weiterging, und zwar aus zwei Gründen. Erstens: Das Leben schleicht sich auch in das Gefängnis ein. Es gibt immer Orte, wo es noch weiter abwärtsgeht, selbst wenn man beim großen Spiel nicht mehr mitspielen darf; das Leben geht weiter, selbst wenn es nur ein Leben unter dem Mikroskop oder ein Leben im Käfig ist. Und zweitens: Wenn man sich zusammenreißt, müssen sie dich irgendwann rauslassen.
Am Anfang war dieser Zeitpunkt noch so weit weg, dass Shadow kaum daran dachte. Dann wurde daraus ein entfernter Hoffnungsschimmer, und wenn irgendwelche Knastscheiße ablief, lernte er, sich immer wieder zu sagen, dass »auch das vorbeigehen würde«, und es lief immer irgendwelche Knastscheiße ab. Eines Tages würde sich die magische Tür öffnen, und er würde hindurchgehen. Also strich er in seinem Kalender mit den Singvögeln Nordamerikas die Tage ab, dem einzigen Kalender, den sie im Gefängnisladen verkauften, und die Sonne ging unter, und er sah sie nicht, und die Sonne ging auf, und er sah sie nicht. Er übte Münztricks aus einem Buch, das er in der Einöde der Gefängnisbibliothek gefunden hatte; er hielt sich fit; und er stellte in seinem Kopf eine Liste auf, was er nach seiner Entlassung tun würde.
Shadows Liste wurde immer kürzer und kürzer. Nach drei Jahren standen nur noch zwei Dinge darauf.
Erstens: Er würde ein Bad nehmen. In einer Wanne mit Seifenblasen, und zwar so lange wie irgend möglich. Vielleicht würde er dabei Zeitung lesen, vielleicht auch nicht. An einem Tag stellte er es sich so vor, an einem anderen anders.
Zweitens: Er würde sich mit dem Handtuch abrubbeln und einen Morgenmantel anziehen. Und vielleicht Pantoffeln. Die Vorstellung gefiel ihm. Wenn er rauchen würde, dann hätte er in diesem Moment eine Pfeife im Mund, aber er rauchte nicht. Er würde seine Frau mit starken Armen hochheben (»Welpchen«, würde sie kreischen, mit gespieltem Entsetzen und echter Freude, »was machst du denn da?«). Er würde sie ins Schlafzimmer tragen und die Tür schließen. Wenn sie Hunger bekamen, würden sie Pizza bestellen.
Drittens: Nachdem Laura und er – vielleicht zwei Tage später – wieder aus dem Schlafzimmer herausgekommen waren, würde er den Kopf einziehen und sein ganzes Leben lang anständig bleiben.
»Und dann wärst du glücklich?«, fragte Low Key Lyesmith. An dem Tag arbeiteten sie in der Gefängniswerkstatt – sie setzten Futterhäuschen für Vögel zusammen, was nur minimal interessanter war, als Nummernschilder zu stanzen.
»Ob jemand glücklich war«, erwiderte Shadow, »weiß man erst bei seinem Tod.«
»Herodot«, sagte Low Key. »Langsam lernst du was.«
»Wer zum Teufel ist Herodot?«, fragte Iceman, der die einzelnen Teile der Futterhäuschen ineinandersteckte und sie dann an Shadow weiterreichte, der sie mit Schrauben versah und diese festdrehte.
»Ein toter Grieche«, sagte Shadow.
»Meine letzte Freundin kam auch aus Griechenland«, sagte Iceman. »Was für einen Scheiß die bei ihr zu Hause gegessen haben! Das würdet ihr nicht für möglich halten. In Blätter eingewickelten Reis und so was. Ekelhaft.«
Iceman hatte die gleiche Größe und Form wie ein Cola-Automat; seine Augen waren blau und seine Haare so blond, dass sie fast weiß wirkten. Er hatte einem Kerl eine Tracht Prügel verpasst, der seine Freundin in einer Bar begrapscht hatte, in der sie tanzte und er als Rausschmeißer arbeitete. Dessen Freunde hatten die Polizei gerufen, und die Bullen hatten Iceman überprüft und festgestellt, dass er auf Bewährung draußen und vor achtzehn Monaten vom Arbeitsfreigang nicht zurückgekehrt war.
»Was hätt ich denn machen sollen?«, hatte Iceman entrüstet gefragt, als er Shadow die ganze traurige Geschichte erzählte. »Ich hab ihm erklärt, dass sie meine Freundin ist. Hätte ich zulassen sollen, dass er mich respektlos behandelt? Echt, Mann? Ich mein ja nur – der Kerl hat wild an ihr rumgefummelt!«
Shadow hatte etwas Bedeutungsloses wie »Recht hast du« gesagt und es dabei belassen. Eine Sache hatte er gleich am Anfang gelernt: Im Gefängnis sitzt man seine eigene Zeit ab. Man lädt sich nicht noch die Geschichten der anderen auf. Man zieht den Kopf ein. Und bemüht sich, nicht aufzufallen.
Vor einigen Monaten hatte Lyesmith ihm eine zerlesene Taschenbuchausgabe von Herodots Historien geliehen. »Das ist nicht langweilig. Das ist cool«, hatte er gesagt, als Shadow einwandte, er würde keine Bücher lesen. »Schau erst mal rein, dann wirst du mir recht geben.«
Shadow hatte das Gesicht verzogen, aber er hatte damit angefangen und war gegen seinen Willen begeistert gewesen.
»Griechen«, sagte Iceman abschätzig. »Und es stimmt auch gar nicht, was man über sie erzählt. Ich hab versucht, es meiner Freundin in den Arsch zu besorgen, und sie hat mir fast die Augen ausgekratzt.«
Eines Tages war Lyesmith verlegt worden, und das ohne jede Vorwarnung. Seinen Herodot schenkte er Shadow, zusammen mit mehreren Münzen, die zwischen den Seiten versteckt waren – zwei Vierteldollar, einen Penny und einen Nickel. Münzen waren verboten: Man konnte die Ränder an einem Stein wetzen und jemandem damit bei einer Prügelei das Gesicht aufschlitzen. Shadow war nicht auf Waffen aus; er wollte nur etwas mit den Händen zu tun haben.
Shadow war keineswegs abergläubisch. Er glaubte nicht an Dinge, die er nicht sehen konnte. Trotzdem hatte er in jenen letzten Wochen das Gefühl, dass eine dunkle Wolke über dem Gefängnis hing, wie damals, in der Woche vor dem Raubüberfall. Er verspürte ein leeres Gefühl in der Magengrube, redete sich jedoch ein, er würde sich nur davor fürchten, in die Welt da draußen zurückzukehren. Aber sicher war er sich nicht. Er war noch paranoider als normalerweise, und im Gefängnis war man normalerweise schon sehr paranoid, weil man das dort zum Überleben brauchte. Shadow wurde noch stiller, noch mehr ein Schatten als ohnehin schon. Er ertappte sich dabei, wie er die Körpersprache der Wachleute und der anderen Insassen beobachtete, auf der Suche nach einem Hinweis auf die Katastrophe, die – und davon war er überzeugt – unmittelbar bevorstand.
Einen Monat vor seinem Entlassungstermin saß Shadow in einem kühlen Büro einem Mann gegenüber, dem ein Feuermal auf der Stirn prangte. Zwischen ihnen stand ein Schreibtisch; der Mann hatte Shadows Akte vor sich liegen und hielt einen Kugelschreiber in der Hand.
»Ist Ihnen kalt, Shadow?«
»Ja«, sagte Shadow. »Ein wenig.«
Der Mann zuckte mit den Achseln. »So läuft das hier nun mal«, sagte er. »Die Heizöfen werden erst im Dezember in Betrieb genommen, und am ersten Mai werden sie wieder ausgeschaltet. Auf meinem Mist ist das nicht gewachsen.« Damit waren die Nettigkeiten abgehakt, und er fuhr mit dem Zeigefinger über ein Blatt Papier, das innen links an der Mappe festgetackert war. »Sie sind zweiunddreißig Jahre alt?«
»Jawohl, Sir.«
»Sie sehen jünger aus.«
»Man tut, was man kann.«
»Hier steht, Sie hätten sich mustergültig geführt.«
»Ich habe meine Lektion gelernt, Sir.«
»Wirklich? Haben Sie das wirklich?« Er betrachtete Shadow eingehend, wobei das Feuermal auf seiner Stirn nach unten rutschte. Shadow überlegte, ob er ihm einige seiner Theorien über das Gefängnis darlegen sollte, ließ es dann aber bleiben. Stattdessen nickte er und konzentrierte sich darauf, angemessen reumütig auszusehen.
»Hier steht, Sie sind verheiratet, Shadow.«
»Meine Frau heißt Laura.«
»Wie läuft’s denn mit ihr?«
»Ganz gut. Als ich verhaftet wurde, war sie ziemlich sauer auf mich. Aber sie ist so oft wie möglich hier runtergefahren, um mich zu besuchen – was ein ziemliches Stück ist. Wir schreiben uns, und wenn es geht, rufe ich sie an.«
»Was macht Ihre Frau beruflich?«
»Sie betreibt ein Reisebüro. Schickt Leute in die ganze Welt.«
»Wie haben Sie sich kennengelernt?«
Shadow wollte kein Grund einfallen, warum sein Gegenüber ihn das fragte. Fast hätte er ihm erklärt, dass ihn das nichts angehe, doch er sagte: »Sie war die beste Freundin der Frau meines besten Kumpels. Die beiden haben uns miteinander verkuppelt. Wir haben uns gleich super verstanden.«
»Und Sie haben einen Job, der auf Sie wartet?«
»Jawohl, Sir. Mein Kumpel Robbie, von dem ich Ihnen gerade erzählt hab, dem gehört die Muskelfarm, wo ich früher Trainer war. Er hat mir versprochen, dass mein alter Job auf mich wartet.«
Eine Augenbraue zuckte nach oben. »Wirklich?«
»Er behauptet, ich würde bestimmt eine Menge Leute anlocken. Ehemalige Kunden, aber auch ein paar harte Jungs, die noch härter werden wollen.«
Das schien den Mann zufriedenzustellen. Er kaute auf dem Ende seines Kugelschreibers herum und schlug die nächste Seite auf.
»Was denken Sie inzwischen über Ihre Straftat?«
Shadow zuckte die Schultern. »Das war äußerst dumm«, sagte er und meinte es ernst.
Der Mann mit dem Feuermal seufzte und hakte einige Punkte auf seiner Liste ab. Dann blätterte er noch ein wenig in Shadows Akte herum. »Wie kommen Sie denn von hier aus nach Hause?«, fragte er. »Greyhound?«
»Ich fliege. Hat seine Vorteile, mit einer Reiseberaterin verheiratet zu sein.«
Das Feuermal legte sich in Falten. »Hat sie Ihnen ein Ticket geschickt?«
»Das war gar nicht nötig. Sie hat mir nur die Bestätigungsnummer geschickt. Für ein elektronisches Ticket. Ich muss lediglich in einem Monat am Flughafen aufkreuzen und meinen Ausweis vorzeigen, und schon ist alles geregelt.«
Der Mann nickte, kritzelte noch etwas auf ein Blatt, schloss dann die Mappe und legte den Kugelschreiber beiseite. Zwei blasse Hände ruhten wie pinkfarbene Tiere auf dem grauen Schreibtisch, bewegten sich aufeinander zu und bildeten mit den Zeigefingern einen Turm.
»Sie haben Glück.« Er schaute Shadow mit wässrigen haselnussbraunen Augen an. »Auf Sie wartet jemand, und dann kriegen Sie auch noch Ihren alten Job zurück. Sie können all das hier hinter sich lassen. Sie bekommen eine zweite Chance. Machen Sie das Beste daraus!«
Als der Mann aufstand, reichte er Shadow nicht die Hand, was dieser allerdings auch nicht erwartet hatte.
Die letzte Woche war furchtbar. In gewisser Hinsicht war sie schlimmer als die ganzen drei Jahre zusammen. Shadow fragte sich, ob es am Wetter lag, das kalt und klamm war. Es fühlte sich an, als wäre ein Gewitter im Anzug, aber das Gewitter blieb aus. Er hatte Bauchweh und bekam andauernd eine Gänsehaut; und das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, wurde mit jedem Tag stärker. Auf dem Innenhof wehte ein böiger Wind. Shadow glaubte fast, den kommenden Schnee riechen zu können.
Schließlich führte er ein R-Gespräch mit seiner Frau. Shadow wusste, dass die Telefongesellschaften für jeden Anruf aus einem Gefängnis einen Aufschlag von drei Dollar berechneten. Deshalb waren die Telefonistinnen auch immer so höflich, vermutete er: Sie wussten, wer ihren Lohn bezahlte.
»Irgendwas fühlt sich seltsam an«, erklärte er Laura. Das war nicht das Erste, was er zu ihr sagte. Das Erste war: »Ich liebe dich«, denn das ist etwas Großartiges, wenn man es ernst meint, und Shadow meinte es ernst.
»Hallo«, sagte Laura. »Ich liebe dich auch. Was fühlt sich seltsam an?«
»Ich weiß es nicht. Vielleicht das Wetter. Ich habe den Eindruck, dass alles okay wäre, wenn es nur mal ordentlich gewittern würde.«
»Hier ist es schön«, sagte sie. »Noch sind die letzten Blätter nicht alle abgefallen. Falls es nicht stürmt, kannst du sie sehen, wenn du nach Hause kommst.«
»Fünf Tage«, sagte Shadow.
»Einhundertundzwanzig Stunden, und dann kommst du nach Hause«, sagte sie.
»Alles okay bei dir? Nichts passiert?«
»Alles okay. Heute Abend treffe ich mich mit Robbie. Wir planen eine Überraschungsparty für dich.«
»Überraschungsparty?«
»Ja, klar. Du weißt doch nichts davon, oder?«
»Rein gar nichts.«
»So ist’s recht.«
Shadow wurde sich bewusst, dass er lächelte. »Ich lieb dich, Schatz.«
»Ich lieb dich, Welpchen«, sagte Laura.
Shadow legte den Hörer auf die Gabel.
Nach ihrer Hochzeit hatte sich Laura einen Welpen gewünscht, aber ihr Vermieter hatte sie darauf hingewiesen, dass ihr Vertrag keine Haustiere zuließ.
»Hey«, hatte Shadow gesagt, »dann bin ich eben dein Welpe. Was soll ich tun? Auf deinen Latschen rumkauen? Auf den Küchenboden pinkeln? Dir die Nase ablecken? Dir im Schritt herumschnüffeln? Ich wette, ich kann alles, was so eine Töle kann.« Und er hob sie hoch, als wäre sie federleicht, fing an, ihr über die Nase zu lecken, während sie kicherte und kreischte, und trug sie dann ins Bett.
In der Gefängniskantine setzte sich Sam Fetisher wie zufällig neben Shadow, entblößte seine gelben Zähne zu einem Lächeln und aß seine Makkaroni mit Käse.
»Wir müssen reden«, sagte er.
Sam Fetisher war einer der schwärzesten Menschen, denen Shadow je begegnet war. Er mochte gut und gerne achtzig sein. Oder erst sechzig. Andererseits kannte Shadow dreißig Jahre alte Cracksüchtige, die älter aussahen als Sam Fetisher.
»Mm?«, fragte Shadow.
»Da zieht ein Unwetter auf«, sagte Sam.
»Fühlt sich so an«, sagte Shadow. »Vielleicht schneit’s bald.«
»Kein solches Unwetter. Uns steht was Heftigeres bevor. Glaub mir, mein Junge, wenn’s losgeht, bist du hier drin besser dran als draußen auf der Straße.«
»Ich hab meine Zeit abgesessen«, sagte Shadow. »Am Freitag hau ich ab.«
Sam Fetisher starrte Shadow an. »Wo kommst du her?«
»Aus Eagle Point. In Indiana.«
»Du verlogenes Arschloch«, sagte Sam Fetisher. »Ich meine ursprünglich. Woher stammt deine Familie?«
»Aus Chicago«, sagte Shadow. Seine Mutter hatte als junges Mädchen in Chicago gewohnt, und sie war dort vor einer halben Ewigkeit gestorben.
»Wie ich gesagt hab. Da zieht ein heftiges Unwetter auf. Zieh bloß den Kopf ein, Shadow. Das wird … wie heißen diese Dinger noch mal, auf denen die Kontinente rumrutschen? Irgendwelche Platten?«
»Tektonische Platten?«, riet Shadow.
»Genau. Tektonische Platten. Das wird wie wenn die anfangen zu rutschen und Nordamerika in Südamerika reinschlittert. Da willst du nicht dazwischengeraten. Hast du kapiert?«
»Nicht im Mindesten.«
Ein braunes Auge schloss sich zu einem Zwinkern. »Verdammt, sag nachher bloß nicht, ich hätt dich nicht gewarnt«, brummte Sam Fetisher, während er sich einen zitternden Klumpen orangefarbenen Wackelpudding in den Mund schaufelte.
Shadow war die ganze Nacht halb wach – mal döste er ein, dann schreckte er wieder hoch, während er zuhörte, wie sein neuer Zellengenosse in dem Bett unter ihm ächzte und schnarchte. Mehrere Zellen entfernt winselte und heulte und schluchzte ein Mann wie ein Tier, und von Zeit zu Zeit brüllte ihn jemand an, er solle verdammt noch mal das Maul halten. Shadow versuchte wegzuhören. Einsam und träge ließ er die leeren Minuten über sich hinwegrinnen.
Zwei Tage noch. Achtundvierzig Stunden, die mit Haferbrei, Gefängniskaffee und einem Wachmann namens Wilson anfingen, der Shadow fester als nötig auf die Schulter tippte und sagte: »Shadow? Mitkommen.«
Shadow überprüfte sein Gewissen. Es regte sich nicht, was – wie er hatte erfahren müssen – in einem Gefängnis keineswegs bedeutete, dass er nicht in der Scheiße steckte.
Die beiden Männer gingen mehr oder weniger nebeneinanderher, und ihre Schritte hallten vom Metall und Beton zurück.
Weit hinten im Rachen schmeckte Shadow Angst, die so bitter war wie alter Kaffee. Jetzt würde geschehen, was er befürchtet hatte …
In seinem Hinterkopf flüsterte eine Stimme, dass sie auf seine Strafe noch ein Jahr draufhauen, ihn in Einzelhaft stecken, ihm die Hände abhacken würden oder den Kopf. Auch wenn er sich einredete, dass das Unsinn war, pochte sein Herz so stark, dass ihm die Brust zu platzen drohte.
»Ich begreif dich einfach nicht, Shadow«, sagte Wilson, während sie einen Fuß vor den anderen setzten.
»Was begreifen Sie nicht, Sir?«
»Dich. Du bist so verdammt still. Und viel zu höflich. Du wartest einfach nur ab, wie die alten Knaben, aber wie alt bist du? Fünfundzwanzig? Achtundzwanzig?«
»Zweiunddreißig, Sir.«
»Und was bist du? Ein Spion? Ein Zigeuner?«
»Nicht dass ich wüsste, Sir. Vielleicht.«
»Vielleicht hast du Niggerblut in den Adern. Hast du Niggerblut in den Adern, Shadow?«
»Gut möglich, Sir.« Shadow hielt sich aufrecht, blickte stur geradeaus und konzentrierte sich darauf, sich von diesem Mann nicht provozieren zu lassen.
»Yeah? Tja, ich weiß nur, dass du mir unheimlich bist.« Wilson hatte sandfarbenes Haar, ein sandfarbenes Gesicht und ein sandfarbenes Lächeln. »Verlässt du uns bald?«
»Ich hoffe es, Sir.«
»Du kommst wieder. Das sehe ich an deinen Augen. Du bist ein Versager, Shadow. Wenn’s nach mir ginge, käme keines von euch Arschlöchern hier jemals raus. Wir würden euch in ein Loch schmeißen und vergessen.«
Oubliettes, dachte Shadow, schwieg jedoch – schließlich wollte er überleben. Er widersprach nicht, sagte nichts über Arbeitsplatzsicherheit bei Wachleuten oder über das Wesen von Reue, Rehabilitation oder Rückfallquoten. Er sagte nichts Witziges oder Kluges, und um auf Nummer sicher zu gehen, sagte er wenn möglich gar nichts, wenn er sich mit einem Gefängnisbeamten unterhielt.
Sprich nur, wenn du angesprochen wirst. Sitz deine Zeit ab. Mach, dass du rauskommst. Nach Hause. Gönn dir ein langes, heißes Bad. Sag Laura, dass du sie liebst. Bau dir dein Leben wieder auf.
Sie passierten eine Reihe von Kontrollen, und Wilson zeigte jedes Mal seinen Ausweis. Nachdem sie eine Treppe hinaufgegangen waren, standen sie vor dem Büro des Gefängnisdirektors. Shadow wusste das, obwohl er noch nie hier gewesen war. Auf der Tür stand in schwarzen Lettern der Name des Gefängnisdirektors – G. Patterson –, und neben der Tür hing eine Ampel.
Die oberste Lampe leuchtete rot.
Wilson drückte einen Knopf direkt darunter.
Ein paar Minuten traten sie schweigend von einem Fuß auf den anderen. Shadow versuchte sich einzureden, dass alles in Ordnung sei, dass er am Freitagvormittag in einem Flugzeug nach Eagle Point sitzen würde, aber er glaubte nicht daran.
Die rote Lampe ging aus, und die grüne Lampe ging an. Wilson öffnete die Tür, und sie traten ein.
Shadow hatte den Direktor im Laufe der drei Jahre ein paarmal gesehen. Einmal hatte er einen Politiker herumgeführt, den Shadow nicht gekannt hatte. Einmal hatte der Direktor während eines Einschlusses zu Gruppen von jeweils einhundert Häftlingen gesprochen und ihnen erklärt, das Gefängnis sei überfüllt, und da es überfüllt bleiben würde, sollten sie sich besser damit abfinden. Heute stand Shadow ihm zum ersten Mal gegenüber. Von Nahem sah Patterson noch hässlicher aus. Er hatte ein längliches Gesicht, und seine grauen Haare waren militärisch kurz geschnitten. Er roch nach Old Spice. Hinter ihm stand ein Regal voller Bücher, jedes mit dem Wort Gefängnis im Titel; sein Schreibtisch war blitzsauber, und außer einem Telefon und einem Far-Side-Abreißkalender war er leer. Hinter dem rechten Ohr trug Patterson ein Hörgerät.
»Bitte setzen Sie sich.«
Shadow setzte sich vor den Schreibtisch, wobei ihm nicht entging, wie höflich er behandelt wurde.
Wilson blieb hinter ihm stehen.
Der Direktor zog eine Schreibtischschublade auf, holte eine Akte heraus und legte sie auf den Tisch.
»Hier steht, dass Sie wegen schwerer Körperverletzung zu sechs Jahren verurteilt wurden. Drei Jahre haben Sie verbüßt. Sie sollten am Freitag entlassen werden.«
Sollten? Shadow spürte, wie sein Magen ins Schlingern geriet. Er fragte sich, wie lange er noch würde hierbleiben müssen – ein weiteres Jahr? Zwei? Alle drei?
Er sagte nur: »Jawohl, Sir.«
Der Direktor leckte sich über die Lippen. »Was haben Sie gesagt?«
»Jawohl, Sir.«
»Shadow, wir werden Sie bereits heute Nachmittag entlassen. Sie kommen zwei Tage früher raus.« Der Direktor sagte das so freudlos, als würde er eine Todesstrafe verlesen. Shadow nickte und wartete auf die eigentliche Hiobsbotschaft. Der Direktor warf einen Blick auf die Akte. »Das hier wurde vom Johnson Memorial Hospital in Eagle Point an uns geschickt … Ihre Frau. Sie ist heute Morgen gestorben. Bei einem Autounfall. Es tut mir leid.«
Shadow nickte ein weiteres Mal.
Wilson begleitete ihn ohne ein Wort zurück in seine Zelle. Er schloss die Tür auf und ließ Shadow hinein. Dann sagte er: »Das ist wie bei einem dieser Witze, wo sie einem erst eine gute und dann eine schlechte Nachricht überbringen, stimmt’s? Die gute Nachricht ist: Wir lassen dich früher raus. Die schlechte Nachricht ist: Deine Frau ist tot.« Er lachte, als wäre das wirklich komisch.
Shadow sagte nichts.
Wie betäubt packte er seine Habseligkeiten zusammen, wobei er manches verschenkte. Low Keys Herodot ließ er ebenso zurück wie das Buch mit den Münztricks und – was ihm überraschend schwerfiel – die schwarzen Metallscheiben, die er aus der Werkstatt geschmuggelt und anstelle von Münzen verwendet hatte, bis er Low Keys Wechselgeld in dem Buch gefunden hatte. Draußen würde es Münzen geben, richtige Münzen. Er rasierte sich. Zog seine Zivilklamotten an. Trat durch eine Tür nach der anderen, in dem Wissen, dass er nie wieder zurückkehren würde. Dabei fühlte er sich innerlich völlig leer.
Regen wehte böig vom grauen Himmel herab, ein eiskalter Regen. Eiskügelchen trafen Shadow schmerzhaft im Gesicht, und die Tropfen drangen durch seinen dünnen Mantel, während die Freigelassenen von dem Gefängnisgebäude zu dem gelben ehemaligen Schulbus liefen, der sie in die nächste Stadt bringen würde.
Als sie den Bus erreichten, waren sie klatschnass. Acht Häftlinge sind freigelassen worden, dachte Shadow im Stillen, fünfzehnhundert bleiben zurück. Er saß im Bus und zitterte, bis die Heizung richtig lief, und fragte sich, was er nun tun solle, wohin er jetzt gehen würde.
Gespenstische Bilder nahmen vor seinen Augen Gestalt an. In seiner Vorstellung verließ er ein anderes Gefängnis, vor langer Zeit …
Er war viel zu lange in einer lichtlosen Dachkammer eingesperrt gewesen: Sein Bart wucherte wild, und seine Haare waren verfilzt. Die Wachleute hatten ihn eine graue Steintreppe hinuntergeführt und auf einen Platz hinaus, auf dem es von bunten Dingen nur so wimmelte – von Menschen und auch von Gegenständen. Es war Markttag, und der Lärm und die Farben waren überwältigend. Er kniff die Augen zusammen und betrachtete den Platz, der im Schein der Sonne erstrahlte, roch die salznasse Luft und all die guten Dinge, die hier feilgeboten wurden, und zu seiner Linken funkelte grelles Licht auf dem Wasser –
Der Bus hielt klappernd vor einer roten Ampel.
Der Wind fuhr heulend um die Karosserie, und die Scheibenwischer klatschten träge hin und her, verschmierten die Stadt zu roten und gelben Neonschlieren. Es war früher Nachmittag, aber hinter dem Glas sah es aus wie nachts.
»Scheiße«, sagte der Mann auf dem Sitz hinter Shadow, rieb das Kondenswasser mit der Hand vom Fenster und starrte einer nassen Gestalt nach, die den Gehsteig entlangeilte. »Da draußen läuft ’ne Möse.«
Shadow schluckte. Ihm wurde bewusst, dass er noch nicht geweint hatte – dass er eigentlich rein gar nichts empfand. Keine Tränen. Keine Trauer. Nichts.
Er dachte an einen Typen namens Johnnie Larch, mit dem er sich eine Zelle geteilt hatte, ganz am Anfang. Johnnie hatte Shadow erzählt, wie er nach fünf Jahren hinter Gittern entlassen worden war, mit hundert Dollar und einem Ticket nach Seattle, wo seine Schwester wohnte.
Johnnie Larch war zum Flughafen gefahren und hatte der Frau am Schalter sein Ticket gegeben, woraufhin sie seinen Führerschein sehen wollte.
Er zeigte ihn ihr. Er war schon ein paar Jahre abgelaufen. Sie erklärte ihm, das sei kein gültiger Ausweis. Er erklärte ihr, das sei vielleicht kein gültiger Führerschein, aber ausweisen könne er sich wohl damit, schließlich sei ein Foto von ihm darauf, und da stehe seine Größe und sein Gewicht, und, verdammt noch mal, wer solle das bitte schön sein, wenn nicht er.
Sie sagte, sie wäre ihm sehr dankbar, wenn er nicht so laut sprechen würde.
Er fuhr sie an, sie solle ihm die verdammte Bordkarte geben, oder sie würde es bereuen, so etwas wolle er sich nicht bieten lassen. Im Gefängnis ließ man sich so etwas nicht bieten.
Da drückte sie auf einen Knopf, und kurz darauf kam die Flughafensicherheit anmarschiert und versuchte, Johnnie Larch zu überzeugen, den Flughafen freiwillig zu verlassen, aber er wollte nicht gehen, also gab es eine kleine Auseinandersetzung.
Das Ergebnis war, dass Johnnie Larch nie Seattle erreichte und die nächsten paar Tage in irgendwelchen Bars verbrachte, bis die hundert Dollar aufgebraucht waren und er mit einer Spielzeugpistole eine Tankstelle überfiel und die Polizei ihn schließlich festnahm, weil er auf die Straße pinkelte. Bald war er wieder im Knast, um den Rest seiner Strafe abzusitzen, plus noch was obendrauf, wegen der Sache mit der Tankstelle.
Und die Moral von der Geschichte war, laut Johnnie Larch: Leg dich nicht mit den Leuten an, die auf dem Flughafen arbeiten.
»Bist du dir sicher, dass die Moral nicht eher so was sein sollte wie: ›Ein Verhalten, das in einem bestimmten Umfeld angemessen ist, wie zum Beispiel einem Gefängnis, ist außerhalb dieses Umfelds möglicherweise unangemessen, wenn nicht sogar schädlich‹?«, hatte Shadow gefragt.
»Nein, Mann, hör mir doch zu«, hatte Johnnie Larch erwidert. »Leg dich bloß nicht mit diesen Schlampen auf dem Flughafen an.«
Als er daran zurückdachte, musste Shadow beinahe lächeln. Sein Führerschein würde erst in etlichen Monaten ablaufen.
»Busbahnhof! Alles aussteigen!«
Das Gebäude stank nach Pisse und schal gewordenem Bier. Shadow stieg in ein Taxi und forderte den Fahrer auf, ihn zum Flughafen zu bringen. Er erklärte ihm, er bekomme fünf Dollar extra, wenn er das schweigend tat. Sie brauchten zwanzig Minuten, und der Fahrer sagte nicht ein Wort.
Shadow stolperte durch das hell erleuchtete Flughafenterminal. Die Sache mit dem E-Ticket bereitete ihm Kopfzerbrechen. Er wusste, dass er ein Ticket für einen Flug am Freitag hatte, aber er wusste nicht, ob es auch für heute gültig war. Dieses ganze elektronische Zeug war Shadow nicht geheuer, und er rechnete jeden Moment damit, dass es sich in Luft auflösen würde. Ihm war es lieber, etwas Greifbares in der Hand zu halten.
Immerhin hatte er zum ersten Mal seit drei Jahren wieder seine Brieftasche in der Hand, die mehrere abgelaufene Kreditkarten enthielt, darunter zu seiner freudigen Überraschung auch eine Visa Card, die noch bis Ende Januar gültig war. Er hatte eine Reservierungsnummer. Und er war fest davon überzeugt, dass alles wieder gut sein würde, wenn er erst einmal zu Hause war. Laura wäre gesund und munter. Vielleicht war die ganze Sache nur ein Jux, damit er zwei Tage früher eintraf. Oder einfach eine Verwechslung: Die Leiche irgendeiner anderen Laura Moon war auf dem Highway aus einem Autowrack gezerrt worden.
Jenseits der riesigen Glasscheiben des Flughafengebäudes zuckte ein Blitz über den Himmel. Shadow wurde bewusst, dass er die Luft anhielt und auf etwas wartete. In der Ferne grollte Donner. Er atmete aus.
Eine Frau mit heller Haut stand hinter einem Schalter und schaute ihn müde an.
»Hallo«, sagte Shadow. Sie sind die erste fremde Frau, mit der ich seit drei Jahren leibhaftig spreche. »Ich habe die Nummer für ein E-Ticket. Eigentlich ist sie erst für Freitag gültig, aber ich muss heute schon fliegen. In meiner Familie gab es einen Todesfall.«
»Hm. Es tut mir leid, das zu hören.« Sie tippte etwas, starrte den Bildschirm an, tippte noch etwas. »Kein Problem. Ich habe Sie für den Flug um 15.30 Uhr eingetragen. Gut möglich, dass er sich wegen des Gewitters ein wenig verspätet, also behalten Sie die Anzeige im Auge. Möchten Sie irgendwelches Gepäck aufgeben?«
Er hielt seine Umhängetasche hoch. »Das muss ich doch nicht aufgeben, oder?«
»Nein«, sagte sie. »Das ist okay. Haben Sie einen Ausweis mit einem Bild?«
Shadow zeigte ihr seinen Führerschein. Dann versicherte er ihr, dass niemand ihm eine Bombe mitgegeben habe, und im Gegenzug gab sie ihm eine ausgedruckte Bordkarte. Schließlich stapfte er durch den Metalldetektor, und seine Tasche ruckelte durch das Röntgengerät.
Es war kein großer Flughafen, aber es erstaunte ihn doch, wie viele Leute hier herumliefen. Shadow beobachtete Menschen, die wie selbstverständlich ihre Koffer abstellten, schaute zu, wie Geldbörsen in Gesäßtaschen gestopft und Handtaschen unbeaufsichtigt unter Stühle geschoben wurden. Da wurde ihm bewusst, dass er sich nicht länger im Gefängnis befand.
Dreißig Minuten Wartezeit blieben ihm, bis er an Bord gehen konnte. Shadow besorgte sich ein Stück Pizza und verbrannte sich die Lippen an dem heißen Käse. Er nahm sein Kleingeld und ging zu den Telefonen hinüber. Wählte Robbies Nummer in der Muskelfarm, erreichte aber nur den Anrufbeantworter.
»Hey, Robbie«, sagte Shadow. »Ich hab gehört, dass Laura tot ist. Sie haben mich früher rausgelassen. Ich komm nach Hause.«
Und dann, weil Menschen Fehler machen, wie er selbst nur allzu oft erlebt hatte, rief er zu Hause an und lauschte Lauras Stimme.
»Hallo«, sagte sie, »ich bin nicht da, oder ich kann nicht ans Telefon kommen. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht, und ich rufe zurück. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!«
Shadow konnte sich nicht dazu durchringen, eine Nachricht zu hinterlassen.
Er setzte sich auf einen Plastikstuhl neben dem Flugsteig und hielt seine Tasche so fest umklammert, dass ihm die Hand wehtat. Er dachte daran zurück, wie er Laura zum ersten Mal begegnet war. Damals hatte er nicht mal ihren Namen gekannt. Sie war einfach eine Freundin von Audrey Burton gewesen. Er hatte mit Robbie in einer Nische im Chi-Chi gesessen und über irgendwas gequatscht, wahrscheinlich darüber, dass einer der anderen Trainer gerade sein eigenes Tanzstudio eröffnen wolle, als Laura einen oder zwei Schritte hinter Audrey hereinkam. Shadow starrte sie, ohne es zu wollen, wie gebannt an. Sie hatte langes kastanienbraunes Haar und so blaue Augen, dass Shadow irrigerweise davon ausging, sie würde gefärbte Kontaktlinsen tragen. Sie bestellte einen Erdbeer-Daiquiri und wollte unbedingt, dass Shadow ihn probierte. Als er es tat, kicherte sie begeistert.
Laura liebte es, wenn Leute etwas probierten, das sie probierte.
Er hatte sie an jenem Abend zum Abschied geküsst, und sie hatte nach Erdbeer-Daiquiris geschmeckt, und er hatte nie wieder jemand anders küssen wollen.
Eine Frauenstimme gab bekannt, dass das Flugzeug jetzt bereitstehe, und Shadows Reihe war die erste, die aufgerufen wurde. Er saß ganz hinten, hatte neben sich einen leeren Platz. Der Regen prasselte in einem fort gegen den Flugzeugrumpf, und er stellte sich vor, dass kleine Kinder haufenweise getrocknete Erbsen vom Himmel warfen.
Als das Flugzeug abhob, schlief er ein.
Shadow befand sich an einem dunklen Ort, und das Ding, das ihn anstarrte, trug einen Büffelkopf auf den Schultern, hatte riesige feuchte Augen und stank entsetzlich. Es hatte den glatten, eingeölten Körper eines Menschen.
»Große Veränderungen stehen bevor«, sagte der Büffel, ohne die Lippen zu bewegen. »Entscheidungen müssen getroffen werden.«
Feuerschein flackerte über die feuchten Höhlenwände.
»Wo bin ich?«, fragte Shadow.
»In der Erde und unter der Erde«, sagte der Büffelmensch. »Du bist dort, wo die Vergessenen ausharren.«
Seine Augen waren glänzende schwarze Murmeln, und seine Stimme war ein Grollen von unterhalb der Welt. Er roch wie eine nasse Kuh.
»Glaube!«, sagte die grollende Stimme. »Wenn du überleben willst, musst du glauben.«
»Was denn?«, fragte Shadow. »Was soll ich glauben?« Der Büffelmensch starrte Shadow an und richtete sich, Feuer in den Augen, zu seiner ganzen Größe auf. Dabei öffnete er das mit Speichel gesprenkelte Büffelmaul, und darin loderten, tief unter der Erde, rote Flammen.
»Alles!«, brüllte der Büffelmensch.
Die Welt drehte sich und kippte weg, und Shadow befand sich wieder an Bord des Flugzeugs; das Kippeln hörte nicht auf. Ganz vorn schrie eine Frau, wenn auch halbherzig.
Um das Flugzeug zuckten blendend helle Blitze herab. Der Kapitän gab über die Bordsprechanlage bekannt, dass er versuchen würde, etwas an Höhe zu gewinnen, um das Gewitter unter sich zu lassen.
Das Flugzeug erbebte, und Shadow fragte sich so kaltblütig, als ginge ihn das alles gar nichts an, ob er sterben würde. Möglich ist es, überlegte er, aber nicht wahrscheinlich. Er starrte zum Fenster hinaus, wo Blitze den Horizont erleuchteten.
Dann döste er wieder ein wenig und träumte, er wäre noch im Gefängnis, und Low Key flüsterte, während sie in der Kantine anstanden, jemand hätte eine Prämie auf seinen Kopf ausgesetzt, aber Shadow würde nicht herausfinden, wer oder warum. Als er aufwachte, befanden sie sich bereits im Landeanflug.
Blinzelnd taumelte Shadow aus dem Flugzeug und kam erst langsam wieder zu Verstand.
Vor langer Zeit war er zu dem Schluss gekommen, dass alle Flughäfen fast gleich aussahen. Eigentlich spielte es keine Rolle, wo man war, denn man war in einem Flughafen: Fliesen und Laufgänge und Toiletten, Flugsteige und Kioske und Neonröhren.
Dieser Flughafen sah aus wie jeder andere Flughafen. Das Problem war nur – es war nicht Shadows Zielflughafen, sondern ein viel zu großer Flughafen mit viel zu vielen Leuten und viel zu vielen Flugsteigen.
Die Menschen hatten müde, glasige Augen, wie man sie nur auf Flughäfen und in Gefängnissen sieht. Wenn andere Menschen die Hölle sind, dachte Shadow, dann sind Flughäfen das Fegefeuer.
»Verzeihen Sie, Ma’am?«
Die Frau blickte von ihrem Klemmbrett zu ihm auf. »Ja?«
»Was für ein Flughafen ist das hier?«
Sie musterte ihn eingehend und schien sich zu fragen, ob er sich einen Scherz erlaube. Schließlich sagte sie: »St. Louis.«
»Ich dachte, diese Maschine fliegt nach Eagle Point.«
»Sollte sie auch. Aber sie wurde wegen des Gewitters umgeleitet. Wurde das nicht durchgesagt?«
»Wahrscheinlich schon. Ich bin eingeschlafen.«
»Sie müssen mit dem Mann dort drüben sprechen, dem mit dem roten Mantel.«
Der Mann war fast so groß wie Shadow und sah aus wie der Vater in einer Fernsehkomödie aus den Siebzigern. Er tippte etwas in seinen Computer und forderte Shadow auf, zu einem Flugsteig auf der anderen Seite des Terminals zu rennen – zu rennen!
Shadow rannte durch den Flughafen, doch als er den Flugsteig erreichte, waren die Türen bereits geschlossen. Durch die Glasscheibe schaute er zu, wie die Maschine zurücksetzte. Dann erklärte er sein Problem der Dame am Flugsteig (und zwar in aller Ruhe und betont höflich), und sie schickte ihn zum Serviceschalter, wo Shadow erläuterte, dass er sich nach langer Abwesenheit auf dem Weg nach Hause befinde, seine Frau bei einem Autounfall ums Leben gekommen und es deshalb von allergrößter Wichtigkeit sei, dass er möglichst bald dorthin gelangte. Das Gefängnis erwähnte er nicht.
Die Frau am Serviceschalter (klein und braun, mit einem Leberfleck auf der Nase) besprach sich mit einer anderen Frau, telefonierte (»Nein, der geht nicht. Der wurde gerade gestrichen.«) und druckte schließlich eine weitere Bordkarte aus.
»Damit kommen Sie an Ihr Ziel«, erklärte sie ihm. »Wir rufen am Flugsteig an und sagen Bescheid, dass Sie kommen.«
Shadow fühlte sich wie eine Erbse, die zwischen drei Bechern hin und her geschnippt wurde, oder wie eine Spielkarte in einem Stapel, den gerade jemand mischte. Erneut rannte er durch den Flughafen, bis er sich schließlich fast wieder dort befand, wo er vor einer ganzen Weile ausgestiegen war.
Am Flugsteig nahm ein kleiner Mann seine Bordkarte entgegen. »Wir haben auf Sie gewartet«, sagte er und riss den Abschnitt von der Bordkarte ab, auf der Shadows Platznummer stand: 17-D. Shadow eilte an Bord, und hinter ihm schlossen sich die Türen.
Er lief durch die erste Klasse; dort gab es nur vier Sitze, und drei davon waren belegt. Ein bärtiger Mann in einem hellen Anzug, der in der ersten Reihe neben dem leeren Platz saß, grinste Shadow an, hob den Arm und tippte auf sein Handgelenk.
Yeah, yeah. Ich bin schuld, dass du dich verspätest, dachte Shadow. Wenn das mal deine ärgsten Sorgen sind.
Während Shadow nach hinten eilte, hatte er den Eindruck, dass das Flugzeug voll belegt war. Und das war es bis auf den letzten Platz, wie er feststellte, denn auf 17-D saß eine Frau in mittleren Jahren. Shadow zeigte ihr seine Bordkarte, und sie zeigte ihm ihre: Sie waren identisch.
»Könnten Sie sich bitte setzen, Sir?«, bat ihn die Flugbegleiterin.
»Nein«, erwiderte er. »Ich fürchte, das kann ich nicht. Diese Dame sitzt auf meinem Platz.«
Sie schnalzte mit der Zunge und verglich die Bordkarten. Dann führte sie ihn wieder ganz nach vorn und deutete auf den freien Platz in der ersten Klasse. »Sieht so aus, als wäre heute Ihr Glückstag.«
Shadow setzte sich.
»Darf ich Ihnen etwas zu trinken bringen?«, fragte sie ihn. »Wir haben noch etwas Zeit bis zum Start. Und Sie können jetzt bestimmt einen Schluck gebrauchen.«
»Ich hätte gerne ein Bier, bitte«, sagte Shadow. »Was Sie dahaben.«
Die Flugbegleiterin eilte davon.
Der Mann in dem hellen Anzug auf dem Platz neben Shadow streckte den Arm aus und tippte mit dem Fingernagel auf seine Armbanduhr. Es war eine schwarze Rolex.
»Sie sind spät dran«, sagte er mit einem breiten Grinsen, in dem nicht die geringste Wärme lag.
»Wie bitte?«
»Ich habe gesagt, Sie sind spät dran.«
Die Flugbegleiterin reichte Shadow ein Glas Bier. Er nippte daran. Einen Moment fragte er sich, ob der Mann verrückt war, doch dann entschied er, dass er das Flugzeug meinte, das auf den letzten Passagier hatte warten müssen.
Die Maschine setzte zurück. Die Flugbegleiterin kam vorbei und nahm das nur halb leere Bierglas wieder an sich.
Der Mann in dem hellen Anzug grinste und sagte: »Keine Angst, das lasse ich so schnell nicht los.« Daraufhin erlaubte sie ihm, sein Glas mit Jack Daniel’s zu behalten, wobei sie ihn halbherzig darauf hinwies, dass das gegen die Vorschriften der Fluggesellschaft verstoße. (»Das lassen Sie mal meine Sorge sein, Schätzchen.«)
»Die Zeit drängt, ganz ohne Frage«, sagte er schließlich zu Shadow. »Aber nein, ich habe es nicht eilig. Ich habe mir lediglich Sorgen gemacht, Sie könnten die Maschine nicht mehr erwischen.«
»Das ist sehr freundlich von Ihnen.«
Das Flugzeug stand spürbar unruhig und mit pulsierenden Triebwerken an der Rollbahn – es wollte baldmöglichst starten.
»Von wegen freundlich«, sagte der Mann in dem hellen Anzug. »Ich habe einen Job für Sie, Shadow.«
Die Triebwerke heulten auf. Die kleine Maschine machte einen Satz nach vorn, und Shadow wurde in den Sitz gedrückt. Dann waren sie in der Luft, und die Lichter des Flughafens fielen hinter ihnen zurück. Shadow musterte den Mann neben sich.
Seine Haare waren rötlich grau; sein Bart, der lediglich aus Stoppeln bestand, gräulich rot. Er war kleiner als Shadow, aber er schien verdammt viel Platz einzunehmen. Ein kantiges, zerfurchtes Gesicht mit hellgrauen Augen. Sein Anzug wirkte teuer und hatte die Farbe geschmolzener Vanilleeiscreme. Seine Krawatte war aus dunkelgrauer Seide; die Krawattennadel hatte die Form eines Baums und war aus Silber gearbeitet: Stamm, Äste und lange Wurzeln.
Während sie starteten, hielt er sein Glas Jack Daniel’s fest und verschüttete keinen einzigen Tropfen.
»Wollen Sie mich nicht fragen, was für einen Job?«
»Woher wissen Sie, wer ich bin?«
Der Mann kicherte. »Ach, nichts ist leichter, als zu wissen, wie die Leute sich nennen. Ein bisschen Nachdenken, ein bisschen Glück, ein gutes Gedächtnis. Fragen Sie mich nach dem Job.«
»Nein«, sagte Shadow. Die Flugbegleiterin brachte ihm ein frisches Bier, und er trank einen Schluck.
»Warum nicht?«
»Ich bin unterwegs nach Hause. Dort wartet bereits ein Job auf mich. Einen anderen will ich nicht.«
Das zerfurchte Lächeln des Mannes veränderte sich nicht, aber jetzt wirkte er ehrlich belustigt.
»Auf Sie wartet zu Hause kein Job«, sagte er. »Dort wartet überhaupt nichts auf Sie. Ich dagegen biete Ihnen einen vollkommen legalen Job an – gutes Geld, eine gewisse Sicherheit, erstaunliche Nebenleistungen. Teufel auch, wenn Sie so lange leben, leg ich noch eine Altersvorsorge drauf. Vielleicht finden Sie ja daran Gefallen.«
Shadow sagte: »Möglicherweise haben Sie meinen Namen auf meiner Bordkarte gesehen. Oder auf meiner Tasche.«
Der Mann sagte nichts.
»Wer auch immer Sie sind«, fuhr Shadow fort, »Sie können unmöglich gewusst haben, dass ich an Bord dieses Flugzeugs sein würde. Ich wusste das ja selbst nicht, und wenn meine Maschine nicht nach St. Louis umgeleitet worden wäre, wäre ich jetzt gar nicht hier. Meine Vermutung ist, dass Sie anderen Leuten gerne Streiche spielen. Vielleicht wollen Sie mich ja irgendwie abzocken. Aber ich denke, es ist für uns beide besser, wenn wir dieses Gespräch jetzt beenden.«
Der Mann zuckte mit den Achseln.
Shadow griff nach dem Bordmagazin. Das kleine Flugzeug ruckte und tanzte, und es fiel ihm schwer, sich zu konzentrieren. Die Wörter schwebten durch seinen Kopf wie Seifenblasen – wenn er sie las, waren sie da, aber einen Moment später waren sie bereits gänzlich verschwunden.
Der Mann saß schweigend auf dem Sitz neben ihm und nippte an seinem Jack Daniel’s. Er hatte die Augen geschlossen.
Shadow las die Liste der Musikprogramme, die auf transatlantischen Flügen verfügbar waren, und dann betrachtete er eine Weltkarte mit roten Linien, die anzeigten, welche Strecken die Fluggesellschaft flog. Schließlich hatte er das Magazin ausgelesen, klappte es widerstrebend zu und schob es in die Tasche an der Wand.
Der Mann öffnete die Augen. Irgendetwas ist seltsam an seinen Augen, dachte Shadow. Eines davon war dunkelgrauer als das andere. Er sah Shadow an.
»Ach, übrigens«, sagte er, »es tat mir leid, das über Ihre Frau zu erfahren. Ein herber Verlust.«
Fast hätte Shadow ihm eine geknallt. Stattdessen atmete er tief durch. (»Glaub mir, mit den Schlampen auf den Flughäfen willst du dich nicht anlegen«, sagte Johnnie Larch in seinem Hinterkopf. »Sonst sitzt du wieder hinter Gittern, bevor du weißt, wie dir geschieht.«) Shadow zählte bis fünf.
»Mir auch«, sagte er.
Der Mann schüttelte den Kopf und seufzte. »Wirklich, eine Tragödie.«
»Sie ist bei einem Unfall ums Leben gekommen«, sagte Shadow. »Das geht schnell. Es hätte schlimmer kommen können.«
Der Mann schüttelte weiter bedächtig den Kopf. Für einen Moment hatte Shadow den Eindruck, sein Sitznachbar wäre gar nicht richtig da; als wäre das Flugzeug plötzlich realer geworden und sein Sitznachbar weniger real.
»Shadow«, sagte er, »das ist kein Spaß. Und auch kein Trick. Bei mir verdienen Sie mehr als bei irgendeinem anderen Job. Sie sind ein ehemaliger Häftling. Es gibt nicht eben viele Leute, die sich darum prügeln, Sie einzustellen.«
»Mister Wer-zum-Teufel-Sie-auch-sind«, sagte Shadow gerade laut genug, um über das Dröhnen der Triebwerke verständlich zu sein, »dafür reicht das ganze Geld der Welt nicht.«
Das Grinsen wurde breiter. Shadow musste an eine PBS-Sendung denken, die er als Teenager gesehen hatte. Darin war behauptet worden, dass Affen und Schimpansen nur die Zähne blecken, um Hass, Wut oder Angst auszudrücken. Wenn ein Schimpanse grinst, ist das eine Drohung. Dieses Grinsen war eindeutig ein solches.
»Klar reicht es dafür. Und Zulagen gibt es obendrein. Arbeiten Sie für mich, und ich werde Ihnen so manches verraten. Ein kleines Risiko mag natürlich dabei sein, aber wenn Sie überleben, können Sie alles haben, was Ihr Herz begehrt. Sie könnten der nächste König von Amerika sein. Und außerdem«, sagte der Mann, »wer sonst bezahlt Sie so gut? Hmm?«
»Wer sind Sie?«, fragte Shadow.
»Ach ja. Das Informationszeitalter – junge Dame, können Sie mir noch ein Glas Jack Daniel’s einschenken? Mit wenig Eis –; ein anderes Zeitalter hat es allerdings auch nie gegeben. Information und Wissen: Das sind die Währungen, die nie außer Mode gekommen sind.«
»Ich habe Sie gefragt, wer Sie sind.«