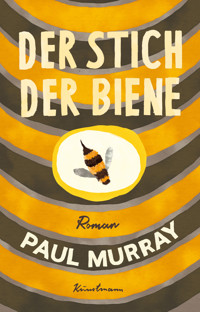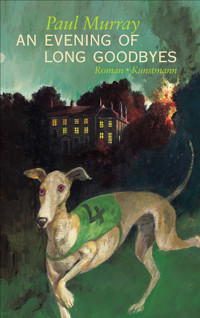
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Paul Murrays brillanter Gesellschaftsroman erzählt die Geschichte von Charles Hythloday, der im Herrenhaus seiner Familie den skurrilen Lebensstil eines Landedelmanns pflegt. Umsorgt von der bosnischen Haushälterin verbringt er seine Tage Cocktails schlürfend auf der Chaiselongue und schaut sich alte Schwarzweißfilme an. Als regelmäßige Arbeit sieht er die unregelmäßige Pflege der Pfauen seines verstorbenen Vaters. Allerdings müssen Charles und seine Schwester Bel bald feststellen, dass sie nicht so reich sind, wie sie dachten. Die von einem Alkoholentzug nach Hause zurückkehrende Mutter zwingt Charles, sich einen Job zu suchen, den Landsitz zu verlassen und endlich auf eigenen Beinen zu stehen. Doch auf die harte Realität in Dublin ist er nicht vorbereitet. Andererseits ist das wirkliche Leben aber auch nicht vorbereitet auf einen wie Charles Hythloday...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 805
Ähnliche
Paul Murray
An Evening of Long Goodbyes
Roman
Aus dem Englischen von Wolfgang Müller
Verlag Antje Kunstmann
Für Miriam
Inhalt
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Danksagung
Eins
DRAUSSEN VOR DEM ERKERFENSTER blies ein schwarzer Wind. Schon den ganzen Nachmittag spielte er seine Spielchen. Haufenweise klaubte er Laub auf und scheuchte es über den Rasen, wirbelte die Wetterfahne vom alten Thompson mal in die eine, mal in die andere Richtung, und riss raffgierig an Bels rubinrotem Ledermantel, die sich die Einfahrt hinunterkämpfte, um pünktlich zu ihrem Vorsprechtermin zu kommen. Hin und wieder hörte ich, wie er hinter dem Haus durch das Turmgerippe heulte. Dann zuckte ich zusammen und schaute kurz vom Bildschirm auf. Wenn wir jetzt in Kansas wären, dachte ich damals, könnten das die Vorboten eines furchtbaren Wirbelsturm sein. Aber wir waren nicht in Kansas, und was der Wind uns da hereinwehte, das war schlimmer als Hexen oder geflügelte Affen. Denn heute war der Tag von Franks Ankunft in Amaurot.
Es war jetzt nach vier, aber ich lag immer noch im Morgenmantel auf der Chaiselongue und erholte mich bei einem alten Schwarzweißfilm mit Mary Astor, die eine ganze Kollektion Hüte vorführte. Am Abend zuvor war ich mit Pongo McGurks aus gewesen und hatte es wohl ein bisschen übertrieben. Jedenfalls war ich mit rasenden Kopfschmerzen und in einem Sarong, der nicht meiner war, auf dem Billardtisch aufgewacht. Inzwischen fühlte ich mich schon wieder besser. Tatsächlich fühlte ich mich, als ich die heilkräftige Spezial-Consommé löffelte, die Mrs P für mich gemacht hatte, schon wieder ganz im Reinen mit der Welt. Ich dachte gerade, dass niemand einen Hut so trug wie Mary Astor, als ich ihn beziehungsweise es zum ersten Mal zu Gesicht bekam. Es war eine große, entfernt menschlich aussehende Gestalt, die sich hinter dem Glasfries zur Halle bewegte. Sie ähnelte keiner der Gestalten, die von Rechts wegen dort sein konnten – weder der schlanken Figur Bels noch der gedrungenen, einem Trapez gleichenden Dienstbotenfigur von Mrs P. Die Gestalt sah massig und auf groteske Weise aufgebläht aus, wie einer von diesen Ikea-Kleiderschränken zum Selberaufbauen, die ich in der Fernsehwerbung gesehen hatte. Ich hievte mich auf die Ellbogen und rief: »Wer ist da?«
Keine Antwort; plötzlich war die Gestalt verschwunden. Leise seufzend stellte ich meine Consommé ab. Ich bin nicht so eitel, mich für generell heldenhafter zu halten als meinen nächsten Nachbarn, aber das Heim eines Mannes ist seine Burg, und wenn sich schwedisches Mobiliar darin herumtreibt, muss er geeignete Maßnahmen ergreifen. Ich band den Gürtel meines Morgenmantels zu, nahm den Schürhaken und ging langsam zur Tür. Die Halle war leer. Ich hielt eine Hand ans Ohr, hörte aber nur das Geräusch des Hauses selbst, das wie ein endloses Atmen zwischen den hohen Decken und hölzernen Dielen widerhallte.
Fast schon glaubte ich, mir alles nur eingebildet zu haben. Doch dann fiel mir dunkel ein, dass erst kürzlich jemand von einer Einbruchsserie erzählt hatte, und ich setzte meinen Weg durch die Halle fort – nur um sicherzugehen. Es gab jede Menge Nischen, in denen sich Halunken verstecken konnten. Den Schürhaken einsatzbereit für den Fall, dass er aus dem Hinterhalt zuschlug, kontrollierte ich die Bibliothek und das Musikzimmer. Langsam drehte ich den Türknauf, stieß dann ruckartig die Tür auf und fand – nichts. Niemand lauerte hinter Brancûsis Janus, niemand kauerte unter dem wuchernden Weihnachtsstern meiner Mutter. Einer Eingebung folgend probierte ich die Flügeltür zum Ballsaal. Sie war verschlossen, natürlich, sie war immer verschlossen.
Erleichtert ging ich Richtung Küche, um auch dort noch einen flüchtigen Blick hineinzuwerfen und mich gleichzeitig nach etwas Gebäck oder Ähnlichem als Nachtisch für meine Consommé umzusehen, als ich hinter mir ein Geräusch hörte. Ich wirbelte herum, gerade als die Tür zur Garderobe aufgerissen wurde. Und da war sie, die grässliche Gestalt, mit tapsigen Schritten kam sie auf mich zu. Ohne das angenehm Trennende der Milchglasscheibe war der Anblick noch schauerlicher. Mein Mut verließ mich, der Arm samt Schürhaken erstarrte mitten im Schlag…
»Charles!«, kreischte meine Schwester, die plötzlich wie ein Geist neben dem Ding aufgetaucht war.
»Hooo«, knurrte das Ding, dann hatte ich meine Sinne wieder beisammen und verpasste ihm einen kräftigen Schlag auf die Schläfe. Als es dumpf auf dem Boden aufschlug, war aus dem Zimmer nebenan deutlich das Klirren der Porzellansammlung meiner Mutter zu hören.
Einen Augenblick lang herrschte Stille. Draußen heulte der Wind.
»Herrgott, Charles, was hast du getan?«, sagte Bel und beugte sich besorgt über die gefällte Bestie.
»Mach dir keine Sorgen, er atmet noch«, beruhigte ich sie. »Was soll’s, er hat nur bekommen, was er verdient. Einfach so in ein fremdes Haus einzubrechen. Sei froh, dass du nicht allein hier warst, Bel, schau dir diesen Frankenstein doch an.«
»Charles«, stöhnte sie. »Das ist kein… «
»Und ob es einer ist, ich wünschte, du hättest das nicht mit ansehen müssen. Aber es ist nun mal eine Tatsache, dass wir in einer Welt leben, die…«
»Halt den Mund, du Idiot. Das ist kein Frankenstein, das ist Frank – ein Freund, wir gehen heute Abend zusammen aus.« Sie kniete sich neben das Wesen und betastete dessen Stirn. »Wenn er noch mal zu Bewusstsein kommt.«
»Oh«, sagte ich. Durch die Tür sah ich Mary Astor. Sie trug einen Männerhut und tanzte einen gewagten Charleston. Nicht zum ersten oder letzten Mal wünschte ich mir, dass ich in den Bildschirm springen und mittun könnte.
»Ist das alles, was dir dazu einfällt, ›Oh.‹?« Sie richtete sich halb auf, um mich besser beschimpfen zu können. »Weil er mich von diesem dämlichen Vorsprechen nach Hause fahren wollte, hat sich der arme Kerl extra den Nachmittag freigenommen, und noch bevor ich ihm einen Drink anbieten kann, fällst du über ihn her.«
»Ich hab gedacht, er ist ein Einbrecher«, wandte ich ein.
»Ein Einbrecher«, wiederholte Bel.
»Na ja«, sagte ich. »Da war doch diese Einbruchsserie, und…« Es war unmöglich, ihr das auf die nette Art beizubringen. »Und er sieht ja nun wirklich wie ein Einbrecher aus, Bel, das musst du zugeben. Ich meine, schau ihn doch an.«
Wir wandten unsere Aufmerksamkeit der Gestalt auf dem Boden zu. Er trug eine Jeansjacke, ein schmuddeliges weißes Hemd und unscheinbare braune Schuhe. Er war sehr groß und auf eine irgendwie unpassende Art klobig. Sein Kopf war allerdings faszinierend. Er ähnelte dem ersten Versuch eines Töpferlehrlings für eine Suppenterrine. Er sah aus wie eine matschige Knolle, mit einer einzigen vorstehenden Augenbraue, einem Stoppelbart und zwei schon lückenhaften Zahnreihen. Die Ohren als asymmetrisch zu beschreiben, täte allem Asymmetrischen unrecht.
»Unrecht? Was meinst du?«, rief Bel, als ich ihr meinen Eindruck schilderte. »Du schlägst jemandem den Schädel ein, und dir fällt nichts Besseres ein, als seine Ohren zu bekritteln. Tickst du noch richtig?«
»Wenn’s nur die Ohren wären«, sagte ich. »Stell dir bloß vor, was Mutter sagen würde, wenn sie das da sehen würde.«
»Ich kann mir sehr gut vorstellen, was sie sagen würde«, sagte Bel säuerlich. »Sie würde sagen, dass ihr ein bisschen unwohl sei, und ob ihr nicht jemand einen Gin einschenken könnte.«
»Mach keine Witze über Mutters schwache Nerven«, wies ich sie zurecht. Aber sie war schon unterwegs zur Küche und kam kurz darauf mit einem Geschirrtuch voller Eiswürfel zurück. Das Wesen kam gerade wieder zu sich.
»Mann o Mann«, sagte es. »Scheiße.«
»Alles in Ordnung?«, fragte Bel und zog es mit beiden Händen in eine sitzende Position.
»Was ist passiert?«, sagte das Wesen. »Ich hab die Küche gesucht. Und dann war ich plötzlich in diesem Zimmer, alles voll Mäntel, und dann, weiß nicht, als wenn mich einer geschlagen hätte…«
»Du hattest einen kleinen Unfall«, sagte Bel und starrte mich eisig an.
»Na ja, jetzt ist es ja überstanden«, sagte ich. »Wie wär’s mit einem Drink? Ein Cognac vielleicht? Oder kann ich dich zu einem Gimlet überreden? Ich wollte mir gerade selbst…«
»Eine Tasse Tee wäre wunderbar«, sagte der Eindringling. Er rappelte sich auf, hielt sich an Bels Schulter fest und schleppte sich über das Parkett in den Salon. Dort sank er auf meinem Chaiselongueplatz nieder.
»Tee. Natürlich«, sagte ich gnädig, während er die Fernbedienung nahm und Mary Astors lächelnde Augen von einer auseinander gezogenen, im Kreis herumrennenden Hundemeute ersetzt wurden.
Niemand reagierte, als ich die Dienstbotenglocke läutete. Ich stand in der Küche und starrte hilflos die Küchenschränke an, als Bel hereinkam. »Wo hat Mrs P den Tee?«, fragte ich. Bel riss Millimeter vor meiner Nase eine Schranktür auf, und ich blickte auf eine Reihe glasierter Tontöpfe. »Ob er Earl Grey mag? Ist eigentlich ein bisschen zu früh dafür, oder?«
Bel stöhnte auf, nahm eine Schachtel mit Verbandsmaterial aus einer Schublade und ging wieder.
Vielleicht mag er lieber Lapsang Souchong, überlegte ich, folgte dann aber doch meiner ersten Eingebung. Ich trug das Tablett mit dem Tee und einem Teller von Mrs Ps vom Vorabend übrig gebliebenen Amuses gueules in den Salon. Unser Gast war entzückt und schaufelte sie sich beidhändig in den Rachen. Der Tee war allerdings weniger zu seiner Zufriedenheit.
»Gibt’s keine Milch?«, fragte er.
Ich verdrehte die Augen in Richtung Bel, die mich sotto voce mit weiteren Verwünschungen bedachte und aus dem Zimmer stürmte. Jetzt waren wir allein. Ich spürte, dass er mich ansah, und ich wusste, dass der Schürhaken in seiner Reichweite lag. Ich starrte auf den Fernsehschirm. Wichtig war jetzt, keine Angst zu zeigen. Er brach das lange, gespannte Schweigen und sagte: »Interessierst du dich für Fußball?«
»Nein«, sagte ich.
»Oh.« Er räusperte sich. »Tja … und ihr zwei lebt hier ganz allein?« In seinem starken Dubliner Dialekt klang alles, was er sagte, irgendwie bedrohlich.
»Hmm?«, sagte ich. Bedrohung hin oder her, die Hunde im Fernseher zogen mich in ihren Bann. Obwohl sie aussahen, als hätten sie seit Tagen nichts mehr zu fressen bekommen, rasten sie mit Vollgas um die Bahn. Der fröhliche kleine Elektrohase hielt sie ganz schön zum Narren. Frank wiederholte seine Frage.
»Ja, ja, im Moment nur wir beide. Und Mrs P natürlich. Vater ist vor ein paar Jahren gestorben.« Ich deutete auf das Foto an der Wand, das ihn mit dieser Westwood bei irgendeiner Modeveranstaltung in London zeigte. »Und Mutter ist in letzter Zeit nicht ganz auf dem Damm. Die Nerven. Aber sie ist zäh, jammert nie.«
»Oh«, sagte Frank. Sein Gehirn kaute das Gehörte durch, dann verzerrte sich sein Mund zu einem lüsternen Grinsen. »Wenn eure Alten nicht da sind, dann könnt ihr ja richtig auf die Kacke hauen.«
Ich verstand nicht ganz, was er damit meinte, aber es hörte sich an, als spielte er auf etwas Verderbtes an. »Was?«, sagte ich.
»Na ja, Feste und so. Partys, Remmidemmi, so was eben.«
»Oh ja, sicher.« Ich entspannte mich wieder. »Klar haben wir ab und zu eine Party. Das heißt, ich. Bel hängt meistens mit ihren öden Schauspielerfreunden rum. Wenn ich es mir recht überlege, war es in letzter Zeit ziemlich ruhig. Aber stimmt schon, manchmal ist richtig was los. Letzten April zum Beispiel, da hat eine gute Freundin von mir, Patsy Olé, die hat … Vielleicht kennst du sie? Jeder kennt Patsy…«
Er schaute mich ausdruckslos an.
»Egal, sie ist sowieso nicht in der Stadt«, sagte ich und ärgerte mich über das leichte Zittern in meiner Stimme. »Sie ist auf großer Tour, Indien und so. Wo war ich? Ah, richtig, also die Nacht damals, ein wahres Schlachtfest. Da war dieser Typ, Pongo McGurks, der hat…« Ich beugte mich verschwörerisch vor. »Also, der taucht Schlag Mitternacht auf und schleppt einen ganzen Hirsch an. Geklaut, aus dem Guinness-Anwesen oben in den Bergen. Und wir…« Ich hörte auf zu reden. Sein verständnisloser Blick ließ mich zu dem Schluss kommen, dass es keinen Sinn hatte, die Erzählung dieser Anekdote fortzusetzen. Wir widmeten unsere Aufmerksamkeit wieder den Windhunden und deren Hatz auf die kleine unverdauliche Beute.
»Und wer ist Mrs P?«, fragte er plötzlich. »Deine Tante oder so?«
»Mrs P? Nein, nein. Sie ist die Haushaltshilfe. Aus Bosnien. Oder aus Serbien? Egal, eine echte Perle. Wie ich immer zu Bel sage: Wenn dieser ganze Schlamassel da unten im Balkan irgendwas Gutes hat, dann, dass man endlich wieder erstklassiges Personal bekommt…« Die Worte erstarben mir auf den Lippen, und erneut verlor ich mich im Blick dieser reglosen Augen, einer Art schwarzem Loch – so kam mir der Bursche vor. Ich wurde wieder unruhiger. Wo war eigentlich Bel? Was fiel ihr ein, mich der Willfährigkeit dieses Primaten zu überlassen? Wollte sie, dass man mich in Stücke riss und in den Kamin stopfte?
»Entschuldige mich bitte einen Augenblick«, sagte ich, stand auf und ging hinaus. Ich fand sie schließlich in ihrem Zimmer, wo sie mit gerunzelter Stirn vor ihrem Schuhregal stand.
»Herrgott, Charles, kein Mensch stopft dich in irgendeinen Kamin«, sagte sie. »Ich bin in einer Minute wieder unten. Ich zieh mir nur was anderes an, wenn du nichts dagegen hast?«
»Ich hab etwas dagegen«, sagte ich. »Und zwar sehr viel. Ich hab gedacht, du holst ihm nur ein bisschen Milch.«
»Charles.« Bel drehte sich um und wedelte ungeduldig mit der Haarbürste. »Kannst du dich vielleicht mal fünf Minuten lang nicht wie ein Idiot aufführen und dich einfach mit ihm unterhalten, bis ich…«
»Hab ich ja versucht«, sagte ich und zog den Vorhang auf. Der Wind jagte immer noch durch das hohe Gras. »Alles, was ich sage… als ob er es einfach runterschluckt. Sehr unangenehm. Außerdem hab ich dauernd Angst, dass er Hunger bekommt und mich mit einem Stück Roastbeef verwechselt.«
»Dann lass mich einfach in Ruhe, bis ich angezogen bin, ich bin gleich da … Apropos, was ist eigentlich mit dir? Hast du vor, dich heute noch anzuziehen? Oder haben wir inzwischen ein neues Stadium deines offenbar endlosen Niedergangs erreicht?«
»Welcher Niedergang?«, fragte ich. Barfuß stapfte sie an mir vorbei zur Kommode. »Was meinst du?«
»Ich meine Folgendes«, sagte sie, zog ein Dessous nach dem andern aus der Schublade, hielt es zur Begutachtung in die Höhe und ließ es dann auf den Boden fallen. »Dass du dich jetzt seit was weiß ich wie lange hier im Haus verrammelst und allmählich… «
»Allmählich was, allmählich was genau?«
»Es ist einfach so, dass ich in letzter Zeit immer öfter keinen Schimmer habe, wovon du überhaupt redest.« Sie warf einen Slip und ein Paar schieferblauer Mokassins aufs Bett. »Ich kann mich noch daran erinnern, als du dich wesentlich besser im Griff hattest.«
»So ein Quatsch«, erwiderte ich scharf. »Gestern zum Beispiel, da war ich außer Haus. Pongo McGurks geht nach London, er tritt da eine Stelle bei seinem alten Herrn an. Also sind wir zum Abschied ins Sorrento, auf ein paar Gimlets… «
»Verstehe. Das würde auch den seltsamen Traum erklären, den ich heute Morgen um vier hatte. Ihr beide beim Tanzen auf dem Rasen. Waren das Bambusröckchen, die ihr da anhattet? Bitte sag mir, dass das keine Bambusröckchen waren.« Sie öffnete den Kleiderschrank. »Egal, spielt ja keine Rolle. Ich will bloß eins, versuche dich wie ein normaler Mensch zu benehmen und sei einfach nur höflich.«
»Schon gut«, sagte ich. »Aber wenn die vom Zirkus kommen, um ihn abzuholen – ich lehne jede Verantwortung ab.«
Sie nahm ein Kleid aus dem Schrank, drehte sich zum Spiegel und schüttelte sich angriffslustig das Haar aus. »Was ist, hast du nichts Besseres zu tun, als hier rumzustehen und mich zu langweilen?«, sagte sie.
»Tja, stimmt, das hab ich tatsächlich. Ich hatte mir nämlich gerade einen Film mit Mary Astor und Hüten angeschaut.«
»In einer Minute sind wir weg«, sagte sie mit gerunzelter Stirn. Ich wollte noch eine witzige Bemerkung des Inhalts anbringen, dass, wenn ich das Haus nicht oft verließe, so wahrscheinlich deshalb, weil es von Leuten wie Frank überall nur so wimmelte. Als ich jedoch im Spiegel ihre Augen sah, hielt ich lieber den Mund. Bel zog eine ziemliche Show ab, aber sie war bei weitem nicht so hart, wie sie glauben machen wollte. Ich wusste, wie lange sie für die Mascara brauchte, und wenn sie jetzt anfing zu weinen, dann hätte ich die beiden die ganze Nacht am Hals. Das Vorsprechen war wohl eher schlecht gelaufen.
»Ich hab noch gar nicht gefragt, wie es heute gegangen ist«, sagte ich beiläufig. »Hast du die Rolle bekommen?«
»Nein«, murmelte sie, stellte den Drehspiegel schräg und hielt sich das Kleid vor den Körper. »Es war schrecklich. Eine Firma, die übers Internet Türen verkauft. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas derart Eseliges gehört. Die Idee war die, dass ich und dieser Typ, der mein Freund ist, in dieser Wohnung sind und einen Riesenkrach haben. Also, zwei Minuten lang brüllt er mich an, beleidigt mich und macht einen auf Riesenarschloch, bis ich aus dem Zimmer stürme und die Tür hinter mir zuknalle. Und dann kommt der Slogan: Türen. Manchmal ist es besser, man geht. Das ist doch bescheuert, oder?«
»Immerhin, das war ja das erste Mal seit langem«, sagte ich. »Es kommt schon noch was Besseres.«
»Hmm.« Sie wurde rot. »Ich muss mich jetzt wirklich umziehen, Charles. Okay?«
»Ich meine, etwas, das du wirklich machen … Du willst ja wohl zu dem Kleid nicht diese Mokassins anziehen, oder?«
»Charles, bitte, hau jetzt endlich ab.«
Ich zog mich ohne weiteren Kommentar zurück. Unten in der Küche ging ich so lange nervös auf und ab, bis ich hörte, dass sie die Treppe herunterkam und zu Frank in den Salon ging.
»Du brauchst nicht aufzubleiben«, rief sie aus der Halle.
»Ha!«, rief ich zurück, aber da waren sie schon draußen.
Man könnte vielleicht meinen, dass ich ein bisschen harsch gewesen sei, aber da Mutter im Cedars war, hielt ich es für meine Pflicht, ein Auge auf meine Schwester zu haben. Bel war einundzwanzig, drei Jahre jünger als ich, ein auffallend hübsches Mädchen mit den blassblauen Augen meines Vaters, dem wie Herbstlaub leuchtenden Haar meiner Mutter und einem Hang zum Leichtsinn, einer verächtlichen Ungeduld mit ihrem eigenen Leben, die sie von keinem der beiden hatte. Im Juni hatte sie das Trinity College beendet, mit einem ziemlich wohlwollenden Abschluss in Schauspiel. »Bel und Schauspiel«, hatte Vater gestöhnt, als er den Scheck unterschrieben hatte. »Das ist, als ob man Kohle nach Newcastle schafft.« Ein nicht ganz faires Urteil. Bel neigte zwar zum Melodramatischen und hatte auch einen scharfen Sinn für sie persönlich betreffendes Unrecht, aber der extravagante Typ war sie eigentlich nicht. Obwohl Schauspielern ihre Leidenschaft war, hatte sie es bei den Collegeproduktionen immer vorgezogen, hinter den Kulissen zu arbeiten, am Bühnenbild oder am Drehbuch, und wenn sie doch mal die Bühne betrat, dann wurde ihre Rolle jedes Mal von ihrer eigenen Schüchternheit zugedeckt.
Seit ihren letzten Prüfungen wusste sie nichts mit sich anzufangen. Die Leere bedrückte sie, das war klar. In den letzten Monaten hatte sie eine Serie männlicher Begleiter durchlaufen, die selbst nach ihren eigenen willkürlichen Maßstäben von zunehmend minderer Qualität waren. Den Rest der Zeit schloss sie sich in ihrem Zimmer ein, hörte Dylan-Platten und blies den Rauch ihrer Joints aus dem Fenster in die Abendluft.
»Du hast Ferien, amüsier dich«, riet ich ihr. »Entspann dich ein bisschen. Schau mich an.«
»Das sind keine Ferien«, sagte sie. »Kommt mir eher vor wie das Fegefeuer. Ich sitz hier mitten in der Pampa, bin abgeschnitten von allem und jedem und warte. Worauf, weiß ich auch nicht. Ich hab kein Geld, ich bin ein Nichts, eine totale Null… «
»Du bist erst einen Monat vom College weg, du machst eine Übergangsphase durch, das ist alles. Ich versteh nicht, worüber du dir Sorgen machst.«
»Ich mache mir Sorgen, dass ich so werde wie du«, sagte sie und vertiefte sich mit einem verzweifelten Seufzer wieder in die Zeitung, in die endlosen Stellenanzeigen für Computerprogrammierjobs. Was ein Jammer war, der Sommer beglückte uns in diesem Jahr mit herrlich sonnigen Tagen, und der Park präsentierte sich so bezaubernd wie selten. Mutter war nicht da, also konnte ich nach Gusto umherstreifen und den Grünton der Eichenblätter, die flauschigen Blüten der Rosskastanie, die hoch aufragenden Ritterstern und Akelei bewundern. Es war eine friedvolle Zeit, und im Gegensatz zu dem, was Bel gesagt hatte, fühlte ich mich ungewöhnlich ausgeglichen. Obwohl mir natürlich von Zeit zu Zeit der Gedanke kam, dass ein Gefährte für meine Streifzüge schon angenehm wäre – ein Wolfshund vielleicht oder ein Setter, der schwanzwedelnd neben mir durchs Gras tollte und sich zu meinen Füßen einrollte, während ich mich mit einem erbaulichen Buch unter einem Baum niederließ.
Nachdem Bel und Frank gegangen waren, brauchte ich eine halbe Stunde, um die Kuhle, die Frank auf der Chaiselongue hinterlassen hatte, aus dem Polster zu kneten. Mir war nach Abendessen, aber weit und breit keine Mrs P. Als ich so am Fenster stand und auf sie wartete, sah ich den Postboten, der betrunken den Weg zur Haustür heraufschwankte. Einer der Nachteile unseres Hauses war seine Lage. Es befand sich an der Küste, von einem Dorf namens Dalkey etwa zwei verschlungene Landstraßenmeilen entfernt. Die Post sah sich nur selten imstande, ihren Dienst zu versehen; an Regentagen oder an Tagen, an denen es nach Regen aussah, oder an Tagen vor oder nach Regentagen konnte man sie vergessen. Aber die letzten Tage waren relativ gnädig gewesen, sodass der Postbote, ein weißhaariger Kauz von wenig vertrauenswürdigem Äußeren, offensichtlich beschlossen hatte, es zu wagen. Ich öffnete die Tür, als er sich gerade mit einem Packen Post zum Briefkasten hinunterbückte.
»Morgen«, sagte er. Die Schamlosigkeit dieser Lüge nahm mir den Wind aus den Segeln und die Standpauke, die ich schon seit Tagen im Kopf hatte, gleich mit. Stattdessen riss ich ihm die Briefe aus der Hand und knallte die Tür zu. Und er bummelte flötend davon, quer über den Rasen, den zu betreten eigentlich nur den Pfauen erlaubt ist.
Ich schaute die Briefe flüchtig durch. Keiner für mich. Ein paar offiziell aussehende für meine Schwester und ein paar für Mutter, die alle den gleichen roten Stempel trugen. Irgendeine Sonderzustellung. Solange Mutter unpässlich war, oblag die Familienpost Bel. Ich legte die Briefe zur Seite und wandte meine Gedanken wieder dem Verbleib von Mrs P zu. Ich hatte sie seit dem Lunch nicht mehr gesehen und wurde allmählich ganz schwach vor Hunger. Was ich zu Frank gesagt hatte, war keine Übertreibung gewesen: Ihr gutmütiges Wesen und ihre exzellente Küche hatten diesen Haushalt durch einige schwierige Phasen gesteuert. In letzter Zeit jedoch schien die gewohnte Hingabe gelitten zu haben. Ihre Arbeitszeiten waren unberechenbar geworden, und sie wirkte abwesend – als wären ihre Gedanken woanders. Ich hatte Bel noch nichts gesagt, aber ich fing doch an, mir ein klein wenig Sorgen zu machen. Ich fragte mich, ob sie etwas bedrückte oder, noch schlimmer, ob ganz einfach das Ende ihrer nützlichen Tage gekommen und sie reif für das Gnadenbrot war.
Als Plus konnte ich verbuchen, dass mein Kater sich inzwischen verflüchtigt hatte. Ich ging also in den Keller, um eine Flasche fürs Abendessen auszusuchen. Ich war gern im Keller. Die kühle, dünne Luft war wie eine Decke, die sich angenehm feucht an den Körper schmiegte. Und im schwachen Licht glänzten karmesinrot, malven- und burgunderfarben die Flaschen, Regenbögen innerhalb von Regenbögen, eine der wenigen ungetrübten Freuden im Leben meines Vaters. Zugegeben, in jüngster Zeit hatten sich die Reihen etwas gelichtet. Es waren recht ausgelassene Monate gewesen – die alte Gang mal wieder komplett versammelt, fabelhafte, törichte Partys, ineinander übergehend wie der flatterhafte, atemlose Raum zwischen Nacht und Tag. Rückblickend würde ich sagen, dass diese Zeit all die Merkmale eines letzten Versuchs aufwies. Ich fragte mich, ob ich der Einzige gewesen war, dem das nicht aufgefallen war.
Nicht dass es von Belang war – nichts hatte irgendwelche Folgen gehabt, weder die wilden Feste noch der Schnaps, noch die Mädchen mit den Pfauenfedern im Haar. Ich war hinter Patsy Olé her gewesen. Patsy Olé war exquisit und bezaubernd und kümmerte sich einen Scheiß. Und wie um alle Mädchen, die exquisit waren und bezaubernd und sich einen Scheiß kümmerten, scharwenzelten immer jede Menge Kerle um sie herum. Zudem war sie eins von den Mädchen, die an dem Streit und dem Hass, den sie unter ihren Freiern hervorrief, mindestens genauso viel Spaß hatte wie an den Beziehungen selbst, und als solche war sie für zwei oder mehr Liebschaften parallel jederzeit zugänglich. Und doch, an gewissen Abenden hatte es den Anschein gehabt, als wären wir auf dem Sprung gewesen zu etwas ganz…
Ich schüttelte mich und war wieder da. Sie war jetzt in Indien; und wir beide waren wahrscheinlich so besser dran. Ich wählte eine Flasche aus und ging nach oben in die Küche. Man konnte leicht im Keller hängen bleiben. Wenn ich nicht aufpasste, geisterte ich Stunden da unten herum und ließ mich von Spinnweben einwickeln.
Inzwischen tat mir richtiggehend der Magen weh. Und Mrs P war immer noch unerlaubt entfernt. Das war lächerlich. Niemand konnte von mir erwarten, dass ich die ganze Nacht wartete. Im Fernsehen lief später ein Gene-Tierney-Double-Feature, auf das ich mich schon die ganze Woche freute. Ich beschloss, Mrs P eine Lektion zu erteilen und mir selbst was zu kochen.
Die Speisekammer bereitete zunächst einiges Kopfzerbrechen. Fisch musste man ausnehmen, Fleisch schneiden, Gemüse schälen, schnipseln, sautieren. Doch dann stieß ich zufällig auf eine Büchse Bohnen. Bohnen, sagte ich mir, da kann nichts schief gehen. Zusammen mit einer Tasse voll Reis schüttete ich sie in einen Topf. Ich wartete, bis sich über dem Wasser etwas Dampf zusammenbraute, schüttete die Flüssigkeit ab, kippte Bohnen und Reis auf einen Teller und trug mein Mahl ins Speisezimmer. Ich war mächtig stolz auf mich. Wenn man schnell aß und immer wieder mit Wein nachspülte, war es ganz genießbar. Ich dinierte allein, die melancholisch tickende Uhr und eine Motte, die stimmungsvoll um den Schirm der neben dem langen Mahagonitisch stehenden Stehlampe herumflatterte, wachten über mich.
Danach mixte ich mir einen Gimlet und ging zurück in den Salon zu meiner wiederhergestellten Chaiselongue.
Der erste Film des Double Features war der unbedeutende Heaven Can Wait, in dem Gene Tierney nur eine kleine Rolle als Don Ameches fromme Ehefrau hat. Danach lief der großartige Whirlpool von Otto Preminger. Ihre seltsame Mischung aus Anziehungskraft und Geistesabwesenheit kam darin aufs Beste zum Tragen. Gene passte zu Hollywoods Absichten, als hätte man sie auf einem Studiogelände in Burbank gezüchtet. Sie zog den Zuschauer im gleichen Maße in die Handlung, wie sie sich selbst aus ihr entfernte. Wenn sie wie eine Sirene, blasser und blasser werdend, schließlich ganz aus dem Film verschwand, hatte sie einen völlig in den Film hineingesogen. Man fand sich allein in dem Raum wieder, wo eigentlich sie sein sollte, in den Schatten und den Spinnweben von Premingers grausamer Konstruktion.
Ich schaue mir jede Menge alter Filme an, und seit ich sie zum ersten Mal gesehen habe, war Gene Tierney mein Lieblingsstar aus jener Ära der wahren Stars. Obwohl sie heute weitgehend vergessen ist, betrachtete man sie zu ihrer Zeit als die schönste Frau, die jemals die Leinwand beglückt hatte. Ihre Schönheit offenbarte sich in Form einer schwelenden, rein femininen Düsterkeit, ohne die beruhigende Maskulinität einer Bacall oder Frivolität einer Hayworth. Den Filmemachern schien das Angst einzujagen. Sie besetzten sie konsequent gegen ihren Typ, als dümmliche Hausfrau, als gutmütigen Dussel oder als Karikatur einer arabischen Prinzessin. Rollen, die darauf angelegt waren, die Furcht einflößende Kraft ihres Gesichts einzuschränken und herunterzuspielen und stattdessen die ihr eigene, tief sitzende Unsicherheit hervorzukehren. Selbst als sie sie schon liebten, beharrten Kritik und Filmindustrie einmütig darauf, dass sie nicht spielen konnte. (Zum Beispiel schrieb ein Kritiker über Whirlpool, in dem sie eine von einem skrupellosen Psychoanalytiker ausgenutzte Kleptomanin spielt: »Manchmal fällt es schwer, an Gene Tierneys Spiel abzulesen, ob sie unter Hypnose steht oder nicht.«) Der einzige Regisseur, der sie und das, was die Zuschauer in ihr sahen, zu verstehen schien, war Otto Preminger. In Laura, seinem und ihrem besten Film, ist sie die meiste Zeit tot, erscheint auf der Leinwand nur in Form eines Gemäldes oder in den Aussagen der Personen, die verdächtigt werden, sie umgebracht zu haben.
Ich hatte jedoch beide Filme schon vorher gesehen, sodass ich, ausgelaugt durch die Strapaze der Essenszubereitung, eindöste. Während ich schlief, hatte ich nicht zum ersten Mal in den letzten Monaten das merkwürdige Gefühl, dass auf irgendeine unerklärliche Weise der Film mich sah. Ich wurde gequält von üblen Träumen, von lockenden, vampirhaften Frauen, die ich aber nur unscharf erkennen konnte, und die sich schließlich in schreckliche Monster verwandelten, die mich mit zahnlosen Mäulern angrinsten und bedeutungsvoll auf einen breiten Kamin deuteten, auf dessen Sims Reihen von leeren Flaschen standen. Ich wurde geweckt von Stimmen, die von der Tür kamen, und von einem fremden, lähmenden Schmerz im Magen. Die Stimmen gehörten zu meiner Schwester und dem Wesen und hatten einen eindeutig romantischem Klang, doch war ich unfähig, mich zu erheben und einzuschreiten. »Genug«, rief ich matt, doch meine Stimme versagte, und alles drehte sich, während ich kraftlos und schweißgebadet dalag. Auf dem Bildschirm in der Ecke bewegten sich stumme Menschen in einer Art provisorischem Zeltlager – tausende und abertausende von weinenden und wehklagenden Menschen. In einem bei Übelkeit bisweilen auftretenden Augenblick von äußerster Klarheit nahm ich wahr, dass mein Cocktailglas nicht mehr auf dem Tisch stand. Mrs P war wieder da! Mit letzter Kraft zog ich an der Klingelschnur, von weither hörte ich das Bimmeln widerhallen, und dann wurde ich bewusstlos.
Als ich wieder zu mir kam, lag ich in meinem Bett. Ich war ausgedörrt, der Schmerz wütete in meinen Eingeweiden. Die kleine Nachttischlampe beleuchtete zwei besorgte Gesichter, das meiner Schwester und das von Mrs P. Im Blick von Letzterer, so mein Eindruck, lag ein Hauch von Schuldbewusstsein; zweifellos war ihr klar, dass es im Grunde ihre Fahrlässigkeit gewesen war, die mich dazu getrieben hatte, mich zu vergiften. Ein drittes Gesicht, tumb und abwesend, gehörte zu Frank. Bel biss sich auf die Lippen, legte mir die Hand auf die Schulter und fragte, ob alles in Ordnung sei.
»Bohnen«, krächzte ich.
»Was?«, sagte sie.
»Ich glaube, er hat viele weiße Bohnen gegessen«, sagte Mrs P schaudernd. »Viele Bohnen, nicht gekocht.«
»Bohnen«, heulte ich wie von Sinnen.
»Um Himmels willen«, sagte Bel. »Charles, hör mir jetzt gut zu. Hast du die Bohnen vor dem Kochen eingeweicht?«
»Eingeweicht?«, sagte ich. »Natürlich nicht. Wovon redest du?«
»Was meinen Sie?«, sagte Bel zu Mrs P. Mrs P warf die Hände in die Luft, drehte sich um und redete aufgeregt Bosnisch. Oder was immer das war.
»Sie waren ziemlich hart«, sagte ich.
Frank zwinkerte mir zu. »Mordskater, was? Wie wär’s mit’m kleinen Kick zum Aufwachen?«
»Was?«, sagte ich, dann »oh«, als er einen Flachmann aus der Tasche zog. Der Gedanke, mit meinen Lippen etwas zu berühren, das er schon berührt hatte, widerte mich an. Aber ich hätte alles getan, um diese schrecklichen Schmerzen loszuwerden. Also riss ich mich zusammen und trank einen Schluck sehr billigen Whiskys. Und es funktionierte – Sekunden später übergab ich mich ausgiebig in einen silbernen Champagnerkübel. Danach fühlte ich mich nicht mehr ganz so schlecht, zumindest so gut, dass ich Bel um ein Wort unter vier Augen bitten konnte.
»Charles«, sagte sie, setzte sich aufs Bett und tätschelte mir die Stirn. »Wann wirst du endlich lernen, dich nicht wie ein Idiot zu benehmen?«
»Ja, ja, schon gut«, blaffte ich sie an. »Erst will ich wissen, was hier gespielt wird?«
»Was hier gespielt wird? Wir sind nach Hause gekommen und haben dich auf dem Boden gefunden. Du hast dich in Krämpfen gewälzt, also…«
»Nicht das, verdammt. Dieser Kerl, Frank, was macht der hier?«
Bel lehnte sich zurück. »Was meinst du?«, sagte sie.
»Ich meine, dass ich den Burschen heute das erste Mal zu Gesicht bekomme, und schon bleibt er über Nacht. Nur weil Mutter weg ist, heißt das nicht, dass du aus unserm Haus ein … ein Bordell machen kannst.«
Bel lief puterrot an. »Was fällt dir ein?«, sagte sie kalt.
»Ich denke dabei nur an dich«, sagte ich. »Ich versuche dich von etwas abzuhalten, was du vielleicht bereuen könntest. Einer von uns muss ja schließlich einen kühlen Kopf bewahren.«
»Mach dir keine Sorgen, mein Kopf ist vollkommen kühl.«
»Ach ja, ist er das, trotz allem?«
Bel stand auf. »Was meinst du mit ›trotz allem‹?«
»Ich meine, dass du nicht gut drauf bist. Das hast du selbst gesagt, Bel. Du fühlst dich einsam und bist sauer, weil du deine Freunde aus dem College nicht mehr um dich hast. Du bist schon den ganzen Sommer so. Das ist ja auch absolut verständlich. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, da muss man wieder eingreifen ins Leben und sich in den Griff kriegen. Tatsache ist, dass vereinsamte und todtraurige Menschen oft bei den falschen Leuten nach Hilfe suchen. Ihr Verstand ist benebelt, und deshalb treffen sie diese grässlichen Fehlentscheidungen…«
Bel knirschte hörbar mit den Zähnen. »Wie kannst du es wagen, so was zu sagen, Charles, und dann auch noch davon auszugehen, du wüsstest, was ich fühle. Herrgott nochmal, wenn mich irgendetwas dazu treibt, Fehlentscheidungen zu treffen oder etwas zu tun, das ich mal bedauern könnte, dann…«
»Ich denke nur an dein Wohlergehen. Kannst du dich nicht einfach mal hinsetzen und eine Sekunde zuhören?« Ein stechender Schmerz jagte mir durch die Eingeweide; ich zuckte zusammen und presste mir die Hand in die Seite. »Wer ist dieser Frank? Das ist doch die Frage, die wir uns stellen müssen. Was will er hier?«
»Ich weiß, wer er ist, und ich weiß, was er hier will, mich.«
»Aber weißt du, ob er…? Ich meine, er könnte sonst wer sein, ein Serienmörder oder ein perfekt verkleideter Supergauner, der hinter unserem Familienvermögen her ist… «
»Warum führen wir immer wieder die gleichen Diskussionen?« Sie richtete die Frage an die Decke. »Warum muss ich mir immer wieder das Gleiche anhören, wenn ich jemanden mit nach Hause bringe? Hinterhältige Vorwürfe und Gejammere, bis ich es nicht mehr aushalte. Das ist unerträglich.«
»Nun ja«, sagte ich. »Du hast eben einen unausgegorenen Geschmack…« Hastig, weil sie drauf und dran war, mich zu schlagen, setzte ich hinzu: »Du bist eben ein außergewöhnlicher Mensch, Bel, du verdienst Besseres.«
»Noch vor zwei Minuten, Charles, hast du mich mehr oder weniger deutlich eine Prostituierte genannt.«
»Das habe ich nicht.«
»Doch, das hast du. Du hast gesagt, dass ich aus unserem Haus ein Bordell mache.«
»So habe ich das nicht gemeint«, sagte ich. »Ich habe nur gemeint, dass du, na ja, dass du deine Zeit nicht mit solchen Schwachköpfen verplempern sollst. Ich weiß, wie schwer es ist, den Richtigen zu finden. Aber das heißt doch nicht, dass du unermüdlich alle Falschen ausprobieren musst. Anscheinend führst du dein Liebesleben nach der Trial-and-Error-Methode. Als ob man einen Louis-quartorze-Stuhl mit einem Verandatisch aus Plastik kombiniert. Das passt einfach nicht.«
»Verstehe«, sagte Bel. »Du meinst also, ich bin ein Stuhl?«
»Ein Louis-quartorze-Stuhl«, präzisierte ich.
»Und meine Freunde sind die Verandatische.«
»Tja, zugegeben«, sagte ich. »Der da draußen sieht eher aus wie einer von diesen schwedischen Do-it-yourself-Kleiderschränken.«
»Du machst mir Sorgen«, sagte Bel. Sie stand auf und drehte sich im Lichtschein der Lampe wütend um. »Ernsthafte Sorgen. Dir scheinen echt böse Geister im Nacken zu sitzen, Charles. Du tust alles, um jede meiner Beziehungen zu zerstören. Du schaffst es, dass sich jeder, den ich mitbringe, unwohl fühlt, und du schaffst es, mich wie eine hochnäsige Society-Schickse aussehen zu lassen. Keiner war gut genug für dich. Kevin war zu schlecht angezogen… «
»Die Sandalen. Und die Socken.«
»Liam war zu schottisch…«
»Aber so was von schottisch. Also, Bel, wirklich. Der Dudelsack. Und die endlosen Zitate aus Braveheart. Offensichtlich gibt es bei jedem, der stolz auf seine schottische Herkunft ist, gewisse Punkte… «
»David?«
»Watschelgang.«
»Roy?«
»Verdrängte Homosexualität.«
»Anthony?«
Ich kratzte mich am Kopf. »Eine Vollnull.«
»Thomas, was war der? Wie hat der dich beleidigt?«
Warum singen Vögel? Warum ist der Himmel blau? Thomas, der angebliche Körperkünstler, der aussah, als wäre er mit dem Gesicht voraus in einen Sack voller Nägel gefallen. Ich enthielt mich eines Kommentars und gönnte mir nur ein herablassendes Glucksen.
»Ist dir eigentlich nie der Gedanke gekommen«, fuhr Bel in ironischem Tonfall fort, »dass das Problem bei dir liegen könnte? Hast du dich nie gefragt, warum bin ich nur so besessen vom Liebesleben meiner Schwester? Bin ich nicht ein klein bisschen krank, vor allem, weil ich selbst den ganzen Tag nur im Haus rumhänge und Vaters Wein trinke, vor dem Fernseher sitze und mit einzigartig blöden Mädchen rummache, in deren hübschen kleinen Köpfen sich auch nicht ein Hauch von Hirn befindet? Wie dieses eine grässliche Püppchen, der Name hatte irgendwas mit Stierkampf zu tun. Und gleichzeitig krittel ich an meiner unglücklichen Schwester rum, weil sie versucht, eine normale, echte Beziehung aufzubauen und ein richtiges Leben zu führen?« Sie war jetzt auf hundert und fing an, im Zimmer herumzustapfen. »Soll ich etwa für den Rest meines Lebens hier auf Amaurot rumhängen und nichts anderes tun, als meine Nase in anderer Leute Angelegenheiten zu stecken, ganz so, als gehörten sie mir, wo mich doch in Wahrheit das alles einen Dreck angeht?« Zitternd vor Wut drehte sie sich um und schaute mich an, als erwarte sie eine Antwort.
»Reden wir immer noch über mich?«, sagte ich.
»O ja, Charles«, sagte sie und stampfte mit dem Fuß auf.
»Was schlägst du vor? Soll ich etwa, anstatt mich um meine Familie zu kümmern und sie zu beschützen, da draußen eine … eine Arbeit annehmen? Meinst du das?«
»Mit einem Wort, ja«, sagte Bel.
Ich war verwirrt. »Das ist nicht das Thema«, sagte ich störrisch.
»Möglich«, sagte Bel. »Aber es ist höchste Zeit, dass dir mal einer ein paar unangenehme Wahrheiten sagt.«
»Ich glaube, mir wird wieder übel«, sagte ich schnell.
Sie sagte sie mir trotzdem. Unbarmherzig. Sie erklärte mir, dass ich aufgrund irgendeiner verqueren Logik meine unerbetenen Einmischungen als väterlich und fürsorglich missdeute, dass diese aber in Wahrheit aufdringlich und erstickend seien. »Der einzige Grund dafür ist, dass du sonst nichts zu tun hast. Die letzten beiden Jahre hast du hier rumgesessen und getrunken, allein oder mit deinen nichtsnutzigen Freunden. Du hast im Grunde nicht den geringsten Begriff davon, was es bedeutet, erwachsen zu sein. Mir reicht’s, Charles. Mir ist es inzwischen völlig egal, ob du noch mal zurück ans College gehst. Mir ist es egal, ob du dein Leben ruinierst. Aber ich seh nicht mehr ein, warum ich meins auch ruinieren soll. Wenn du vorhast, als Versager zu enden, bitte. Aber zieh mich da nicht mit rein.«
»Versager?«, kreischte ich. »Irgendwer muss ja die Familientradition bewahren, oder? Irgendwer muss die Fahne hochhalten.«
»Vater hat nie einen Tag freigenommen«, sagte sie geringschätzig. »Und hatte die Fahne in der Hand.«
»Ja, aber er hat nicht das ganze Leben gearbeitet, damit seine Kinder auch arbeiten müssen«, parierte ich. »Und nebenbei bemerkt, ich verstehe nicht, worüber du dich so aufregst.« Obwohl auf der Hand lag, dass Bel gnadenlos introspektiv war und wahrscheinlich unter furchtbaren Schuldgefühlen wegen diesem Frank litt. »Ich begreife nicht, warum ein paar freundlich gemeinte Ratschläge dich dazu bringen, mich gleich zum Erbsenschälen zu schicken. Oder in so eine grässliche Maschinenhalle, wo ich den ganzen Tag Deckel auf Marmeladengläser schrauben muss. Am Fließband, dauernd der Krach der Maschinen und kein Stuhl, auf den ich mich mal setzen kann, und die endlose Reihe glänzender Gläser schiebt sich unerbittlich auf mich und mein kleines Deckelaufschraubgerät zu…«
»Ich rede von Verantwortungsbewusstein, Charles, davon, wie ein erwachsener Mensch zu leben…«
»Dein Frank da, der arbeitet vermutlich?«
Bel verstummte mitten im Satz und zupfte am Träger ihres Kleides. »Er arbeitet, ja«, sagte sie ausweichend.
»Und? Gehirnchirurg, Heißluftballonfahrer, dritte Geige…«
Sie senkte den Blick. »Er hat einen Lieferwagen«, sagte sie.
»Einen Lieferwagen!«, rief ich aus und stieß triumphierend einen Finger in die Luft. »Einen Lieferwagen! Und, irgendeine Idee, was er in diesem Lieferwagen herumfährt? Opium? Elefantenstoßzähne? Gutwillige, aber fehlgeleitete junge Mädchen aus gut situierten Familien?«
»Das spielt doch keine Rolle!«, sagte sie laut. »Herrgott, ich hätte wissen müssen, dass man mit dir nicht vernünftig reden kann.«
Draußen übertönte das quengelige Quietschen der Wetterfahne das Heulen des Windes. Seufzend setzte ich mich im Bett auf und schob die Manschetten meiner Pyjamajacke zurück. Der Punkt war, dass ich sie diesmal nicht ausschließlich ärgern wollte. Ich hatte tatsächlich das gespenstische Gefühl, dass sie mit Frank eine Grenze überschritten hatte. »Bel«, sagte ich ernst. »Es tut mir Leid, dass ich so grob war. Du bist erwachsen, du hast einen Collegeabschluss, du kannst selbst entscheiden. Aber auch wenn ich keiner ehrbaren Arbeit in einer Konservenfabrik nachgehe, so habe ich doch das eine oder andere im Leben gesehen. Und dieser Frank…« Obwohl ich mir das Hirn zermarterte, um eine diplomatischere, appetitlichere Formulierung zu finden, fiel mir keine ein. Also holte ich tief Luft und sagte es einfach. »Ist dir eine Figur aus der jüdischen Mythologie bekannt, die man Golem nennt?«
Bel schaute mich verdutzt, aber auch misstrauisch an.
»Die Legende besagt, dass der Golem ein vollständig aus Lehm bestehendes Wesen ist … oder in bestimmten Fällen…« Ich konnte mir diesen Zusatz nicht verkneifen, »… anscheinend auch aus Spachtelmasse…«
»Jetzt reicht’s«, erklärte sie düster. »Das war’s.«
»Komm zurück!«, rief ich verzweifelt und streckte die Arme nach ihr aus. »Um Himmels willen, komm zurück. Das ist kein Witz, Bel. Was ich dir sagen will, könnte für uns beide extrem wichtig sein.«
Sie blieb in der Tür stehen. Leicht nickend schaute sie mich mit ätzendem Blick an und sagte kühl, ich solle fortfahren.
Ich bin kein von Natur aus abergläubischer Mensch, und am nächsten Tag fragte ich mich, ob an meinen wilden, rüden Gedanken vom Vorabend die weißen Bohnen schuld gewesen waren. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist mir allerdings klar, dass ich zumindest teilweise richtig lag: Franks Auftauchen markierte den Beginn unseres Niedergangs – obwohl jeder Einzelne von uns viel dazu beigetragen hat. »Der Golem kann nicht selbstständig denken«, sagte ich Bel. »Er ist ein Roboter, der von mystischen Mächten beseelt wird – von übel wollenden, muss man hinzufügen.«
»Bitte, Charles, es ist spät. Du willst mir also weismachen, dass du Frank nicht deshalb ablehnst, weil du ein Snob und Soziopath bist, sondern weil er irgendein mystisches Wesen ist, dass man geschickt hat, um mich zugrunde zu richten? Gut, sonst noch was?«
»Ich weiß, dass sich das etwas daneben anhört«, sagte ich. »Aber ich weiß nicht, wie ich dir dieses Gefühl, diese böse Vorahnung sonst erklären soll. Ich habe buchstäblich, und das ist mir noch bei keinem von deinen Freunden passiert, eine Gänsehaut bekommen.« Ich erschauerte bei der Vorstellung, wie der düstere, klobige Frank seinen Lieferwagen durch dämmerige Vorstadtstraßen steuerte und mit leeren, glühenden Augen den Ruf seines Meisters erwartete…
Bel ließ die Schultern hängen. »Tja, sieht ganz so aus, als steckten wir in einer Sackgasse.«
»Ehrlich, eine Gänsehaut«, sagte ich und sah Frank vor mir, wie er nächtens mit Hilfe einer Straßensperre oder einer kleinen Mauer einen Überfall verübte.
Bel seufzte erschöpft und setzte sich ans Fußende des Bettes. »Charles«, sagte sie, »es ist ziemlich offensichtlich, dass dir während Mutters Abwesenheit deine neue Macht zu Kopf gestiegen ist. Ich weiß nicht, wie das enden soll oder ob ich irgendetwas dagegen tun kann. Aber eins weiß ich: Ich kann so nicht weitermachen. Wenn wir hier auch nur unter annähernd normalen Umständen zusammen leben wollen, müssen wir was tun. Ich habe zwar ein schlechtes Gewissen dabei, aber ich schlage dir folgendes Abkommen vor.«
»Abkommen?«
»Ja, ein Abkommen.« Sie rieb sich mit der Handkante die Augen. »Wenn du dieser Beziehung ohne weitere Vorwürfe und Anspielungen auf die jüdische Mythologie ihren Lauf lässt, dann verspreche ich hiermit Folgendes: Falls – falls – Frank und ich uns trennen sollten, bleibe ich drei Monate lang zu Hause und treffe mich mit niemandem. Na, wie hört sich das an?«
»Ziemlich zynisch«, sagte ich überrascht. »Ich meine, ich will doch bloß, dass du glücklich bist.«
»Charles, sag mir einfach, was ich tun soll, damit du mich in Ruhe lässt.«
»Hmm«, sagte ich. Zynisch hin oder her, diese ungewöhnliche Vereinbarung reizte mich doch sehr. Normalerweise endeten meine Auseinandersetzungen mit Bel damit, dass sie irgendetwas Zerbrechliches nach mir schleuderte. Die traurige Wahrheit war, dass sie diesen Kerl auch weiter treffen würde, ob mir das gefiel oder nicht. Wenigstens erhielt ich so eine Art Entschädigung – und das war etwas, das man vor ihr normalerweise nie bekam.
»Einverstanden«, sagte ich langsam. »Drei Monate und…«
Ihre Augen wurden schmal. »Und?«
»Und du musst mich einer deiner Freundinnen vorstellen. Laura Treston.«
»Laura Treston?«, wiederholte Bel angewidert. »Sie ist nicht meine Freundin. Mit der habe ich schon seit … Moment mal, wie kommst du eigentlich so plötzlich auf die?« Ich machte ein hüstelndes Geräusch und strich ein paar Dellen aus den Eiderdaunen. Bel stöhnte und zog an ihren Haaren. »Charles, sag bitte, dass du nicht wieder in meinen alten Jahrbüchern geschnüffelt hast.«
»Ich musste was nachschauen«, murmelte ich.
»Hör auf damit. Das ist gruselig, einfach krank. Die Fotos sind mindestens vier Jahre alt, wir waren praktisch noch Kinder damals.«
»Und wenn schon«, sagte ich grob.
»Keiner von uns sieht heute noch so aus. Ein paar sind sogar schon tot.«
»Könnten wir bitte zum Thema zurückkommen?«, sagte ich.
Bel stöhnte wieder. »Bitte, Charles, verlang das nicht von mir. Ich will sie nicht anrufen. Laura ist so was von langweilig. Nach unserer letzten Unterhaltung hab ich mich eine Woche lang an den Espressotropf gehängt.«
»Das ist meine Bedingung«, sagte ich. »Nimm an oder lass es bleiben.«
Sie kapitulierte. »Also gut«, sagte sie. »Ich ruf sie morgen an, und du versprichst, Frank und mich in Ruhe zu lassen. Versprochen?«
»Wo ist er jetzt?«, fragte ich. »Doch wohl hoffentlich im Gästezimmer?«
»Und zwar ab sofort.«
»Okay, okay, versprochen.« Ich streckte die Hand aus, sie schüttelte sie, und damit war das Abkommen besiegelt. Gähnend verließ sie das Zimmer. Ich ließ meinen Kopf, in dem ganze Gedankengalaxien herumwirbelten, aufs Kissen fallen.
Seit meinen mädchenlosen Schultagen waren Bels Jahrbücher mein geheimes Laster gewesen. Ich hatte sie aus dem Stapel unter ihrem Bett geklaut und mit in die Schule genommen, hatte sie meinen Klassenkameraden gezeigt und wurde so der umjubelte Held des Tages. Wir versammelten uns hinter der Cricketumkleide und steckten im Glanz der Fotos die Köpfe zusammen. Wir waren fasziniert von der schieren Masse der Gesichter, Namen und Möglichkeiten, taxierten jedes Mädchen auf einer Skala von eins bis zehn, spekulierten über ihre sexuellen Vorlieben und fantasierten uns in unsere dunklen Schlafsäle, wo – schließlich kannten wir uns ja aus mit Mädchen – unweigerlich Kissenschlachten entbrennen würden … Kurz darauf wurde es still, und jeder verlor sich in seine ganz persönliche Träumerei – versunken in ein Foto, in ein Schein-Elysium, in dem unsere weiblichen Pendants weilten, in schwarzweißen Reihen strahlend oder finster dreinblickend, entrückt und fremd wie Sterne.
Und so war ich ihr das erste Mal begegnet. An einem Sommertag, als ich mich aus Langeweile in Bels Zimmer geschlichen und zum wiederholten Male erfolglos ihr Tagebuch gesucht und stattdessen das neue Jahrbuch gefunden hatte. Ich saß auf dem Bett und betrachtete die Garde zwölfjähriger Mädchen, bis mein Blick plötzlich hängen blieb, mein Atem stockte und mein Lechzen von etwas Reinerem verdrängt wurde, das so klar und vergeblich war wie ein Wunsch. Die Augen, der Mund, die hinreißende Andeutung des Halses unter der Bluse der Schuluniform; die Komposition der Locken, die – ob sie nun haselnussbraun oder blond waren, war nicht zu erkennen – so wunderbar reglos auf den Schultern ruhten. Mit einem merkwürdigen Gespür für den schicksalhaften Augenblick fuhr ich mit dem Finger über die Namensreihe unten auf der Seite. Audrey Courtenay, Bunty Chopin, Dubois Shaughnessy … und dann: Laura, Laura Treston.
Obwohl die Mächte des Schicksals verhinderten, dass wir uns je trafen, so habe ich seitdem doch ihren Werdegang in den Jahrbüchern verfolgt; jedes einzelne erschloss mir eine neue Metamorphose. In den Kissenschlachten meiner Träume waren es mehr als alles andere die polsterweichen Brüste, die bebten und widerhallten vom zarten, dumpfen Aufprall der Federn. Noch heute, die Schulzeit seit Jahren vergangen und sie weiß Gott wo, lebte sie wie ein Hologramm in meinem Herzen fort. Die Patsy Olés dieser Welt kommen und gehen, aber das, da war ich mir sicher, das würde sich als die große Liebe meines Lebens erweisen.
Bel selbst tauchte übrigens weder auf Klassenfotos noch auf irgendwelchen anderen Fotos auf. Was ihr Aussehen anging, war sie immer heikel gewesen. Wenn die Fotos von irgendeiner Familienfeier entwickelt waren, schnappte sie sich sie unweigerlich als Erste, schaute sie zwanghaft durch, legte sie zwei Minuten später zur Seite und sagte traurig: »Was, so sehe ich aus? Warum sagt mir das denn keiner?« Ich habe nie verstanden, warum sie so ein Theater darum machte, denn schon damals konnte jeder sehen, wie schön sie werden würde. Offensichtlich entsprach das Mädchen auf den Fotos nie dem Mädchen, als das sie sich in ihrer Vorstellung sah. Sie fing an, die Fotos zu hassen, die nie verblassenden Augenblicke, deren objektive, unentrinnbare Wahrheit sie einholen und quälen würde. Also beschloss sie im Alter von zwölf Jahren, sich fortan nicht mehr fotografieren zu lassen. In der Schule fand sie immer Wege, sich zu drücken. Zu den Fototerminen wartete sie mit immer verstiegeneren Krankheiten auf. Die alten und tatterigen Nonnen, die sie als Lehrerinnen hatte, fielen immer auf die angemalten Flecken, die Masern, Gelbfieber oder irgendwelche Verletzungen vortäuschten, herein. Auf Familienfotos ist ihre Rolle die der Lücke, die der unerklärlichen paar Zentimeter Mobiliar, die am Rand eines Fotos neben Mutter, Vater oder mir zu sehen waren. Bis heute scheint sie sich in der Sekunde, in der ein Fotoapparat auftaucht, in Luft aufzulösen.
Vor Aufregung konnte ich nicht wieder einschlafen. Eine Stunde lang lag ich glücklich da und stellte mir mein neues Leben mit Laura vor. Aber mit fortschreitender Nacht schwand die Aufregung, Zweifel plagten mich, ob sich auch alles fügen würde. Plötzlich kam mir alles zu übersichtlich, zu leicht vor. Hätte ich mich dem Abkommen verweigern sollen? Hatte ich Bel verraten und verkauft? Und dann glaubte ich Geräusche zu hören. Ich konnte mir einfach nicht einreden, dass nicht er das war, der da todbringend durch Flure und Gänge strich und sich vergewisserte, ob auch alles schlief, bevor er sich an sein verbrecherisches Werk machte.
Ich ärgerte mich über mich selbst. Trotzdem schlüpfte ich in meine Pantoffeln und ging auf den Flur zum Treppenabsatz. Alles war ruhig – bis auf das ferne Knarzen und Rumpeln des schlafenden Hauses und eine irgendwo vor sich hintickende Uhr. Das Bad war leer, allerdings stieg mir ein ungewohnter Gestank in die Nase. Ich zog in Mutters Schlafzimmer die Vorhänge zu und ging dann zu Vaters Arbeitszimmer. An der Tür hielt ich inne: Den Knauf schon halb umgedreht, überfielen mich die Erinnerungen, als hätten sie im Innern des Metallgriffs nur auf mich gewartet. Erinnerungen aus der Zeit, bevor mein Vater angefangen hatte, die Tür abzuschließen, als ich noch mit einem Glas Milch zu ihm kam oder einer Schnecke oder meinen Hausaufgaben (In Norwegen gibt es viele Fjorde, die Menschen dort haben nicht viel zu tun). Er saß dann immer versunken in seinem riesigen Sessel und grübelte über etwas nach. Wie verzaubert der Raum immer auf mich gewirkt hatte, mit seinen Schwindel erregenden Wänden aus geheimnisvollen Büchern und Journalen, dem düsteren Teppich, den Mutter immer wegwerfen wollte, aber nicht durfte, dem servilen, auf seinem Sockel hoffnungsvoll wartenden Gipskopf. Ein Raum wie eine Alchimistenhöhle, die Teil des Hauses war und auch wieder nicht, wo Vater mit uns zusammen lebte und auch wieder nicht…
»Was soll das hier bedeuten, Papa, Knochen?«
»Backenknochen, Charles. Du musst wissen, dass manche Menschen eigentlich gar keine haben, und diese Farben hier…«
»Und das, was ist das?«
»Also, das ist eine chemische Formel, so nennt man das. Und das hier ist ein Stearatradikal. Halt, Charles, nicht anfassen…«
»Ooh, ’tschuldigung.«
»Macht nichts. Schau mal aus dem Fenster, siehst du Mutter? Vielleicht kannst du ihr ein bisschen im Garten helfen?« Und damit schob er mich sanft, aber bestimmt zur Tür hinaus…
Seit seinem Tod war nichts in dem Raum verändert worden. Alles war so, wie er es hatte liegen lassen; als ob er nur mal eben aus dem Zimmer gegangen wäre und jeden Augenblick zurückkommen könnte: die Glasfläschchen mit Farbstoffen und Essenzen, die Farbskalen und Querschnittzeichnungen, der Schreibtisch, der überquoll von Magazinausschnitten mit Fotos ungestümer Models, die Frisuren und Kleider trugen, die schon aus der Mode waren. Sie glichen Geistern, die man allein für diesen Augenblick belebt hatte, aus der Dunkelheit auflodernden Flammen, die dann wieder in ihr Reich, wo es immer 1996 war, zurückkehrten. Die einzige Veränderung war Vaters Porträt, das Mutter gegenüber dem Fenster aufgehängt hatte. So konnte er sich auch weiter an dem Anwesen und dem Park erfreuen, an seinem Empire, das er aus dem Nichts aufgebaut hatte. Nun ja, fast aus dem Nichts: Unsere Familie führt ihre Ursprünge auf die ersten normannischen Eroberer zurück, obwohl einige bedauerliche Tändeleien mit dem ansässigen Kleinbauernstand die Blutlinie über die Jahrhunderte etwas verwässert hat. Diesem Umstand ist möglicherweise die gelegentliche und auch bei meiner Schwester offenbare Laxheit im Urteil geschuldet. Ich stand im Mondlicht, wobei ich mich mit den Armen am Schreibtisch hinter mir abstützte, und studierte die Hakennase, die dünn lächelnden Lippen, die frischen roten Wangen. Obwohl das Bild nach seinem Tod gemalt worden war, nach Fotografien, traf es das Wesen meines Vaters sehr gut. Er war ein Mensch gewesen, der dem Leben auf eine ihn beflügelnde, wenn auch unerklärbare Weise zugetan war.
Ich hatte schon fast vergessen, weshalb ich überhaupt hier war, als mir zufällig etwas Ungewohntes auffiel: zwei rote Vertiefungen in einem samtenen Quadrat. In Vaters Münzsammlung fehlten mysteriöserweise zwei Stücke. Frank! So spielte er also sein Spiel – langsam angehen lassen, dann fällt keinem was auf, bis das ganze Haus ausgeräumt ist! Ich stellte mir die Szene vor: ein schäbiger Vorortpub, unter der Decke der plärrende Satellitenfernseher, Plastiktische im Marmorlook, er und sein Hehler, flache Filzhüte auf den Köpfen, wie sie sich lachend mit klirrenden Gläsern zuprosteten und das schäumende Bier tranken. Ich hörte, wie unten ein Küchenschrank geöffnet wurde. Ha! Wütend krempelte ich meine Pyjamaärmel hoch. Auf frischer Diebestat erwischt, das Maul werde ich ihm stopfen, Golem hin oder her!
Leise tappte ich die Treppe hinunter. Aus dem Salon holte ich den Schürhaken, dann sah ich auf den Bodendielen der Halle einen schwach glänzenden Lichtschein. Vor der ausladenden Treppe wirbelte ich herum und blickte von einer verschlossenen Tür zur anderen. Dann ein Geräusch! Ich stürzte mit erhobenem Schürhaken durch die Tür der Spülküche – und konnte mich gerade noch rechtzeitig fangen. Der Hieb streifte Mrs P zwar nur leicht, aber er reichte unglücklicherweise aus, um das Silbertablett aus ihren Händen schießen und auf den Boden krachen zu lassen. »Master Charles«, kreischte sie. »Sie erschrecken mich zu Tode.«
»Tut mir Leid, Mrs P, hätte nicht gedacht, dass Sie so spät noch auf sind… «
»Doch, ja«, sagte sie stockend. »Ich … ich mache das Frühstück.«
Ich hob einen zartes Stück Fasan vom Boden auf. Ein paar verlockende Stückchen Röstkartoffeln klebten daran. Frühstück um drei Uhr morgens? Zudem kein gewöhnliches Frühstück. Zum Fasan gab es – beziehungsweise lag jetzt neben ihm auf dem Boden – ein himmlisch aussehendes Soufflé und eine Flasche ziemlich anständigen Armagnacs. Es schien ganz so, dass sich da jemand berechtigte Hoffnungen auf ein Frühstück erster Klasse im Bett machen konnte. Und es bestand kaum ein Zweifel daran, wer dieser Jemand war – die Arme war immer noch ganz außer sich wegen des Weiße-Bohnen-Debakels. Und tatsächlich, jetzt, da ich sie mir genauer anschaute, sah ich die Ringe, die Kummer und Müdigkeit in ihr einfaches, bäuerliches Gesicht gegraben hatten.
Sie protestierte zwar, aber ich ließ nicht zu, dass sie das Frühstück um diese Stunde noch einmal zubereitete. Ich sagte ihr, sie solle sich keine Gedanken mehr über die weißen Bohnen machen und sofort schlafen gehen, wenn sie den Boden sauber gemacht habe. Dankbar verbeugte sie sich, und ich verließ die Küche. Ich staunte über ihren Eifer, machte mir aber doch zunehmend Sorgen um ihre geistige Standfestigkeit – ich meine, Fasan zum Frühstück, ich bitte Sie. In all der Aufregung war mir das Frank-Mysterium glatt entfallen. Und es dauerte auch noch einige Zeit, bis ich merkte, dass die Ottomane und der kunstvoll verzierte Teekessel auch verschwunden waren.
Zwei
ES KÖNNTE DER EINDRUCK ENTSTANDEN SEIN, als habe Bels Standpunkt etwas für sich. Ich meine den Punkt, dass ich keinen Job hatte. Für den oberflächlichen Betrachter mag es so ausgesehen haben, als führte ich – verglichen mit dem lärmenden Arbeitseifer, mit dem sich die Stadt nördlich von uns selbst zerfleischte – ein Leben in Trägheit. Es stimmte, dass ich nach einer kurzen und zu bedauernden Verirrung in höhere Ausbildungswege meine Aktivitäten im Wesentlichen auf das Haus und seine Umgebung beschränkte. Aus einem einfachen Grund: Ich war dort glücklich. Und da ich weder über nennenswerte Kenntnisse noch weiterreichende Talente verfügte, sah ich keine Veranlassung, der Welt mit meiner Anwesenheit zur Last zu fallen. Die Behauptung allerdings, ich täte nichts, war falsch. Es gab einige Projekte, die mich auf Trab hielten, wie zum Beispiel Komponieren und die Überwachung der Turmbauarbeiten im Garten. Ich sah mich als jemanden, der eine bestimmte Art zu leben wieder erweckte, eine fast verschwundene Lebensart, nämlich die kontemplative des Landedelmannes, der sich in Einklang weiß mit seiner Stellung und Geschichte. Die Menschen der Renaissance nannten das sprezzatura: Die Idee war, jede Handlung des Menschen habe von Schönheit durchdrungen zu sein, aber bei ihrer Ausführung doch mühelos zu erscheinen. Wenn nun eine Person, sagen wir, im Rechtswesen tätig war, so habe sie diese Tätigkeit auf die Stufe der Kunst zu erheben; und wenn jemand faulenzen wolle, dann habe er in Schönheit zu faulenzen. Dies, so der Renaissancemensch, sei die wahre Bedeutung eines Lebens als Aristokrat. Ich hatte das Bel mehrere Male erklärt, aber sie schien es nicht zu begreifen.
Unser Haus hieß Amaurot. Es lag in Killiney, etwa zehn Meilen von Dublin entfernt, einer schattigen Gegend mit Meeresluft und niedrig hängenden Zweigen über schmalen, gewundenen Straßen. Die meisten Häuser waren im neunzehnten Jahrhundert von Richtern, Vizekönigen und Menschen erbaut worden, die bei Heer und Marine tätig waren. In den vergangenen Jahren jedoch war aus der Gegend eine Art Steuerparadies für ausländische Autorennfahrer und Soi-disant-Musiker geworden. Trotzdem besaß sie immer noch eine weltabgeschiedene Eleganz und atmete die Stille des Waldes. Nirgendwo sonst hätte ich leben wollen.
An so manch strahlendem Morgen stieg ich unter dem Blätterdach von Esche und Bergahorn die moosbewachsenen Stufen zum Killiney Hill hinauf. Auf der Anhöhe stand ein Obelisk, den man zum Gedenken an die Freundlichkeit des Landadels gegenüber den einheimischen Bauern während des Hungerjahres 1741 errichtet hatte. Von dort hatte man einen Blick über die halb versteckten Dächer bis zu den blauen Bergen und der goldenen Sichel des Strandes. Neben dem Denkmal stand eine Zikkurat, ein kleiner babylonischer Turm. Die Legende besagte, dass man einen Wunsch frei habe, wenn man jede Ebene des Turms siebenmal umrundete. Aber weder Bel noch ich hatten es jemals bis ganz nach oben geschafft, und wenn wir es geschafft hätten, wäre uns wohl viel zu schwindelig gewesen, um überhaupt noch einen Wunsch äußern zu können.
Amaurot war groß und hunderte von Jahren alt. Als wir noch Kinder waren, glaubten Bel und ich, dass uns nie etwas Böses zustoßen könnte, so lange wir nur hier blieben. Die Welt draußen könnte in Flammen aufgehen, und wir würden einfach im Schatten der hohen Steinmauern weiterspielen. Was uns betraf, so war Amaurot die Welt – sie gehörte uns, wie die Wellen zum Meer und bestimmte Blautöne zum Himmel gehörten.
Das Haus stand am Fuß von steilen Hügeln auf einer Landzunge, die an zwei Seiten vom Meer umspült war. Zu jeder Stunde des Tages konnte man die See flüstern oder donnern hören, konnte man sehen, wie sie sich von Jadegrün in Amethystviolett, von Grau in tiefstes Schwarz verfärbte. Ich liebte sie als Gefährtin für meine Gedanken, als Ohr, der ich meine Wünsche offenbarte. Über die Rasenflächen führte in weitem Bogen eine stolze, lange Allee zurück zur Straße. Uralte Bäume, junge Bäume, wilde Blumen drängten sich dicht an dicht. Hinter dem Haus befanden sich der in den letzten Jahren ziemlich verwahrloste Gemüsegarten, Apfelbäume, Kirschbäume und ein Bach, der die Frösche hinunter ins Meer spülte. Hier hatten Bel und ich den Großteil unserer Kindheit verbracht, in hohem Gras, auf einem Teppich aus Kiefernnadeln.