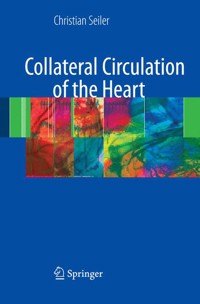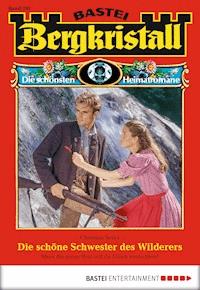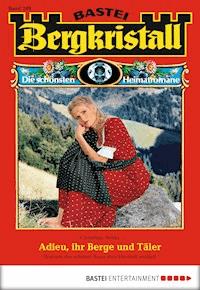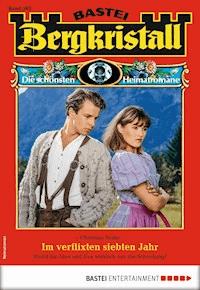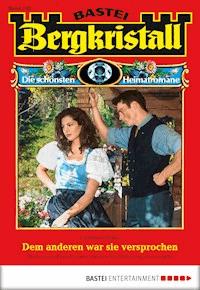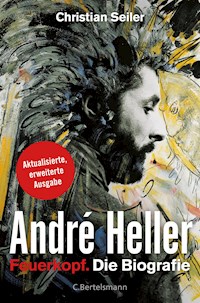
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
»Wer André Hellers Spuren folgt, sieht einem universellen Gesamtkunstwerk beim Wachsen zu.« (Christian Seiler)
André Heller ist seit Jahrzehnten der Tausendsassa des internationalen Kulturbetriebs, dem es wie keinem anderen gelingt, künstlerischen Anspruch und Publikumswirksamkeit zu verbinden. Mit seinem Namen sind einzigartige Theater-, Musik- und Artistikinszenierungen verknüpft, die Welterfolge wurden: Ob »Circus Roncalli«, »Begnadete Körper« oder »Afrika! Afrika!«, ob die Bewerbung Deutschlands für die Fußballweltmeisterschaft 2006 unter dem Slogan »Die Welt zu Gast bei Freunden« – Heller schöpft aus dem Fundus der Weltkulturen, zeigt nie Gesehenes, bringt ohne Berührungsängste bislang stets Getrenntes zusammen. Dabei hat er immer auch politisch Position bezogen und sich nie gescheut zu polarisieren. Anlässlich seines 65. Geburtstags zeichnet Christian Seiler, der den unermüdlichen Visionär seit zwei Jahrzehnten gut kennt, in seiner autorisierten Biografie mit vielen unveröffentlichten Dokumenten und Bildern ein außerordentlich buntes Leben als Gesamtkunstwerk nach.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 621
Ähnliche
Christian Seiler
André Heller.Feuerkopf
Die Biografie
C. Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2012 by C. Bertelsmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: R·M·E Roland Eschlbeck und Rosemarie Kreuzer auf der Basis eines Entwurfs von Stefan Fuhrer unter Verwendung einer Fotografie (Titel) von © Peter Rigaud und eines Gemäldes (Rückseite) von © Christian Ludwig Attersee Das Foto auf dem Einband (André Heller mit seinem Sohn) stammt von Martin Vukovits
Gestaltung der Bildteile: Stefan Fuhrer
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-06844-8V002
www.cbertelsmann.de
Vorwort
Das ganze Leben ist ein ewigesWiederanfangen.
Hugo von Hofmannsthal
Die Vormittage gehören André Heller allein. An Vormittagen nimmt er keine Anrufe entgegen, vereinbart er keine Termine, sagt nicht Bescheid, wo er ist. Manchmal arbeitet er, manchmal liest er ein Buch, manchmal, wenn es abends spät geworden ist oder der Schlaf sich nicht wie gewünscht einstellen wollte, bleibt er im Bett. Die Nächte, sagt Heller, sind ruhiger geworden, seit er das so hält. Selbst wenn er, ein schweres Kissen auf den Füßen, auf dem Rücken liegt und an die Decke seines Schlafzimmers starrt, weiß er, dass er den nächsten Tag erst beginnen muss, wenn er sich ausgeschlafen und ein Bad genommen hat, seine Gedanken ordnen konnte und bereit ist, mit der Arbeit zu beginnen. An den Vormittagen ist André Heller eine private Person, aber das ist natürlich nur die andere Seite der Geschichte.
Dieses Buch ist die Biografie des Mannes der vielen Eigenschaften. Der schlampige Ausdruck »Multimediakünstler«, mit dem Franz André Heller oft bedacht wird, resultiert aus dem Unvermögen, seine vielen Talente in einen passenden Begriff zu packen. Natürlich ist Heller kein Multimediakünstler oder jedenfalls nicht das, was landläufig darunter verstanden wird, nämlich jemand, der irgendwas mit Video und Tonspuren macht. Das macht Heller notfalls auch, aber nicht nur. Er ist Schriftsteller und Theaterautor, Regisseur und Bühnenbildner, Maler und Impresario, Dokumentarfilmer und Schauspieler, Zirkusdirektor und Sänger, politischer Aktivist und Lebensberater, Weltreisender und Gartenkünstler, Showdirigent und Geschäftsmann, Ausstellungsmacher und Bildhauer, Komponist und Feuerwerker, Vater und Liebhaber und darüber hinaus noch so manches, was sich aus der Kombination oder Neuerfindung all dieser Berufe und Leidenschaften ergibt.
Die Lebensbeschreibung so einer Person gerät zwangsläufig in dramaturgische Turbulenzen. André Hellers Biografie verweigert sich der natürlichen Ordnung der Chronologie. Es gab und gibt Zeiten in Hellers Leben, die so dicht mit Aktivitäten belegt sind, dass es einem Geschicklichkeitsspiel gleichkommt, die Fäden zu entwirren und den Resultaten, zu denen sie führen, zuzuordnen.
Die Dramaturgie dieser Biografie ist dem Überschwang an Resultaten, oder wie Heller gern sagt, »Verwirklichungen« geschuldet. Ihre Kapitel fassen eher Themenbereiche als genaue Zeitabschnitte zusammen. Manchmal – wie in den Abschnitten über Musik, Literatur oder Politik werden Entwicklungen so dargestellt, dass die Draufsicht Zusammenhänge klarmacht und dafür das darunterliegende Raster der Chronologie sprengt. Es empfiehlt sich, die Biografie von vorne nach hinten zu lesen, aber genauso gut ist es möglich, sich der Person André Heller nach Themengebieten zu nähern. Wobei: kaum ein Thema steht für sich allein, und Heller ist nur in der Gesamtheit seiner unzähligen Hervorbringungen und Motive wirklich zu verstehen.
André Heller ist ein Mensch, der sich sein Leben nach den eigenen Vorlieben möbliert. In seinen Wohnsitzen ist das buchstäblich zu sehen. Heller besitzt drei. Ein Palais in Wien, eine Villa am Gardasee, einen Landsitz in Marokko.
In Wien zog Heller Ende der neunziger Jahre von Hietzing, wo er in der von Adolf Loos umgebauten und eingerichteten Familienvilla in der Elßlergasse gewohnt hatte, in den ersten Bezirk, wo er im Palais Windischgrätz die Beletage übernahm und nach seinen Bedürfnissen umgestaltete. Der über hundert Quadratmeter große Salon wirkt auf den ersten Blick wie ein Museum. An den Wänden zahlreiche Bilder unterschiedlicher Epochen, ein Selbstporträt von Picasso, ein Ölbild von Braque, ein besonders schöner Chagall, ein Basquiat, ein Navratil, ein Hockney, ein Walla, eine meterhohe Vitrine, in der eine Skulptur von Keith Haring steht, Tierfiguren, Kultgegenstände, afrikanische Möbel, bodenlange, seidene Vorhänge, Unmengen von Büchern. Hier trifft Heller seine Gäste, Freunde und Mitarbeiter, hält Besprechungen ab, gibt Interviews, führt seine Geschäfte.
Die prächtige Ausstattung der Wohnung ist einerseits eine Visitenkarte Hellers, mit der er jedem Besucher sofort vermitteln kann, wer ihn da empfängt: ein Gastgeber, dem man Weltläufigkeit und Geschmack nicht buchstabieren muss. Andererseits hat Heller ein so starkes Bedürfnis nach der von ihm selbst geprägten Ästhetik, dass er sich nur im Ausnahmefall an andere Orte begibt, die seinen Vorstellungen von Licht, Geruch, Diskretion und Großzügigkeit nicht entsprechen. Oft huscht er nachmittags in eines der nahe gelegenen Restaurants, um im leeren Lokal einen Fisch oder einen Teller Pasta zu essen, und kehrt im Anschluss daran sofort nach Hause zurück. Die eklektizistische, pittoreske Pracht, mit der er sich umhüllt, ist sein Kokon.
Auch in Gardone, wo Heller eine Villa im venezianischen Stil bewohnt, wurde fast das gesamte Erdgeschoss in einen Salon verwandelt, wo Heller wie in Wien Gäste und Geschäftspartner empfängt. In Gardone sind die Tage durch die Mahlzeiten, die von der Köchin bereitet werden, getaktet. Punkt vierzehn Uhr gibt es Mittagessen, eine Glocke läutet die stets zahlreich anwesenden Gäste an den großen Tisch neben der Küche oder, wenn das Wetter danach ist, in den Garten unter das Sonnendach. Heller lässt mit Vorliebe Vor- und Hauptspeisen gleichzeitig servieren, ihm gefällt das appetitliche Durcheinander, wie man es von arabischen Tischen kennt. Er geht großzügig mit Einladungen nach Gardone um, so dass sich beim Essen oft eine unkonventionelle Mischung von Menschen trifft: Künstler, Politiker, Unternehmer, Esoteriker, Freunde von Freunden, Runden, die so vielfältig sind wie die Interessen André Hellers.
In Marrakesch hat er ein ganzes Haus bauen lassen, das den Gästen in seinem neuen, riesigen Garten als Salon dienen kann. Vor den Gästehäusern, die wie ein kleines Dorf zusammengewürfelt sind, befindet sich so etwas wie ein Dorfplatz, mit Steinen gepflastert, in den Stufen eingelassen sind, wo abends Musikanten sitzen und den Platz vor der weiten Landschaft mit orientalischen Melodien füllen.
Hellers Wohnsitze ähneln einander, weil sie an allen drei Orten dieselben Funktionen erfüllen. Überall gibt es mehr zu schauen, als man sich bei einem einzigen Besuch merken könnte, nur der Maßstab ist unterschiedlich. Was in Gardone schon weitläufig wirkt, ist in Marokko zehnmal so groß. Wenn sich Heller in Wien in den hinteren privaten Trakt der Beletage zurückzieht, hat er dafür in Gardone einen ganzen Stock und in Marokko ein eigenes Haus.
Seit 2008 arbeitete ich mit André Heller an dieser Biografie. Wir führten Gespräche in Wien, Gardone und Marrakesch, die insgesamt hunderte Stunden dauerten. Nachdem sich Heller entschieden hatte, mir für die Arbeit an seiner Lebensgeschichte zur Verfügung zu stehen, unterstützte er das Projekt nach Kräften. Er öffnete mir sein Adressbuch und informierte seine Freunde und Wegbegleiter darüber, dass sie mir ohne Einschränkungen Auskunft über ihn geben sollten. Er ermunterte mich, auch bei Gegnern seiner Arbeit und seiner Person Auskünfte einzuholen, erwies sich jedoch in unseren Gesprächen in seiner Selbstkritik schärfer als die meisten seiner Kritiker mit ihren Anwürfen.
Heller und ich kennen einander seit 1995. Als Chefredakteur des Nachrichtenmagazins profil und der Kulturzeitschrift du traf ich ihn regelmäßig und schrieb über einige seiner Bücher, Projekte, Filme und Platten.
Meinen ersten Artikel über André Heller hatte ich freilich schon viel früher verfasst, 1989 als Beitrag für die Tageszeitung Der Standard, die für ihre Wochenendausgabe ein »Pro und contra André Heller« plante und verzweifelt nach jemandem suchte, der den Pro-Part übernahm.
1989 war meine Meinung zu André Heller indifferent. Ich mochte seine Musik, aber zu singen hatte er ja schon ein paar Jahre davor aufgehört. Ich war 1982 als Maturant in einem seiner beiden Abschiedskonzerte im Wiener Konzerthaus gewesen und erinnere mich an das Bedauern, mit dem ich das Haus verließ, weil ich mir mehr von diesem gescheiten, koketten, weltwienerischen Performer gewünscht hätte. Aber er wollte ja nicht mehr.
Sagen wir so: Es war 1989 keine Mehrheitsposition, André Heller gut zu finden. Seine Unberechenbarkeit als Künstler, vor allem aber seine öffentliche Selbststilisierung, die damals sein vielleicht wichtigster Kommunikationskanal war, reizte entweder zur Verehrung oder aber zum Widerspruch, erzeugte bei vielen aber bloß blanke Antipathie. Die populären Künste, denen sich Heller verschrieben hatte, waren noch nicht kanonisiert. Den Kulturredakteuren der großen Zeitungen galt es bereits als mutiger Akt, ein neues Popalbum auf die Aufmacherseite zu rücken, und Heller hatte sich ja vom Pop verabschiedet, um noch populärere, noch weniger kanonisierte Disziplinen auszuprobieren und neu zu erfinden. Zirkus, Varieté oder Feuerwerk standen aber noch weniger auf der Speisekarte der Rezensenten, die es sich im Elfenbeinturm der Hochkultur eingerichtet hatten.
Gemessen daran, was Heller von den Kritikern verlangte, bekam er erstaunlich viele Ermunterungen. Aber er kämpfte auch um sein Leben. Gute Kritiken motivierten nicht nur den Erfinder und Impresario Heller, sondern auch die, die ihm Geld für seine großen Projekte geben sollten, die Produzenten und Gönner. Wenn Heller während seiner ganzen Karriere mit besonderer Aufmerksamkeit darauf bedacht war, zu vermitteln, was er tat, und dafür Lesarten anbot, die er als begnadeter Formulierer gleich mitlieferte, dann war das die direkte Folge seiner Angst, das Scheitern eines Projektes mit dem Scheitern der gesamten Karriere zu bezahlen.
Kein Außenstehender kannte diese Angst, denn unerschrockener als Heller konnte man in der Öffentlichkeit nicht auftreten. Er legte sich mit Publikumslieblingen genauso an wie mit Politikern und Zuständen, und nur die, die ihn abends zu Hause erwarteten, wussten von der Kraft, die es ihn kostete, mutig zu sein. Er leistete sich, in frühen Jahren, oft der puren Originalität und Pointenlust wegen, den Luxus, unabhängig aufzutreten, und das wurde ihm von denen, die dazu nicht in der Lage waren, schon allein deshalb übel genommen.
Außerdem führte es zu einem Missverständnis, das bis heute nicht ausgeräumt ist. Heller war kein rich kid, das sein Leben lang nur das Vermögen der Familie verjubelte. Er kam aus großbürgerlichen Verhältnissen, das schon, aber sein gesamtes Erbe, das ihm 1965 ausgezahlt wurde (und das viel weniger war, als man sich gemeinhin denkt), steckte er augenblicklich in einen Film, dessen Hauptdarstellerin die Schauspielerin Erika Pluhar war, die Heller erobern wollte. Der Film blieb eine Fußnote in der Filmgeschichte, Pluhar jedoch wurde Hellers Frau, und alles an Geld, was er seither investiert, verjubelt, in kulturelle Expeditionen gesteckt hat, war selbstverdient. Mehr als einmal stand er mit einem Fuß am Abgrund, weil die Schulden so hoch waren. Aber das hielt ihn nie davon ab, zu agieren, als ob Geld abgeschafft wäre: Er wollte immer nur das Beste. Das beste Zimmer im besten Hotel, einen Butler, die besten Musiker der Welt, um mit ihnen die weltläufigsten Wienerlieder zu singen, die es jemals gegeben hatte, die besten Artisten, Verwandlungskünstler und Pyrotechniker, die kostbarsten Anzüge, die schönsten Frauen.
Ich fragte den Kollegen des Standard, wer contra Heller schreiben würde: der Schriftsteller Antonio Fian. Fian war mir als Verfasser kleiner Dramolette bekannt, in denen er Originalzitate Prominenter aus Zeitungsinterviews sarkastisch montierte, das war manchmal ganz lustig. Sein Beitrag zu Heller jedoch war deftig. Fian verglich Heller mit Hitler, mit dem dieser nicht nur die Initialen gemeinsam habe. Beide seien als Künstler gescheitert, beide bewegten die Massen. Heller behaupte wie Hitler mit dem Gestus des Erlösers die eigene Kultur, mit der er die Welt beglücken wolle. Fians abenteuerlicher Schluss: Von allen geliebt werden zu wollen, heiße, alle beherrschen zu wollen.
Das war so impertinent, dass mir die Luft wegblieb. Bei allen möglichen Vorbehalten gegen Heller, dachte ich mir, kann man so etwas nicht stehen lassen. Ich übernahm also den Pro-Heller-Part im Standard und erarbeitete mir eine Meinung zu Heller, die je nach Disziplin ganz unterschiedlich ausfiel. Seine Lieder fand ich großartig, seine Bücher bemerkenswert, seine Ausstellungsräume interessant und anregend, manche seiner Shows toll, andere ließen mich kalt. Aber besonders interessierten mich damals die Gründe, warum seine pure Präsenz so tollwütige Reaktionen auf sich zog, warum sich einzelne Autoren am Gift ihrer eigenen Kritik an Heller berauschten.
Es stimmt, dass sich Heller den Ruf als »Reizfigur« hart erarbeitet hat. Nicht nur übrigens, weil er beim Austeilen zu Beginn seiner Karriere nicht zimperlich war. Viel wichtiger für seine Umstrittenheit war die Frequenz seiner Projekte – und ihr Erfolg. Dass ein junger Mann die Bühne betrat und ankündigte, sich selbst verwirklichen zu wollen, war noch zu ertragen gewesen. Dass er es tatsächlich tat, unterschied ihn von den meisten, und wie er es tat, von allen anderen.
Fast alles, was Heller anpackte, hatte Erfolg. Seine Zuschauer zählte er nicht nach Hunderten, sondern buchstäblich nach Millionen. Das schürte den Generalverdacht der weniger Erfolgreichen gegen Heller, er verbünde sich mit dem Kommerz, er inszeniere dem Publikum nach dem Maul, er bediene sich unlauterer künstlerischer Mittel. Wer jemals eine Show oder eine andere Großveranstaltung von ihm gesehen hat, weiß, dass das Gegenteil stimmt. Ihr Erfolg liegt darin begründet, dass er den Menschen etwas zumutet, nicht, dass er sie berieselt.
Klar, Heller bedient sich quer durch alle Disziplinen einer figurativen Formensprache und einer erzählerischen Metaphorik, die jedes kleine Kind versteht, der aber auch der Gebildeteste unter den Zuschauern etwas abgewinnen kann, sofern er sich darauf einlässt.
Heller war nie ein cooler, ein intellektueller Künstler. Vielleicht wollte er das einmal, als er ein junger Avantgardist war, aber er ist es nicht geworden. Er ist ein kluger, sentimentaler Mensch, ein sensibler Melancholiker, der weiß, wie man Gefühle erweckt und die Seelen seines Publikums erreicht. »Ja, es stimmt, Heller geht oft und gern zu weit«, schrieb Hans Magnus Enzensberger in einer auf fünfzig Exemplare beschränkten Festschrift zu Hellers sechzigstem Geburtstag 2007. »Das missfällt der unsichtbaren Zensur, die der Kunst im Nacken sitzt und die er schamlos ignoriert. Vor dem Sentiment, das die Priester der Nüchternheit scheuen wie der Teufel das Weihwasser, hat er keine Angst; das Ornament, das die Puritaner abschaffen wollten, ist ihm heilig; und selbst was den Kitsch angeht, so scheint er ihm ein geringeres Übel als die Entsagung zu sein. Die Grenzen des guten Geschmacks zu respektieren, fällt ihm, wie allen Träumern, nicht ein.«
Darüber ätzen die Coolen. Die Missgünstigen arbeiteten sich nicht nur an Heller, sondern auch gleich an seinem Publikum ab, weil ihrer Meinung nach nur die »Illiteraten« (Sigrid Löffler) auf Hellers Poesie hereinfallen können. Der Germanist Wendelin Schmidt-Dengler beklagte sich gar darüber, dass seine Verrisse von Hellers Büchern ohne Wirkung geblieben seien: Der Betrieb sei so stark, dass er Polemiken absorbiere. Das sind, man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um das herauszulesen, Vernichtungsphantasien.
Wenn man diese Kritiken studiert, von denen es doch eine ganze Menge gibt, versteht man erst, wie viel Kraft es Heller gekostet haben muss, mit erhobenem Kopf weiter und immer weiter zu machen, seine Selbstzweifel, an denen er sowieso litt und die auf diese Weise immer neue Nahrung bekamen, zu überwinden und sich künstlerisch und menschlich, wie er gern sagt, »lernend zu verwandeln«. Er zahlte einen hohen Preis dafür, wie im Kapitel »Verstörung« ab Seite 344 nachzulesen ist.
Hellers Stimme besitzt noch immer die brüchige, melancholische Färbung, wie man sie von seinen Platten kennt, sie ist nur ein bisschen tiefer geworden. Seine Haare und der kurz geschnittene Bart glänzen silbrig. Heller hält sich mit Gymnastikübungen fit, seine Haltung ist besser als vor fünfzehn Jahren. Er trinkt Roibusch-Tee und nimmt homöopathische Medikamente, die seine Ernährung ergänzen.
Die meisten Gespräche beginnt er damit, dass er sich nach dem Befinden seines Gesprächspartners erkundigt. Er hat schon viele Journalisten aus dem Konzept gebracht, indem er, bevor er bereit war, ihre Fragen zu beantworten, etwas über sie wissen wollte. Er hat ein erstaunliches Talent zur Aufmerksamkeit. Er vertrödelt keine Zeit mit Smalltalk, sondern steuert in jedem Gespräch schnell und sicher aus der Komfortzone in einen Bereich, wo es wirklich um etwas geht: um Überzeugungen, Pläne, Ängste, Bedenken, und er findet in diesen Gesprächen immer einen Punkt, an dem er seine Gesprächspartner zum Nachdenken bringt.
Mit der Erschütterung, die er erreicht, geht Heller sorgfältig um. Er ist ein notorischer Ermutiger. Sobald er über die Träume anderer Menschen Bescheid weiß, stiftet er sie dazu an, sie auch Wirklichkeit werden zu lassen. Die Kompetenz dafür verkörpert er. Viele der Menschen, die mit ihm befreundet sind, erzählen, dass ihr Leben ohne seine Motivationen anders, weniger befriedigend verlaufen wäre.
Als ich den Regisseur Michael Haneke besuchte, der Heller als »einen von zwei engen Freunden« bezeichnet, war ich beeindruckt von der Intensität, mit der Haneke diese Freundschaft beschrieb. Heller sei ein »besonders guter, herzlicher Freund«, sagte Haneke, »eine faszinierende, amüsante Persönlichkeit«. Er, Haneke, der sonst nicht zum Wohlwollen gegenüber anderen Personen neige, empfinde, wenn er »mit dem Franzi« zusammen sei, so etwas wie »Behaustheit«. Manchmal rufe er bei dem Freund nur an, damit sich nach wenigen Minuten am Telefon dieses Gefühl einstelle.
Hellers Talent zur Freundschaft und zur freundschaftlichen Treue kam überwältigend oft zur Sprache. Menschen, die ihn über lange Zeitspannen kennen, beschrieben seine Präsenz und Aufmerksamkeit als seine überragenden Eigenschaften. Die Geschichten, dass Heller sich aufmerksam um Freunde kümmert, die gesundheitliche oder beziehungsmäßige Schwierigkeiten haben, sind zahlreich und in ihren Details eindrucksvoll. Er bemüht sein gesamtes Netzwerk, um beste Hilfe zu gewährleisten, ob das medizinische oder spirituelle Betreuung ist, finanzielle Unterstützung oder einfach nur seine Zeit und Aufmerksamkeit.
»Man hat schnell das Gefühl, eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm zu haben«, sagte mir der frühere österreichische Kulturminister Rudolf Scholten und beschrieb den Verdacht, der viele Menschen beschleicht, wenn sich Vertraulichkeit schnell einstellt, um ihn augenblicklich zu zerstreuen: »Aber das ist nicht nur ein Gefühl, sondern einlösbare Realität.« Scholten unterstrich seine Einschätzung mit der Geschichte, dass er in einer wirklich essenziellen Situation den Rat Hellers brauchte und ihn am Mobiltelefon erreichte, als Heller auf dem Weg nach Süden war und gerade den Semmering überquerte. Als er hörte, worum es ging, drehte er um und war eine Stunde später wieder in Wien.
Mit seinem Talent zur Freundschaft hat Heller längst so etwas wie eine Großfamilie um sich geschart. Bei Anlässen und Feiern tauchen regelmäßig Menschen auf, die zu ihm in quasifamiliären Beziehungen stehen. Es sind das alte Weggefährten wie Gerd Bacher und neuere Freunde wie Michael Haneke, eine Gruppe von Freundinnen, die sich scherzhaft »die Franziskanerinnen« nennen, aber auch zahlreiche Frauen, mit denen Heller liiert gewesen war und nach den oft schmerzhaften Trennungen zu einer haltbaren, tiefen Form von Freundschaft gefunden hat.
Als Heller im November 2011 in Gutenstein den Raimund-Ring verliehen bekam, saß neben ihm seine Lebensgefährtin Albina Bauer und auf der anderen Seite seine frühere Geliebte Andrea Eckert, die bei der Feier den Monolog der »gefesselten Phantasie« aus dem gleichnamigen Raimund-Stück vortrug. Eckert beschloss ihren kurzen Vortrag mit einem prägnanten Dank an André: Danke, dass du so ein guter Freund bist.
In der zweiten Reihe saß Erika Pluhar, Hellers Ex-Frau, die er eine »Erzfreundin« nennt. Erika Pluhar sagte mir, wenn es drauf ankomme, sei keiner so verlässlich zur Stelle wie »der Franzi«. Mit aller Behutsamkeit, die ihr eigen ist, bestätigte das auch Albina Bauer, mit der Heller seit fast zehn Jahren zusammen ist.
Es muss eine Zeit gegeben haben, als es nicht leicht war, zu André Hellers Familie zu gehören, namentlich, wenn man seine Mutter war. Während langer Zeit hielt er bei öffentlichen Auftritten mit seiner Kritik an der Lebensführung von Elisabeth Heller nicht hinter dem Berg, auch und gerade wenn sie anwesend war – und Hellers Mutter ließ sich nur die wenigsten Premieren ihres berühmten Sohnes entgehen.
Inzwischen ist das Verhältnis der beiden innig. Heller telefoniert täglich mit »der Mami«, egal, wo auf der Welt er gerade ist, und er kümmert sich rührend um sie, wenn sie ihre Sommer in Gardone verbringt.
Als Elisabeth Heller dort im August 2011 ihren 97. Geburtstag feierte, schenkte der Sohn ihr ein Seidentuch und ein falsches Gebiss aus Marzipan. Die italienische Köchin hatte eine Torte gebacken, die höflicherweise nur mit einer Kerze geschmückt war, und sie trug das Geburtstagsgeschenk nach dem Mittagessen auf: Alles Gute, Signora Heller, tanti auguri.
Heller, der wie immer am Kopf des Tisches saß, rief aufgebracht in Richtung Köchin: Was soll denn das? Das ist doch nicht meine Tante Auguri! Das ist meine Mutter aus Wien!
Die Mutter aus Wien verschluckte sich fast vor Lachen. Sie musste sich die Tränen aus den Augenwinkeln wischen und jubelte: Das ist der Franzi …
1. DIE ELTERN (1895–1946)
Schatten ihrer Zeit
Als André Heller empfangen wurde, bebte die Erde. Eines der Nachbeben des großen Erdbebens von Sierre-Ayent, das Ende Mai 1946 den Kanton Wallis schwer in Mitleidenschaft gezogen hatte, brachte auch ein Doppelbett im Grand Hotel von Montreux zum Zittern, in dem sich der gerade aus dem Londoner Exil zurückgekehrte Verbindungsoffizier der französischen Armee, Stephan Heller, mit seiner Gattin Elisabeth spätnachmittags auf die Ausübung der ehelichen Pflichten besann.
»Interessant, dass mein Vater ein Erdbeben brauchte, um einen Orgasmus zu haben«, sagt Heller, dem der Gedanke freilich zu gefallen scheint: Wer würde die eigene Entstehung nicht gern als Naturereignis betrachten?
Elisabeth Heller erinnert sich ihrerseits plastisch an die vierzehn Tage, die sie mit ihrem Mann in dem zum Genfersee gewandten Hotelpalast verbrachte. Sie erinnert ihren ersten Aufenthalt in der Schweiz nach dem Krieg, sie erinnert beleuchtete Schaufenster und üppig gedeckte Tische, kräftige Kontraste zu den Kriegsjahren, die sie getrennt von ihrem Mann in Wien, bei ihrer Mutter in Gutenstein und im Kriegsdienst in Nancy und Bad Ischl verbracht hatte, sie erinnert den Nachmittag, sie erinnert das Beben des Betts und dass sie mit einiger Verwunderung bemerkte, wie sie etwas Besonderes empfand, »man spürt das als Frau irgendwie«.
Elisabeth Wenig und Stephan Heller heirateten am 3. Oktober 1933 in Wien, sie neunzehn, er achtunddreißig Jahre alt. Elisabeth trug vor der Kapelle der Piaristenkirche einen verwegen aufgesetzten Hut zu einem eleganten braunen Kostüm, Stephan Frack, weißes Hemd, weiße Weste, weiße Krawatte und Zylinder.
Elisabeth war bis dahin Schülerin an der Handelsakademie gewesen, Stephan war Industrieller. Ihm gehörte ein Anteil der G. & W. Heller-Chocoladefabrik, die am Belgradplatz im zehnten Wiener Gemeindebezirk einen ganzen Häuserblock einnahm.
Die Verbindung zwischen den ungleichen Eheleuten war von einer erstaunlichen Person gestiftet worden, von Elisabeths Mutter Lotte. Sie hatte den Schokoladefabrikanten Heller im Salon von Friedrich Austerlitz kennengelernt, dem Chefredakteur der sozialistischen Arbeiterzeitung, wo sich Menschen von Stand in den dreißiger Jahren zu treffen pflegten.
Lotte Scholdan, Jahrgang 1894, war eine Person, von der einiger Zauber ausging. Sie war keine Schönheit im klassischen Sinn, aber sie hatte Charisma. Sie stammte aus einer Familie Südtiroler Weinbarone, den di Paulis. Ihre Mutter Karoline war die uneheliche Tochter einer Di-Pauli-Herrschaft und einer Kellnerin gewesen, war in Kaltern aufgewachsen und bekam, als sie mit zwanzig einen Wiener heiratete, ein Haus in der Walfischgasse geschenkt, mitten in Wiens Zentrum. Die beiden betrieben durchaus erfolgreich einen Weinhandel und ein bekanntes Lokal, die Paulistuben, bevor Karoline es vorzog, nach Südtirol zurückzukehren.
Karolines Tochter Lotte blieb in Wien. Sie absolvierte die Matura, reiste auf ihrer Maturareise nach Ägypten, wo sie niemand Geringeren als den König von Ägypten bezaubert haben soll. André Heller erzählt eine Szene, als seine Großmutter mit einem Chauffeur im Auto sitzt, während der König ihr aus seinem vorbeifahrenden Fahrzeug Orchideen zuwirft – ob wahr oder nicht, das Bild beschreibt, wie Heller seine Großmutter sehen mag, die ihm aus seiner Familie stets die Liebste war: eine Frau voller Ambition und Allüre, von eigenwilligem Charakter und der tiefen Überzeugung, nichts tun zu wollen, was ihr nicht entsprach – und auch nichts auszulassen, was ihr wichtig schien.
Ihre Familie nannte sie »Pieps«, weil ihre Stimme klang wie die eines Spatzen. Aber die Pieps hatte ganz und gar nichts Kleines, Niedliches an sich, sondern wusste, was sie wollte, und handelte danach. Ihre erste große Liebe war Fritz, der Sohn des damaligen Burgtheaterstars Georg Reimers, so dass sie, noch in den letzten Jahren der Monarchie, jede Aufführung im Burgtheater sah. Sie trat in die Wiener Künstlerwelt ein, machte die Bekanntschaft von Karl Kraus, Peter Altenberg, Hermann Bahr, Alma Mahler und Adolf Loos. Aus dieser Zeit stammt eine Postkarte von Peter Altenberg, die dieser aus Venedig an die junge Lotte Scholdan geschickt hat: »Danke für die Übersendung der Photographie, die allerdings nur einen schwachen Abglanz Ihrer wunderbaren Persönlichkeit widerspiegelt.«
Lotte wollte Fritz Reimers heiraten, aber ihre Eltern verboten ihr den Eintritt in ein Milieu, das sie als unseriös empfanden. Aus Trotz angelte sich die Pieps den »schönsten Mann von Wien«, eine, wie es André Heller formuliert, »wirklich ideale Erscheinung« namens Hans Wenig.
Die beiden heirateten 1913, und wieder rankt sich eine Legende um das Datum. Als der attraktive Hans vor dem Traualtar Ja gesagt habe, sei draußen vor der Kirche ein Schuss gefallen, mit dem sich eine enttäuschte Liebschaft vom Leben zum Tod befördert habe.
Für ihre Hochzeitsreise ließ sich die Pieps, das wiederum ist verbrieft, etwas Spezielles einfallen. Sie ging mit Goethes »Italienischer Reise« ins Reisebüro und verlangte, dass man ihr genau das buche.
Das auf diese Weise zum zweiten Bildungsweg gezwungene Büro brachte das Kunststück zuwege, Goethes Route in ein organisiertes Reiseprogramm umzusetzen. Doch die Pieps fuhr nur bis Venedig. Dort traf das junge Paar Hermann Bahr und Peter Altenberg. Hans Wenig spielte ein paar Nächte lang mit den Dichtern Karten, bevor er allein weiterreiste. Seine Frau aber war selig, in der »Serenissima« zu bleiben. Die Ehe war zu Ende, bevor sie ernsthaft begonnen hatte, auch wenn die Umstände dagegensprachen: Lotte war schwanger.
Elisabeth kam wenige Wochen, nachdem Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajevo ermordet worden war, zur Welt: am 9. August 1914. Das Kind wurde bald nach Südtirol zur Großmutter gebracht, wo es während der Kriegsjahre blieb. Die Pieps jedoch ließ sich scheiden und heiratete nun doch Fritz Reimers, ihre Jugendliebe.
Aber auch von ihm trennte sie sich wenige Jahre später wieder. Reimers selbst komponierte Couplets der Sorte »Wenn’s mich juckt, dann muss ich küssen« genierten erstens seine Frau und brachten ihm zweitens kein Geld ein. Er machte Schulden, und sie fand es quälend, ihre Eltern um Geldzuwendungen anbetteln zu müssen.
In dritter Ehe heiratete sie also 1920eine gute Partie, den Bankdirektor Fritz Reitler, der für die Privatbank des Bankiers Siegmund Bosel arbeitete. Als die Bank in den »Postsparkassenskandal«, einen beispiellosen Spekulationsbetrug, verwickelt wurde, der in der Politik der Ersten Republik für ein Köpferollen (und für die dramatische Flucht des österreichischen Finanzministers nach Kuba) sorgte, verlor Fritz Reitler seinen Job, und auch die Beziehung zu seiner Frau zerbrach wenig später. Reitler ging zurück in seine Heimatstadt Karlsbad. Er wurde 1944 in Auschwitz ermordet. Die Pieps blieb in Hietzing.
Die Villa in der Elßlergasse 9, die Lotte Scholdan von ihren Eltern bekommen hatte, war vom revolutionären Architekten Adolf Loos, den sie durch Alma Mahler in der Wiener Gesellschaft kennengelernt hatte, umgebaut worden. Zum Alltag der Familie gehörten regelmäßige Theater- und Opernbesuche, man gab Gesellschaften, man wurde zu Gesellschaften eingeladen.
Bei Friedrich Austerlitz gingen Wiens bessere Kreise ein und aus, eine durchaus spezielle Konstellation. Austerlitz war ein vom Judentum konvertierter Mann aus einfachsten Verhältnissen, der sich selbst Bildung angeeignet hatte und von Victor Adler, dem Begründer der österreichischen Sozialdemokratie, entdeckt und gefördert wurde, bis er zum Chefredakteur der mächtigen Arbeiterzeitung aufstieg.
Bei Austerlitz verkehrten keineswegs nur Sozialdemokraten, sondern auch die Mächtigen aus Wirtschaft und Industrie. Hier lernte Lotte Scholdan auch Stephan Heller kennen. Die beiden kamen sich so nah, dass die Nachricht von der Verlobung Stephan Hellers mit Elisabeth Wenig für Verwirrung sorgte: Stand auf der Verlobungsadresse tatsächlich der richtige Name? War nicht ihre Mutter gemeint?
Elisabeth war eine bildhübsche Frau, achtzehn Jahre alt, 1,79 Meter groß, schlank und blond, sie entsprach dem Schönheitsideal ihrer Zeit. Sie hatte, wie sie sagt, »viele Verehrer. Die waren aber alle nur Studenten. Keiner von ihnen hat Geld gehabt. Der Stephan war halt schon ein Industrieller. Er hat mich ausgeführt. Und er war riesig gebildet. Er konnte fabelhaft Sprachen sprechen, Englisch, Französisch, Italienisch, alles so gut wie Deutsch. Das hat mir alles imponiert.«
Stephan Heller war ein Aristokrat seiner Zeit – mit der feinen Einschränkung, dass er keinen Adelstitel trug. Status spielte in der Selbstwahrnehmung seiner Familie eine Hauptrolle, und zu einem akzeptablen Status gehörte selbstverständlich die wirtschaftliche Unabhängigkeit, die dem Adel der Habsburgermonarchie in die Wiege gelegt war, der Familie Heller jedoch nicht. Sie hatte sich ihren Reichtum erwirtschaftet, oder, genauer gesagt, eine Gründergeneration hatte aus dem Nichts ein Imperium errichtet, dessen Reichtum Stephan Heller hinnahm und für seine wahren Interessen einsetzte – sein Geschäft, die Schokoladenproduktion, interessierte ihn reichlich wenig.
Den Grundstein zum Heller-Vermögen hatte Moritz Heller gelegt, ein jüdischer Holzhändler aus Sazawa im heutigen Tschechien. Er machte mit einem Kaufmannsgeschäft und dem Holzhandel gutes Geld, das seine Kinder vervielfachen sollten.
Moritz Heller hatte neun Kinder, zwei Töchter, sieben Söhne. Zwei von ihnen, Gustav und Wilhelm Heller, errichteten das Süßigkeitenimperium der Hellers – und die Bezeichnung »Imperium« ist durchaus nicht übertrieben.
In Sazawa gab es keine höhere Schule, also absolvierte Gustav in Prag die Handelsschule, während Wilhelm in der Schweiz das Handwerk des Zuckerbäckers lernte. Gustav nahm nach dem Abschluss eine Stelle als Komptorist in Budweis an, spielte aber bald mit dem Gedanken, sich selbstständig zu machen. Wilhelm stand den Plänen des Bruders skeptisch gegenüber, ließ sich jedoch gegen sein Bauchgefühl auf das vermeintliche Wagnis ein.
Gustav und Wilhelm gründeten ihre Firma 1891, Gustav war vierunddreißig, Wilhelm zwei Jahre jünger. Mit einer klaren Geschmackskonzeption und grundlegenden technischen Neuerungen positionierten sie neuartige Bonbons auf dem Markt. Während die Konkurrenz ihre Süßwaren noch über dem offenen Feuer kochte, erfanden die Heller-Brüder ein Verfahren, das Dampf aus dem Beatrixbad in Wien-Landstraße nutzte, um in Vakuumapparaten »Zuckerl« herzustellen – harte, mit Fruchtmarmelade gefüllte Lutschbonbons, die in buntes Papier verpackt wurden und »Wiener Zuckerl« oder im Volksmund »Heller-Zuckerl« hießen.
»Wir hatten gleich von Anfang an einen enormen Erfolg«, schreibt Gustav Heller in seinen Erinnerungen. Es dauerte nur wenige Jahre, bis die Heller-Brüder zu »k.u.k. Hoflieferanten« für Marmelade, Kompotte und Bonbons ernannt wurden. Kaiser Franz Joseph persönlich pflegte, wenn er »unter die Leut’« ging, Wiener Zuckerl an die Kinder zu verteilen. Die Gunst, die er den Hellers gewährte, drückte er in deren Beförderung zu »Kammerlieferanten des Kaisers« aus.
In Wien errichteten sie zwischen 1898 und 1900 die neue Fabrik im Bezirk Favoriten, ein viergeschossiges Gebäude, das mehrere Produktionshallen und ein Kesselhaus umfasste. Die Steigerung der Produktion zeigte sich in ständig neuen Erweiterungsbauten. 1906 kam ein in der Mitte des Fabrikareals gelegenes Gebäude dazu, das Platz für Stallungen bot. Zwischen 1910 und 1914 wurde die Fabrik schließlich um den Schokoladefabriktrakt, den markanten Turmtrakt sowie ein fünfgeschossiges Wohn- und Fabriksgebäude erweitert. Zu dieser Zeit waren in der Heller-Fabrik 1400 Arbeitskräfte beschäftigt, die meisten von ihnen Frauen.
Zur Produktpalette gehörten neben den Wiener Zuckerl auch Fourreés, Drops, hohle Früchte, Malzbonbons und Gummibonbons. Darüber hinaus produzierte man in der neuen Fabrik Kakao- und Tunkmassen, Schokoladebonbons und Tafelschokolade in verschiedenen Variationen, von einfachen Pralinés bis zu 6 Kronen teuren Likörbonbons. Marmeladen, Fruchtsäfte, Obstkonserven und Backwaren ergänzten das Angebot.
Die Hellers lieferten ihre Produkte nicht nur in alle Länder der Monarchie, sondern sie exportierten auch in insgesamt 64 Staaten, von Serbien über Rumänien, Bulgarien, die Türkei bis nach Ägypten. Nach Ende des Ersten Weltkriegs eröffneten sie Zweigniederlassungen in Frankreich, Belfast, New York, Lissabon und Turin.
Die Performance der Heller-Unternehmen war in der Zwischenkriegszeit so eindrucksvoll, dass eine Schweizer Firma namens Nestlé den Heller-Konzern kaufen wollte und als Kaufpreis 23 Prozent der eigenen Aktien anbot. Die Hellers lehnten ab. 2012 hätten diese Aktien einen Wert von etwa 35 Milliarden Euro.
Stephan Heller war der Sohn Wilhelm Hellers. Als Wilhelm 1931 starb, übernahm Stephan die Wiener Fabrik, gleichzeitig hatte er sich um die Niederlassungen in Turin und Paris zu kümmern. Zwei seiner Brüder gingen nach Südamerika, einer betreute die Firmen in Irland und Portugal.
Allerdings interessierte sich Stephan Heller für alles, nur nicht für das Unternehmen. Seine Leidenschaft gehörte der Politik. Er war Monarchist. Er traf den ins Exil verstoßenen Otto Habsburg in Paris und verehrte dessen Mutter Zita. Mit Habsburg schmiedete er Pläne für dessen Wiedereinsetzung, und während in Deutschland die Nazis immer stärker wurden, schloss sich Stephan Heller der Heimwehr, dem militanten Flügel der Christlichsozialen, an, die sich offen gegen die Republik stellte und den Austrofaschismus propagierte.
Die faschistische Bewegung Benito Mussolinis hatte der Industrielle mit namhaften Summen aus dem Firmenvermögen unterstützt. Er sah in Mussolini den einzigen Verbündeten Österreichs gegen die Nazis. Die Nazis selbst lehnte er von Beginn an rigoros ab. Mussolini revanchierte sich bei Heller, indem er ihm den Orden »Commendatore« verlieh.
Stephan Hellers Abkehr vom jüdischen Glauben hatte, wie André Heller heute meint, seine Gründe darin, »dass er als Neureicher in der Wiener Gesellschaft als Jude weniger wert war als ein Adeliger oder ein großbürgerlicher alteingesessener Nichtjude«. Glaubensfrage sei das keine gewesen, die Familie habe weitgehend areligiös gelebt. »Es war eine Anbiederung«, sagt André Heller, »aber eine Anbiederung, die nichts gebracht hat. Denn ein paar Jahre später kam der Hitler und verfügte: Ob du getauft bist oder nicht, du bist ein Jude.«
Die Hochzeit von Stephan und Elisabeth Heller fand im kleinsten Kreis statt. Zwei Trauzeugen, ein Essen zu Hause bei der neuen Schwiegermutter, mehr nicht. Kein rauschendes Fest.
Ein Jahr später wusste Elisabeth Heller schon, dass es ein Fehler gewesen war, zu heiraten. Aber sie war schwanger. 1934 kam Fritz zur Welt, dabei war das Verhältnis zu ihrem Mann schon abgekühlt, und das, was ihr an ihm so imponiert hatte, weitgehend aufgebraucht. Stephan Heller, neunzehn Jahre älter als seine Frau, behandelte sie so, wie er sie sah: als Kind. Er erteilte ihr Befehle. Sie gehorchte.
Elisabeth hätte gern einen Beruf ergriffen. Stephan antwortete kategorisch: »Eine Heller arbeitet nicht.«
Das Paar wohnte mit dem kleinen Fritz in einem Stadthaus am noblen Brahmsplatz in der Wiener Innenstadt, während sich die politischen Verhältnisse zuspitzten. Nach wie vor reiste Stephan Heller regelmäßig nach London und Paris, um seinen Geschäften nachzugehen. In beiden Städten besaß er Wohnungen.
In Deutschland hatte Hitler bereits die Macht übernommen. Im Juli 1934 versuchten sich die Nazis auch in Wien an die Macht zu putschen. Der Putsch scheiterte, Kurt Schuschnigg wurde anstelle des erschossenen Engelbert Dollfuß Kanzler des austrofaschistischen Ständestaats. Stephan Heller setzte so lange auf Mussolini, bis dieser 1936 mit Hitler paktierte, die »Achse Berlin–Rom« schmiedete und als Beschützer des österreichischen Sonderwegs ausfiel. Immerhin sollten dem Fabrikanten seine Kontakte zum Duce zwei Jahre später einen Heller’schen Sonderweg auf der Flucht vor den Nazis ermöglichen.
Elisabeth Heller erinnert sich an ein Gespräch ihres Mannes, das der am Tag nach Österreichs Anschluss mit einem befreundeten Gynäkologen führte. Der Arzt hatte Stephan Heller angerufen, um ihm mitzuteilen, dass er am nächsten Tag das Land verlasse, sein Haus in Grinzing zurücklasse, seine Kunstsammlung, alles. Hauptsache weg. Heller hatte kein Verständnis für den überhasteten Aufbruch seines Freundes. Er sagte: Es wird nichts so heiß gegessen wie gekocht …
Wenige Tage später, in der Nacht auf den 17. März 1938, brachen am Brahmsplatz 1 vier Uniformierte die Tür auf und trieben die Bewohner im Zimmer der Köchin zusammen. Einer der SA-Männer bedrohte die Anwesenden mit einer Pistole, während die anderen das Haus nach Wertsachen durchsuchten. Sie fanden Geld, die Goldmünzensammlung Stephan Hellers, sie nahmen sein Auto.
Wenig später wurde Stephan Heller gemeinsam mit seinem Cousin Hans im Büro der Schokoladefabrik verhaftet und in das SA-Hauptquartier gebracht. »Wir mußten«, schreibt Hans Heller in seiner Autobiografie »Zwischen zwei Welten«, »in der Kaserne Latrinen reinigen unter den ermunternden Worten: ›Es geschieht euch recht, ihr kapitalistischen, jüdischen Schweine.‹ Mein Cousin hatte […] seine Brust geschmückt mit Tapferkeitsmedaillen vom Ersten Weltkrieg und Auszeichnungen von Mussolini.«
Die Erniedrigung für den Fabrikanten, der gewohnt war, dass ihm auf der Straße respektvoll ausgewichen wird, musste grenzenlos sein.
Der italienische Vertreter der Firma Heller, Aldo Milul, verständigte Mussolini, der einen Offizier nach Wien schickte, um die Freilassung Stephan Hellers zu erwirken. Der Bitte des Duce wurde unter der Bedingung Folge geleistet, dass Heller unter Zurücklassung seines Vermögens aus Österreich ausreisen müsse.
Wenn Elisabeth Heller sagt, ihr Mann habe sich, nachdem er freigelassen wurde, »furchtbar aufgeregt«, untertreibt sie vermutlich die Dimension der Verstörung, die den Industriellen gepackt hatte. Stephan Heller kam gedemütigt aus dem Gefängnis nach Hause, all seine Illusionen waren vernichtet. Er war bereit, kategorische Entscheidungen zu treffen.
Zuerst befahl er seiner Frau, sich von ihm scheiden zu lassen. Da seine Konversion zum Katholizismus die Nazis nicht davon abgehalten hatte, ihn als Juden zu behandeln, sah er eine geringe Chance für den Frieden und die Sicherheit seiner Familie darin, sich möglichst rasch von ihm loszusagen. Außerdem wusste Heller, dass darin die wohl einzige Möglichkeit bestand, seine Firma vielleicht nicht ganz zu verlieren. Seine arische Frau, dachte er, könnte von den Nazis nicht einfach übergangen werden.
Fieberhaft traf er Vorkehrungen für seine Flucht. Seiner Frau erzählte er keine Details. Sie wusste zwar, dass ihr Mann Audienzen bei Mussolini gehabt hatte, aber nicht, was dort besprochen wurde. Sie wusste über ihren Mann überhaupt nur wenig, über seine Eltern und Großeltern praktisch nichts.
»Ich habe meinen Mann eigentlich gar nicht gut gekannt«, sagt Elisabeth Heller, »zumindest denke ich das heute. Damals habe ich das gar nicht so empfunden, es hat mich aber auch nicht so wahnsinnig interessiert. Heute, wenn ich darüber nachdenke, finde ich das sehr merkwürdig. Er hat über viele Dinge überhaupt nicht geredet.«
Stephan Heller floh nach Italien, traf den Duce, der revanchierte sich für die jahrelangen Zuwendungen immerhin damit, dass er Heller ein Visum für den Grenzübertritt nach Frankreich ausstellte. Aldo Milul, der italienische Vertreter der Firma, kannte einen Schlafwagenschaffner auf der Linie Wien–Rom, der für Heller Wertgegenstände und Geld nach Italien schmuggelte.
»Er war ein ganz überzeugter österreichischer Patriot«, sagt André Heller über seinen Vater. »Sicher, er hat sich in diese Heimat verliebt, in dieses k. u. k. Österreich, wie es Joseph Roth beschrieben hat.«
Stephan Heller war ein Jahr jünger als Joseph Roth, und er hatte seine Liebe zur Monarchie spätestens als berittener Offizier im Ersten Weltkrieg entdeckt. Roth selbst lernte er vermutlich über Otto Habsburg in Paris kennen, die ersten Briefe von Roth an Stephan Heller datieren aus den frühen dreißiger Jahren. Heller liebte nicht nur Joseph Roths großartige Romane und Erzählungen, er teilte mit ihm auch den Glauben an ein gemeinsames Projekt: die Wiedereinführung der Monarchie in Österreich.
»Ein grausamer Wille der Geschichte hat mein altes Vaterland, die österreichisch-ungarische Monarchie, zertrümmert«, hatte Roth 1932 als Einleitung zum Vorabdruck seines Romans »Radetzkymarsch« in der Frankfurter Zeitung geschrieben. »Ich habe es geliebt, dieses Vaterland, das mir erlaubte, ein Patriot und ein Weltbürger zugleich zu sein, ein Österreicher und ein Deutscher unter allen österreichischen Völkern. Ich habe die Tugenden und die Vorzüge dieses Vaterlands geliebt, und ich liebe heute, da es verstorben und verloren ist, auch noch seine Fehler und Schwächen. Deren hatte es viele. Es hat sie durch seinen Tod gebüßt. Es ist fast unmittelbar aus der Operettenvorstellung in das schaurige Theater des Weltkriegs gegangen.«
Das hätte Stephan Heller bedingungslos unterschreiben können, aber er begnügte sich nicht damit, den alten Zeiten nachzutrauern, sondern fasste konkrete Pläne. Als er 1938 schließlich nach dem Umweg über Italien in Paris ankam, traf er Roth und Habsburg, der bereits in den Jahren des Ständestaats unermüdlich seinen Anspruch als legitimer Herrscher Österreichs angemeldet hatte. Die Idee einer Restauration der Habsburgermonarchie war in den Jahren permanenter Staatskrisen nicht so abwegig, wie das heute klingen mag. Habsburg genoss die Unterstützung zahlreicher Parlamentarier, die in der Monarchie eine Möglichkeit für einen österreichischen Ausweg sahen, eine realistische Chance, das Land vor der Vereinnahmung durch Nazi-Deutschland zu schützen. Stephan Heller investierte in diese Idee. Er investierte persönliche Energie – und viel Geld aus den Kassen seiner Firma.
Elisabeth Heller blieb mit ihrem Sohn Fritz in Wien. Sie übersiedelte aus dem Haus am Brahmsplatz zurück nach Hietzing in die Villa ihrer Mutter in der Elßlergasse. Lotte Scholdan hatte inzwischen ihren Lebensmittelpunkt nach Gutenstein in Niederösterreich verlagert, wo die Familie einen Besitz hatte, und dort den Dorfarzt Albert Pogazhnik geheiratet, ihren vierten und, wie sich zeigen sollte, letzten Mann.
Elisabeth Heller sah ihren geschiedenen Mann in diesen Jahren nur noch einmal, als sie mit Fritz nach Paris reiste und dort eine Atmosphäre vorfand, die sie zutiefst beunruhigte. »Er war mit lauter Leuten beinander, die furchtbare Putschsachen machen wollten. Immer ging es um die Wiedereinführung der Monarchie. Mir war das unheimlich. Wir sind dann wieder zurück nach Wien, er hätte ja mit uns nichts anfangen können.« Fritz Heller hingegen hat den Aufenthalt in Paris als bunt und »so schön« in Erinnerung, dass »ich nicht mehr nach Wien zurück wollte«.
Die Monarchie wurde nicht wieder eingeführt, Hitler schrieb Otto Habsburg steckbrieflich zur Fahndung aus, Joseph Roth starb im Mai 1939, im September begann der Krieg. Stephan Heller nahm die französische Staatsbürgerschaft an und ging zur französischen Armee. Er trat in den Stab des damaligen Obersts Charles de Gaulle ein, der sich mit aller Entschlossenheit in den Kampf gegen Nazi-Deutschland warf. Als die deutsche Wehrmacht im Juni 1940 in Paris einmarschierte, war es de Gaulle, der den von Marschall Philippe Pétain mit Hitler vereinbarten Waffenstillstand für illegitim erklärte und mit einer kleinen Propellermaschine nach London floh, um dort das Komitee »Freies Frankreich« zu gründen, eine Gegenregierung zu Pétains Vichy-Regierung.
Stephan Heller folgte ihm. Er bekleidete den Posten eines Verbindungsoffiziers zwischen de Gaulles englischer Exilregierung und den amerikanischen Streitkräften. Ab 1940 flog Heller regelmäßig von London nach Washington, um persönlich geheime Depeschen zu überbringen. Er bekam einen »Nom de guerre«, einen Kampfnamen, wie alle Mitglieder der Résistance: Heller-Huart. Dieser Name tauchte später auch in der Geburtsurkunde André Hellers auf, genauso wie die französische Staatsbürgerschaft, die von seinem Vater auf ihn überging.
Wie Stephan Heller in diesen Jahren in London lebte, was er jenseits seiner Pflichten als Offizier tat, ist unbekannt. Er schwieg sich zeit seines Lebens darüber aus. Seine Cousine Susi Spitz, die die Kriegsjahre wie Stephan im Londoner Exil verbrachte, erzählt, dass sie während all der Jahre nur einmal Kontakt hatten, als Stephan aus der Wohnung, die er seiner Cousine Gretl überlassen hatte, ein Bett abholen ließ.
Kein Wunder, dass es Mutmaßungen gibt, Heller habe in jenen Jahren eine andere Frau, vielleicht sogar eine andere Familie gehabt. Es gibt keine verlässlichen Informationen darüber. Dass seine militärpolitischen Anstrengungen erfolgreich waren, ist hingegen dokumentiert. Gleich nach dem Krieg traf ein Brief des amerikanischen Präsidenten Harry S. Truman in Wien ein, in dem sich dieser bei Stephan Heller für dessen Engagement in der Vorbereitung des D-Days in der Normandie bedankt und ihm »outstanding services« und »a notable contribution to the effectiveness of American air operations« bescheinigt.
Elisabeth Heller musste sich mit der Tatsache abfinden, dass ihr Mann in den Kriegswirren verschwand. Sie schrieben einander, das schon, die Briefe wurden an Hellers Mutter Helene, die inzwischen in Bern lebte, adressiert und von dort jeweils weitergeleitet.
Der Plan, dass die Firma an Elisabeth Heller fallen könnte, ging nicht auf. Ein Jahr lang bezahlte die G. & W. Heller-Chocoladefabrik ihr noch eine Apanage, dann wurde die Firma nach allen Regeln der Kunst arisiert. Ein Jagdfreund von Göring wurde mit der Leitung des Unternehmens betreut, das Vermögen eingezogen. Zum ersten Mal in ihrem Leben stand Elisabeth Heller vor der Aufgabe, selbst für ihr Auskommen und das ihres Kindes sorgen zu müssen. Sie arbeitete zuerst in der Weinhandlung des Großvaters, später ließ sie sich zum Arbeitsdienst einteilen.
Ihre Vergangenheit als Frau eines Großindustriellen war Elisabeth Heller jedoch nicht los. Zweimal wurde sie von übelwollenden Nachbarn wegen Hörens eines Feindsenders angezeigt und musste sich dafür vor dem Landesgericht verantworten. Zweimal stand sie vor demselben Staatsanwalt, »der kein Nazi war«, wie sich Elisabeth Heller erinnert, »er hat zweimal den Akt fallen lassen. Es waren furchtbare Zeiten. Jedesmal, wenn das Telefon geläutet hat, hatte ich Angst, dass ich womöglich wieder vorgeladen werde.«
Als ihr Onkel Heinrich Scholdan eingezogen und als Oberst einem in Nancy stationierten Luftnachrichtenregiment zugeteilt wurde, machte er ihr den Vorschlag, sich zum Arbeitsdienst zu melden. Er werde dafür sorgen, dass sie in seine Nähe komme. »Er hat mir gesagt: So kannst du verschwinden. Solange du in Wien bleibst, bist du immer die Frau Heller.«
Elisabeth Heller meldete sich also freiwillig. Ihren Sohn Fritz überließ sie der Mutter, die ihn nach Gutenstein holte, wo er die Kriegsjahre verbrachte.
In Nancy wurde Elisabeth Heller über die Vermittlung ihres Onkels Sekretärin eines Wehrmachtsgenerals. Sie nahm an Kommandobesprechungen teil und reiste im Gefolge des Generals oft nach Paris. Sie erinnert die Zeit als »günstig«, konnte Geld und Kleider nach Gutenstein zu ihrem Sohn schicken.
Auch aus heutiger Sicht mutet die Situation reichlich skurril an: Stephan Heller kämpfte mit aller Entschlossenheit aus London gegen die Nazis und bereitete die Landung in der Normandie vor. Seine Frau arbeitete derweil für einen Nazi-General im besetzten Frankreich und fürchtete, dass der sich abzeichnende Angriff der Alliierten ihren persönlichen Mikrokosmos durcheinanderbringen würde. Sie lebte in einer Luftblase inmitten des allgemeinen Chaos, und weil sie gelernt hatte, die angenehmen Seiten des Lebens zu genießen, genoss sie so lange, bis die Luft in der Blase verbraucht war.
1944 ließ sie sich zurück nach Wien versetzen und wurde dort dem Luftgaukommando zugeteilt. In der Villa in der Elßlergasse hatte sie gerade noch ein Zimmer, der Rest des Hauses war von sogenannten »Einquartierungen« belegt. Ihr Vorgesetzter brachte die alten Vorwürfe der »jüdischen Versippung« wieder in Stellung und traktierte Elisabeth Heller mit Misstrauen und Anschuldigungen, einer »monarchistischen Zelle« anzugehören.
Sie gehörte definitiv keiner monarchistischen Zelle an. Den Widerstand gegen die Staatsgewalt hatte Elisabeth Heller bestimmt nicht erfunden. Trotzdem wurde sie als »politisch unzuverlässig« eingestuft und nach Bad Ischl strafversetzt, in ein Luftwaffenlazarett für Hirnverletzte.
»Ich musste die Schwerverletzten empfangen, die von der Front gekommen sind, und ihre Papiere überprüfen. Wenn jemand gestorben ist, musste ich die Verwandten verständigen. Es war eine furchtbare Arbeit.«
Während dieser Zeit absolvierte Fritz Heller in Gutenstein die Volksschule. In die Hauptschule durfte er nicht aufsteigen, genauso wie er als Halbjude nicht bei der Hitlerjugend aufgenommen wurde. Das traf ihn am härtesten. Während seine Freunde begeistert die paramilitärischen Programme der HJ mitspielten, »saß ich auf dem Boden und las den Völkischen Beobachter und die Wiener Kriegszeitung«, sagt Fritz Heller. Über das Schicksal des Vaters hörte er immer nur in chiffrierter Form: »Serafino geht es gut.« Serafino, das war Stephan Heller.
Knapp vor Kriegsende holte Elisabeth Heller ihren Sohn Fritz aus Gutenstein, »die Russen kamen ja immer näher«. Von St. Pölten durchquerte sie zu Fuß den Paßtaler Wald, einen schweren Koffer im Schlepptau. Die Rückfahrt nach Ischl erfolgte auf Irrwegen. »Wir fuhren nach St. Pölten auf einem Brotwagen«, erinnert sich Fritz, »nach Melk nahm uns ein Panzer mit. Dann fuhren wir mit einem LKW, einem Zug und einem Bus nach Wels.« In Wels ließ Fritz, der von der siebzigstündigen Reise völlig übermüdet war, seinen Koffer stehen. Er besaß, als er in Ischl ankam, nicht mehr als das, was er buchstäblich am Leib trug.
»Fritz saß dann oft auf der Stiege vor meinem Büro und wartete, bis ich fertig war. Rundherum wurde gestorben. Es war nicht schön«, sagt Elisabeth Heller. Fritz Heller erinnert sich an den permanenten Hunger: »Ich habe am Misthaufen nach Kartoffeln gesucht.«
Im Mai 1945 wurde Wirklichkeit, was in Nancy noch Besorgnis erregt hatte: Die Nazis verschwanden. Elisabeth Heller blieb. Ein Freund ihres Mannes, der den amerikanischen Befreiern beim Aufbau einer funktionierenden neuen Verwaltung zur Hand ging, machte sie mit dem »Chief of Police« bekannt, der stellte sie als Sekretärin ein, »eine Mordsposition«, wie Elisabeth Heller befand. »Ich stellte die wichtigen Permits aus, jeder wollte etwas und stellte sich gut mit mir.«
Sie wunderte sich auch nicht über ihren fliegenden Wechsel von den Besatzern zu den Befreiern, es waren schließlich alte Netzwerke, die hier Tragfähigkeit bewiesen. Außerdem konnte sie Englisch, eine Tatsache, die in der bildungsfernen Nachkriegsgesellschaft der österreichischen Provinz ein wertvoller Trumpf war.
General Charles de Gaulle kämpfte an zahlreichen Fronten um die Befreiung Frankreichs. 1943 gründete er in Algier das »Französische Komitee für die nationale Befreiung« und stellte sich an dessen Spitze. Das Komitee rief sich zur Provisorischen Regierung Frankreichs aus und zog im August 1944 in das befreite Paris ein, wo de Gaulle trickreich dafür sorgte, dass Frankreich einer alliierten Besetzung entging und stattdessen selbst als Siegermacht auftreten durfte.
Stephan Heller befand sich im Gefolge des Generals, als dieser sein Hauptquartier zurück nach Paris verlegte. Als schließlich der Krieg gewonnen war, recherchierte Heller, wo sich seine Frau und sein Sohn befanden, und machte sich auf den Weg nach Bad Ischl.
Als er im Salzkammergut ankam, saß Stephan Heller in einem Jeep. »Er kam als Sieger«, sagt seine Frau, und er fragte sie nicht, ob sie mit ihm nach Hause gehen wollte, sondern er nahm sie mit, als wäre gar nichts anderes möglich.
»Wir kamen an einem Sonntag von einem Spaziergang zurück«, erinnert sich Fritz Heller. »Da sahen wir einen Mann, den meine Mutter zu kennen schien. Dann rief sie: Jessas, der Steffl.«
Stephan Heller trug eine blaue Uniform mit amerikanischen Abzeichen. Er war in Besitz eines Schreibens der amerikanischen Besatzer, dass er kraft seiner Funktion requirieren konnte, was ihm für richtig und wichtig erschien. Heller zog mit Elisabeth und Fritz zuerst nach Traun in ein Hotel. Bald darauf machte er von seinem Requirierungsrecht Gebrauch und beschlagnahmte die repräsentable Landauer Villa in Bad Ischl samt dem gesamten Inventar. Fritz durfte in die Hauptschule gehen und bekam Nachhilfestunden von einem ehemaligen Nazi-Lehrer, der nicht mehr unterrichten durfte. Im Esplanade-Kino durfte er die Aufführungen für die amerikanischen Soldaten besuchen.
Noch 1945 heirateten Elisabeth und Stephan zum zweiten Mal, und im Sommer 1946, bevor sie aus Bad Ischl zurück nach Wien übersiedelten, reisten sie miteinander in die Schweiz, nach Montreux, und stiegen im Grand Hotel ab.
2. DIE KINDHEIT (1947–1959)
Hietzinger Traumwelten
Francis Charles Georges Jean André Heller-Huart kam am 22. März 1947 im Krankenhaus zum Goldenen Kreuz in Wien zur Welt. Die Geburt musste früher stattfinden, als sie eigentlich sollte.
Der Vater hatte es eilig. Stephan Heller verbrachte maximal ein paar Monate pro Jahr in Österreich, davon vier Wochen in St. Gilgen am Wolfgangsee, zur Sommerfrische. Der Rest seiner Anwesenheit in Wien war auf einzelne Tage aufgeteilt, etwa auf den geplanten Geburtstag seines zweiten Sohnes, und als dieser sich anschickte, noch etwas länger in seiner Mutter zu bleiben, drohte der Vater, dennoch wie geplant am nächsten Tag abzureisen. Er habe Termine. Wenn das Kind bis dahin nicht angekommen sei, werde er es eben beim nächsten Besuch begrüßen. Um diesen familiären Katastrophenfall zu vermeiden, wurde schleunigst die Geburt eingeleitet.
»Aus diesem kleinen Vorfall«, kommentiert ein unbeeindruckter André Heller heute, »würde ein ambitionierter Psychiater ein lebenslanges Drama konstruieren. Ein Kind, das gezwungen wird, auf die Welt zu kommen, weil der Vater mit der Geliebten woanders verabredet ist …«
Doch dieses Drama ließ André Heller aus. Er widmete sich stattdessen vielen anderen.
Das Haus, in das der kleine Franz geboren wurde, war kein glückliches. Um die Beziehung seiner Eltern stand es nicht gut. Der Vater war meistens abwesend, die Mutter nahm sich ihre Freiheiten, der große Bruder Fritz absolvierte, nachdem er 1950 einige Monate in Cornwall verbracht hatte, um Englisch zu lernen, 1951 eine Zuckerbäckerlehre bei der Konditorei Zauner in Bad Ischl und wurde dann vom Vater nach Belfast in die Firma des Bruders Karl geschickt. Franz wuchs als zweites Einzelkind der Familie auf.
Die Hellers lebten wieder in sichtbarem Wohlstand. Im Haus gab es zahlreiches Personal. »Der Franzi«, wie der kleine Lockenkopf genannt wurde, machte unter der Obhut der Köchin, des Kindermädchens Grete Fritz und seiner Großmutter die ersten Gehversuche.
»Ich kann mich nicht erinnern, jemals mit meiner Mutter gespielt zu haben«, sagt André Heller, »und mit meinem Vater sowieso nicht.« Der Vater blieb für den Kleinen der, mit dessen Strafe man ihm drohte, erführe er von den Verfehlungen seines Sohnes. Aber er war ohnehin nie da.
Es war die Großmutter, die Pieps, die den Kleinen unter ihre Fittiche nahm. Sie sagte ihm: Du bist mein Kind. Vielleicht holte sie, die selbst keine begabte Mutter gewesen war, nun nach, was sie bei ihrer eigenen Tochter, der »Hasi«, Franzis Mutter, versäumt hatte. Die Pieps besaß ein Zimmer in der Elßlergasse, und sie kümmerte sich mit Leidenschaft darum, dass der kleine wache Knabe etwas Interessantes erlebte.
Die Pieps gab dem Franzi Unterricht in Sinnlichkeiten. Sie brachte ihm bei, wie sich ein schlechter Stoff anfühlt und wie ein guter. Greif das an. Das ist billig. Das ist kostbar. Sie erfand ein »Geruchstheater« für den Kleinen, eine Kiste mit verschiedenen Laden, wo in jeder Schublade etwas lag, das einen charakteristischen Geruch verströmte. Safran, Schuhcreme, eine Muschel aus der Adria, ein Stück Leder. Riechst du’s? Beschreib, was du riechst.
Sie zeigte ihm Bilder, die Illustrationen der »Märchen aus 1001 Nacht« von Edmund Dulac, einem Illustrator, der detailversessen und stimmungsvoll Bilder von großer Tiefe und einer verführerischen Magie entstehen ließ, die den kleinen Heller so faszinierten, dass er stundenlang in sie eintauchen, sich an ihrer Anmut und ihrer Verheißung vom Süden wärmen konnte.
Und sie las ihm vor. Wenn der Franzi bei der Pieps in Gutenstein war, nahm sie ihn an der Hand und spazierte mit ihm in den englischen Park von Schloss Hoyos, dessen Schlüssel sie besaß. Dort spielten die beiden am Waldrand »Efeukrönung des Königs und der Königin«, errichteten Kathedralen aus Moos, bastelten Tiere aus Kastanien und Zahnstochern, bevölkerten ihre erfundenen Paradiese, riefen Feiertage aus wie den »Lachmittwoch« und den »Grieskochsamstag« und Naturkatastrophen wie »den Himmel, der ins Meer stürzt«.
Zum Abschluss jedes Spaziergangs führte die Pieps den Franzi jedoch regelmäßig auf den Friedhof von Gutenstein. Dort ist der Dichter Ferdinand Raimund begraben. Umgeben von einem schmiedeeisernen Zaun sind eine Büste des Dichters und ein darüber aufragender Obelisk »Dem Andenken« des »dramatischen Dichters und Schauspielers (1790–1836)« gewidmet.
Ferdinand Raimund war ein begnadeter Volksschauspieler, der sich in der Provinz seine Sporen verdienen musste, bevor er in Wien mit volkstümlichen Tragikomödien populär wurde. In seinen Zaubermärchen schrieb er sich so unvergessliche Rollen wie den Aschenmann in »Der Bauer als Millionär« oder den Valentin im »Verschwender« auf den Leib, prägte mit feiner Komik, mit treffenden Wechseln zwischen Hochsprache und Dialekt ein neues Genre, das den Geschmack des Biedermeierpublikums vollkommen traf.
Raimunds Versuche, im ernsten Fach genauso viel Erfolg zu haben wie mit seinen Komödien, scheiterten. Sein Tod hatte etwas Tragikomisches: Raimund, der ein übertriebener Hypochonder war, wurde von einem Hund gebissen und steigerte sich in seiner Angst vor der Tollwut in eine solche Raserei, dass er dem vermeintlichen Leiden ein Ende setzte, bevor es eintrat: Er schoss sich eine Kugel in den Kopf.
Auf den Stufen vor dem Raimund-Grab las die Pieps ihrem Enkel ein Raimund-Stück um das andere vor. Noch bevor er selbst lesen konnte, trat der kleine Heller an privilegierter Stelle »ins Dreidimensionale des Theaters« ein, tummelte sich auf der Zauberinsel des »Barometermachers«, suchte mit dem Magiersohn Eduard nach der Diamantstatue des Zauberkönigs Longimanus, lernte mit dem Alpenkönig Astragalus die Skepsis des Menschenfeinds Rappelkopf besiegen.
Heller konnte die Raimund-Stücke allesamt auswendig, als ihn die Großmutter als Achtjährigen zum ersten Mal ins Burgtheater mitnahm, wo die besten Schauspieler an der Verwirklichung von Raimunds Phantasien arbeiteten. Inge Konradi, Josef Meinrad, Paula Wessely. Der Franzi konnte die Stücke »lippensynchron« mitsprechen.
»Das Zaubertheater war eine grundlegende Prägung«, sagt André Heller. »Es gab keine Sekunde des Nachdenkens darüber, ich erkannte: Das bin ich.«
Die Großmutter hieß jetzt Pogazhnik wie ihr vierter Mann, der Gutensteiner Gemeindearzt Albert Pogazhnik. André Heller erinnert sich, dass er Albert Schweitzer ähnlich sah, ein Glasauge hatte und seine Aufgaben als einziger Mediziner der Gemeinde universell einsetzte, als Zahnarzt genauso knorrig und leidenschaftlich war wie als Geburtshelfer und Veterinär.
Die Pieps fand in dieser ländlichen Idylle zur Ruhe und zum katholischen Glauben. Wenn sie als junge Frau alle Anlagen gehabt hatte, eine Alma-Mahler-artige Muse für darauf ansprechende Herrn zu sein, verwendete sie ihre Talente jetzt darauf, das Gutensteiner Haus und den dazugehörigen Garten in ein Schmuckstück der Biedermeierästhetik zu verwandeln.
Die Räume waren offen und interessant, an den Wänden hingen ausdrucksvolle Bilder von Friedrich Gauermann und Anthonis van Dyck, in Vitrinen fand sich ein Panoptikum verführerischer Gegenstände. André Heller erinnert sich an asiatische Schnitzereien und kleine edelsteinbesetzte Elfenbeinschreine, an bunte Millefiori-Briefbeschwerer, aber auch an Vitrinen, in denen neben den Postkarten von Peter Altenberg eine Halskette lag, die Leo Tolstoi einer Freundin der Pieps einmal unter mysteriösen Umständen verehrt hatte.
Auf ihren Biedermeiermöbeln arrangierte Lotte Pogazhnik schönes Geschirr und dazu passendes Besteck. Bei Einladungen wurde jeder Platz am Esstisch durch eine handgeschriebene Tischkarte zugewiesen. In blauen Bauernkrügen standen Schnittblumen aus dem eigenen Garten, wo Blumen und Gemüse nebeneinander wuchsen. In den Räumen erklang klassische Musik.
»Am Abend hat man sich an einen Kachelofen aus dem achtzehnten Jahrhundert gesetzt, und die Großmutter las mir Märchen vor, solche aus 1001 Nacht oder von Oscar Wilde. Selbst als ich erst fünf oder sechs Jahre alt war, las sie mir Gedichte vor, ich erinnere mich gut an die Geborgenheit, die mir das gab: Ich hatte das Gefühl, in der Nähe meiner Großmutter bin ich unverwundbar.«
Wenn André Heller von seiner Großmutter erzählt, zeichnet er stets Kontraste. Er unterscheidet zwischen der schönheits- und zärtlichkeitsgetränkten Welt der Pieps und dem Sich-selbst-Überlassensein in der Elßlergasse, wo niemand das Rüstzeug hatte, ihn so zu begeistern und klug in den Bann zu ziehen wie die geliebte Großmutter, die nach Lavendel roch.
»Die Großmutter war mein Atlas«, sagt Heller, »sie war mein Geschichtsbuch und mein Kunstgeschichtslexikon.«
Zu Hause verbrachte der kleine Heller viel Zeit allein. Dabei kam ihm eines seiner Grundtalente zugute: Ihm wurde nie langweilig. Er konnte sich stundenlang mit sich selbst und dem, was in seinem Kopf gerade irrlichterte, beschäftigen, und er wurde seiner Ideen nicht überdrüssig.
Eine Lieblingsbeschäftigung bestand darin, Länder zu erfinden. Der fünf- oder sechsjährige Bub legte Karten an, erfand Hauptstädte und Häfen, entwarf Flaggen und dachte sich Sprachen und Hymnen aus. Wenn zu Hause eine Gesellschaft gegeben wurde – und es wurden oft Gesellschaften gegeben –, tauchte er am Tisch der Gäste auf und sang die Hymne eines fernen Landes, das außer ihm niemand kannte, in einer Sprache, die außer ihm niemand sprach.
»Er hat sich immer gern produziert«, sagt seine Mutter etwas allgemein. Aber es war mehr als ein Heischen nach Aufmerksamkeit, der kleine Heller hatte etwas mitzuteilen. Schon als Kind trat er den Beweis an, dass seine Welt größer war als ein Esszimmertisch in der Elßlergasse in Wien-Hietzing.
Jemand fragte ihn scherzhaft, wie viele Sprachen er spreche.
Heller antwortete ganz im Ernst: Vierzig.
Dann erzähl uns mal was auf Krusitanisch.
Das war kein Problem, der Franzi wusste ja, wie Krusitanisch klingt. Nur er wusste das.
Aber da war mehr als ein originelles Kind, das Gefallen daran fand, eine Tischgesellschaft zum Lachen zu bringen. Da entstand gerade ein tiefer Glaube, dass die eigene Wahrnehmung identisch mit der Welt ist.
Die Pieps nahm ihren Enkel mit in die erste Van-Gogh-Ausstellung, die nach dem Krieg in Wien eröffnet wurde. Sie ging mit ihm ins Theater an der Wien, wo nach dem Krieg die Staatsoper ihr Ausweichquartier hatte, und beide liebten die »Zauberflöte«. Mit seinem glockenhellen Sopran sang der Franzi die Arien der Pamina auswendig nach.
Die Pieps kochte ihm Speisen, die er nicht kannte, etwa eine Grütze nach einem Rezept aus Wyk auf der Nordseeinsel Föhr, auf der ihr temporärer Schwiegervater Georg Reimers ein Haus gehabt hatte, und diese Grütze schmeckte so anders als alles, was die Köchin in der Elßlergasse auf den Tisch stellte. Der neue Geschmack korrespondierte mit all den anderen Eindrücken von Welterweiterung, die der kleine Heller aus dem Haus seiner Großmutter mitnahm.
Eines Tages bereitete die Pieps dem Franzi ein Vanilleeis. Derlei gab es damals höchstens beim Demel, der Meisterkonditorei am Kohlmarkt, wo man in der dritten Person angesprochen wurde: »Haben schon gewählt?« Das Zeitalter der italienischen Eissalons war noch längst nicht angebrochen.
Der Franzi wollte zuschauen. Die Pieps zeigte ihm den Vanillestängel, aus dem sie das duftende Mark der Schote schabte, und erklärte dem staunenden Kind, dass dies das Produkt einer exotischen Pflanze aus der Familie der Orchideen sei.
Was sind Orchideen?
Besonders schöne Blumen, die schönsten wachsen in den Tropen.
Wo sind die Tropen?
Die Tropen befinden sich in Südamerika, Afrika und Asien, es ist heiß und feucht dort, und es wachsen dort außergewöhnliche Pflanzen. Willst du sie sehen?
Ja, bitte.