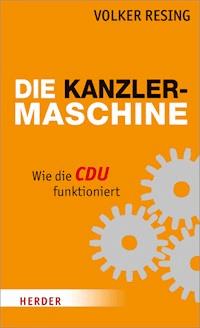Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: HERDER spektrum
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Angela Merkel ist nicht nur Bundeskanzlerin und eine der mächtigsten Frauen der Welt, sie ist auch eine gläubige Protestantin. Volker Resing, Journalist und Korrespondent in Berlin, nähert sich der Regierungschefin in diesem Porträt von einer ungewohnten Seite: der religiösen. Eigentlich ist der Glaube für die Pfarrerstochter eher Privatsache, doch in diesem Buch erfährt man, wie sehr das Christentum sie prägt. Sie sucht den Kontakt zu den Kirchen, scheut dabei keinen Konflikt. Wie steht Angela Merkel zum "C" ihrer Partei? Worum müssen sich die Kirchen in der Gesellschaft kümmern? Wo sieht sie das Christliche in der Politik? Dieses Porträt der gibt authentische und überraschende Antworten. Vollständig überarbeitet und erweitert zeigt es auf, wie sehr Angela Merkel in der Flüchtlingskrise nicht nur verändert hat, sondern sich auch treu geblieben ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Volker Resing
Angela Merkel
Die Protestantin
Ihr Aufstieg, ihre Krisen – und jetzt?
Impressum
Titel der Originalausgabe: Angela Merkel - Die Protestantin
Copyright © 2015 St. Benno Buch und Zeitschriften
Verlagsgesellschaft GmbH Leipzig
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2017
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlagkonzeption: Gestaltungssaal
Umschlaggestaltung: © dpa Picture Alliance
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing service, Leipzig
ISBN (E-Book): 978-3-451-81222-4
ISBN (Buch): 978-3-451-06588-0
Inhalt
Einleitung – Die neue und die alte Kanzlerin
Kapitel 1 Pfarrerstochter privat
Artischocken einkaufen
Hamburgerin auf dem Land
Der schlechte Staat und das schöne Leben
Kapitel 2 Die unpolitische Politikerin
Aus dem Chaos heraus und mit Zufall zur Macht
Ihre Kirche – beten und singen
Der Streit um das Leben
Von der Umweltministerin zur Energiewendekanzlerin
Kapitel 3 Das »C« und die Machtfrage
Der Islam und die Zuwanderung
Die »Rechten« und die Religion
Drei Päpste und eine Kanzlerin
Merkel – und jetzt? Ein Ausblick
Nachwort
Zeittafel
Ausgewählte Literatur
Anmerkungen
Einleitung – Die neue und die alte Kanzlerin
Die neue Kanzlerin tritt das erste Mal am 31. August 2015 auf. Ab jetzt wird Angela Merkel allmählich zur Flüchtlingskanzlerin. Nur bemerkt es an dem Vormittag in Berlin in der Bundespressekonferenz kaum einer. Das Neue kommt bei Angela Merkel – wenn überhaupt – schleichend und ohne großen Knall daher. Erstmals verwendet sie an diesem Tag die Formel, die später Karriere macht: »Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein: Wir haben so vieles geschafft – wir schaffen das.«
Später ist viel in diesen Satz hineingedeutet worden. Als Merkel ihn spricht, fällt er kaum einem auf. Merkel löst Probleme, das macht sie immer so. Alle andern schauen zu. Ein Routinetermin, ein Routinesatz, eine Routinekanzlerin – und doch etwas Neues?
Einmal im Jahr im Sommer setzt sich Angela Merkel vor die blaue Wand im Haus der Bundespressekonferenz unweit des Kanzleramtes auf der anderen Seite der Spree und stellt sich rund zwei Stunden lang den Fragen der Journalisten. Eine Mischung aus Bilanzpressekonferenz und Klassentreffen. Manchmal geht es um die großen Linien der Politik, manchmal auch nur um den Alltag einer Kanzlerin im Supermarkt. Im August 2015 im zehnten Jahr von Merkels Kanzlerschaft scheint es nur das Übliche zu sein. Merkels Dinner for one.
Der Netz-Journalist Tilo Jung stellt in der Pressekonferenz gegenüber Merkel eine gewohnt spöttische Frage: »Was möchten Sie noch Großes erreichen?«, will er wissen. Und: »Warum sind Sie noch Kanzlerin?« Ihre Vorgänger hätten auch nach so langer Zeit im Amt keinen politischen Antrieb mehr gehabt, fügt er hinzu.
Soweit zur Stimmung in Berlin in jenem August 2015: Es passiert nichts Neues. Merkel bleibt ungerührt. Sie zählt ein paar »Herausforderungen« auf und erklärt, sie tue ihre Pflicht und wolle Deutschland dienen. Doch keiner bemerkt, dass Merkel das »Große«, das sie erreichen will, gerade genannt hat. Merkels Mission, so denken alle, ist nicht existent. Doch in den darauffolgenden Monaten ändert sich dies. Die Flüchtlinge, so scheint es, sind ihre Mission.
Ein Jugendwort des Jahres 2015 war »merkeln«. Es stand für »nichts tun, nichts sagen und keine Entscheidung treffen«. Es bündelt geradezu frappierend die allgemeine Sicht auf Merkels Politikstil. Tilo Jung fragt, was sie zu dieser Zuschreibung meint. Merkel antwortet, dies beschäftige sie nicht, sie nehme es »emotionslos zur Kenntnis«. Das passt (noch) ins Bild. Spätestens im Herbst 2015 aber wird dann - zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung - aus der emotionslosen Merkel die emotionale Flüchtlingskanzlerin?
Merkel war immer die unwahrscheinliche Kanzlerin und sie ist immer auch die unbekannte Kanzlerin, die Unerklärliche geblieben. Die Beobachter kreisen um Angela Merkel seit den frühen 90er-Jahren, als sie als Quereinsteigerin aus dem Osten in der Politik auftaucht. Sie war ein unbeschriebenes Blatt, 35 Jahre alt als die Mauer fiel. Anders als etwa bei Helmut Kohl und Gerhard Schröder, deren Charaktere und Motivlagen doch irgendwann entschlüsselt waren, ist sie ein Stück rätselhaft geblieben. Bis heute. Das belegen auch die vielen Zuschreibungen, die ihr zuteilwerden, die aber immer wieder abperlen wie Wasser auf dem Ginkoblatt. Bild-Journalist Nicolaus Blome wähnt sie einmal als die »Zauder-Künstlerin«, die zur Mitte der Legislaturperiode zurücktreten werde, weil sie ihre Mission erfüllt sähe. Doch von Rücktritt im Sommer 2015 fehlt jede Spur.
Deutschland hatte sich an Angela Merkel gewöhnt. Aus einer völlig unerwartbaren Kanzlerschaft war eine fast schon langweilige Selbstverständlichkeit geworden. Die Routinekanzlerin. Die Merkel-Kanzlerschaft als absoluter Normalitätszustand. Der glücklose SPD-Politiker Thorsten Albig bringt dies ausgerechnet im Sommer 2015 mit seiner Forderung auf den Punkt, die SPD solle zur Bundestagswahl keinen Kanzlerkandidaten aufstellen. Denn besser als Merkel könne das auch kein Sozialdemokrat.
Bei Merkel wechseln die Charakterisierungen immer wieder – genauso schnell, wie sie auftauchen. Hier noch Nichtstuerin, ein paar Wochen später Flüchtlingskanzlerin - wahlweise als Heldin gefeiert oder als Deutschlands Totengräberin gebrandmarkt. Wiederum zwei Jahre später im Sommer 2017 scheinen selbst diese Aufgeregtheiten schon lange zurückzuliegen.
Das vielleicht Überraschendste ist, dass die Flüchtlingskrise in besonderer Weise auch die Frage nach Merkels persönlicher Haltung, eben auch jene Gretchenfrage nach dem Glauben, erneut und verstärkt in das Zentrum der politischen Debatte rückt. War zum Anfang ihrer Karriere das Denkmuster dominant, nun komme eine weitgehend glaubens- und kirchenferne Ostdeutsche an die Schalthebel bundesdeutscher Macht, wo seit dem Krieg vor allem engagierte Christen – und in der CDU an führender Stelle Katholiken – den Ton angaben, meinen nun einige in den Handlungen der Kanzlerin vom September 2015 eine nicht nur humanitäre, sondern gar christliche Kehrtwende oder zumindest entsprechende Besinnung der Kanzlerin zu erkennen.
Der Philosoph Konrad Ott beschreibt diesen vermeintlichen Wandel von der alten zur neuen Kanzlerin im Deutschlandfunk-Interview mit Christiane Florin als ethische Kehrtwende. Im Sommer 2015 sei Merkel »gesinnungsethisch losgaloppiert«, so formuliert er. Seit Anfang 2016 versuche sie, wieder stärker verantwortungsethisch zu agieren. Unter Gesinnungsethik versteht Ott die radikale Betrachtung des Einzelschicksals, ohne die Folgen für die Gemeinschaft abzuwägen.
Doch stimmt das? Hat Merkel nicht lediglich die Flüchtlingspolitik in eine Reihe mit der Energiewende und der Abschaffung der Wehrpflicht gestellt? Hat nicht gerade Merkel sich dagegen gewehrt, ihre Flüchtlingspolitik als erstmalig »mutig« darzustellen? Sie sagt, es seien auch zuvor »mutige Entscheidungen« getroffen worden. Merkel hat sich davor gehütet, ihre Politik als etwas Höheres und gänzlich Neues darzustellen. Es sind andere, die es so erscheinen lassen wollen.
Angela Merkel ist nicht in der Flüchtlingskrise plötzlich christlich-barmherzig geworden oder hat ihr Christentum wiederentdeckt. Auch die geradezu abstruse Gegenthese ist völlig fernliegend, sie habe hunderttausende Muslime ins Land gelassen, um die christliche Prägung des Landes weiter auszuhöhlen und eine Entkirchlichung voranzutreiben. Merkel macht keine Politik mit solchen »Projekten«, sie hat keine größere oder höhere Agenda, die außerhalb der konkreten politischen Ziele läge. Das allenfalls kann man von ihr sagen: Sie ist oft situativ orientiert, konkrete und lageabhängige Umstände fallen bei ihr mehr ins Gewicht als abstrakte Überlegungen.
Nur hat in besonders ausgeprägter Weise die Flüchtlingskrise gezeigt, wie stark Zuschreibungen und kommunikatives Agieren das Bild bestimmen. Merkel bietet durch ihren Politik-Stil und die reduzierte Art ihrer Rede weitaus leichter und umfassender eine Projektionsfläche für Wünsche und Deutungen – und auch Gegnerschaft. Dass Merkel dies immer wieder auch zu nutzen versucht, liegt auf der Hand.
Es gibt eine Konstellation im Mai 2017, die zeigt diese neue und alte Merkel in besonderer Weise, die Bundeskanzlerin, die bejubelt und beschimpft wird – manchmal von denselben Leuten. Es ist ein besonderer Marker in ihrer Karriere: Sie sitzt neben Barack Obama vor dem Brandenburger Tor. Es könnte symbolischer kaum sein, dort auf der westlichen Seite der Mauer, wo einst US-Präsident Ronald Reagan sein »Mr. Gorbatschow, open this gate« gerufen hat, spricht nun vor 70000 Besuchern auf dem Evangelischen Kirchentag zum Reformationsjubiläum die deutsche Bundeskanzlerin mit dem ehemaligen amerikanischen Präsidenten. Jeweils Pioniere in ihren Ämtern als Frau und als Schwarzer, jeweils für ihre moralische Haltungen geehrt wie angefeindet.
Obama spielt auf seinen Nachfolger Donald Trump nur in Andeutungen an, wenn er gegen Grenzen und Mauern wettert und für Barmherzigkeit plädiert. Am selben Tag noch wird Merkel Trump in Brüssel beim NATO-Gipfel treffen und einen Tag später - auf dem G7-Gipfel – seine ablehnende Haltung zu einer Kooperation für den Klimaschutz zu spüren bekommen. Wiederum einen Tag später steht Angela Merkel im Bierzelt der »Truderinger Festwoche« in München und überrascht nationale wie internationale Beobachter mit ihrem Verdikt gegen Trump: »Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, sind ein Stück weit vorbei. Das habe ich die Tage erlebt.«
Merkel die Weltpolitikerin, zwischen diesen beiden so verschiedenen Präsidenten. Eine Rolle in die sie gewachsen ist und die ihr die Leute abnehmen, auch an jenem sonnigen Tag des Kirchentags.
In diesem Gespräch vor dem Brandenburger Tor bekennen sich Merkel und Obama beide zu ihrem Glauben und ihrem Christentum. Es ist bemerkenswert, dass sie in einer Zeit, in der sich die Gesellschaft weiter säkularisiert, einen solchen prominenten Gegenakzent setzt. »Es gibt etwas über mir, in mir, das mich als ein Geschöpf Gottes verstehen lässt, mit Fähigkeiten«, sagt die Bundeskanzlerin. Und gerade vor dem Hintergrund der starken Kritik an ihren Entscheidungen wisse sie »inspiriert auch durch den christlichen Glauben«, dass sie Fehler mache, ja sogar fast das Recht habe Fehler zu machen. »Ich bin damit nicht vernichtet, sondern ich bin darin auch aufgehoben.« Dafür gibt es Applaus.
Merkel kommt auf die Flüchtlingspolitik zu sprechen. Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Menschen in Deutschland hätten »Mitgefühl, Aufnahmebereitschaft, Solidarität gezeigt«. Dafür müsse man dankbar sein und es zeige, »dass man etwas bewegen kann«. Das Gute ist machbar! Applaus auch dafür vorm Brandenburger Tor. Doch der Zuspruch, den sie dafür erntet, ist nicht weit entfernt von den Pfiffen, die wenig später aus dem Publikum zur Bühne schallen. Es sind Pfiffe gegen die Bundeskanzlerin, die ihre Haltung zur Ausweisung abgelehnter Asylbewerber verteidigt. Ganz einfach ist Merkel eben nie zu haben. Auf die Frage des EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm, warum gut integrierte Afghanen abgeschoben würden und es nicht mehr Ausnahmen gäbe, erklärt Merkel, keineswegs seien Ausnahmen eine Lösung, vielmehr müsse die Verlässlichkeit des Rechts gelten. Es könnten nun mal nicht alle bleiben, die kommen. Das bringt ihr den Unmut der Menge ein.
Im Kern ist sie genauso wenig Flüchtlingskanzlerin, wie sie auch keine Abschiebekanzlerin geworden ist. Daran ändern auch die berühmten Selfies mit Flüchtlingen nichts. Und so gilt auch 2017 weiterhin ihr Slogan aus der Bundestagswahl 2013: »Sie kennen mich.« Eine neue Merkel gibt es nicht, sie bleibt die alte.
Doch auf sie lohnt ein genauerer Blick, ein Blick, der auch abseits der tagespolitischen Analyse ihren Weg nachzeichnet.
Angela Merkel und das Kreuz – das ist ein Thema, das abseits der Tagespolitik wie kaum ein zweites die Debatte um die Person und Amtsführung der Bundeskanzlerin und Parteivorsitzenden durchzieht. Ihr Büro liegt in der siebten Etage des betonweißen Bundeskanzleramtes. Dort hängt kein Kreuz an der Wand, aber im Regal steht ein rostbraunes schweres Metallkreuz. Außer dem Adenauerporträt von Oskar Kokoschka über dem großen, schnörkellosen, dunklen Schreibtisch und der stehlampengroßen Deutschlandfahne daneben gibt es kein auffälliges Dekor. In einer Ecke stehen noch kindsgroße Schachfiguren, die ihr der Waldbauernverband geschenkt hat.
Das Kreuz scheint fast beiläufig Platz gefunden zu haben, nicht festgeschraubt, eben zwischen die Bücher gerückt. Es ist angelehnt an eine Prachtausgabe des Grundgesetzes. Nebenan steht Bertolt Brecht mit seiner Gesamtausgabe, der Große Brockhaus und auch Hegels in Leinen gebundene Werke bilden die Nachbarschaft für die massive Kreuzplastik im Bücherschrank der Regierungschefin.
Mit Merkel verliere die CDU ihr christliches Profil, so lautet immer wieder der Vorwurf ausverschiedenen Ecken. Ihr christliches Fundament sei nicht stabil, zu wenig verankert. Merkels Kritiker verbinden dabei meist das Christliche mit dem Konservativen. Ihre Modernisierung der CDU habe viele Anhänger verschreckt.
Angesichts von Pegida und AfD spricht der Dresdener Politologe Werner J. Patzelt von einer »Repräsentationslücke« im konservativen Spektrum, das nun nach außerparlamentarischer Ergänzung suche. Extremisten und Populisten würden dies ausnutzen. Die Flüchtlingskrise hat dieser schon schwelenden Debatte nun eine neue Facette hinzugefügt und teilweise Auftrieb gegeben. Allerdings ist durch die stark christlich aufgeladene Position Merkels in der Migrationsfrage der Mangel an »C«-Orientierung im Vokabular ihrer Kritiker zumeist verschwunden.
Merkels Losung ist legendär. In der Talkshow von Anne Will sagt sie: »Ich bin mal liberal, mal christlich-sozial, mal konservativ.« Ist das zu wenig, wenn Führung gefragt ist? Oder wird sie missverstanden? Seit 2005 ist sie Kanzlerin. Dass sie die heftigen Angriffe in den Jahren 2015 und 2016 und die lauter werdenden Merkel-Muss-Weg-Rufe überstehen würde, scheint zeitweise ungewiss. Doch sie hat ihre Partei längst wieder hinter sich versammelt.
Als beim Parteitag in Essen im Dezember 2016 Merkel erneut zur Kanzlerkandidatin ausgerufen wird, gibt es kaum noch spürbaren Gegenwind. Die CDU ist eine Kanzlermaschine, die ein feines Gespür für Wahlerfolge hat. Das ist ihr das wichtigste. Und für die steht, so die Mehrheitsmeinung in der CDU, allein Merkel.
Dennoch wird immer wieder beklagt, die spezifisch katholische Prägung oder die katholisch-konservative Grundierung der Partei und auch der Regierungsarbeit sei nicht mehr genügend spür- und wahrnehmbar. Schuld daran sei vor allem Angela Merkel, die ostdeutsche Physikerin oder säkularisierte Pfarrerstochter. Sie sei hauptverantwortlich für die Modernisierung, Liberalisierung, Sozialdemokratisierung, kurz: die Abschaffung der CDU als einer im Kern christlichen Volkspartei.
Der Freiburger Theologe Eberhard Schockenhoff fasst die Kritik 2010 in einem Beitrag für die Zeitschrift Cicero zusammen: »Das Programm einer strategischen Modernisierung der Union, dem sich die gegenwärtige Parteiführung verschrieben hat, setzt auf eine Zurückdrängung des christlichen Einflusses, die das »C« als Markenzeichen einer wertorientierten, dem christlichen Menschenbild verpflichteten Politik verblassen lässt.«
Meist liegen die Vorwürfe auf anderen Ebenen als die Entkräftungsversuche, was die politische Debatte am Laufen hält. Mal geht es um inhaltliche Punkte, um die Familienpolitik, um den Lebensschutz, dann verweist die CDU-Parteizentrale auf Debattenkultur und innerparteiliche Pluralität. Mal geht es ums Gefühlte, die fehlende Nestwärme wird in den katholischen Stammlanden der Union beklagt.
Die als »Mutti« im Berliner Politsprech bespöttelte Merkel lasse gerade das Mütterliche innerparteilich vermissen. Sie könne keine engen Beziehungen aufbauen, so der immer wieder zu vernehmende Vorwurf aus den Reihen altgedienter Parteigrößen. Kohl sei da eben anders gewesen, der kannte jeden Kreisvorsitzenden persönlich, zumindest aber hatte er stets die jeweilige Telefonnummer zur Hand, falls nötig auch am Wochenende.
Merkel kuschelt die Seele der Partei nicht, so wird das Unbehagen umrissen. Verweise auf ihren persönlichen Glauben, auf ihre christliche Sozialisation und auch auf ihre im Kern persönlich sehr konservative Weltsicht helfen da nicht weiter. Man redet beherzt aneinander vorbei, wie das so ist in Beziehungskrisen, die in diesem Fall zwischen der Vorsitzenden und Teilen der Parteihierarchie und der Basis so schnell offenbar nicht zu lösen sind. Ein in Parteikreisen gängiger Vorwurf war lange: »In Merkels Kanzleramt gibt es nur To-Do-Listen, aber keine Ziele und keine Ideen.«
Doch wer sind die Kritiker und wer ist diese Basis? Und wer ist diese Angela Merkel eigentlich? Wie groß ist noch das vielbeschworene katholische Klientel in der Union? »Das Kreuz mit den Katholiken«, so wurde das Problem der Parteivorsitzenden immer Mal wieder beschrieben. Nun scheint dies alles vergessen angesichts der Flüchtlingskrise. Welche Klischees, die Angela Merkel angeheftet werden, sind noch plausibel? Inzwischen ist Merkel eine Art Kultfigur geworden. International wie national. Und auch in ihrer Partei.
Im Wahlkampf 2013 plakatiert die CDU die überdimensionale Merkel-Raute, die Hände der Kanzlerin, in ihrer typischen Fotohaltung. Das Bild ist aus tausenden Porträts zusammengesetzt. Mehr zur Schau gestellte Identifikation geht nicht. Man könnte fast auch an eine Gebetshaltung denken; so wird Merkel zur politischen Ikone gemacht. Die Kanzlerin muss mit immer wieder neuen Charakterisierungen leben, doch ihrer Persönlichkeit kommt man nur schwer nahe. Eine christliche Kanzlerin? Ist das zu dick aufgetragen? Die Protestantin, die auf Gott vertraut, seine Hilfe erbittet in der Krise? Ist das nur das positive Wunschbild, ein Zerrbild aus der PR-Trickkiste?
Glaubwürdigkeit und Authentizität scheinen in der Mediendemokratie die wertvollsten Eigenschaften von Politikern zu sein, noch vor Sachkompetenz und Führungsfähigkeit. Doch diese Glaubwürdigkeit scheint oft zerbrechlich gerade in ganz persönlichen Dingen. Zeigt ein Politiker sich besonders fromm, wird ihm dies als Show angelastet. Ist er eher zurückhaltend mit dem Offenbaren persönlicher Details wie dem Glauben, so gilt er als verschlossen und dann möglicherweise religionsfern. Angela Merkel hat sich auch - gerade in den zurückliegenden Jahren - immer wieder als gläubiger Mensch vorgestellt, aber sie dosiert dies, versucht sich zurückzunehmen.
Bei einem Auftritt im Oktober 2014 »predigt« sie erstmals in ihrer Heimatgemeinde in der Maria-Magdalenen-Kirche in Templin, dort, wo sie in einem Pfarrhaushalt aufgewachsen ist, dort, wo sie zur »Christenlehre« gegangen ist, dort, wo sie konfirmiert wurde. »Gott wollte keine Marionetten, keine Roboter, keine Menschen, die einfach tun, was sie gesagt bekommen«, sagt sie. Es ist eine Predigt über die Freiheit, die christliche Freiheit. So hätte sie das vor 25 Jahren, als sie in die Politik einstieg, öffentlich noch nicht formuliert. Doch schon 2013 bekennt sie bei einem Besuch im Zentrum Schönblick, in der Herzkammer des schwäbischen Pietismus: »Vor Gott bin ich Mensch, nicht Bundeskanzlerin«. Das kommt bei einer bestimmten Wählerklientel natürlich gut an, aber es zeigt auch eine veränderte, offensivere Herangehensweise Merkels in diesen Dingen.
Der politische Weg der Protestantin Merkel ist auch ein Weg aus dem Privaten ins Öffentliche – auch was Glaubensfragen angeht. Wie sehr sie die gesellschaftlichen Veränderungen von religiöser Sozialisation umtreiben, erklärt sie in einem Interview mit den Journalisten Peter Seewald und Markus Günther. Merkels Konsequenz lautet: Glauben und Kirche werden erklärungsbedürftiger. »Für Christen kann das durchaus eine Chance sein, sie sind vielleicht mehr als früher wieder aufgerufen, anderen von ihrem Glauben zu erzählen.«
Als sie 2009 mit US-Präsident Barack Obama die Frauenkirche in Dresden besucht, verharren beide gemeinsam im Gebet. Landesbischof Jochen Bohl bittet den einen Gott um Frieden. Es ist eine besondere Situation: die deutsche Regierungschefin und der amerikanische Präsident am Altar der Frauenkirche. Doch Fotos gibt es davon nicht. Vielleicht fehlt das einigen an Merkel, die symbolischen Handlungen, die auch Bilder in den Köpfen der Menschen zurücklassen. Derartiges ist in ihrer Kanzlerschaft bislang selten oder gar nicht vorhanden.
Ein anderes kleines Zeichen von Frömmigkeit und öffentlicher Gottesrede findet sich in den Worten der Kanzlerin am Abend des 11. März 2009. Nach dem Attentat von Winnenden sagt sie in der Tagesschau die üblichen Worte von Mitgefühl und Mitleid. Aber dann fügt sie den Satz an: »Wir beten für die Opfer.« Es ist in unserer säkularisierten Politikersprache ungewöhnlich geworden, von einem kollektiven »Wir beten« zu sprechen, da der Gottesglaube und die Gottesansprache eben nicht mehr selbstverständliches Allgemeingut sind.
Merkel hingegen spricht inzwischen häufiger öffentlich vom Glauben, nicht von einem persönlichen, aber davon, dass die Gesellschaft ihn brauche. Sie hat gemerkt, dass es eben auch eine Entchristlichung und Entkirchlichung bedeutet, wenn keiner mehr öffentlich von Gott spricht und sich zu ihm bekennt.
Wer also ist Angela Merkel? Seit über 25 Jahren kennt die deutsche Öffentlichkeit die heutige Bundeskanzlerin, doch bei kaum einem anderen Politiker hat sich das öffentliche Bild in dieser Zeit so oft verändert und ist nach wie vor so unscharf in seinen Konturen. Von »Kohls Mädchen« zur deutschen »Eisernen Lady«, graues Mäuschen, männermordende Machtmaschine oder »Taste-Kanzlerin«, Frau Legt-sich-nicht-fest oder »Physikerin der Macht« bis hin zur Weltenlenkerin? Der legendäre Spiegel-Journalist Jürgen Leinemann erwähnt Angela Merkel in einer Spiegel-Reportage vom Mai 1990 zum ersten Mal, als sie der Öffentlichkeit noch unbekannt ist. Die Pressesprecherin des Demokratischen Aufbruchs trete mit »fast rührender Aufrichtigkeit« auf, heißt es da.
Auf dem Ökumenischen Kirchentag 2010 in München ist Angela Merkel auffallend begeistert von den Besuchern empfangen worden, doch das ändert an der politischen Wahrnehmung und Beurteilung ihrer Person wenig. Sie bleibt doch immer die Distanzierte und Unnahbare. Das führt dazu, dass immer neue Zuschreibungen ihren Stil zu typisieren versuchen. Sie sei zu zaudernd, ohne Linie und Prinzipien, würde wie Kohl alles aussitzen und erst so spät wie möglich entscheiden. Sie segelt erst los, wenn alle Untiefen ausgemessen sind und alle anderen sich schon auf einen Kurs festgelegt haben und damit berechenbar werden. In ihrem Umfeld heißt es hingegen, ihre visionäre Kraft werde verkannt. Die Kanzlerin habe sehr wohl eigene Ideen und Ziele. Sie lasse die Öffentlichkeit allerdings erst dann daran teilhaben, wenn sie, Merkel, wisse, dass die Wahrscheinlichkeit, die eigenen Vorstellungen auch durchzusetzen, sehr hoch ist. Ihre Kritiker sagen dazu: »Sie riskiert nichts.«
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt einmal, die »Methode Merkel« sei es, einsam zu entscheiden und zwar nicht nur als Bundeskanzlerin, sondern auch als Parteivorsitzende. Das funktioniere aber nicht, denn die Partei unterliege »kooperativen Spielregeln«. Sie scheint es keinem Recht machen zu können. Mal ist sie die politische Titanin, die als mächtigste Frau der Welt Deutschland sicher durch die Krisen führt, mal die Versagerin, die auf dem europäischen Parkett zu zögerlich agiere. Vielleicht ist sie vor allem eins, dem politischen wie intellektuellen Establishment auch über ein Vierteljahrhundert nach der deutschen Einheit fremd geblieben. Sie saß nicht mit an den (Bier-) Tischen der Jungen Union in den 60er-, 70er- und 80er-Jahren, und sie meidet noch immer den kumpelhaften Umgang, der sich aus Bonner Zeiten in Teilen noch herübergerettet hat in die Berliner Republik.
Das Kreuz in ihrem Büro stammt vom Künstler Markus Daum. Kein katholisches Kruzifix und auch keine schlichte protestantische Variante ohne Korpus. Das Kreuz, das sie tagtäglich vor Augen hat, ist die kleine Modellversion eines großen Kunstwerks, das im Fraktionssitzungssaal gegenüber im Reichstag hängt.
Die Eisenguss-Plastik des Bildhauers aus Radolfzell, Schüler von Alfred Hrdlicka, ist eine ungewöhnliche Interpretation des klassischen lateinischen Kreuzes. Wie beim griechischen Kreuz setzt der Querbalken in der Mitte und nicht oberhalb der Mitte an. Der Längsbalken ist eine Art nach unten sich verjüngender Pfahl, der Querbalken erinnert an einen überdimensionalen Nagel, der sich durch die Mitte der senkrechten Achse bohrt. So nimmt der Künstler ein sehr bildliches Motiv aus den Leidensdarstellungen Christi auf. Das Kreuz hat Ausmaße von ein mal zwei Metern und zieht die Blicke in dem sonst leeren Saal auf sich. Es ist alles andere als nur dekorativ. Zur Einweihung 1999 sagte der damalige Unions-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Schäuble, es erinnere daran, »dass wir aus eigener Vollkommenheit letztlich überhaupt nichts tun können«.
Der jetzige Fraktionsvorsitzende Volker Kauder hat Merkel das Modell geschenkt. Es hat seinen Platz im Regal bekommen. Es ist viel kleiner als das Original, nur 30 mal 15 Zentimeter. Übrigens liegt in dem Regal auch noch eine grünspanige Kupferschindel. Sie stammt vom Dach des Großen Michel, der evangelischen Hauptkirche Hamburgs. Die Hansestadt an der Elbe ist Angela Merkels Geburtsstadt. Der Belag des alten Daches ist ein Geschenk zur Erinnerung an ihren Lebensweg, der früh von West nach Ost führte.
Ihr Vater, der Theologe Horst Kasner, fand nach seinem Studium in Hamburg eine Pfarranstellung in seiner Brandenburgischen Heimat. Dass ausgerechnet die Pfarrerstochter unter den Verdacht gerät, in der CDU das »C« zu vergessen, charakterisiert schon die besonders schwierige Annäherung der deutschen Öffentlichkeit an ihre Kanzlerin – und umgekehrt.
»Ein Mensch wird nicht dadurch gläubig, dass er im Pfarrhaus aufwächst« wissen die Autoren des Buches »Das erste Leben der Angela M.«. Günther Lachmann und Ralf Georg Reuth versuchen, Beweise dafür zu finden, dass Merkel keineswegs Regimegegnerin, sondern Sympathisantin des DDR-Regimes war, zumindest mehr als nur Mitläuferin. Ihrem Vater werfen sie zu viel Nähe zum Sozialismus vor – um damit gleich die Kirchlichkeit und den Protestantismus von ihm und seiner Tochter insgesamt zu desavouieren.
Merkel selbst habe den Sozialismus reformieren wollen und die deutsche Einheit nicht angestrebt, lautet der Vorwurf, der sich vor allem aus Quellen der Wendezeit speist, als vieles im Fluss und ungewiss war und als viele selbst im freien und demokratischen Westen die Deutsche Einheit ablehnten. Ihr Mitgliedschaft in der FDJ und ihre Tätigkeit als Funktionärin in der SED-nahen Organisation würden zu wenig berücksichtigt, so die Autoren. In der Tat ist die Tatsache, dass die Kanzlerin Diktaturerfahrung hat, im Gegensatz zu inzwischen fast allen deutschen Spitzenpolitikern, zu wenig im Bewusstsein der Öffentlichkeit. Sie muss bei einer Annäherung an ihre Person größere Berücksichtigung finden. Ob allerdings die Problemlagen zwischen Anpassung und Widerstand von den Autoren Lachmann und Reuth genügend gewürdigt wurden, ist fraglich.
Angela Merkel kommt in der Wendezeit aus einer völlig anderen Sozialisation in diesen Umbruchsprozess der westdeutschen Gesellschaft. Sie hat religiöses Bekenntnis als absolute Außenseiterposition und auch als Diskriminierungsfaktor erlebt. Vor allem hat sie eine Politisierung des Glaubens und der Kirchlichkeit erlebt, die sie eher nicht positiv bewertet. Und dies persönlich vielleicht sogar in zweifacher Hinsicht. Der Staat hat ihr den Gottglauben austreiben wollen und dies zum politischen Credo erhoben, umgekehrt hat ihr Elternhaus den Glauben auch ins Öffentliche gezogen, das war im Pfarrhaushalt kaum anders möglich.
Dem charismatischen Vater, den gerade die Frage nach der »Kirche im Sozialismus«, also der Umsetzung des Glaubens im gegebenen (repressiven) politischen Kontext, bewegt hat, entkam sie nicht. Freiheit, so scheint es, die so ersehnte Freiheit, bestand für sie nach 1989 auch gerade darin, allen Glaubensdingen endlich unpolitische Privatheit angedeihen zu lassen. Es ist ihr Akt der persönlichen Freiheit, das Bekenntnis zu verbergen. Und damit das zu tun, was die meisten Menschen tun, aber was ihr seit ihrer Einschulung und ihrem Besuch der Christenlehre in Kindheit und Jugend im uckermärkischen Templin, wo sie aufwuchs, nicht mehr möglich war.
So ist ihr Satz in einem Interview zu verstehen, Glaube sei zunächst einmal eine private Angelegenheit. Dieser Rückzug des Glaubens ins Private, der in den westdeutschen Debatten Alarmsirenen im engagierten Christentum beiderseits der konfessionellen Demarkationslinie auslöst, ist bei ihr ein antidiktatorischer Affekt, ein großer Freiheitsimpuls. Es ist diese auch antiideologische Grundierung, die sich bis heute beobachten lässt, selbst in beiläufigen Situationen.
Beim Ökumenischen Kirchentag 2010 in München nimmt Angela Merkel auf dem »Roten Sofa« Platz, einem Interviewforum der evangelischen und katholischen Kirchenpresse. Dort sollen abseits der Vorträge und Podien kurze, lockere Gespräche stattfinden. Nina Hagen kam vorbei. Auch Margot Käßmann und Erzbischof Robert Zollitsch saßen dort. Es regnet in München mal wieder, als die Bundeskanzlerin Platz nimmt. Dennoch drängen sich die Besucher vor das kleine Bühnenzelt mit dem knalligen Sitzmöbel.
Angela Merkel hat gerade zuvor in der überfüllten Halle C3 vor 6000 Zuhörern die neue Sparpolitik der Bundesregierung angekündigt. Es werde harte Einschnitte geben, erklärt sie. Die Agenturen melden dies eifrig nach Berlin in der Freude, vom Christentreffen auch politische News liefern zu können. Das irgendwie elektrisierte Publikum lässt sich hingegen nicht verdrießen. Sogar »Angie, Angie«-Rufe gibt es auf dem Kirchentag.
Der Zusammenhalt der Gesellschaft könne nicht von der Politik allein garantiert werden, vielmehr müsse die Grundlage immer neu erarbeitet werden. Sie sagt: »Politik kann Werte nicht verordnen.« Werte würden in der Familie und in der Erziehung vermittelt. Die Bibel sei dafür eine gute Quelle, das ist Merkels Botschaft, die offenbar verstanden wird. Das gemeinsame Beten und Singen, aber auch das Diskutieren, so wie es auf dem Kirchentag geschehe, sei Ausgangspunkt, die Wertegrundlagen immer wieder neu zu gewinnen und sich auch seiner selbst zu vergewissern. Sie spricht von der Bibel und vom Beten. Doch sie sagt es politisch. Christen müssen zu ihrem Glauben stehen, müssen von ihm reden, nur dann entsteht ein Fundament.