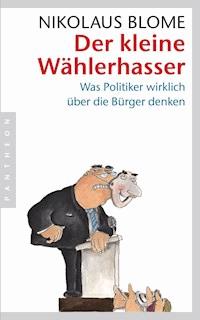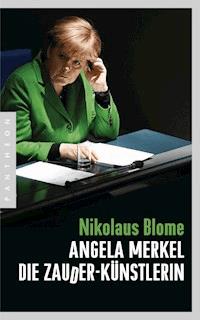
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pantheon
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Wie ist die Kanzlerin wirklich? - Ein intimer Insiderbericht
Wie ist Angela Merkel aus der Nähe und wann kriegt sie einen echten Wutanfall? Wer hat ihr Vertrauen und wer ist unten durch? Hat sie einen politischen Kompass oder regieren Beliebigkeit und Opportunismus? Wie denkt sie über die Deutschen, was macht ihr Angst? Und warum hält sie eigentlich die Hände immer so komisch? Aus vielen Betrachtungen und Einsichten setzt Nikolaus Blome ein ganz neues Bild der Kanzlerin zusammen.
Faszinierend an Angela Merkel ist: Auch nach Jahrzehnten in der Politik und nach fast acht Jahren auf dem Präsentierteller des Kanzleramts werden wir nicht schlau aus ihr. Selbst auf die vermeintlich einfachen Fragen zu ihrer Person gibt es keine befriedigenden Antworten. Es mangelt zwar nicht an Großthesen: »Kanzlerin ohne Volk«, »Die halbe Kanzlerin«, »Angela Mutlos«. Was aber ist wirklich der rote Faden von Angela Merkels Regieren? Und wo der Kern ihrer Persönlichkeit? Der Leiter des Hauptstadtbüros der Bild-Zeitung und intime Kenner der Berliner Republik Nikolaus Blome geht dem Phänomen Angela Merkel auf den Grund. Er schreibt aus dem inner circle im Regierungsflieger, von unzähligen Reisen, Begegnungen und Gesprächen, bei denen er die Kanzlerin erlebt hat. Nikolaus Blome stellt die richtigen Fragen, und seine höchst unterhaltsamen Antworten ergeben ein erfrischendes wie tiefgründiges Bild von Angela Merkel als Frau und Politikerin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 222
Ähnliche
Nikolaus Blome
ANGELA MERKEL –
DIE ZAUDERKÜNSTLERIN
Pantheon
Der Pantheon Verlag ist ein Unternehmen der VerlagsgruppeRandom House GmbH
Erste Auflage
April 2013
Copyright © 2013 by Pantheon Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Satz: Ditta Ahmadi, Berlin
ISBN 978-3-641-09512-3
www.pantheon-verlag.de
Für Karola
Inhalt
Noch ein Merkel-Buch?
Wie ist Angela Merkel so aus der Nähe?
Was denkt sie über die Deutschen?
Warum hält sie die Hände immer so komisch?
Wie macht Angela Merkel Politik? Hat sie einen Standardtrick?
Hat sie vor irgendetwas richtig Angst?
Gibt es überhaupt jemanden, dem Angela Merkel vertraut? Und wer ist alles unten durch bei ihr?
Sagt sie auch mal »Scheiße«?
Macht Merkel für Macht alles?
Wie viel Inszenierung steckt in Angela Merkel? Und wie viel weibliche Eitelkeit?
Die hat doch bestimmt ein Problem mit Männern?
Wofür steht Angela Merkel wirklich? Und warum verachtet sie die Konservativen?
Die muss sich doch dauernd beidrehen, oder?
Kratzt sie überhaupt noch, was die Journalisten über sie schreiben?
Was möchte Angela Merkel über sich im Geschichtsbuch lesen?
Wie lange will sie eigentlich noch regieren?
Abspann
Noch ein Merkel-Buch?
Ein Buch über Angela Merkel? Noch eins? Aber bitte schön, könnte man antworten, das ist ja wohl unvermeidlich. Immerhin ist die Dame die deutsche Bundeskanzlerin, stellt sich im Herbst 2013 nach acht Jahren im Amt wieder zur Wahl, regiert die Republik womöglich noch einmal vier Jahre lang. Ehrlich, da ist schon deutlich Dünneres zwischen zwei Buchdeckel gepackt worden. Andererseits: Seit ihrem politischen Beginn zur Wendezeit entstanden über Angela Merkel eine lange Reihe von Analysen, Porträts, Nahaufnahmen. Und es stimmt: Wiederholungen gefallen nicht. Dass Verlage an Autoren herantreten und sagen: »Machen Sie mal, Sie kennen die Kanzlerin doch«, wird keinem Leser reichen. So denken halt Verlage (und Autoren selbstverständlich auch).
Was für einen Grund gibt es dann? Die Antwort ist: Es gibt nicht den einen Grund. Es gibt viele. So viele, wie es offene Fragen gibt. Und »Angela Merkel« ist in Wahrheit ein anderes Wort für »offene Fragen«.
Denn das wertungsfrei Faszinierende, das Geheimnisvolle an dieser Frau ist: Dass man immer noch nicht schlau wird aus ihr, auch nach Jahren auf dem Präsentierteller im Kanzleramt nicht. Dass es gerade auf die (vermeintlich) einfachen Fragen keine wirklich befriedigende Antwort zu geben scheint, die man mit dem Weinglas in der Hand auf einer Party lässig zum Besten geben könnte – und alle Umstehenden nicken beeindruckt: Ah, so ist das, na klar. Dabei mangelt es nicht an Groß-Thesen. Allein der Spiegel hat die meisten schon einmal durch: »Kanzlerin ohne Volk«, »Die halbe Kanzlerin«, »Die Herrin auf Schloss Ungefähr«, »Angela Mutlos«. Wohl wahr, die Kollegen hatten es nicht leicht in den Jahren, wo alle sechs Monate eine neue These hermusste, ein neuer General-Schlüssel zum Enigma namens Angela.
Wer aber ständig nach einer Erklärung sucht, die noch origineller ist als die vorhergehende, der verliert den Blick für den geraden Weg ins Ziel. Der geht so: Der rote Faden von Angela Merkels Regieren ist – das Regieren. Was sie macht, wie, wann oder warum, das lässt sich in wenigen Sätzen zusammenfassen: Diese Kanzlerin kann Krise. Kreativ kann sie nicht. Das Operative beherrscht sie wie keine zweite. Beim Programmatischen ist sie zweite Wahl. Ihre politische Marke kristallisiert sich nicht an ihren politischen Vorstellungen, sondern an ihrem politischen Vorgehen. Deshalb nennen sie die einen präsidial und die anderen opportunistisch. Und deshalb ist sie so beliebt.
»Es ist nicht leicht, Angela Merkel zu charakterisieren«, schrieb einmal der Schweizer Thesen-Publizist Roger Köppel kleinlaut über die Kanzlerin. »Es fehlt das Archetypische. Man wüsste nicht, welche Rolle ihr in einem Shakespeare-Drama zukäme.« Wirklich? Ich meine: Angela Merkel ist eine Zauder-Künstlerin. Sie hat eine eigentlich negativ besetzte Charaktereigenschaft, das Zaudern, zur regierungsamtlichen Stilform gemacht wie keiner ihrer Vorgänger. Das hat im Alltag nicht selten einen Preis, aber den zahlt sie. Sie hat ihre persönliche Eigenart zu einer politischen Kunstfertigkeit entwickelt, die vielen Deutschen offenbar eingeht und behagt – den gar nicht kleinen Rest aber enttäuscht oder blutrot empört. Das sollte für eine Shakespeare-Rolle reichen.
Wie zum Beweis hat auch nicht Angela Merkel das Thema ihrer Kanzlerschaft gefunden. Das Thema hat sie gefunden: der Euro und seine Rettung; Europa und der Neubau; Deutschland und die neue Rolle, die es darin spielen will – oder muss. Eher Leitplanken als ferne Leuchttürme weisen ihr dabei den Weg. Und wenn Politik notwendigerweise eine Menge von »trial and error« hat, dann ist Angela Merkel die Allerletzte, die damit hadert. Versuch und Irrtum hat sie als Physikerin verinnerlicht, ebenso wie die simple Regel, dass das Labor hinterher nicht komplett in Trümmern liegen darf, wenn ein Versuch daneben geht. Das beschreibt exakt ihr Vorgehen in der Euro-Krise: »Jeder einzelne Schritt muss in seinen Folgen beherrschbar bleiben«, sagt sie. Und zwar gerade dann, wenn er der falsche war.
Von Herfried Münkler stammt ein Aufsatz, der Angela Merkel tief beeindruckt hat. Darin unterscheidet Münkler zwischen »Optimum« und »Maximum« und stellt die Frage, woran Politiker oder ihr Handeln sinnvollerweise zu messen seien: Am Maximum, also daran, ob ein gesetztes, objektiv wünschenswertes Ziel zu hundert Prozent erreicht wird? Oder am Optimum, also daran, wie viel vom Möglichen ein Politiker im Rahmen der vorgefundenen Gegebenheiten erreicht? Und es beschreibt Angela Merkel präzise, dass sie wohl diejenige deutsche Spitzenpolitikerin ist, deren Werte bei Optimum und Maximum am weitesten auseinanderklaffen. Sie ist die Kanzlerin des Optimums, Topnote. Sie ist nicht die Politikerin des Maximums, darin nur schwacher Durchschnitt.
Henry Kissinger sagte schon sehr früh über Angela Merkel, sie sei »der perfekte Ausdruck ihrer Zeit«. Was so viel heißt wie: In einer komplizierten Welt, die jeden Tag komplizierter wird, gibt es weder »Projekt« noch politische Vision, mit der die Kanzlerin zu entschlüsseln wäre. Nein, es ist das Agieren, seit fast acht Jahren das Regieren, das sie entschlüsselt; die Praxis, nicht das Programm. Deshalb stimmt: Sie könnte seit mehr als 20 Jahren, es hätte nur einiger kleiner Wendezeit-Zufälle bedurft, auch in der SPD sein. Dann sähe die SPD heute freilich ganz anders aus. So ganz anders wie die heutige CDU im Vergleich zur CDU von 1990.
Es geht also um die mächtigste deutsche Politikerin der Nachkriegszeit – die aber instinktiv alles vermeidet, was große Thesen nährt, weil sie große Thesen für eine verkopfte, tendenziell überflüssige Kunstform hält. Erst recht nach mehr als vier Jahren Regieren im Krisen-Modus hat sie eine wirklich radikale Abneigung gegen alle pauschal abgefassten, thesenartigen Erklärungen, mit denen Außenstehende das Handeln von Politikern traktieren. Zu viel davon ist Zufall, findet sie, zu viel kommt aus der Lage, nicht aus den Lehrbüchern. Wer Angela Merkel verstehen will, muss sie also beim Machen verfolgen, nicht beim Philosophieren. Und da ist viel bislang Unbeobachtetes zu beschreiben.
Es hat etwas massiv Frustrierendes, dass selbst polit-professionelle Nahe- und Drumherumsteher, wie es Hauptstadt-Journalisten nun einmal sind, beim Party-Geplänkel nicht uneingeschränkt herausragen wie die Leuchttürme – und die übrigen Gäste entsprechend ehrfürchtig zuhören. Denn es sind leider die einfachen Fragen zu Angela Merkel, zu denen die abschließenden Antworten fehlen. Es sind ausgerechnet die vermeintlich leichten Fragen, wie zum Beispiel: Wie ist sie eigentlich so, persönlich und privat? Was macht sie, wenn sie wütend ist? Was will sie wirklich, außer an der Macht bleiben? Sagt sie manchmal »Scheiße« oder schwitzt sie, wenn sie nervös ist? Hat sie nun einen inneren Überzeugungs-Kompass, oder hat sie keinen? Kriegt sie manchmal richtiggehend Angst oder knibbelt sie sogar an den Fingern, wenn keiner zuguckt? Und, ganz wichtig, hat sie nun ein »Problem mit Männern« – oder ist das einfach nur die Sorte Quatsch, den Männer gern erzählen, wenn sie gegenüber einer Frau nicht mehr weiterwissen?
Wo muss man nach den Antworten suchen? So spannend Angela Merkels Kindheit, Jugend, Studium und erste Berufstätigkeit in der untergegangenen DDR sind: Für die Antworten, die fehlen, spielen sie meiner Einschätzung nach nur eine beisteuernde Rolle. Diese Jahre sind, gemessen am Rest, nicht mehr als der Vorlauf. Das gilt besonders für ein so schnell lernendes »System« wie Angela Merkel. Was sie ins Kanzleramt brachte, hat sie nach der Wende gelernt, im westdeutsch geprägten Politik-Betrieb. Kanzlerin selbst hat sie vor allem im Kanzleramt gelernt, wo auch sonst? Guido Westerwelle brachte es im kleinen Kreis schon am Ende ihrer ersten Amtszeit so auf den Punkt: »Sie fühlt kein Leben vor der Kanzlerschaft mehr. Das kam bei Helmut Kohl erst nach 12 Jahren.«
Wer wissen will, wer uns da seit bald acht Jahren regiert – der muss nach den Antworten also in diesen Jahren suchen. Das soll mein Buch leisten. Es ist keine Nacherzählung dieser Zeit, wiewohl lange Strecken davon höchst spannend waren. Es ist stattdessen der Versuch, an relevanten Stellen genauer hinzuschauen, als in einer breit angelegten Biographie möglich. Gute Biographien, allen voran die von Evelyn Roll, gibt es einige, auf jeden Fall zu viele, um noch eine hinzuzufügen. Ebenso gibt es meinungsstarke, mitunter fulminante Abrechnungen wie die von Cora Stephan aus dem Jahr 2011 oder die von Getrud Höhler (2012). Und sogar ein Interview-Buch liegt vor: neun Stunden Gespräche, aufgeschrieben von Hugo Müller-Vogg, aus dem Jahr 2003. Aber noch einmal: Dieses Buch geht anders vor und fokussiert allein auf die bald acht Jahre Angela Merkels im Kanzleramt. Man ist schließlich nicht lange Zeit im Voraus schon Kanzlerin und fängt nach einer gewonnen Wahl dann an zu regieren. Sondern man fängt an zu regieren und wird irgendwo auf der Strecke Kanzlerin. Oder eben nicht.
Zum Schluss muss es natürlich auch darum gehen, wie lange Angela Merkel noch regieren will. So lange, wie der Wähler sie lässt? So lange, wie die CDU sie lässt? Das sei vorweggenommen: Nein, ich denke, soweit wird es nicht kommen, soweit lässt sie es nicht kommen. Wenn es das Wahlergebnis im September 2013 hergibt, wird die Kanzlerin weiterhin selbstverständlich Angela Merkel heißen. Aber in der ersten Hälfte der Legislaturperiode, spätestens im Jahr 2015, wird sie ihre Ämter an der Regierungs- und der Parteispitze abgeben an nur einen Nachfolger (eine Nachfolgerin) für beides. Das wird ihrer Kanzlerschaft den wichtigsten denkbaren Superlativ verschaffen, den sie aus eigener Kraft erreichen kann: seit 1949 der erste deutsche Kanzler zu sein, dessen Amtszeit nicht mit partei-interner Ablösung oder einer Wahlniederlage endet. Angela Merkel wäre die erste Kanzlerin, die aus freien Stücken aufhört – bevor sie das Vertrauen ihrer Partei oder der Wähler verloren hat. Und dieser Rekord, diese Alleinstellung reizt sie außerordentlich. Dafür gibt es in ihrer politischen Vergangenheit und ganz aktuell hinter den Berliner Kulissen eine stattliche Reihe von deutlichen Belegen sowie Hinweisen aus internen Zirkeln. Man muss sie nur sehen (und aufschreiben).
An der Stelle wird klar, dass es sich bei diesem Buch nicht um ein so genannt »autorisiertes« handelt. Das soll kein Selbstlob sein und auch keine Herabsetzung anderer Autoren, wohl aber ein wichtiger Begleithinweis für die Lektüre. Angela Merkel hat keinen Einfluss auf dieses Buch nehmen können. Weder, indem sie besondere (gleichwohl immer kontrollierte) Nähe und Zugang gewährt hätte, und schon gar nicht, indem sie die Zitate autorisiert hätte, die sich an vielen Stellen im Buch finden. Diese stammen allesamt aus öffentlichen oder nicht ganz so öffentlichen Runden und haben nicht der Auswahl der Kanzlerin unterlegen.
Für mich persönlich ist dieses Buch das vorläufige Fazit von gut zehn Jahren Parlaments-Journalismus als Korrespondent und Hauptstadtbüro-Leiter für Welt und BILD in Berlin, dem »Irrenhaus«, der »Narrentrommel«, wie manche sagen. Acht davon war Angela Merkel die Kanzlerin, also mein wichtigstes Objekt der Beobachtung und Bewertung. Dieses Buch nimmt an Fragen auf, was ich mich in dieser Zeit selbst gefragt habe und was ich gefragt worden bin; sowohl von interessierten Laien als auch von Politikern oder Journalisten-Kollegen. Es sind, wie gesagt, die einfachen Fragen, die vermeintlich einfachen Fragen. Also jene, bei denen die Antwort umso schwerer fällt, je länger man über sie nachdenkt.
Ein halbes Jahr, bevor er dann doch Bundespräsident wurde, hat Joachim Gauck über die Kanzlerin gesagt: »Ich respektiere sie, aber ich kann sie nicht richtig erkennen.« Wohl wahr: Sich Angela Merkel zu nähern, um sie zu erkennen, ist nicht einfach. Macht aber Spaß.
Auf geht’s.
Wie ist Angela Merkel so aus der Nähe?
Wer wissen will, wie Angela Merkel »so aus der Nähe ist«, der muss zuschauen, wie sie lacht. Dazu kann man zum Beispiel mit ihr auf Reisen gehen. Das tun Journalisten oft, die Leiter der Berliner Hauptkorrespondentenbüros der großen Zeitungen und TV-Sender sogar regelmäßig. Die Reisetruppe variiert, aber sie hat einen festen Kern. Das entspannt Angela Merkel, weil sie ihre Umgebung gern berechenbar hat. Eine entspannte Kanzlerin wiederum entspannt ihre engsten Mitarbeiter, die deshalb mehr Nähe zulassen. Ganz praktisch ist Angela Merkel auf Reisen weniger abgeschirmt als im Berliner Alltag. Man kann ihr beim Frühstück im Hotel begegnen, wenn sie am Buffet entlangschlendert und sich etwas aussucht, oft ein Müsli mit Orangensaft. Beim Streunen durch das Gewühl abendlicher Empfänge bleibt man plötzlich an einer Traube mit Merkel in der Mitte hängen und hört einfach zu oder beobachtet. Manchmal steht man auch urplötzlich für ein paar Minuten direkt neben ihr, im Hotel-Aufzug oder wenn sie durch eine Ausstellung oder eine Werkhalle geführt wird und man im engsten Tross einfach mitschwimmt, durch die sie umgebende Reuse der Sicherheitsleute hindurch. Und wenn sich zwei Dutzend Journalisten im Sitzen, Stehen, Hocken in das »Konferenzabteil« des Regierungsfliegers quetschen (der Rekord steht bei knapp unter 30), dann kommt man gelegentlich sogar Hosennaht an Hosennaht mit der Kanzlerin zu sitzen.
Zugegeben, deshalb durchschaut man noch lange nicht, warum sie über den strauchelnden Bundespräsidenten Christian Wulff politisch nie den Stab gebrochen, aber einen glücklosen Umweltminister nach einer Wahlniederlage brutal gefeuert hat, oder warum sie auch in einer schwarz-gelben Regierungskoalition mit Bundesrats-Mehrheit keine richtige Steuerreform machen wollte. Man kann in dem Konferenz-Abteil noch nicht einmal in ihre Unterlagen spinxen, die sie meistens in einer blauen Mappe oder als in Plastik eingeschweißte DINA5-Sprechzettel auf den Oberschenkeln liegen hat. Aber irgendwie darf man sich trotzdem einbilden, Angela Merkel auf solchen Reisen besser in den Fokus zu kriegen, besser ein Gefühl für ihre Person und ihr politisches Wesen zu entwickeln – also für Angela Merkel als Mensch und als Maschine.
Unter dem Strich kann man sagen: Die Maschine Merkel, das ist die mit den runterhängenden Mundwinkeln. Der Mensch Angela Merkel lacht gern. Müsste man es in einem einzigen Wort zusammenfassen, es hieße: angenehm, sie ist wirklich angenehm. Man fährt gern mit und nicht nur, weil man ja muss. Es ist wie Klassenfahrt, wobei offenbleiben kann, ob Angela Merkel nun die Klassenlehrerin ist oder die Klassensprecherin.
Nett wäre dagegen nicht das richtige Wort für Angela Merkel, weil es wie ein anderes Wort für naiv klingt, und das ist sie bestimmt nicht. Auch lustig oder amüsant trifft nicht den Punkt. Man kann mit Angela Merkel zwar gut lachen, und sie lacht selber gern. Gelegentlich auch über sich selbst, weil sie im achten Amtsjahr unverändert zum Blick von außen auf sich selbst und den vielschichtigen Kokon des Amtes fähig ist. Auf ihrer allerersten Dienstreise nach Paris und Brüssel im Herbst 2005 wurde sie gefragt, was sie am meisten an der neuen Situation beeindrucke. Antwort, nach kurzem Zögern: »Die Infrastruktur«. Als Beispiel nannte sie aber nicht die dicke Dienstlimousine, das Krypto-Handy oder ihre BKA-Entourage, sondern ihren ersten Anruf von außerhalb im eigenen Büro. Weil sie ihre Büro-Durchwahl noch nicht im Kopf hatte, rief sie damals also in der Zentrale des Bundeskanzleramtes an – und musste einer verdutzten Telefonistin erklären, dass sie »wirklich Angela Merkel sei, ja, ja, die neue Chefin, ja richtig, seit vorgestern …« Großes Gelächter im Flieger, gute Show, feines Maß an Selbstironie.
Überhaupt: Das Lachen der Kanzlerin ist ansteckend. Sie kann sich wegschütten vor freundlich-schadenfrohem Kichern. Zum Beispiel, wenn sie erzählt, wie vor Jahren der litauische Ministerpräsident mit dem Rad unterwegs ist und an der Grenze zur Ukraine nach der Baustelle des neuen ukrainischen Atomkraftwerks sucht, durchs Unterholz stapft, das Fernglas zückt, aber die Großbaustelle partout nicht finden kann. Oder wenn sie ohne großen Zusammenhang erzählt, was es mit dem krummen U-Boot für Griechenland auf sich hat. Das haben die Deutschen nämlich vor Jahren geliefert, aber die Griechen bezahlen nicht, weil es eben »krumm« sei, erzählt die Kanzlerin und muss das erste Mal kichern. Unzählige U-Boot-Vermesser seien inzwischen auf dem Gefährt herumgekrabbelt, ohne Ergebnis. Aber die Griechen beharrten darauf: Es sei krumm, und die ganze Welt außer den Deutschen wüsste, dass … Den letzten Satz kriegt sie nicht mehr zu Ende, weil sich ihr Kichern in einen Lachkrampf gesteigert hat. »Krumm …, ein krummes U-Boot!«
Da lief ganz offensichtlich ein sehr skurriler Film in ihrem Kopf ab. Dagegen fanden die Zuhörer um Merkel herum die Geschichten selbst eigentlich gar nicht soooo komisch. Ihnen fehlte der Film im Kopf. Angela Merkel aber konnte sich kaum halten – und deshalb mussten alle, angesteckt, mitlachen. Trotzdem: »Lustig« nennt man wohl eher Leute, die es regelmäßig auf einen Lacher anlegen. Aber die Kanzlerin kann herrlich überzeugend so tun, als würde sie von einem Lacher im Publikum völlig überrascht, weil sie gar nicht gewusst haben will, dass sie gerade etwas zum Lachen oder Kichern von sich gegeben hat.
Wenn sie dann, etwas verzögert, auch mitmacht, also ihrem eigenen Witz hinterherlacht, dann nennen das viele »mädchenhaft«. Thomas Gottschalk erzählte nach der Verleihung der »medal of freedom« an Angela Merkel (2011), dass er Merkel nun schon seit längerem immer wieder einmal treffe und von einer stets »fast mädchenhaften Reaktion, wenn sie sich über etwas freut. Das steht ihr gut«. Tatsächlich ist »mädchenhaftes Lachen« seit langem ein Standard in jeder Merkel-aus-der-Nähe-Beschreibung. Aber mädchenhaft ist ein seltsam verquastes Wort für jemanden, der Ende 50 ist und seit jeher einfach frei lachen kann, wenn er etwas zum Lachen findet, womöglich auch sich selbst. Das Einzige, was Angela Merkel von vielen anderen notgedrungen unterscheidet, wenn sie lacht, hängt mit ihrem Amt zusammen. Nicht selten merkt man, dass sie noch ein, zwei Momente länger darüber nachdenkt als andere, ob sie jetzt auch lachen darf. Als Kanzlerin. Meistens sagt sie sich: ja, darf ich.
Zum Beispiel darüber, wie es Anfang Oktober 2008 an jenem Sonntagnachmittag war, als sie mit ihrem damaligen SPD-Finanzminister Peer Steinbrück im Kanzleramt vor eilig herantelefonierten TV-Kameras die Garantie-Erklärung für alle deutsche Sparguthaben abgibt, je nach Definition um die 1600 Milliarden Euro. Kurz zuvor hat die Bundesbank das Kanzleramt wissen lassen, dass die Nachfrage nach 500 Euro-Scheinen an den Bankschaltern spürbar zugenommen habe vor dem Wochenende, ein Hinweis auf beginnende Panik. Ein echter »defining moment« der großen Koalition ist das also und womöglich die zwei Minuten, die Deutschland einen katastrophalen Banken-run ersparten. Eine ernste Sache, aber Merkel fasst ein paar Jahre später in einem kleinen Kreis das Ganze so zusammen: »Wir haben mit dem unschuldigsten Gesicht das größte Ding gemacht.« Stimmt ja auch: Weil der Bund niemals einfach so hätte zahlen können. Weil es keinen Parlamentsbeschluss gab. Weil es kein Kleingedrucktes gab mit Abgrenzungen im Detail. Weil, weil, weil. Das erzählt sie trocken und verschmitzt, einmal in Fahrt gekommen berlinert sie dabei »so’ne, nüscht, ditte« – schlicht schelmisch. Und schelmisch steht zu »mädchenhaft« wie Humor zu Witzigkeit.
»Jaaaaa, wir fliegen heute nach …« So fangen die Unterhaltungen, »briefings«, im Regierungsflieger fast immer an. »Jaaa, heute schauen wir uns mal den Satz des Pythagoras an …« So klingt das in der überfüllten Konferenzkabine, ein bisschen wie eine Lehrerin im (fliegenden) Klassenzimmer. Dann spult sie ihr Wissen über das Zielland ab, über den amtierenden Regierungschef, die Rolle, die Deutschland für dieses Land spielt und umgekehrt, und was sie anstreben will bei diesem Besuch. Als Gedankenstütze machen sich die Journalisten Notizen, obwohl sie kein Wort davon wörtlich schreiben dürfen, weil es die ungeschriebenen Regeln der Hauptstadtpresse verbieten. Und dabei tritt die zweite Eigenschaft zu Tage, die Angela Merkels Persönlichkeit prägt: Neugier. Diese Frau hat immer mehr Fragen als Zeit, sie zu stellen. Egal bei wem, egal wo. Vielleicht ist das Routine einer chronisch zeitknappen Politikerin, aber dann müsste es ja auch für Journalisten Routine sein, die auf ihre Art ebenso chronisch zeitknapp sind. Die allermeisten Journalisten jedoch hören bei einem gegebenen Thema irgendwann auf zu fragen. Nicht weil sie denkfaul oder desinteressiert sind oder meinen, schon alles zu wissen. Sondern weil sie irgendwann das Gefühl haben, nun ist es genug, um einen anständigen Artikel in der vorgegebenen Zeit zu schreiben. Journalisten kennen grundsätzlich eine Grenze, jenseits derer vermutlich nur noch »nutzloses« Wissen, überflüssige Details kommen. Angela Merkel kennt die Grenze sicherlich auch, weil sie mit ihrer Zeit und dem Fassungsvermögen ihrer »Festplatte« ebenfalls strikt haushalten muss. Aber sie fragt trotzdem. Oder würde es, wenn nicht der nächste Termin sie daran hinderte. Am Beginn ihrer bis heute längsten Auslandsreise, sechs Tage durch Südamerika Mitte 2008, sagt sie es so: »Das Entscheidende ist, wie viele Abendessen habe ich und wie oft kann ich etwas fragen.«
Und noch eine dritte Eigenschaft sagt etwas Wichtiges über Angela Merkel, die seit über zwanzig Jahren politisch in der ersten oder allerersten Reihe steht und dort akribisch beobachtet wird: Sie ist immer für eine Überraschung gut. Das meint jetzt nicht politische Volten, Meinungswechsel, Strategiebrüche, dazu an anderer Stelle mehr. Es meint, dass sie plötzlich auf ein Thema kommen kann und dabei Gedanken preisgibt, die man nicht kannte oder von denen man partout nicht gemeint hätte, dass sie ihr gerade durch den Kopf gehen. Ein Beispiel, zugetragen hat es sich auf dem Rückflug von einer Malta-/Zypern-Reise 2011, auf die ganz viele Journalisten mitwollten, um zu hören, was Merkel am Anfang eines »Super-Wahljahres« so denkt und wie das mit dem damals schon heftig rudernden Karl-Theodor zu Guttenberg weitergehen würde. Auf dem Rückflug also kommt kurz auch zur Sprache, dass sich die damalige Linkspartei-Chefin Gesine Lötsch in einem Aufsatz dazu bekannt hat, ihre Partei suche weiterhin nach »Wegen zum Kommunismus«. Und dann legt Merkel los, man staunt: Sie liefert einen ebenso schlüssigen wie weit ausholenden Exkurs über Marx und Engels, über sozialistische Dialektik, den kleinen Kommunismus-Katechismus der FDJ und der SED. Wohl keiner der Mitreisenden hatte davon je so ausführlich, so lebendig gehört. Auch Merkels Motivforschung: Es gehe für Frau Lötsch nicht um Stalin-Verehrung, nein bewahre. Der Grund sei, dass sie in der DDR in die Schule gegangen ist. Folgte ein weiterer Exkurs über DDR-Schulausbildung und wie der Kommunismus und seine Dialektik dort gelehrt wurden, in drei verschiedenen Fächern oder Gruppen: »Die mit den schlechtesten Mathe-Noten nahmen wissenschaftlichen Kommunismus.« Heißt für Merkel: die Deppen, die man allein wegen ihrer schlechten Mathe-Noten getrost verachten durfte, sogar in der DDR. Bei Angela Merkel sind nur wenige Witze ohne doppelten Boden.
Oder auf einer der vielen Reisen nach Washington, Ende Juni 2009: Da zog sie ohne rechte Vorwarnung, aber mit dem konkreten Hintergrund der Debatte um Hartz IV und Guido Westerwelles Satz von der »spätrömischen Dekadenz« einen Aufsatz von Ralf Dahrendorf aus der schwarzen Handtasche. Über die Ethik des Verzichts, über den Wandel vom Spar- zum Pumpkapitalismus, einen Text, über den sie offenkundig lange nachgedacht und mit Vertrauten geredet hat. Merkel lieferte ein bündiges Zehn-Minuten-Referat über den Dahrendorf-Text, folgte dessen Gedanken in mehrere tiefe Verästelungen. Und alle, man muss das sagen, alle mitreisenden Journalisten waren beeindruckt, besonders der Kollege der ZEIT, der schon von Amts wegen alle Dahrendorf-Aufsätze kennen muss.
Angela Merkel lässt sich aber auch selbst überraschen. Sie kann herrlich baff sein – und dann auch so reden. Im April 2010 gerät die Kanzler-Maschine in die Turbulenzen des isländischen Vulkans, dessen Ausbruch den internationalen Flugverkehr kollabieren lässt und zu dem wirklich außergewöhnlichen Umstand führt, dass eine Bundeskanzlerin ihren Regierungs-Airbus besteigt, ohne zu wissen, wo er landen wird. Ein Land nach dem anderen in Europa schließt gerade seinen Luftraum wegen der Aschewolke. Und Merkel sagt im Flieger wie ein staunendes Kind: »Das hat die Welt noch nicht gesehen.« Dann allerdings legt sie sich früh schlafen. Auch typisch Merkel.
Auf dieser Reise war sie sogar richtig fürsorglich, fast wie die oben erwähnte Klassenlehrerin. Der Irrflug der Kanzlermaschine landete nämlich zunächst in Lissabon, dann ging es tags drauf weiter nach Rom, weiter auf der Suche nach einem aschefreien Luftweg bis Berlin. Als das hoffnungslos bleibt, geht es auf der Straße bis ins norditalienische Bozen (auf der Strecke platzt beim Journalisten-Bus auch noch ein Reifen). Schon in Lissabon hätte die Kanzlerin allein weiterreisen können, da wäre sie vermutlich schneller gewesen, und alle Zurückbleibenden hätten es wohl verstehen müssen. Angela Merkel sagte aber: »Wir machen keine dramatischen Sachen, und wir bleiben alle zusammen.« Das hieß konkret: Niemand musste sich um Ausweichflüge bemühen, um ein Hotelbett oder sonst etwas. Man blieb im Tross, und alles war unendlich viel leichter. Deshalb muss man als Journalist Merkels Integrations-Politik nicht gut finden, manches Gezaudere bei der Griechenland-Hilfe oder den schwarz-gelben Dauerknatsch bis ins Wahljahr 2013. Aber angenehm und fast fürsorglich war es doch, und diese Charakterzüge erkennt man an den Menschen ja meistens dann, wenn sie etwas tun, was sie nicht unbedingt tun müssten. Zum Schluss, als man sich wirklich trennte und die Kanzlerin in Süddeutschland einen Helikopter bestieg, sagte sie zum Abschied: »Tschüs. War schön. Muss ich aber nicht gleich wieder haben.« Merkels Spitzname in CDU/CSU war früher »Oberschwester«. Heute heißt sie bei den meisten »Mutti«.
Das alles erzählt etwas, wie Angela Merkel so aus der Nähe ist – wenn man sie als Journalist immer wieder auf Auslandsreisen begleitet. Wie sie mit ihren engsten Mitarbeitern menschlich umgeht, erfährt man, wenn überhaupt, dagegen nur aus dritter Hand: Weil Merkel und die besagten engsten Mitarbeiter darüber so gut wie nicht reden. Nicht umsonst ist die Eintrittskarte in diesen Kreis größte Verschwiegenheit. Als sicher kann allerdings gelten, dass sie anders als andere Politiker nicht mit harten Gegenständen wirft. Selbst wenn sie sich so richtig ärgert.
Lange Rede, kurzer Sinn: Angela Merkel, so wie ich sie kenne, ist eine sehr umgängliche Person, sympathisch und normal. Gleichwohl ist ein sympathischer Mensch nicht automatisch zugleich ein politischer Sympathieträger. Ausweichlich aller Umfragen ist Angela Merkel aber gerade auch das. Es dürfte ihr größter politischer Trumpf sein – und sie weiß es genau.
Was denkt sie über die Deutschen?
Was Angela Merkel über die Deutschen denkt, ist ein gut gehütetes Geheimnis. Das liegt nicht zuletzt an einer der größten Widersinnigkeiten der repräsentativen Demokratie überhaupt: Politiker dürfen nicht mit den Wählern öffentlich hadern, auch mit deren offenkundigsten Defiziten und Fehlleistungen nicht. Sie dürfen noch nicht einmal tiefbraun verbohrten NPD