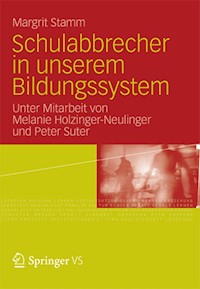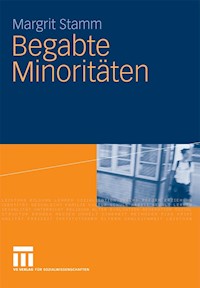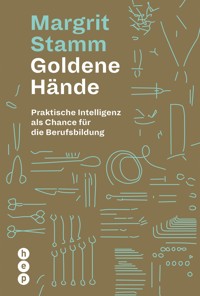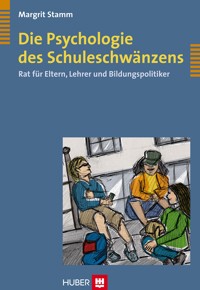19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Erwarten wir zu viel von unseren Kindern? - Geht es immer nur um Leistung?
Besonders fleißig, gute Noten und beliebt – ein solches Kind hat scheinbar beste Aussichten. Unsere Hochleistungsgesellschaft setzt auf leistungsstarken Nachwuchs, auf hohe Bildungsabschlüsse und auf Väter und Mütter, die nach Kräften fördern und so den Erfolg ihrer Kinder möglich machen.
Das erzeugt Stress, bei den Eltern, vor allem aber bei den Kindern. Mit oft traurigen Folgen:
»Überleister« sind Kinder, die permanent mehr leisten, als man von ihnen erwarten dürfte.
Sie sind angepasst, unauffällig und erfolgreich, doch ihre Erfolge erzielen sie nicht in erster Linie wegen ihres IQs oder ihrer Talente, sondern durch Fleiß, Elternunterstützung und Druck. Der muss gar nicht explizit von den Eltern ausgeübt werden – die Kinder spüren die Erwartungen an sie. So setzen sich schon junge Schulkinder selbst unter Druck.
Die Überleister-Kultur ist ein unterschätztes Problem und schuld an mangelnder Lernfreude sowie der Zunahme emotionaler Probleme bei Kindern. Für ihr Buch hat Margrit Stamm intensiv zu der bisher noch zu wenig beachteten Überleistung bei Kindern geforscht.
Ihr Ziel ist es, das gesellschaftliche Bewusstsein für dieses Problem zu schärfen und Eltern sowie Erziehungsexperten neue Wege aufzuzeigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 193
Ähnliche
Über das Buch:
Besonders fleißig, gute Noten und beliebt – ein solches Kind hat scheinbar beste Aussichten. Unsere Hochleistungsgesellschaft setzt auf leistungsstarken Nachwuchs, auf hohe Bildungsabschlüsse und Eltern, die ihre Kinder nach Kräften fördern.
Das erzeugt Stress, bei den Eltern, vor allem aber bei den Kindern. Mit oft traurigen Folgen: »Überleister« sind Kinder, die permanent mehr leisten, als man von ihnen erwarten dürfte. Sie sind angepasst, unauffällig und erfolgreich, doch ihre Erfolge erzielen sie nicht in erster Linie wegen ihrer Talente, sondern durch Fleiß, Elternunterstützung und Druck. Den machen sich die Kinder immer häufiger auch selbst, denn sie spüren die Erwartungen, die an sie gestellt werden.
Das Überleister-Phänomen ist ein unterschätztes Problem und schuld an mangelnder Lernfreude sowie der Zunahme emotionaler Probleme bei Kindern. Margrit Stamm hat intensiv zu der bisher noch zu wenig beachteten Überleistung bei Kindern geforscht. Ihr Ziel ist es, das gesellschaftliche Bewusstsein für dieses Problem zu schärfen und Eltern sowie Erziehungsexperten neue Wege aufzuzeigen.
Margrit Stamm
ANGEPASST
STREBSAM
UNGLÜCKLICH
Die Folgen der Hochleistungsgesellschaft für unsere Kinder
Kösel
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © 2022 Kösel-Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Margarethe Brunner
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-28750-4V002
www.koesel.de
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Das Grundproblem: Die Fixierung auf Hochleistung •Wie versetzt man Kinder in einen gebildeten Zustand? •Überleistung als gesellschaftliches Mandat: die These
ÜBERLEISTUNG:DAS VERSCHWIEGENE THEMA
Sind hochleistende Kinder nicht ein Segen für Schule und Familie? •Nicht normal, sondern speziell soll das Kind sein •Eltern und ihre Abhängigkeit vom Kind •Faktoren von Überleistung
IGESELLSCHAFT UND BILDUNGSSYSTEM: KATALYSATOREN VON ÜBERLEISTUNG
1 Das Bildungssystem provoziert den Elternehrgeiz
Mit dem Kindergarten beginnt der Ernst des Lebens •Das Gras wächst nicht schneller, wenn man an ihm zieht •Die testgetriebene Schulkultur und ihre Auswirkungen •Selbstbeurteilung und selbstorganisiertes Lernen als Achillesfersen •Eltern als Hilfslehrkräfte? •Hochleistungsgesellschaft und Hochbegabung
2 Optimierungsstrategien in der Hochleistungsgesellschaft
Tücken der Talentförderung •Kinder nur spielen lassen? Das geht nicht! •Die Hypothek von Akademikerkindern •Hochleistung zwischen gesundem und ungesundem Perfektionismus
3 Überforderte Kinder im Gymnasium?
Der Hype ums Gymnasium und die »Machiavelli-Strategie« •Überleister am Gymnasium? Ein statistischer Nachweis •Die Verwechslung von Hochbegabung und Überleistung •Wer gehört ins Gymnasium und wer nicht?
4 Optimierte Kinder im Leistungssport
Das frühe Treibhaus des Leistungssports •»Trainings-Eltern« und die Karriere des Kindes •Die Deselektion als Black Box •Wettbewerb trotz kindorientierter Erziehung: Eine Ironie des Schicksals
IITYPEN VON ÜBERLEISTERN UND IHRE MERKMALE
5 Das Überleister-Kind gibt es nicht
Überleistung und der »Supergirl-Komplex« •Erfolgsdruck im Fischteich •Überleister sind keine einheitliche Gruppe •Die Bandbreite von Überleistung •Selbstzweifel als gemeinsamer Nenner
6 Self-Handicapping und Hochstapler
Self-Handicapping und die Banalisierung der eigenen Leistung •Self-Handicapping als Selbstsabotage •Ich scheine mehr, als ich bin: das Hochstapler-Selbstkonzept •Sind Hochstapler vor allem weiblich?
7 Wenig Selbstvertrauen, viele Selbstzweifel
Kindern wird das Selbstvertrauen nicht verliehen, sie müssen es erwerben •»Ich glaube, es ist etwas falsch an mir«: Verborgene Denkmuster •Überleistung im Teufelskreis
IIIELTERN ALS MAXIMIERER
8 Bildungsangst und ihre Folgen
Den Schulerfolg garantieren müssen: Eltern unter Druck•Die Sorge um den Statuserhalt •Elternengagement und Kinder im Hamsterrad
9 Die Psychologie der Elternkontrolle
Das gefährdete Kind •Kontrolle und das kindliche Selbstbewusstsein
Wenn aus Sorge Kontrolle wird •Ein Zehn-Euro-Schein für ein gutes Zeugnis? •Nachhilfe und Feriencamps als »Lerndoping«
10 Gute Noten für die Zuneigung der Eltern
Ambitionen und kindliches Wohlbefinden •Der »Mutter-Effekt«•Liebesentzug als schärfste Form von Strafe•Wie kann ich meinen Eltern weniger Sorgen bereiten? •Gute Leistungen als Indikator für Anerkennung •Elternsorgen können sich im Kind spiegeln
IVDAS AUTHENTISCHE KIND
11 Grundlagen für eine authentische Entwicklung
Das Recht des Kindes auf den heutigen Tag •Die Wertschätzung der Einmaligkeit des Kindes •Die Zone der nächsten Entwicklung als fördernde Aktivierung •Weder Überforderung noch vorschnelle Hilfe •Vom überleistenden zum authentischen Kind: Leitideen nach Korczak und Wygotski
12 Das Recht des Kindes auf die Entwicklung seines Potenzials
Perspektiven für Bildungspolitik und Schule •Weniger Rankings und vergleichende Tests durchführen •Sich stärker an den Lernprozessen orientieren •Hausaufgaben in die Verantwortung der Kinder legen •Lebenskompetenzen stärker gewichten
13 Das Recht des Kindes, scheitern zu dürfen
Perspektiven für die Familie •Das Überengagement zügeln •Mit Stress umgehen •Akzeptieren, dass Noten nicht das Gleiche sind wie Fähigkeiten •Eine Antihaltung gegenüber Optimierung entwickeln •Autonomie fördern: Zeit geben und kindliche Eigenheiten akzeptieren
14 Das Recht auf die Entwicklung von Lebenskompetenzen
Perspektiven für das Kind •Selbstvertrauen: Ich glaube an mein Können – statt: Erwachsene halten mich dazu an, immer besser zu werden •Hartnäckigkeit: Ich bleibe dran – statt: Ich bin mutlos •Begeisterung: Das interessiert mich – statt: Meine Lehrkräfte und Eltern wissen immer, was das Beste für mich ist•Selbstwirksamkeit: Ich kann Herausforderungen bewältigen – statt: Ich zweifle ständig an mir •Frustrationstoleranz: Ich kann mit Niederlagen umgehen – statt: Misserfolge entmutigen mich
Und zum Schluss:
Überleistung kann überwunden werden
Dank
Anmerkungen
Literatur
Abbildungen
Vorwort
Besonders fleißig und gute Noten – ein solches Kind ist der Traum mancher Lehrkräfte und Eltern, weil es beste Aussichten auf eine erfolgreiche Bildungslaufbahn hat. Wenige dieser Kinder mögen hochbegabt sein, doch manche sind Hochleister – oder präziser: Überleister. Überleister sind junge Menschen, die mehr leisten, als man von ihnen aufgrund ihrer Anlagen erwarten würde. Ihre Erfolge basieren auf großer Anstrengung, enormem Ehrgeiz – und oft auch auf hohem Leistungsdruck. Doch Überleistung ist ein Thema, dem man ungern in die Augen schaut.
Unsere Hochleistungsgesellschaft ist ein guter Nährboden für dieses Phänomen, denn die Verschwendung von Humankapital gilt als größtes Hindernis einer florierenden Gesellschaft. Überleistende Kinder gelten folglich als Musterbeispiel für junge Menschen, schöpfen sie ihre Potenziale doch scheinbar voll und ganz aus. Um das Humankapital zu fördern, setzt die Bildungspolitik auf gute Schulen, professionelle Lehrkräfte, einen leistungsstarken Nachwuchs mit förderbereiten Elternhäusern und auf hohe Bildungsabschlüsse. Das heizt die Überleisterkultur mächtig an.
Solche bildungspolitischen Trends haben Auswirkungen auf das Selbstverständnis von Schulen, Lehrkräften, Familien sowie Fachexpertinnen und -experten. Zum einen erfahren sie, wie im Zuge von Akademisierung und Bildungsexpansion viele Abschlüsse zunehmend entwertet werden. Hauptschul- und Realschulzeugnisse zählen deutlich weniger als noch vor zehn Jahren. Studienabschlüsse werden wichtiger, sind aber weniger wert. Ein Bachelor ist Voraussetzung für viele Berufe, aber längst keine Karrieregarantie mehr. Angesichts dieser gesellschaftlichen Entwicklung ist es kaum erstaunlich, dass manche Eltern enorm in die Bildung ihrer Kinder investieren und ihr Engagement bisweilen überdimensioniert wirkt. Doch dahinter steckt nicht einfach nur Ehrgeiz, sondern genauso ein Bildungssystem, das eine Menge vom Elternhaus erwartet – etwa die Kontrolle von Hausaufgaben, die Unterstützung bei der Erstellung von Referaten und Power-Point-Präsentationen oder die Vorbereitung auf Prüfungen.
Diese Entwicklungen sind die Hauptursachen für die Überbetonung von Leistungsexzellenz. Eltern stehen unter einem großen Druck, den sie an ihre Kinder weitergeben und der auch dazu führen kann, dass sie diese zu überdimensionierten Leistungen antreiben. Dieses Phänomen betrifft bei Weitem nicht nur den Weg ins Gymnasium oder den Verbleib in ihm, sondern ebenso Langsamlerner mit deutlichen Leistungsschwächen, deren Eltern mit allen Mitteln auf einen angemessenen Schulabschluss pochen, oder Kinder mit Lernschwierigkeiten, welche nonstop zu guten Leistungen angehalten werden.
Um nicht falsch verstanden zu werden: Leistungsorientierung und hohe Erwartungen von Schule und Elternhaus sind für eine erfolgreiche schulische Laufbahn der Kinder wichtig – dies ist eine wissenschaftlich vielfach bestätigte Tatsache. Problematisch werden hohe Erwartungen erst, wenn sie zum Hauptmerkmal der Schulkultur oder zu einer familiären Lebenshaltung werden. Unter solchen Bedingungen ist es normal, wenn sich Kinder selbst eine Überleister-Brille aufsetzen. Sie sind überzeugt, dass es keine Rolle spielt, wie viele Stunden sie für Hausaufgaben, Prüfungsvorbereitung, zusätzliche Lernunterstützung, Therapie und alle aufwendigen Freizeitaktivitäten einsetzen. Es kann immer noch mehr sein, deshalb nimmt ihr gefühlter Druck ständig zu. Höchste Zeit, einen kritischen Blick auf das zu lenken, was unsere optimierende Konkurrenzgesellschaft mit den Kindern macht.
Solche Gedanken sind Thema dieses Buches. Es beschäftigt sich mit dem gesellschaftlichen Trend, die Ausschöpfung des Leistungspotenzials zu priorisieren, kaum aber auf die tatsächlichen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen Rücksicht zu nehmen. Darum bleibt unberücksichtigt, was zu hohe Erwartungen für ihre Kraft und Motivation – und für ihre Seelen – bedeuten. Überleistung ist ein bisher unberücksichtigtes, nahezu unerforschtes und ebenso verschwiegenes Thema. Wohl gibt es Fachliteratur zu den problematischen Aufwachsbedingungen der Kinder und Jugendlichen, zum Leistungsdruck in der Schule und zu seinen Auswirkungen. Trotzdem bleibt ihr schwieriges Leben im Dunkeln. Eher richtet man einen isolierten Blick auf psychische und physische Störungen und blendet aus, was die Kluft zwischen Leistung, Erwartung und Vermögen anrichtet.
Entstanden ist ein Buch über die neue Kultur der Überleistung als Preis unserer Optimierungsgesellschaft. Doch es ist kein Aufruf zum Mittelmaß, sondern eine Aufforderung, endlich eine Debatte über die Auspressung des Leistungspotenzials unserer Kinder zu führen.
Die Motivation, mich verstärkt mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, hat viel damit zu tun, dass ich selbst Mutter bin und die Zwänge zwischen schulischen Anforderungen und kindlichem Vermögen gut kenne, zwischen dem schwierigen Temperament des Kindes und den Erwartungen respektive Sorgen von Eltern oder zwischen den Vorstellungen der Schule, was Elternengagement sein soll und den zeitlich limitierten Möglichkeiten berufstätiger Mütter und Väter. Deshalb spiele ich weder die Bedeutung von Schulerfolg und guten Noten hinunter noch stelle ich leistungsorientierte Lehrkräfte oder fordernde Eltern und ihre Erwartungshaltungen an den Pranger. Vielmehr ist es für mich zu einer empirisch legitimierten Gewissheit geworden, dass dieses herausfordernde Phänomen weder den Eltern noch der Schule und dem Bildungssystem allein in die Schuhe geschoben werden kann. Die Forderung nach Hochleistung ist zu einem gesellschaftlichen Mandat geworden, das kritisch hinterfragt werden muss.
In erster Linie geht es mir darum, Leserinnen und Leser zu motivieren, sich mit der Thematik und ihren vielen Facetten auseinanderzusetzen. Was brauchen Kinder, damit sie auf einem herausfordernden, aber nicht überfordernden Niveau zeigen können, wozu sie in der Lage sind und was ihnen zu viel ist? Meine Antwort ist: Sie sollen authentischere Kinder werden dürfen und ihre eigene und nicht fremdbestimmte Persönlichkeit entwickeln können. Deshalb widme ich dieses Buch den jungen Menschen, welche wir in Einzelinterviews anlässlich meiner Seminare zu »Kinder und Leistungsdruck« befragt haben sowie ihren Eltern, aber auch allen meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Pädiatrie, die mir Beispiele aus ihrer Praxis erzählt haben. Genauso widme ich es den Schulen, Lehrpersonen, Fachleuten, bildungspolitisch Tätigen und Eltern, die Kindern helfen wollen, authentischer aufwachsen zu dürfen. Die Botschaft, welche wir ihnen vermitteln sollten, ist die: So, wie sie sind, ist gut genug. Oder, mit Johann Heinrich Pestalozzi gesprochen: Ihr Herz darf leben und wirken, doch Kinder müssen nicht immer glänzen.
Aarau, im Frühling 2022
Margrit Stamm
Einleitung
Überleistung? Dieser Begriff ist im deutschen Sprachraum nicht geläufig. Ganz anders in den USA, dort gehört Overachievement zum Alltagsvokabular und gilt als etablierter Fachbegriff, eine deutsche Übersetzung gibt es nicht. Dass Überleistung dort so populär ist, dürfte in den Auswahlsystemen der renommierten Colleges liegen, die neben reichen Eltern hervorragende Leistungen voraussetzen, um überhaupt aufgenommen zu werden. Overachievement gehört deshalb für viele Familien zur strategischen Tagesordnung. Es gibt nur ein Ziel: Bestnoten – unbesehen davon, welche Anstrengungen erforderlich und welche psychischen Beeinträchtigungen damit verbunden sind.
Hierzulande ist die Situation nicht derart krass, doch die Tendenz ist unübersehbar. Manche Kinder sollen unentwegt hochleistungsbereit sein und Ergebnisse liefern, die jedoch nicht selten über ihrem Motivations- oder Fähigkeitsniveau liegen. Manchmal gilt dies auch für ihre anspruchsvollen Freizeitaktivitäten. Solche Kinder wirken wie Hochleister, die fleißig lernen und sich Anforderungen anpassen können. Doch der Eindruck täuscht. Kinder, die mehr leisten müssen als sie eigentlich können, dürfen nicht mehr »normal« sein, weil Scheitern gewissermaßen verboten ist. Deshalb werden schlechte Noten sofort mit zusätzlichem Engagement ausgebügelt oder es wird nach einer Lernstörung gesucht, um nicht zufriedenstellende Leistungen legitimieren zu können.
Das Grundproblem: Die Fixierung auf Hochleistung
In den letzten Jahren sind viele Bücher mit teils aufsehenerregenden Titeln (Die Burnout-Kids) erschienen, die von massiven emotionalen Problemen heutiger Kinder und Jugendlicher berichten. Meist werden der schulische Leistungsdruck, die sozialen Medien und der verwöhnende Erziehungsstil dafür verantwortlich gemacht. Solche Parameter sind keinesfalls zu leugnen, aber sie verkörpern vor allem Begleiterscheinungen, welche die Sicht auf das Grundproblem verdecken.
Der Ursprung von Überleistung liegt kaum in den Kindern selbst und nur teilweise in Lehrkräften oder Eltern, sondern vor allem in Gesellschaft und Bildungspolitik. Wettbewerbsorientierung, Akademisierung sowie der Appell an eine »verantwortete Elternschaft«1 waren um die Jahrtausendwende die Wegbereiter, welche die Überleisterflamme entzündet haben. In der Zwischenzeit hat sie auf Bildungssystem und Familie übergegriffen. Entstanden ist eine Optimierungskultur, welche Überleistung zu einem gesellschaftlichen Mandat macht. Damit ist gemeint, dass Ideen, welche die Sichtweisen von immer mehr Menschen steuern, einen bestimmten Verhaltens- und Denkstil vorgeben, der zu einem gesellschaftlichen Code wird.
Doch es wäre falsch, Überleistung ausschließlich als negatives oder gefährliches Phänomen zu verstehen. Es gibt Kinder, die Merkmale von Überleistung zeigen, aber seelisch in ausgewogener Verfassung sind, ein gutes Selbstwertgefühl haben und sich positiv entwickeln. Beispiele sind durchschnittlich intelligente, wissensdurstige Kinder, die gerne zur Schule gehen, sodass sie von Eltern und Lehrkräften manchmal fast gebremst werden müssen. Doch solche Kinder gibt es eher wenige.
Wie versetzt man Kinder in einen gebildeten Zustand?
Dass Überleistung mit ihren vielen Facetten zwar ein verdecktes, aber belastendes Thema in Schulen und Familien ist, erfahre ich jeweils im Anschluss an meine Referate, gerade im Zusammenhang mit meinem Buch Lasst die Kinder los – Warum entspannte Erziehung lebenstüchtig macht. In solchen Veranstaltungen schlagen die Emotionen hoch, sobald die Frage auftaucht, wie Kinder in einen gebildeten Zustand versetzen werden können und wie ihr Potenzial auszuschöpfen ist.
Meine Erfahrung entspricht keinesfalls dem, was in den Medien immer wieder berichtet wird: dass alle Eltern überehrgeizig seien. Oder dass Schulen grundsätzlich stresserzeugend wirken und die individuellen Möglichkeiten der Kinder zu wenig berücksichtigen würden. Mein Eindruck ist eher der, dass sowohl Lehrkräfte als auch Eltern die Folgen ihres Engagements respektive ihrer Erwartungen sensibilisierter wahrnehmen als je zuvor. Deshalb melden sich in meinen Referaten auch durchaus selbstkritische Zuhörerinnen und Zuhörer zu Wort, die als Väter, Mütter, Lehrkräfte oder Fachexpertinnen und -experten sowie als bildungspolitisch Tätige nach zukunftsträchtigen Lösungen suchen. Trotzdem schwingen in den Diskussionen häufig die Optimierungsgesellschaft und der unbedingte Erfolg der Kinder oder die damit verbundenen Unsicherheiten in Schule und Freizeit als übergreifendes Mantra mit. Im Mittelpunkt stehen beispielsweise Fragen, inwiefern Lehrkräfte und Eltern die Kinder dazu anhalten sollten, ihr Talent zu optimieren und das Potenzial nicht zu vergeuden oder ob frühe Leseinstruktion als Schulvorbereitung Erfolg verspricht. Fast immer schimmert die Sorge durch, die Kinder könnten zu wenig gefördert werden. Selten geht es aber um die vielleicht wichtigsten Fragen: Wie kann man als Lehrperson, Mutter oder Vater Standfestigkeit entwickeln und sich vom Optimierungs-Mainstream abgrenzen? Was braucht es, um realistische Erwartungen zu entwickeln, ohne in überfördernde und überfordernde Erziehungs- und Ausbildungsmuster hineinzuschlittern? Und: Wie können die Entwicklung einer intrinsischen Motivation der Kinder unterstützt und Fallstricke umgangen werden, welche lediglich auf konforme Leistungsprodukte – die Noten – ausgerichtet sind?
Solche Fragestellungen haben mannigfaltige Berührungspunkte mit dem Thema Hoch- und Überleistung. Sie zwingen uns, zur Kenntnis zu nehmen, dass es sich dabei um ein komplexeres Phänomen handelt, als es der alleinige Fokus auf ehrgeizige Eltern suggeriert. Oft spüren Kinder zwar, dass sich die Eltern viel von ihnen erhoffen und auch Druck machen. Doch nicht selten sind es ebenso schulische Anforderungen, Leistungs- und Selektionsdruck. Manchmal sind es auch Freundinnen und Freunde, welche überleistende Kinder nicht verlieren wollen.
Überleistung als gesellschaftliches Mandat: die These
Zu hohe Erwartungen, ein angeschlagenes Selbstbewusstsein, die Angst vor Fehlern – solche Merkmale lassen manche Kinder zu Überleistern werden. Sie können kaum eigenmotiviert Interessen entwickeln, werden immer abhängiger von der Unterstützung durch Dritte und verlieren manchmal sogar die Freunde, die ihnen eigentlich wichtig wären. Und vor allem können sie trotz guten Leistungen kaum je wahrhaftige Freude am eigenen Erfolg entwickeln. Damit bekommen sie einen schweren und mit Risiken bepackten Rucksack auf ihre Schultern geladen.
Solche Erkenntnisse bilden die Basis für die zentrale These meines Buches:
Bildungspolitische und gesellschaftliche Entwicklungen wie Leistungsorientierung und Optimierungszwang, schulische Testkultur oder Akademisierungsbestrebungen sind Hauptursachen dafür, warum immer mehr Kinder auf Hochleistung getrimmt werden. Sie müssen Ergebnisse liefern, die eigentlich über ihren Fähigkeiten liegen. Diese Überleisterkultur ist ein gesellschaftliches Mandat, dem zu widerstehen für Schule und Elternhaus eine Herausforderung geworden ist. Es braucht deshalb einen Perspektivenwechsel hin zum authentischen Kind.
Warum Überleistung als Thema oft verschwiegen wird, ist Thema des hinführenden Kapitels. Anhand von vier Faktoren zeige ich die Hauptpfeiler auf, welche Hoch- und Überleistungen in einem zwiespältigen Licht erscheinen lassen – auch wenn sie vordergründig als bewundernswert gelten. Anschließend konzentriere ich mich im ersten Schwerpunkt auf die Katalysatoren von Überleistung und die damit verbundenen Player: die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen, den auf Optimierung ausgerichteten Zeitgeist, das Bildungssystem und die Probleme und Herausforderungen des Leistungssports.
Im zweiten Schwerpunkt geht es um die überleistenden Kinder selbst, genauer um ihre unterschiedlichen Merkmale. Dabei wird deutlich, dass es den Überleister oder die Überleisterin zwar nicht gibt, sie jedoch einen gemeinsamen Nenner haben: wenig Selbstvertrauen und viele Selbstzweifel. Im Mittelpunkt des dritten Schwerpunkts stehen Väter und Mütter, welche wegen den vorherrschenden gesellschaftlichen Bedingungen zu Maximierern der kindlichen Leistungsfähigkeit werden. Ausdruck dieser Maximierer-Haltung sind Bildungspanik und kontinuierliche Kontrolle der Kinder – beides Phänomene als Folgen der Angst, aus dem Nachwuchs könnte nichts Rechtes werden.
Schließlich ziehe ich im vierten Schwerpunkt Bilanz: Was eine entwicklungsangemessene und humane Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit sein soll, ist neu zu definieren. Kinder müssen nicht durchgehend Hochleistungen an den Tag legen. Sie dürfen manchmal auch lediglich durchschnittlich sein und hin und wieder scheitern. »Das authentische Kind und seine Rechte« wird deshalb zur Leitidee für einen Perspektivenwechsel. Ich zeige Leitideen auf, anhand derer sich Schulen, Lehrkräfte und Eltern von der Überleisterkultur distanzieren können und Bildungssysteme entsprechende Vorkehrungen treffen können. Auf diesem Weg brauchen Kinder und Jugendliche bestimmte überfachliche Kompetenzen wie Selbstvertrauen, Hartnäckigkeit, Begeisterung, Selbstwirksamkeit und Frustrationstoleranz.
ÜBERLEISTUNG: DAS VERSCHWIEGENE THEMA
Geht es um die Schulleistungen der Kinder, werden Eltern oft als überehrgeizige Erziehungsverantwortliche gebrandmarkt. Allerdings liegt die Problematik eher in Bildungspolitik und Bildungssystem, welche die Überleisterkultur mächtig anheizen. Doch dies bekommt manchen Kindern nicht besonders gut. Psychische und physische Auffälligkeiten, insbesondere auch ein mangelndes Selbstvertrauen, dürften Ausdruck überdimensionierter Hochleistung sein.
Sind hochleistende Kinder nicht ein Segen für Schule und Familie?
Schon kleine Kinder werden so gefördert, dass sie möglichst früh als aufgeweckte Kids den Eindruck erwecken, gegenüber anderen Kindern einen Vorsprung zu haben. Dieses Optimierungsstreben ist Ausdruck einer Gesellschaft, welche Bildung ab der frühesten Kindheit als Treibhaus versteht. In ihm soll jedes Kind nach Belieben wie ein Diamant geschliffen und so geformt werden, dass es maximal leistungsfähig wird. Doch Treibhausförderung kann zu überforcierten Hochleistungen führen und eine Nicht-Passung zwischen Fähigkeiten und Leistungsaufwand zur Folge haben. Wichtige Entwicklungsschritte können deshalb beeinträchtigt werden.
Trotzdem ist die Ansicht verbreitet, dass sich die Schule zufrieden schätzen könne, wenn sie hochleistende Kinder zu unterrichten hat und die Eltern stolz sein dürfen über ihr besonders strebsames Kind. Dass Überleistung dahinterstecken könnte, wird meist vernebelt und als Ausdruck eines zu vollen Terminkalenders oder zu hoher Ansprüche des Kindes an sich selbst interpretiert (»Das Mädchen ist einfach derart ehrgeizig«). Zwar wirken überleistende Kinder auf den ersten Blick meist erstaunlich angepasst und enorm fleißig, während andere daneben als Faulenzer erscheinen. Doch manche dieser Kinder wollen vor allem das Image aufrechterhalten, das Schule und Eltern ihnen überstülpen. Als Überleister sind sie oft am Limit und stehen unter Dauerstrom. Sie schlafen bei den Hausaufgaben fast ein oder müssen sich enorm zwingen, nachher noch ins Training zu fahren, auch wenn sie dort Freunde treffen.
Diese Situation hat Konsequenzen, die viel weiter reichen als der Blick auf die möglicherweise beeinträchtigten Psychen der Kinder – obwohl diese Tatsache für Bildungspolitik, Fachexpertinnen und -experten sowie Eltern und Lehrkräfte allein schon ausreichend sein sollte, um die Problematik aus einem neuen Blickwinkel zu diskutieren. Nicht lediglich im Hinblick auf die Burnout-Kids oder die Forderung nach mehr Diagnose und Therapie, sondern aus der Sicht des Overachievements. Die Überleisterkultur beeinflusst nicht nur Schulen, Eltern und deren Kinder, welche das Gymnasium besuchen oder eine Ausbildung absolvieren sollen, die über ihren Fähigkeiten liegt, sondern das ganze Bildungssystem. Diese Kultur trägt dazu bei, junge Menschen in einen Weg zu drängen, der mit Angst vor Misserfolgen und Nichtgenügen gepflastert ist, die unverplante Freizeit und Möglichkeiten zur Selbstbestimmung beiseiteschubst und Kinder in ihrem Selbstvertrauen lähmt. Solche Erfahrungen haben die Aufwachsbedingungen vieler Kinder in den letzten beiden Jahrzehnten drastisch verändert.
Nicht normal, sondern speziell soll das Kind sein
Jedes Kind ist einzigartig. Dies steht in vielen Ratgebern. Nur wird der Begriff »Einzigartigkeit« bisweilen strapaziert. Zu selten wird unterschieden zwischen der angeborenen Einmaligkeit des Kindes und einem unrealistischen »Speziellsein«. Die Anerkennung, dass jedes Kind einmalig ist, bringt es vorwärts, die Pflicht zum »Speziellsein« hindert es an seinem Fortschritt.
Manchmal wird dieses »Speziellsein« mit hoher Intelligenz verbunden und als Vorhersagefaktor für Bildungserfolg herangezogen. Klärt der Psychologe die Eltern auf, das Kind sei intelligenzmäßig normal, sind sie oft etwas enttäuscht. Verständlich, weil damit das Erhoffte vom Tisch ist. Vielleicht hat die Gaußsche Glockenkurve etwas damit zu tun. Denn sie verdeutlicht, dass bei der Messung der Intelligenz einer Vielzahl gleichaltriger Kinder das Bemerkenswerte eintritt: Die Summe der Messwerte ergibt die absolut vorhersagbarste Kurve – die Glocke – und damit die Normalverteilung. Das bedeutet, dass sich die Intelligenzwerte um die Mitte gruppieren, während sich die Ausreißer symmetrisch auf beiden Seiten anordnen. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf eine überragende Intelligenz macht das erhoffte »Speziellsein« der Kinder nur einen Anteil von etwa zehn Prozent aus.
Die Glockenkurve kann allerdings nur in der Theorie ein Wegweiser zur Bestimmung sein, wann Kinder überdurchschnittlich intelligent sind und wann nicht. In der Praxis hat das Normale weitaus unschärfere Grenzen. Dies stürzt Eltern oft in ein Dilemma: Wie hält man die Überzeugung aufrecht, dass das Kind speziell ist? Manchmal, indem man von einer psychologischen Praxis zur nächsten läuft, bis die Bestätigung auf dem Tisch liegt. Doch speziell sein zu müssen und zu bleiben, erfordert von den Kindern meist harte Arbeit. Sie spüren, dass sie permanent beobachtet werden, ob sie die Erwartungen von Lehrkräften und Eltern erfüllen oder nicht. Ein solches Dauermonitoring erschwert die Entwicklung resilienten Verhaltens und züchtet Abhängigkeit.
Eltern und ihre Abhängigkeit vom Kind