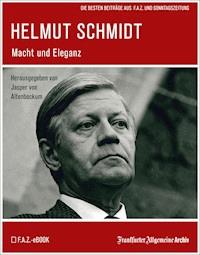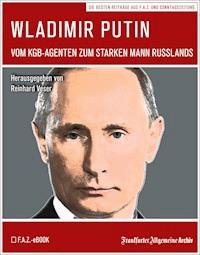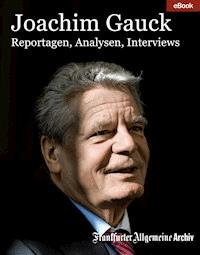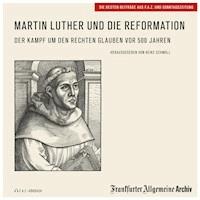Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Der Aufstand der arabischen Massen Anfang des Jahres 2011 kam unerwartet. Die Protestbewegung erfasste Tunesien, Ägypten, Libyen, Jemen, Syrien und weitere arabische Staaten. Die Berichte, Reportagen und Analysen aus der F.A.Z. und der F.A.S. in diesem eBook erklären die Entstehung der heutigen arabischen Staaten und spiegeln die Ereignisse der wichtigsten Schauplätze des Arabischen Frühlings wider. Fotos und Landkarten illustrieren die Beiträge, auf weitergehende Informationen verweisen Internet-Links und Literaturhinweise.Der Herausgeber: Wolfgang Günter Lerch trat im Mai 1978 in die Nahrichtenredaktion der F.A.Z. ein, wo er bis zum Jahr 2012 wirkte. Inhalt seiner zahlreichen Veröffentlichungen sind vor allem die politischen und sozialen Ereignisse im Nahen Osten und in Nordafrika.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 156
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arabellion. Der Aufbruch der arabischen Welt
Herausgegeben von Wolfgang Günter Lerch
F.A.Z.-eBook 4
Frankfurter Allgemeine Archiv
Projektleitung: Franz-Josef Gasterich
Produktionssteuerung: Christine Pfeiffer-Piechotta
Redaktion und Gestaltung: Hans Peter Trötscher
eBook-Produktion: Rombach Druck- und Verlagshaus
Alle Rechte vorbehalten. Rechteerwerb: [email protected]
© 2012 F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main.
Titelgestaltung: Hans Peter Trötscher. Foto: F.A.Z.-Foto / Daniel Pilar.
ISBN: 978-3-89843-163-7
Vorwort
Ein Aufstand, den niemand kommen sah
Die Arabellion kam unerwartet, niemand hatte den Aufstand der arabischen Massen auf der Agenda. Die Autokraten Arabiens, so schien es, herrschten ewig, gleichsam Naturgesetzen folgend; dies schien auch der politischen Stabilität dieser unruhigen Region zu dienen, in der Islamisten und Dschihadisten immer wieder Terroranschläge verübten. So sah das auch der Westen, allen voran die Amerikaner: Sollten doch lieber Diktatoren dort herrschen als die islamischen Eiferer.
Doch Mohammed Bouazizi strafte diese Kalküle Lügen: Als sich der junge Tunesier am 17. Dezember 2010 in der Stadt Sidi Bouzid aus Protest gegen staatliche Schikanen anzündete, konnte niemand ahnen, dass dies auch der Zünder für einen Umbruch sein würde, der bis heute fortdauert und die gesamte nahöstliche und nordafrikanische Region in Aufruhr versetzte – mit unterschiedlicher Intensität allerdings. Auf den Sturz des tunesischen Präsidenten Zine al Abidine Ben Ali folgte der des Ägypters Husni Mubarak. Eines regelrechten Krieges mit Beteiligung der Nato bedurfte es, um Oberst Gaddafi vom libyschen Thron zu stoßen. Auch der jemenitische Präsident Ali Abdullah Salih musste die Macht abgeben, und in diesen Tagen hat sich der Syrer Baschar al Assad eines bewaffneten Aufstands zu erwehren, dessen Ausgang ungewiss ist. Aus einer Protestbewegung vornehmlich der Jugend, die um Ausbildungs- und Arbeitsplätze bangte, die nach Menschenwürde verlangte, sind in Libyen, im Jemen und in Syrien Gewaltorgien mit vielen tausend Toten geworden. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um das Ende dessen, was man die »orientalische Despotie« genannt hat. Insgesamt ist keines der 22 arabischen Länder von der Unruhe verschont geblieben, was zeigt, dass hier ein welthistorischer Wandel im Gange ist. Einige Staaten, wie Marokko, Jordanien, Saudi-Arabien, Kuweit oder Oman, reagierten mit mehr oder minder großen Zugeständnissen oder mit Geld auf die Herausforderung. Im kleinen Golf-Königreich Bahrein wurde der Aufstand vornehmlich der Schiiten einstweilen blutig niedergeschlagen.
Wo die Despoten schon gestürzt sind, ist eine schwierige Neuordnung im Gange. Säkulare Kräfte werden durch religiöse Elemente herausgefordert, die durch das Ende der Unterdrückung aus der Illegalität auftauchen konnten. Nun prallen beide, wie in Tunesien und Ägypten, aufeinander. Gewachsene demokratische Strukturen fehlen und müssen erst erarbeitet werden. Und wie bei anderen Revolutionen auch, vermag niemand anzugeben, wie die Reise weitergehen und wo sie einmal enden wird.
Die hier versammelten Berichte, Reportagen und Analysen aus der F.A.Z. und der F.A.S. spiegeln die Ereignisse der wichtigsten Schauplätze der Arabellion wider. Sie währt nun schon länger als eineinhalb Jahre und wird voraussichtlich auch noch viele Jahre andauern.
Wolfgang Günter Lerch, Nordafrika- und Nahost-Redakteur im Politik-Ressort der F.A.Z., im Juli 2012
I.Wie das heutige Arabien entstand
Der Tragische
»Lawrence von Arabien« ist eine der Schlüsselfiguren der nahöstlichen Konflikte
Von Wolfgang Günter Lerch
Im Jahre 1961 drehte der britische Regisseur David Lean »Lawrence von Arabien«. Er sei nicht sicher gewesen, sagte er später, ob dieser Film über den Führer des arabischen Aufstandes überhaupt Erfolg haben werde, denn es komme nicht eine einzige Frau darin vor – von einer Liebesgeschichte ganz zu schweigen. Eine reine Männerwelt wurde dem Kinobesucher dreieinhalb Stunden vorgeführt. Doch der Film wurde Kult, und zwar so sehr, dass man bisweilen glaubte, der echte, kleinwüchsige Thomas Edward Lawrence habe so ausgesehen wie der attraktive, hochgewachsene Peter O’Toole, der ihn verkörperte.
Lawrence von Arabien war ein zerrissener, tragischer Held. Selbst in seiner englischen Heimat ist er inzwischen umstritten. Den hagiographischen Darstellungen nach dem Ersten Weltkrieg und nach seinem tragischen Unfalltod mit dem Motorrad 1935 folgten äußerst kritische Blicke auf seine Rolle im Nahen Osten. Heute hat sich das Urteil auf eine »mittlere« Linie eingependelt: Lawrence war zwar ein bedeutender Mann, doch charakterlich schwierig. Am wenigsten umstritten ist noch sein Rang als Schriftsteller. Seine »Sieben Säulen der Weisheit« sind, nach Winston Churchill, eines der größten Bücher der englischen Literatur im zwanzigsten Jahrhundert. Sein Autor aber – ein Schöpfer eigener Mythen, ein Phantast, ein Lügner gar, eine gefährliche Mischung aus Geist- und Tatmensch. Lawrence schuf eine Prosafassung der Odyssee, war beschlagen in antiker Philosophie und mittelalterlicher Architektur, konnte aber auch Schnellboote konstruieren.
Die Araber sehen »El Orans« noch viel kritischer, was aus ihrer Sicht verständlich ist. Da fällt das Wort vom »Verräter«. Und von der großen »Verschwörung«, an der er Anteil hatte. Auch dass man Lawrences Rolle als Führer des Aufstandes maßlos überschätze, denn der eigentliche Führer sei Faisal gewesen, der älteste Sohn des haschemitischen Scherifen Hussein von Mekka. General Allenby allerdings, der es als britischer Oberbefehlshaber im Nahen Osten wissen musste, maß Lawrence militärisch eine mitentscheidende Rolle im Kriegsgeschehen zu.
In Lawrence bündeln sich all die politischen Entwicklungen, die während des Ersten Weltkrieges und danach, als man in den Vororten von Paris Frieden machte, jene nahöstliche Neuordnung schufen, die wiederum neue Konflikte gebar – Konflikte, die bis heute ungelöst sind. In den Augen der Araber ist gerade Lawrence der leibhaftige Wortbruch. Die Engländer hatten das Osmanische Reich besiegt und bedienten sich nun an der Konkursmasse des zerfallenen Imperiums. Zwischen Palästina und dem Irak wurden Mandatsgebiete errichtet und, wie im Libanon, Eingriffe in vorhandene Strukturen vorgenommen. Das heutige Staatensystem der Region ist künstlich, mit Grenzen, die das britische Kolonialministerium meist willkürlich gezogen hat. Lawrence trug dazu bei. Geboren wurde er 1888 als Sohn von Sir Thomas Chapman, der seine Frau wegen der Kinderfrau Sarah Maden verließ, sich den Namen Lawrence zulegte und in »wilder Ehe« lebte. Thomas Edward, der noch vier Brüder hatte, wurde Historiker und Archäologe. Für seine Doktorarbeit über die Burgen der Kreuzfahrer wanderte er zu Fuß durch Palästina und Syrien, schon damals genau beobachtend. Vor Ausbruch des Krieges war er Assistent von Leonard Woolley bei den Ausgrabungen von Karkemish am Euphrat. Nicht nur nebenbei sammelte er Material über die Deutschen, die in der Nähe die Trasse der Bagdad-Bahn bauten. Archäologen waren nicht selten für die Sicherheitsdienste ihrer Länder tätig – auf deutscher Seite etwa Lawrences Widerpart, der Diplomat, Orientalist und Ausgräber des Tell Halaf in Syrien, Max von Oppenheim.
Nach Ausbruch des Krieges brauchte man den Arabisch sprechenden Lawrence in Kairo, im Arab Bureau. Allenbys Vorgänger General Murray schickte ihn auf die Arabische Halbinsel, wo er erkunden sollte, was es mit einem Aufstand haschemitischer Beduinen auf sich habe. So fand sich der feinsinnige Gelehrte – sein Vorgesetzter Ronald Storrs nannte ihn seinen »supergeistigen Gefährten« – bald in der Mitte der Aufständischen, die im Namen des Scherifen von Mekka die Herrschaft der Osmanen abschütteln wollten.
Lawrence entwickelte, Jahrzehnte vor Mao, für seine Stammeskrieger eine Guerrilla-Taktik gegen die türkischen Truppen; vor allem jedoch sprengte er die Gleise der Hedschas-Bahn, auf deren Funktionieren die Türken angewiesen waren. Ein staunenswerter Todesritt mit etwa vier Dutzend Kamelreitern durch die Wüste Nefud brachte ihn bis nach Aqaba, das die Türken besetzt hielten. Da deren nicht schwenkbare Kanonen nach Süden gerichtet waren, blieben sie gegen die Angreifer aus dem Norden nutzlos. Die Aufständischen nahmen am 6. Juli 1917 Aqaba. Allenby in Kairo traute seinen Ohren nicht, als ihm Lawrence persönlich von der Eroberung erzählte. Seine rechte Flanke war gesichert.
Allenby teilte Lawrence bei seinem Aufenthalt in Kairo mit, dass London und Paris das Sykes-Picot-Abkommen geschlossen hätten. Darin hatten England und Frankreich jene Gebiete schon unter sich aufgeteilt, die erst noch von den Türken befreit werden sollten. Im November dann sicherte Arthur Balfour den Zionisten zu, England werde sich nach einem Sieg für eine »jüdische Nationalheimstätte« in Palästina einsetzen. Bereits 1915 jedoch hatten die Briten dem Scherifen Hussein die Souveränität über alle arabischen Gebiete »mit Ausnahme Adens« versprochen, wenn sie sich am Kampf gegen die Türken beteiligten.
Es ist unwahrscheinlich, dass ein dem britischen Geheimdienst schon vor dem Krieg verbundener Mann wie Lawrence von allen widersprüchlichen Abreden nicht schon früh gewusst haben sollte. Seinen Kriegern versprach er im Namen Großbritanniens weiterhin Freiheit und Unabhängigkeit. Ein Versprechen machte er allerdings wahr: Er zog am 1. Oktober 1918 mit seinen Beduinenkämpfern noch vor Allenby in Damaskus ein, der einst glanzvollen Hauptstadt des Arabischen Reiches unter den Omajjaden.
Nach dem Sieg über die Türken gehörte Lawrence zur Delegation Faisals bei den Gesprächen, bei denen der Kuchen verteilt wurde. Doch Faisal war dort unerwünscht. Lawrence tat nun – wohl auch aus Scham über Londons doppelbödige Politik und sein eigenes Verhalten – sein Bestes, um den Arabern zu ihrem Recht zu verhelfen, doch scheiterte er. Auch im Kolonialministerium, wo ihn Churchill aufgenommen hatte, konnte er wenig bewirken. Zwar erhielten die Haschemiten den Irak und Transjordanien, jedoch unter englischer Ägide. Im Mandatsgebiet westlich des Jordans nahm die jüdische Einwanderung zu. Faisal wurde aus Syrien vertrieben, man gab ihm den Irak, wo er seit 1921 von Englands Gnaden herrschen durfte. Enttäuscht tauchte Lawrence unter falschen Namen, als einfacher Soldat in der Royal Air Force unter; er suchte Anonymität.
Man hat lange darüber gerätselt, warum er dies tat. Wollte er sich für sein menschliches und politisches Versagen bestrafen, für den Wortbruch, als den er sein Handeln gegenüber den Arabern empfand? Oder waren es vor allem persönliche Gründe, die ihn zu diesem Schritt trieben, etwa die Sehnsucht nach einem mönchischen Dasein? Spielten selbstquälerische, masochistische Motive eine Rolle? In seinem zweiten Buch »The Mint« (»Unter dem Prägestock«) schilderte er die Stupidität des Soldatendaseins, an der er litt, die er aber auch haben wollte. Man hat ihn gelegentlich als den »vierten Karamasow« bezeichnet. T. E. Lawrence mochte ohne Zweifel die Araber und ihre Art zu leben, er teilte ihre Freuden und Leiden. Dennoch betrog er sie.
Im Geist Arabi Paschas
Nationalismus und Einheit der Nation sind die Leitvorstellungen Ägyptens. Der panarabische Nationalismus ist heute eine politische Leiche.
Von Wolfgang Günter Lerch
Die Bewahrung der nationalen Einheit Ägyptens ist nach eigenem Bekunden das wichtigste Ziel der Armee. Wie es damit bestellt sei, wurde nicht zuletzt aus Anlass der Zusammenstöße zwischen Muslimen und Kopten immer wieder gefragt, denn auch schon zu Zeiten Mubaraks und seiner Vorgänger war der nationale Konsens der Ägypter die wichtigste Klammer des Zusammenhalts der achtzig Millionen im Niltal.
Was ein Ägypter sei, darüber herrscht etwa zwischen den christlichen und den muslimischen Ägyptern keine hundertprozentige Übereinstimmung, obwohl es natürlich viele Überschneidungen gibt. Aber ägyptischer Nationalismus und arabischer Nationalismus sind nicht dasselbe. Kopten sprechen zwar auch arabisch und sind in die arabische Kultur integriert, auch gab es Kopten, wie den sozialistischen Autor Salama Musa, die einem speziell arabischen Nationalismus huldigten, doch ist den Kopten bewusst, dass sie mehr als die Muslime die Erben der frühchristlichen und außerdem der dreitausend Jahre alten pharaonischen Kultur am Nil sind. Für die Muslime Ägyptens ist hingegen die Eroberung des Landes durch den muslimischen Feldherrn Amr Ibn al As zwischen 639 und 642 ein entscheidendes Datum der Identifikation.
Keimzelle des ägyptischen wie des arabischen Nationalismus in Ägypten ist der Aufstand Arabi Paschas im Jahre 1882. Er war eine Reaktion auf den wachsenden Einfluss des Auslands, insbesondere Großbritanniens, auf die ägyptischen Belange. Seitdem der Khedive Ismail, um seine Schulden loszuwerden, 1876 die Suezkanal-Aktien an London »verkauft« hatte, war der Einfluss noch gewachsen. Die von Arabi Pascha ausgelösten Unruhen, insbesondere in Alexandria, kosteten etliche Ausländer das Leben. London antwortete mit der massiven Beschießung der Stadt und schickte Truppen. Fortan standen die Vizekönige in Kairo, nominell immer noch dem Sultan in Istanbul/Konstantinopel untertan, unter britischer Kuratel. Doch der Keim des Nationalismus konnte nicht mehr abgetötet werden, im Gegenteil.
Unter Sir Evelyn Baring (Lord Cromer) nahm der Einfluss der Briten zu, vor allem militärisch, doch auch die Strömungen gegen die Fremdherrschaft gewannen an Intensität. Von Kairo aus wurde nicht nur Ägypten britisch verwaltet, sondern, seit der Beseitigung des Mahdi-Staates im Jahre 1899 unter Lord Kitchener, auch der Anglo-Ägyptische Sudan. Während des Ersten Weltkriegs war Kairo das Hauptquartier der britischen Armee, die im Nahen Osten gegen die Türken kämpfte. Im Arabischen Büro hatten die Briten ihre Orient-Fachleute versammelt. Vorübergehend deckten sich die Interessen der Briten und die der ägyptischen (und arabischen) Nationalisten: Man wollte die Türken endgültig loswerden. Mit der türkischen Niederlage in Syrien-Palästina 1917 und dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches am Ende des Krieges war dieses Ziel erreicht.
Mehr und mehr gewann der arabische Nationalismus Raum. Neben Ägypten wurden auch Syrien und der Irak Zentren der arabischen Nationalisten. Offiziere spielten dabei oft eine wichtige Rolle. Ägypten erlebte nach 1922 einen Modernisierungsschub, der zwei Ziele hatte: einerseits die Briten ganz zu vertreiben, andererseits das ägyptische Volk – ob Muslime oder Kopten – zu einer modernen Nation zusammenzuschweißen und kulturell voranzubringen. Die arabische Renaissance, die Nahda, deren Anfänge noch in das Syrien und den Libanon des 19. Jahrhunderts reichten, trug auch am Nil reiche Früchte, in Sprache und Literatur vor allem. Durch den Film fand der ägyptische Dialekt weite Verbreitung.
Politisch entstand eine machtvolle, vom Bürgertum der Städte und von Honoratioren getragene Bewegung, die in die einflussreiche Wafd-Partei mündete. Ihr Führer, Saad Zaghlul Pascha (1860–1927), war die tonangebende Figur eines speziell ägyptischen Nationalismus, freilich ohne revolutionäre oder sozialrevolutionäre Züge. Die Wafd war in ihren Grundansichten moderat. Sie strebte nach dem Ende der britischen Dominanz, die nach dem Ende des Protektorats 1922, als Ahmed Fuad sich zum König erklärte, zwar vermindert worden war, aber noch immer zu spüren.
Der panarabisch gefärbte Nationalismus, wie er in Syrien für die dort neu entstandene Baath-Partei Michel Aflaqs und Salah al Bitars charakteristisch war, erzeugte, zusammen mit den Lehren ägyptischer Panarabisten und Nationalisten, die revolutionäre arabisch-nationalistische Ideologie, der auch jene Freien Offiziere folgten, die im Jahre 1952 in einem Staatsstreich unter Mohammed Naguib und Gamal Abdel Nasser König Faruk stürzten und ins Exil schickten, die Republik ausriefen und ein Ägypten mit panarabischen Vorzeichen schufen.
Vor allem Nasser, der endgültig seit 1954 den Kurs bestimmte, wurde das Idol nicht allein der ägyptischen Massen, sondern vieler arabischer Nationalisten überall in der arabischen Welt. Noch der libysche Staatschef Muammar Gaddafi, seit 1969 an der Macht und ein Fossil des arabischen Nationalismus, verehrt ihn bis heute, und die algerische FLN hatte Nasser zum Paten. Als das nasseristische Ägypten sich 1958 mit Syrien zu der – freilich kurzlebigen – Vereinigten Arabischen Republik zusammenschloss, war Nasser auf dem Höhepunkt seiner Karriere, Ägypten die führende Macht des arabischen Nationalismus. In Syrien empfand man die ägyptische Dominanz freilich mehr und mehr als lästig, so dass man 1961 schon wieder auseinanderging. Im Irak hatten unter dem Oberst Abdal Karim Kassem 1958 ebenfalls arabische Nationalisten die Macht ergriffen. Im Jemen sorgte Nasser zu Beginn der sechziger Jahre für den Sturz des feudalen Imam-Regimes, in Algerien errangen die Kämpfer der FLN 1962 die Unabhängigkeit von Frankreich.
Mit der dramatischen Niederlage der arabischen Armeen im Sechstage-Krieg gegen Israel 1967 begann der Abstieg des Panarabismus und auch Nassers. Als Nasser 1970 starb, hatten schon jene Kreise, gestützt durch Saudi-Arabien, Oberwasser, die man heute als Islamisten bezeichnet. Auch da hatte 1928 Ägypten Pate gestanden, als dort die Muslimbruderschaft gegründet wurde. Eine Rückbesinnung auf den Islam sollte Arabien stark machen. Nicht zuletzt in Ägypten war diese Bewegung intensiv zu spüren.
Der panarabische Nationalismus ist heute ein lebender Leichnam, der Islamismus hat, wo er an die Macht gelangte, den Menschen nicht das gebracht, was sie sich erhofft hatten. Die ägyptischen Demonstranten jüngst waren in der Regel keiner dieser Ideologien verpflichtet; doch dass Kopten und Muslime einig sein sollen und sich alle als Ägypter fühlen, demonstrierten sie auf beeindruckende Weise auf dem Tahrir-Platz.
Arabellion und Scharia
Fänden sich traditionelle Kräfte und solche eines säkularen Aufbruchs zusammen, wäre schon viel gewonnen.
Von Wolfgang Günter Lerch
Die Voraussagen sind eingetroffen: Bei der ersten freien Wahl in Tunesien hat die islamisch-integristische Partei Ennahda (Wiedergeburt) die meisten Stimmen erhalten. So wird sie in der Verfassunggebenden Versammlung, die eine neue Konstitution erarbeiten soll, ein gewichtiges Wort (mit)sprechen. Viele Tunesier haben dieser Gruppierung ihre Stimme gegeben, weil die Neuordnung des Landes ihrer Auffassung nach mehr den islamisch geprägten Traditionen und Werten und damit ihrer fast eineinhalb Jahrtausende alten Geschichte entsprechen soll als der Ordnung des gestürzten Regimes, die den meisten Gängelei und Repression einbrachte und die sozialen Verwerfungen sowie bedrängende Probleme wie die Arbeitslosigkeit der Jugend nicht beseitigen konnte.
Für Ennahda bedeutet das Wahlergebnis eine Wiedergeburt. In den siebziger und frühen achtziger Jahren war diese Partei in Tunesien, was in den neunziger Jahren die Nationale Heilsfront (FIS) in Algerien wurde: eine radikale, doch insgesamt schon differenziertere, auch weniger gewaltgeneigte islamistische Bewegung. Unter dem im Januar gestürzten Präsidenten Ben Ali war sie verboten worden, viele ihrer Anhänger wurden inhaftiert. Ihr Vorsitzender Rachid Ghannouchi floh ins Exil nach London. Nun ist er zurück und kann den Triumph seiner Partei an der Wahlurne auskosten.
Im Wahlkampf gab sich Ennahda als gemäßigt islamische Gruppierung. Jedoch ist das Misstrauen groß, insbesondere bei jenen Protagonisten der Arabellion, die der religiös geprägten Lebenswelt der Mehrzahl der Tunesier fernstehen: Verschleiern die Integristen nicht ihre wahren Ziele? Ausgeschlossen ist das nicht – trotz gegenteiliger Beteuerungen. Sein Vorbild sei die türkische Regierungspartei AKP, sagt Ghannouchi. Sie sei im Islam verwurzelt, betreibe aber eine eher pragmatische Politik, insbesondere auf dem Gebiet der Wirtschaft.
Schon jetzt hat das »Abschütteln« (intifada) der arabischen Autokraten zwischen Tunis und Kairo – zuletzt traf es Gaddafi in Libyen, Salih im Jemen und Assad in Syrien könnten bald folgen – gezeigt, dass islamische Kräfte bei der Gestaltung der neuen Ordnungen überall ein erhebliches Wort mitreden werden. Schon hat der Nationale Übergangsrat in Libyen mitgeteilt, die Scharia solle Grundlage des neuen Libyen sein. In Kairo kam es schon im Sommer zu einer machtvollen Demonstration der Muslimbrüder auf dem Tahrir-Platz, bei der die ägyptischen Islamisten – auch sie sind um ein gemäßigtes Image bemüht – die Rechte des Islam einforderten. Wenn nicht alle Zeichen trügen, werden alle neuen Ordnungen geprägt sein von größeren Spannungen zwischen stark islamisch gefärbten konservativen Kräften und den Verfechtern einer weltlichen Zivilgesellschaft, die am Ursprung der Arabellion standen.
Als gottgegebener religiös-gesellschaftlicher kollektiver »Heilspfad« ist die Scharia eine Ordnung, die zwar interpretiert, aber nicht verändert werden darf. Daher ist sie bis in die alltägliche Lebenswelt hinein auf weite Strecken mit der Demokratie westlicher Prägung nicht vereinbar. Dies gilt für ihre Strafpraxis, für das Familien- und Personenstandsrecht, vor allem jedoch für die individuellen Freiheitsrechte, wie sie in der westlichen Hemisphäre in Jahrhunderten erkämpft worden sind. Freilich klaffen auch in der indischen Demokratie die seit Jahrzehnten eingeübten demokratischen Usancen und das Wertesystem der Hindus auseinander – das Kastenwesen ist Beispiel genug. Auch europäische Länder waren schon demokratisch verfasst, als ihre allgemein verbindlichen Wertvorstellungen sich von den heute als selbstverständlich erachteten, unter Freiheit subsumierten Regeln noch erheblich unterschieden. Mit dem Segen des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt gestehen viele auch den Chinesen das Recht auf den eigenen Weg zu.