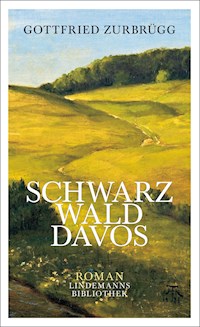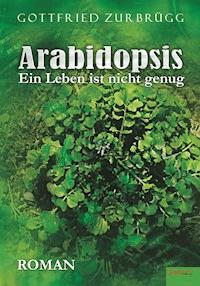
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Arabidopsis, das klingt wie ein Zauberwort, aber es ist nur der lateinische Name für eine kleine Pflanze, die überall wächst. Ackerschmalwand ist ihr deutscher Name. Ein Unkraut, das man ausreißt und fortwirft. Trotzdem hat diese unscheinbare Pflanze unser ganzes Leben verändert. Unglaublich, aber wahr! Die Wissenschaftler fanden heraus, dass diese Pflanze ein einfaches Genom hat, und haben schon lange alle Gene entschlüsselt. Vor Jahren hat Gottfried Zurbrügg Biologie und Chemie für das Lehramt studiert. So kam er vor dreißig Jahren auch nach Tübingen in das Botanische Institut. Die Gentechnik war damals neu und umstritten. Man wollte neue Lebensmittel schaffen, vielleicht auch tatsächlich den Hunger in der Welt besiegen, aber auch uralte Fragen der Menschheit beantworten. Was ist das Leben und was ist der Tod? Zurbrügg entwarf einen Roman und schrieb die Geschichte von Professor Scherrer, dem Genetiker und Ägyptologen. Menschen sind auf der Suche nach Unsterblichkeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 485
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gottfried Zurbrügg
ARABIDOPSIS –
EIN LEBEN IST NICHT GENUG
ROMAN
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2016
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Copyright (2016) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2016
www.engelsdorfer-verlag.de
Alles hat seine Zeit
(aus der „Prediger“ – die Bibel)
Personen:
Prof.Dr.Dr.Edwin Scherrer, Genetiker und Ägyptologe, emeritierter Professor der Gentechnik an der Morgenstelle in Tübingen, jetzt Leiter des Botanischen Gartens in Karlsruhe
Frau Dr.Dagmar Scherrer, seine Frau
Anne Neidhardt, Doktorandin
Anneliese Ehlert, Sekretärin im alten Botanischen Institut Karlsruhe
Dr.Meyer, Mitarbeiter im Institut
Nubi, Geschäftsmann in Kairo, Jugendfreund von Prof.Scherrer
Ahmed, sein Sohn
Irmgard, Hausmädchen bei Scherrers
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Zitat / Personen
Vorwort
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
Glossar
VORWORT
Arabidopsis, das klingt wie ein Zauberwort, aber es ist nur der lateinische Name einer kleinen Pflanze, die überall wächst. Ackerschmalwand ist ihr deutscher Name. Die Pflanze sieht einem Hungerblümchen oder einem Hirtentäschelkraut ähnlich, aber sie hat längliche Schoten. Ein Unkraut, das man ausreißt und fortwirft. Trotzdem hat diese unscheinbare Pflanze unser ganzes Leben verändert. Unglaublich, aber wahr!
Die Wissenschaftler fanden heraus, dass diese Pflanze ein einfaches Genom hat, und haben schon lange alle Gene entschlüsselt. Sie ist ein Modell für pflanzliches Leben geworden. In allen genetischen Laboren stehen Arabidopsispflanzen. Sie gehören dazu wie die Mäuse, die seit Langem Grundlage für die Forschung sind.
Vor vielen Jahren war ich in der Lehrerfortbildung tätig. Ich habe Biologie und Chemie für das Lehramt studiert und mich stets für Neuerungen in der Forschung interessiert.
So kam ich vor dreißig Jahren auch nach Tübingen in das Botanische Institut und durfte als Gast an den Forschungen teilnehmen. Ich war Gast und nicht Wissenschaftler, deshalb habe ich die Forschungen auch ganz anders erlebt. Mich begeisterten die Tafeln vor den Laboren, auf denen die Forschungsergebnisse veröffentlicht wurden, um eine enge Zusammenarbeit im Institut zu ermöglichen. Die blauen Lampen auf den Fluren waren für mich geheimnisvoll und schön. Für die Forscher waren es Lampen mit einer optimierten Strahlung.
Die Gentechnik war damals neu und umstritten. Mit Misstrauen und Angst begegnete man der neuen Technik. Ging der Mensch nicht zu weit, wenn er in die Keimbahn eingriff und Lebewesen veränderte?
Die Forschungsrichtungen waren vorgegeben: Man wollte neue Lebensmittel schaffen, vielleicht auch tatsächlich den Hunger in der Welt besiegen, aber auch uralte Fragen der Menschheit beantworten. Was ist das Leben und was ist der Tod? Kann es ewiges Leben oder besser ewige Jugend geben?
Die Faszination der Forschung ist auch nach dreißig Jahren für mich nicht geringer geworden. Mit großem Interesse lese ich Forschungsberichte und informiere mich in Fachzeitschriften über den neuesten Stand.
Damals entwarf ich einen Roman und schrieb die Geschichte von Professor Scherrer, dem Genetiker und Ägyptologen.
Inzwischen habe ich viel erleben dürfen, aber mehr denn je fasziniert mich die Frage nach dem Leben. Was ist Leben?
Damals begeistere mich eine junge Biologin, die ihr Leben der Forschung verschrieben hatte, heute fühle ich mich dem alternden Professor verwandt, der in all den Jahren seinen Lebenshunger nicht verloren hat.
Der Roman wurde in den Jahren immer wieder überarbeitet. Ort und Titel wurden verändert, aber die Geschichte blieb: Menschen auf der Suche nach Unsterblichkeit.
In Ägypten wurden in der Antike die damaligen Weltwunder geschaffen, um dem Pharao Unsterblichkeit zu sichern.
Heute werden in der Forschung Milliarden eingesetzt, um dem gleichen Ziel näher zu kommen.
Aber kann man das? Geht nicht das Leben einen ganz anderen Weg? Die uralten Fragen sind geblieben und aktuell wie eh und je.
Aber lesen Sie selber!
Zell a. H., Jan. 2016
1. KAPITEL
Professor Scherrer bewohnte seit seiner Emeritierung von der Universität Tübingen mit seiner Frau eine schöne Villa am Turmberg in Durlach.
Vielleicht hatte er genug von den vielen Pflanzen, die in den Gewächshäusern wuchsen, oder genug von der Grundlagenforschung und den langen Verhandlungen mit den möglichen Sponsoren, wenn es um Fördermittel ging. Die Genetik war ein Teil seines Lebens gewesen, aber eben nur ein Teil. Die Ägyptologie hatte ihn ebenfalls seit jeher gefesselt, und es war mehr als ein Hobby geworden. Im Garten seiner Villa standen einige wunderschöne Nachbildungen berühmter ägyptischer Statuen, und die Nachbarn waren sich nicht sicher, ob es tatsächlich nur Nachbildungen waren. Professor Scherrer behandelte die Figuren mit besonderer Fürsorge, als wären sie seine Kinder, denn er und seine Frau hatten selber keine Kinder. Sein erklärter Liebling war die etwa eineinhalb Meter hohe Nachbildung einer berühmten Katzengöttinenstatue aus Kom Ombo. Sie stand neben dem Hauseingang und Scherrer verließ nie das Haus, ohne der Katze über den Kopf zu streichen, so wie man ein geliebtes Haustier streichelt. Er genoss die Berührung mit dem kühlen, glatten Stein.
Deshalb war er auch leicht irritiert, als er eines Morgens sein Haus verließ. Es war noch kühl und Wolken hingen am Turmberg. Aber der sonst stets kühle Stein fühlte sich warm an. Scherrer wandte sich um und schaute die Statue erstaunt an. Die Katzengöttin stand da wie immer. Die Augen waren lebensecht gearbeitet und ihr Blick sah in die Weite. Trotzdem hatte Scherrer an jenem Morgen das Gefühl, es würde ihm jemand nachschauen.
Er war jetzt sechzig Jahre alt und eigentlich wollte er sich seinen privaten Studien widmen, aber man hatte ihn gebeten, noch nicht ganz in den Ruhestand zu gehen, sondern sich der Neugestaltung des Botanischen Gartens der Universität Karlsruhe anzunehmen. Zögernd nahm Scherrer die neue Berufung an, besonders da ihm das alte Gebäude des Botanischen Institutes in der Kaiserstraße zugesagt wurde. „Sie werden volle Unterstützung bekommen, wenn Sie Ihre Forschungen im Bereich der Genetik privat fortsetzen wollen“, hieß es, und das war die Zugabe, die Scherrer nach Karlsruhe gehen ließ.
Scherrer hasste den Stadtverkehr, dessen Lärm bis zum Turmberg heraufbrandete. Zu seinem Institut war es nicht weit, deshalb nahm er stets die Straßenbahn Linie S5, die ihn zusammen mit Studenten und Angestellten bis zum Institut brachte. Auch die Enge in der Straßenbahn mochte er nicht, aber man kannte ihn und hielt ihm einen Sitzplatz an der Tür frei, damit er sie nicht ganz so sehr spüren musste. Scherrer genoss diese Sonderstellung, die er als Professor beanspruchen durfte. Er mochte es nicht, dass ständig irgendein Handy klingelte und sich die Leute mit anderen, die fernab waren, über private Dinge unterhielten. Deshalb merkte er nicht sofort, dass es sein Handy war, das sich an diesem Morgen aufdringlich meldete.
Anne Neidhardt, seine Assistentin, eine junge Frau mit braunem, dichtem Wuschelkopf, wohnte ebenfalls in Durlach, wo sie eine kleine, aber sehr feine Altbauwohnung bekommen hatte, und fuhr mit der gleichen Straßenbahn in das Institut. Sie stand in seiner Nähe und beugte sich zu Scherrer hinunter. „Herr Professor, Ihr Handy“, sagte sie leise.
Scherrer suchte in seinen Manteltaschen nach dem klingelnden Gerät. „Danke, Frau Neidhardt“, sagte er und lächelte. „Der Umgang damit ist noch etwas ungewohnt.“
Sybille Walter, Journalistin bei der bekannten Welt der Wissenschaften, amüsierte sich über die Szene, denn irgendwie passte das Handy nicht ganz zu dem älteren Herrn.
„Ja, bitte!“ Scherrer hielt das Handy ans Ohr, aber niemand meldete sich. Stattdessen erschienen auf dem Display Bilder einer Pflanze. Scherrer wollte das Handy schon wieder einstecken, als sein Blick auf das Display fiel. Der Bildschirm flackerte und meldete eine ganze Reihe von E-Mails als Schriftzüge auf dem Hintergrund der Arabidopsispflanze. Es war eine lange Liste von neuen Eigenschaften, die man dieser kleinen, unscheinbaren Pflanze gegeben hatte. Arabidopsis konnte nun Kunststoff herstellen, Minen anzeigen, neue Wirkstoffe produzieren und langwierige Tests verkürzen. Scherrer sah die Nachrichten gelangweilt durch. So viele Universitäten arbeiten mit der gleichen Pflanze, dachte er. Die Ackerschmalwand, Arabidopsis thaliana, war wohl auch die geeignete Pflanze dafür. Das enorm kleine Genom machte sie so wunderbar manipulierbar.
Plötzlich erschien eine Nachricht auf dem Display und unterbrach die Arbeit. Scherrer klickte sie weg, aber sofort war die Nachricht wieder da. Ärgerlich versuchte er das Handy auszuschalten. Anne Neidhardt und Sybille Walter verfolgten gespannt, wie Scherrer sich bemühte. Aber das Handy war nicht auszuschalten.
„Was ist die wichtigste Frage in Ihrem Leben?“
Eine Sekte?, dachte Scherrer amüsiert. Ausgerechnet bei mir? Vergeblich bemühte er sich, die Schrift zu löschen. „Drücken Sie auf Okay“, mahnte das Display. Weil alles andere vergeblich war, gab Scherrer nach. Sofort verschwand die Nachricht und Bilder erschienen. Ein Computerspiel?, fragte sich Scherrer interessiert. Aber die Bilder, die dort liefen, waren seine Bilder. Erinnerungen aus längst vergangenen Tagen tauchten auf. Er und Nubi, sein ägyptischer Freund, gemeinsam in der Wüste, im Sandsturm, ein Sarkophag auf einem Jeep, eine wilde Verfolgungsjagd. Beduinen auf weißen Pferden jagten dem Auto nach, das in Höchstgeschwindigkeit durch die Wüste fuhr. Schüsse fielen. Zum Glück trafen sie nicht. Dann hüllte eine Staubwolke Verfolger und Verfolgte ein. Scherrer erinnerte sich. Das war die wildeste Jagd, die er je erlebt hatte. Und trotzdem hatten sie es geschafft, den Sarkophag aus der Wüste nach Tübingen zu bringen.
Das Gesicht der Göttin Hathor füllte den Bildschirm aus. Sie schien ihn anzusehen und ihm zuzuzwinkern. Dann verschwand Hathors Bildnis und der Eingang zu einem Grab erschien. Die Kamera lief den langen Gang hinunter, zeigte das Innere der leeren Grabkammer und leuchtete die Kammer aus. An den Wänden erkannte Scherrer Szenen aus dem ägyptischen Totenbuch. Die Seele des Pharao stand vor ihrem Richter. Auf der Waage lag das zitternde Herz des Menschen. Im Hintergrund wartete ein gieriges Krokodil auf das Urteil. „Möge dein Herz nicht schwerer sein als eine Feder“, murmelte Scherrer und sah gebannt weiter auf das Display.
Die Kamera wandte sich einer Scheintür zu und blieb stehen. Ganz groß zeigte sie das Bild der geheimnisvollen Tür, die in jedem ägyptischen Grab aufgemalt war. Aber alle bisherigen Forschungen hatten gezeigt, dass sich nichts dahinter befand. Es war nie eine reale Tür und doch war sie so realistisch gemalt und wohl auch gemeint. „Möchten Sie weiter, dann klicken Sie Okay“, meldete das Display.
Scherrer sah wie gebannt auf die Scheintür. Alle Fragen, die ihn unterschwellig beschäftigt hatten, waren plötzlich wieder da. Gab es einen anderen Weg als den Schritt durch diese geheimnisvolle Tür? Mit Bohrwerkzeugen konnte man der Lösung des Problems nicht näher kommen, das wusste Scherrer recht gut. Aber vielleicht kam man auf anderem Wege der Lösung näher. Deshalb hatte er damals den Sarkophag von den Beduinen gekauft und die wilde Verfolgungsjagd riskiert. Deshalb war er all die Jahre immer wieder in Ägypten gewesen und hatte Kunstgegenstände mitgenommen. Seine Sammlung war berühmt geworden, aber sie hatte auch keine Antwort gebracht. Seine brennende Frage: „Gibt es keine Möglichkeit, dem Tode zu entrinnen?“, hatte ihn nie losgelassen.
Nun sah er die Tür wieder vor sich und die Lösung schien so nahe. Wie magisch zog ihn das kleine Feld auf dem Bildschirm an. Er holte die Pfeilspitze auf das „Okay“ und drückte. Sofort verschwand alles vom Bildschirm und eine tiefschwarze Fläche sah ihn an.
„Herr Professor, wir müssen hier aussteigen“, sagte Anne Neidhardt und schüttelte ihren braunen Wuschelkopf.
Scherrer sah irritiert auf. Über dem Display hatte er die rumpelnde Straßenbahn und die Fahrgäste völlig vergessen. „Natürlich“, sagte er. „Natürlich! Vielen Dank, Frau Neidhardt.“
Er ging mit den anderen Fahrgästen zur Tür und stieg aus. Dabei wirkte er etwas benommen und Anne fragte sich, ob sie ihm noch einmal Hilfe anbieten sollte. Aber dann wollte sie nicht aufdringlich sein und reihte sich in den Strom der Studenten ein, die zur Universität gingen.
Sybille sah dem Herrn Professor aus dem Fenster der Straßenbahn nach. Immer noch ein faszinierender Mann, dachte sie. Ich möchte wissen, warum er hier in Karlsruhe ist, der ist doch einer von den ganz Großen.
Scherrer ging zu seinem Institut. Bis auf die seltsame Unterbrechung in der Straßenbahn begann der Tag wie gewohnt. Scherrer hatte es eilig, in sein Büro zu kommen. Hatte sich jemand in seinen Computer eingeloggt und war deshalb die Liste der E-Mails auf dem Handy erschienen? Scherrer war erleichtert, als er die grünen Türen zu seinem Institut aufschloss und alles wie gewohnt vorfand. Anneliese, seine Sekretärin, saß noch nicht an ihrem Platz, aber auch das war ihm heute Morgen recht, denn so konnte er gleich seinen Computer anschalten. Auf dem Computer erschien aber kein Bild. Die gleiche schwarze Fläche sah ihn an, die ihn auch schon in der Straßenbahn auf dem Display seines Handys so erschreckt hatte.
„Nichts?“, fragte sich Scherrer irritiert. „Oder kann ich nur nicht sehen, weil meine Augen an das Licht gewöhnt sind?“
„So ist es“, sagte eine Stimme hinter ihm.
Erschreckt drehte sich Scherrer um: „Wer sind Sie? Woher kommen Sie? Was tun Sie hier?“
„So viele Fragen auf einmal und doch nur eine einzige Frage“, sagte der Mann im weißen Kittel, der in seinem Büro stand. „Ich bin Ihr neuer Mitarbeiter!“
„Was tun Sie in meinem Büro?“
„Ich möchte mich vorstellen.“
„Aber ich habe niemanden angefordert. Sie wissen sicher auch, dass die Mittel sehr begrenzt sind.“
„Es war Zeit, zu kommen, deshalb konnte ich mich nicht anmelden, was mir sehr leidtut. Mein Name ist Meyer. Ein ganz gewöhnlicher Name und doch mit einer Besonderheit, „ey“. Etwas Besonderes muss unsere Bekanntschaft schon haben.“
„Was wollen Sie? Haben Sie nicht das Schild an der Tür gelesen?“
„Doch, Professor Dr.Dr.Scherrer. Das heißt: Dr. rer nat und Dr. phil mit dem Spezialgebiet Ägyptologie. Sprechstunde nur nach Voranmeldung.“
„Woher wissen Sie das?“, fragte Scherrer.
„Was?“
„Den Doktor der Ägyptologie.“
„Ihre Arbeiten über das Totenbuch der Ägypter sind bemerkenswert.“
„Aber sie sind in der Bibliothek und nicht allgemein zugänglich.“
„Es gibt Wege, sich zu informieren“, lachte Meyer. „Jetzt enttäuschen Sie mich, Herr Professor.“
Scherrer sah seinen Gesprächspartner ungehalten an. Das Gespräch lief nicht nach seinen Wünschen. „Was wollen Sie?“
„Ich bin Ihr neuer Mitarbeiter. Die Forschungen …“
„Was wissen Sie von unseren Forschungen? Wir hatten strengste Geheimhaltungsstufen in Tübingen“, unterbrach ihn Scherrer heftig.
Meyer sah ihn mit schwarzen, unergründlichen Augen an. „Ihre veröffentlichten Arbeiten habe ich gelesen, und ich sagte schon, dass es verschiedene Wege gibt, Informationen einzuholen. Es ist Zeit, dass ich mit Ihnen persönlich zusammenarbeite.“
„Sind Sie schon länger in der Gentechnik tätig?“, fragte Scherrer. „Nehmen Sie doch Platz!“
Meyer setzte sich in den Sessel vor dem Schreibtisch und sah Scherrer unverwandt an. Der durchdringende Blick seines neuen Mitarbeiters ließ ihn stiller werden. Ich kann mich gegen ihn nicht wehren. Ich brauche ihn, und weiß nicht warum, dachte Scherrer.
„Sie brauchen mich“, sagte Meyer und lächelte, „weil Sie ein Forschungsgebiet betreten, das neue Dimensionen erschließt.“
Was weiß er wirklich?, überlegte Scherrer.
Ein Kratzen im Hals rief einen Hustenanfall hervor, wie er ihn bisher noch nicht erlebt hatte. Keuchend versuchte er Luft zu bekommen. Krächzend rasselte der Atem. Todesangst befiel ihn. Das Büro begann sich zu drehen. Krampfhaft hielt sich Scherrer an seinem Schreibtisch fest. Meyer saß ihm ruhig gegenüber und sah zu. „Helfen Sie mir“, keuchte Scherrer, als er wieder ein wenig Luft bekam. „Dort, dort!“ Er zeigte auf die kleine Sprayflasche, die unerreichbar für ihn auf dem Schreibtisch stand. Gelassen stand Meyer auf, nahm das Spray, kam zu ihm, nahm seinen Kopf, beugte ihn nach hinten, öffnete mit geschicktem Griff den verkrampften Mund und sprühte die Flüssigkeit hinein. Sofort ließ der Husten nach. Scherrer holte tief Luft und atmete freier. Die Nebel verzogen sich. Er sah nach Meyer. „Danke, dass Sie mir geholfen haben. Sie kennen sich aber aus! Sind Sie auch Arzt?“
„Könnte man fast meinen“, bestätigte Meyer. „Ich habe neben dem genetischen Fach auch medizinische Seminare besucht. Wer sich mit dem Tod beschäftigt, muss viele Kenntnisse haben.“
„Sie beschäftigen sich mit dem Tod?“, fragte Scherrer.
„So wie Sie“, sagte Meyer. „Seit ich ihm begegnet bin, kommt er mir nicht mehr aus dem Sinn. Ich fühle mich ihm nahe und ich glaube, dass wir mit der modernen Forschung die Möglichkeit haben, ihn zu entschlüsseln.“
„Glauben Sie?“, fragte Scherrer. „Glauben Sie wirklich?“
„Professor Scherrer“, sagte Meyer. „Erinnern Sie sich an Ihren Aufenthalt in Ägypten?“
Plötzlich war Scherrer wieder dort. Ein Sandsturm tobte mitten in der Wüste. Der Staub legte sich auf alles. Eine feine, gelbe Schicht überzog die Windschutzscheibe des Jeeps. Vergeblich versuchten die Scheibenwischer gegen den Staub anzukommen. Nubi, sein Freund und Geschäftsmann aus Luxor, kannte die Wüste wie kein Zweiter, aber in diesem Sturm war jede Orientierung unmöglich. Feiner gelber Staub legte sich auch auf den Sarkophag, der auf der Ladefläche des Kleinlasters stand, als wolle die Wüste ihr Eigentum zurückholen. Scherrer öffnete das Seitenfenster, um mit der Hand die Windschutzscheibe zu reinigen. Sofort breitete sich der Staub auch im Innenraum des Autos aus. Entsetzt drehte er die Scheibe hoch.
„Wir müssen anhalten, Scherrer“, sagte Nubi. „Wir haben keine Chance mehr weiterzukommen. Gebe Allah, dass der Sandsturm sich bald legt.“
„Was ist, wenn sie uns einholen?“, fragte Scherrer.
Nubi drehte sich um, wickelte den Turban langsam vom Kopf und sah den jungen Wissenschaftler lächelnd an. „In dem Falle gnade uns Gott. Du kennst die Beduinen nicht.“
Scherrer versuchte aus dem Fenster zu sehen, aber der feine Staub machte jede Sicht unmöglich. „Warum haben sie uns den Sarkophag verkauft, wenn sie uns nun verfolgen, um ihn uns wieder abzunehmen?“, fragte er.
Nubi nahm die Hände vom Lenkrad und bückte sich nach vorne, um eine Flasche Wasser aus dem Handschuhfach zu nehmen. Er hielt sie Scherrer hin. „Trink, mein Freund! Deine Lungen sind den Staub nicht gewöhnt. Er könnte dir schaden.“
Scherrer nahm die Flasche, öffnete sie und hielt sie hoch wie ein Weinglas. „Auf unsere Freundschaft. Möge sie ein Leben lang so ungetrübt wie dieses Wasser sein.“
Nubi lachte. „Du wählst einen guten Trinkspruch. Klares Wasser ist die größte Kostbarkeit in der Wüste. Unsere Freundschaft ist auch für mich eine Kostbarkeit, sonst hätte ich mich auf dieses Abenteuer nicht eingelassen.“
Scherrer genoss das klare Wasser und reichte seinem Freund die Flasche zurück. „Der Sturm wird unsere Spuren auch für den besten Fährtensucher verwischen.“
„Auch die Straße“, ergänzte Nubi. „Uns bleiben nur die Sterne, wenn der Sturm bis zur Nacht abflaut. Der Sirius wird dann unser Leitstern sein. Wenn wir Luxor erreichen, sind wir in Sicherheit. Der weitere Transport ist dann kein Problem.“
„Warum verfolgen uns die Beduinen?“, wiederholte Scherrer seine Frage. „Haben sie nicht ein gutes Geschäft gemacht?“
„Du kennst die Beduinen nicht“, sagte Nubi. „Sie sind Kinder der Wüste, aber auch Nachfahren der Pharaonen. Jedenfalls empfinden sie sich so. Wenn sie Geld sehen, verfallen sie ihm wie wir alle, aber wenn sie wieder allein mit der Wüste sind, dann hören sie tausendfach Vorwürfe. Der Sand, die Ruinen, die Zelte wispern: ‚Was habt ihr getan? Sie sind eure Feinde! Sie haben euch betrogen! Der Geist des Pharao wird euch verfolgen!‘ Dann erwachen wieder die Gefühle für das Land, für die Tradition. Dann wird der Fremde zum Grabräuber, den man verfolgt und tötet.“
„Sind sie nicht selber seit Jahrtausenden Grabräuber? Es gibt kaum eine Grabstätte, die nicht ausgeraubt wurde!“, regte sich Scherrer auf. „Diesen Widerspruch verstehe ich nicht!“
„Sie holen das Gold aus dem Wüstensand, weil es sie lockt, weil es ein einfaches Leben verspricht, mein Freund. Menschen sind so. Zwischen religiösen Ansprüchen und der Wirklichkeit liegen auch bei euch Welten, oder?“, sagte Nubi.
Scherrer nickte. „Das ist leider wahr. Aber der Sarkophag von Ammenemes VII wurde doch nie benutzt.“
„Nein, dieser Ammenemes ist unbekannt. Trotzdem glaube ich, dass der Sarkophag echt ist. Wenn ein Pharao den Thron bestieg, begannen die Arbeiter mit den Vorbereitungen für sein Grab. Unsterblichkeit zu erreichen, die ewige Vereinigung mit Isis als Osiris, das war das wichtigste Lebensziel für den Pharao. Nur, wenn er mit allen verfügbaren Mitteln daran arbeitete und arbeiten ließ, war es vielleicht möglich, die Unsterblichkeit zu erlangen.“
„Ewige Jugend und Unsterblichkeit“, sagte Scherrer, „der uralte Menschheitstraum.“
„Du verwechselst da etwas“, sagte Nubi. „Unsterblichkeit ist ein Platz bei den Göttern und bedeutet nicht ewige Jugend sondern eher ein Aussteigen aus dem ewigen Kreislauf von Geborenwerden und Sterben. Aber jetzt lass uns schlafen. Hörst du den Sturm? Wir können nichts tun, aber nachher brauchen wir die volle Konzentration. Also jetzt keine unnützen Diskussionen mehr!“
Nubi drehte den Sitz hinunter und schloss die Augen. Der treibende Sand schliff am Lack des Autos, der Wind heulte um die Karosserie ein eintöniges Lied. Scherrer gab der Müdigkeit nach.
Stunden später hörte das gleichmäßige Schleifen auf und plötzlich umgab sie atemlose Stille. Die Stille ließ sie erwachen.
„Wir müssen raus“, sagte Nubi. Er versuchte die Fahrertür zu öffnen. Der Wüstensand hatte eine hohe Barriere angehäuft. Nubi bekam die Tür gerade weit genug auf, um sich hinauszwängen zu können. Scherrer folgte ihm. Der Staub hatte sich gelegt, kein Windhauch wehte mehr. Rund um sie herum lag dicht der gelbe Sand. Der Jeep war weitgehend zugeweht, aber auch ihre Spuren. Von der Straße war nichts mehr zu sehen.
„Es wird Nacht“, sagte Scherrer. „Wie du es vorausgesehen hast. Die Sterne gehen auf.“
Nubi zeigte auf den hellsten Stern am Himmel. „Sieh dort den Sirius! Er wird uns sicher nach Hause leiten. Graben wir den Wagen aus!“
Gemeinsam schaufelten die Männer den gelben Sand zur Seite. Nubi startete den Wagen und war erleichtert, als er problemlos ansprang. Scherrer band die Sandleitern vom Dach, legte sie vor die Räder und der Jeep rollte über sie auf festeren Boden.
„Fahren wir los“, sagte Nubi. „Man wartet auf uns.“
Scherrer schaute aus dem Fenster und versuchte die Straße auszumachen. „Wonach orientierst du dich?“, fragte er den Freund.
„Nach dem Gefühl. In der Wüste musst du ein Gespür für den richtigen Weg haben. Das Ruckeln des Wagens, das Geräusch der Reifen, all das sagt dir, ob du auf festem Boden bist.“
„Allein wäre ich verloren“, erkannte Scherrer.
„Du bist kein Kind der Wüste“, sagte Nubi. „Du bist ein Träumer. Auf der Jagd nach einem ganz großen Traum. Du sehnst dich nach Unsterblichkeit. Wie kommst du nur auf solche Gedanken?“
Scherrer sah in die Dunkelheit hinaus. Die Sterne leuchteten so klar wie nie über Tübingen. „Vielleicht möchte ich nicht Unsterblichkeit, sondern eher den Augenblick festhalten“, sagte er.
„Werd ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön?“, zitierte Nubi. „Faust?“, fragte er.
„Vielleicht auch Faust. Es ist die Sehnsucht nach dem Leben und nicht die Angst vor dem Tod. Du fährst auf den Sirius zu? Nennt man ihn nicht den ‚Schoß der Isis‘?“
„Genau dort ist der Platz der Götter“, sagte Nubi. „Du denkst auch daran? Vor ihr geht Osiris, das Sternbild des Orion. Er ist der Mann, hoch aufgerichtet das ‚Schwert des Orion‘.“
„Die Menschen früher dachten sehr konkret“, sagte Scherrer.
„Aus der Erfahrung, aus dem Überleben. In der Wüste kann niemand allein überleben. Nur die Gruppe, die Familie macht ein Leben möglich. Eine Aufgabe von Mann und Frau ist es, Kinder zu haben. Leben muss weitergegeben werden, gezeugt werden, nur so kann Leben weiterbestehen. Das ist das Geheimnis des Lebens und das Geheimnis der Götter.“
„Der Pharao strebte an, ein Osiris zu werden und mit Isis …“ Scherrer verstummte nachdenklich.
„Mit Isis Mann und Frau zu werden“, sagte Nubi. „Die Pyramiden sind auf dieses Sternbild ausgerichtet, um das möglich zu machen. Der ‚Schoß der Isis‘ ist das Ziel der Pyramiden. Isis ist auch unser Ziel. Die Frauen warten sicher schon ungeduldig auf uns.“
„Auf dich, Nubi“, sagte Scherrer.
„Die Tänzerin, die ich für den Abend eingeladen habe, wird auch dich erfreuen.“
„Du weißt, ich danke dir sehr, aber nicht hier“, sagte Scherrer ablehnend.
„Ihr lebt zu sehr im Kopf“, sagte Nubi. „Zum Leben gehört der ganze Körper. Ihr Europäer wollt ewige Jugend, aber ihr nehmt das Leben nicht wahr.“
„Als Wissenschaftler muss ich meinen Kopf anstrengen“, sagte Scherrer. „Nur damit wird die Welt gewonnen, nur mit strenger, wissenschaftlicher Arbeit können wir die Probleme unserer Zeit lösen.“
Nubi schaute auf die Sterne und lenkte den Wagen mit hoher Geschwindigkeit und Präzision durch die fahle Dünenlandschaft. „Habt ihr die Probleme lösen können? Warum wolltest du unbedingt einen Sarkophag kaufen? Denkst du nicht ganz anders, als du meinst?“
Scherrer lachte. „Vielleicht hast du recht. Ich bewundere, wie sicher du deinen Weg durch die Wüste findest. Mich faszinieren die Gedanken und das Wissen eurer Kultur.“
„Es ist nicht mehr unsere Kultur“, wehrte Nubi ab. „Wir verehren zwar die alten Ägypter, aber wir hatten sie vergessen. Es war Napoleon, der sie uns wieder schenkte und auch nahm. Wir lieben und hassen die Europäer dafür. Aber im Ernst, wofür wolltest du den Sarkophag? Nur für deine Sammlung?“
„Erwischt“, sagte Scherrer. „Er bedeutet mir mehr. Er ist Mahnung und Ansporn zugleich.“
„Woran arbeitest du eigentlich? Du sprachst von ganz neuen Erkenntnissen.“
„Zwei Wissenschaftler, Watson und Krick, haben das Geheimnis des Lebens in einem Nucleinsäuremolekül entdeckt.“
Nubi schwieg und gab Gas, um eine flache Düne hochzufahren. Jede geringste Abweichung von der Geraden würde den sicheren Tod bedeuten. Ruhig zog der Wagen hoch. Oben auf der Düne sah man am Horizont eine Kette schwacher Lichter. Nubi hielt den Wagen an.
„Schau, Scherrer, dort liegt Luxor. Wir sind bald zurück in der Welt. Die Wüste liegt hinter uns.“
Hell strahlten die Sterne im dunklen Blau des Wüstenhimmels.
„Du liebst die Wüste?“, fragte Scherrer.
„Die Beduinen sagen: Die Wüste liebt nur der, der sie nicht kennt. Wahrscheinlich haben sie recht“, antwortete Nubi.
„Du hast den Weg ins Leben zurückgefunden“, scherzte Scherrer.
Nubi sah seinen Freund nachdenklich an. „Wenn du den Sarkophag betrachtest, solltest du daran denken, dass Unsterblichkeit nicht ewige Jugend verspricht. Vergiss über deinen Forschungen nicht zu leben.“
„Versprochen“, sagte Scherrer und hielt seinem Freund die Hand hin.
„Sage bitte nichts in meinem Haus von dem Sarkophag. Ich weiß nicht, wie meine Leute darüber denken“, bat Nubi.
„Und du? Wie denkst du darüber?“, fragte Scherrer.
„Dieser Sarkophag wurde nie benutzt. Er wurde gemacht, um einem Menschen den Weg in die Unsterblichkeit zu ermöglichen. Vielleicht wirst du mit deiner Arbeit unsterblich, und ich habe meinen Teil daran.“
Nubi gab Gas und fuhr in rascher Fahrt auf Luxor zu. Scherrer lachte noch amüsiert, als sie das Tor in den Palmengarten erreichten, der das große Anwesen umgab. Die Palmen rauschten, als sie ausstiegen. Von der Wüste her wehte ein leichter Wind in die Oase. Scherrer sah fragend zum klaren Himmel hinauf.
„Es wird so bald keinen Sandsturm mehr geben“, sagte Nubi. „Komm, wir gehen hinein.“
Nach dem Essen saßen die Männer im Kreis zusammen und tranken süßen Pfefferminztee. Eine Tänzerin trat ein. Sie trug die üblichen weiten Hosen und einen Büstenhalter mit Münzen und Ketten. Hinter ihr kamen ein kleiner Mann mit Tamburin und zwei Flötenspieler herein. Sie setzten sich und der Mann begann einen betörenden Rhythmus zu schlagen. Ein Zittern ging durch den Körper der Frau. Rhythmisch begann sie mit dem Bauch zu schwingen. In wildem Takt klopften ihre Füße, ihre Hüften schwangen hin und her. Sie durcheilte den Kreis der Männer, zog einen Schleier hinter sich her, der die Gesichter streifte, war zum Haschen nah und doch unnahbar. Keiner der Männer regte auch nur eine Hand, um sie zu fangen. Hin und her sprang sie in wildem Tanz, blieb stehen, schüttelte die großen Brüste und schwang ihr Tuch über den Kopf. Plötzlich erlosch die Musik. Die Tänzerin ging von Mann zu Mann, schwang ihren Oberkörper zitternd hin und her, dass ihre Brüste bebten. Die Männer steckten ihr Geldscheine in den Büstenhalter. Auch vor Scherrer blieb sie stehen und musterte den jungen Europäer mit klugen Augen. Der nahm einen großen Geldschein und steckte ihn in den Büstenhalter. Die Frau zuckte zusammen, als seine Hände sie unabsichtlich berührten. Rasch schlang sie das Tuch um den Kopf, um sich zu verhüllen, aber ihre dunklen Augen blieben auf ihn gerichtet, Frage und Bitte zugleich. Ruhig ging sie weiter, durchschritt den Kreis und bedankte sich mit einer tiefen Verbeugung. Ihr letzter Blick mit einem Augenaufschlag galt ihm.
„Herr Professor“, unterbrach Meyer. Die Bilder aus längst vergangenen Tagen verschwanden und Scherrer sah sich dem seltsamen Gast wieder gegenüber. „Seit Ihrem ersten Besuch in Ägypten träumen Sie davon, den Tod zu entschlüsseln, Herr Professor. Der Papyrus über Ihrem Schreibtisch ist mir wohlbekannt.“
„Sie haben sich aber genau mit meiner Person beschäftigt“, stellte Scherrer gereizt fest.
„Man sollte den kennen, mit dem man zusammenarbeiten möchte“, antwortete Meyer.
„Aber jetzt lassen Sie mich bitte allein“, bat Scherrer. „Auf dem Schreibtisch liegen viele Dinge, die ich erledigen muss. Geben Sie Ihre Bewerbung bei meiner Sekretärin ab.“ Meyer erhob sich und ging. An der Tür rief ihn Scherrer zurück. „Dr.Meyer, eigentlich würde ich einen Gärtner brauchen, aber ich bin gespannt, wie sich unsere Zusammenarbeit entwickeln wird. Lassen Sie sich einen vorläufigen Ausweis ausstellen. Haben Sie noch Fragen?“
„Nein!“ Meyer verneigte sich und verschwand.
Ohne Zögern wandte sich Scherrer seiner Arbeit zu. Habe ich die Tür gehen hören?, fragte er sich schon wieder in die Arbeit vertieft. Er sah kurz auf. Sein Büro lag wie immer um diese Zeit im Schein der Mittagssonne, die alles heller und freundlicher werden ließ. Der seltsame Gast war verschwunden. Ich muss es überhört haben, dachte Scherrer, ich bin überarbeitet. Ich sehe Dinge und Personen, die es nicht gibt.
Dann rief er seine Sekretärin an. Er sagte nicht einmal Guten Morgen, sondern gleich: „Anneliese, können Sie versuchen, über einen Dr.Meyer etwas herauszubekommen? Er ist Gentechniker und wahrscheinlich ein bekannter Mann. An welcher Universität er gearbeitet hat, ist mir unbekannt, aber als Doktor muss er veröffentlicht haben. Er wird Ihnen seinen vollständigen Namen genannt haben.“
„Hier war niemand“, erklärte sie. „Dr.Meyer sagten Sie? Ohne Vornamen und das Geburtsdatum werden wir unter diesem Namen zu viele Einträge finden, um ihn sicher ausmachen zu können.“
Dr.Meyer wurde ohne weitere Probleme ein enger Mitarbeiter von Scherrer im Botanischen Institut.
Auch Sybille Walter hatte es eilig, an ihren Computer zu kommen. Sie klickte eine der bekannten Suchmaschinen an und gab den Namen Scherrer ein. Interessiert las sie über seine langjährige Tätigkeit in Tübingen am genetischen Institut, über seine großen Erfolge, die plötzliche Emeritierung und die Berufung nach Karlsruhe. „Um den Botanischen Garten will er sich kümmern?“, las sie erstaunt. Aber der doch nicht! Da steckt sicher mehr dahinter. Eine Frau? Wäre ihm zuzutrauen. Der lässt sicher immer
2. KAPITEL
Die Arbeit im Institut war einfach. Meist ging es darum, Pläne für den Botanischen Garten zu entwerfen. Scherrer hatte immer neue Wünsche. Am liebsten wollte er die ganze Welt auf engstem Raum zeigen. Da er sehr viel und weit gereist war, kannte er die Vegetation vieler Länder und bestand auf möglichst originalgetreuen Nachbildungen der Landschaften. Außerdem verfolgte Scherrer weiterhin mit großem Interesse die Forschungen in der Morgenstelle Tübingen, als sei er immer noch der Chef des Genetischen Institutes.
In der Mittagszeit pflegte er durch den Fasanengarten zu spazieren und hatte es sehr gern, wenn sich Anne Neidhardt, seine Doktorandin, die Zeit nahm, mit ihm die alten Bäume zu bewundern.
Anne erledigte alle Arbeiten zu seiner Zufriedenheit, aber sie merkte, dass sie in ihren eigenen Forschungen nicht recht weiterkam. Sie sah, wie man sich in Tübingen bemühte, neue Pflanzensorten zu züchten, aber sie erkannte auch, dass alle Institute an den gleichen Pflanzen forschten. Immer kamen neue Tomaten – oder Maissorten auf den Markt, aber an die wichtigen Pflanzen zur Versorgung der Menschheit wie Baumwolle oder Weizen wagte sich kaum jemand heran. In welche Richtung wollte sie ihre eigenen Forschungen ausrichten?
„Warten Sie ab! Sobald wie möglich werde ich Ihnen ermöglichen zu reisen und Sie werden die Welt sehen. Dann werden Sie helfen, den Hunger in der Welt zu besiegen. Noch arbeiten wir an einem Botanischen Garten, aber so lernen Sie die Pflanzen kennen, die in aller Welt wachsen, und dann werden Sie auch Ihr spezielles Forschungsbiet finden. Ich bin sicher, Sie werden das schaffen“, tröstete Scherrer Anne Neidhardt auf den gemeinsamen Spaziergängen.
„Natürlich möchte ich das gern“, antwortete Anne, „aber ich bin an dieses Botanische Institut gefesselt, das zwar sehr interessant ist und mir doch nicht das ermöglicht, was ich eigentlich möchte.“
Auf ihren Spaziergängen begegneten sie oft einer jungen Frau, die mit einer Aktentasche unter dem Arm immer eilig zum Schloss lief. Sie trug auffallend hohe Absätze und einen kurzen Rock, der ihre langen Beine zur Geltung brachte. Die langen blonden Haare fielen über ihre schönen Schultern. Zuerst eilte sie nur vorbei und Professor Scherrer sah ihr nach. Aber als sie ihr öfter begegneten, spürte Anne Neidhardt, dass das wohl kein Zufall war. Sie sah auch, dass Professor Scherrer von dem Anblick der jungen Frau sehr angetan war. Was will sie wohl?, fragte sich Anne. Aber dann waren ihre Gedanken wieder ganz bei ihrer Arbeit.
Dr.Meyer bemerkte, wie sehr Anne hin- und hergerissen war, und half ihr auf seine sonderbare Art.
„Frau Neidhardt“, begrüßte er sie eines Morgens vor dem Institut. „Bevor Sie an Ihre Arbeit gehen, möchte ich Ihnen eine kleine Pflanze zeigen. Professor Scherrer weiß Bescheid. Wenn Sie möchten, dann kommen Sie mit zum Forschungszentrum für Umwelt. Es ist nicht weit. Wir müssen nur den Adenauer Ring hinuntergehen.“
„Ich weiß“, sagte Anne ungehalten. „Aber die Arbeit wartet. Gerade heute habe ich mir so viel vorgenommen.“
„Wir können leider nicht mehr warten“, sagte Meyer und sah sie eindringlich mit seinen schwarzen Augen an. „Die Pflanze stirbt ab, und dann kann ich Sie Ihnen nicht mehr zeigen.“
„Ich bringe eben meinen Rucksack hinein“, sagte Anne, nun doch interessiert, „dann komme ich mit Ihnen. Ich bin gespannt, was Sie für mich entdeckt haben.“
Sie mochte Dr.Meyer nicht, denn er schien ihr nicht ehrlich. Natürlich setzte er sich für den Botanischen Garten ein wie kein Zweiter und seine globalen Pflanzenkenntnisse waren wirklich ungewöhnlich. Besonders die Vegetation Nordafrikas beherrschte er wie niemand sonst. Das brachte ihm auch bei der Universitätsleitung manches Lob ein, aber er schien auch andere Ziele zu verfolgen, über die er nie sprach.
Nachdenklich öffnete sie die blaue Tür zum Institut, bewunderte wie fast jeden Morgen kurz die feine Stuckarbeit an der Backsteinfassade, sprang schnell die Stufen zum ersten Stock hoch, lief den langen Gang entlang bis zu ihrem Zimmer und war kurz darauf zurück. „Ich bin wieder da“, sagte sie, ein wenig außer Atem und schüttelte ihren braunen Wuschelkopf.
„Dann können wir losgehen.“
Dr.Meyer schritt kräftig aus und Anne hatte Mühe mitzukommen. Zwar machte ihr Joggen nichts aus, aber Meyer hatte einen ungewöhnlichen Rhythmus und sie hatte Schwierigkeiten, sich seinem Schritt anzupassen.
Am Botanischen Garten hielt Meyer an und zeigte auf die Gewächshäuser. „Die Scheiben sind trüb geworden. Es wird schwer sein, die Gewächshäuser wieder in Ordnung zu bekommen. Die langen Baumaßnahmen schaden den Pflanzen. Wir werden auch da weiterhin investieren müssen, aber das wissen Sie ja aus den vielen Anträgen, die ich stelle. Wir brauchen einen Sponsor, eine Firma, die unsere kleinen Forschungsarbeiten so unterstützt, dass wir die großen Aufgaben bewältigen können.“
„In der Führung eines Botanischen Gartens sehen Sie eine große Aufgabe?“, fragte Anne erstaunt. „Sie wissen doch auch, dass die systematische Botanik aus dem Blickzentrum der Forschung herausgefallen ist. Alle Forscher beschäftigen sich nur noch mit Genen.“
„Es ist nicht gut, dem allgemeinen Strom nachzuschwimmen“, sagte Meyer. „Wenn man wirklich bahnbrechende Erkenntnisse finden möchte, muss man ungewöhnliche Wege gehen.“
„Sie denken an Heinrich Hertz, der hier in Karlsruhe gearbeitet hat, und seine Entdeckung der elektromagnetischen Wellen?“
„Wie kommen Sie gerade darauf?“, fragte Meyer. „Ja, zum Beispiel an ihn. Niemand hielt elektromagnetische Wellen für möglich und heute arbeitet alle Welt mit seiner Entdeckung.“
„Gehen wir also auch ungewöhnliche Wege“, sagte Anne und lächelte. „Also, was wollten Sie mir zeigen?“
„Kommen Sie“, sagte Meyer. „Wir haben es nicht mehr weit.“
Bald hatten sie den Eingang zum Umweltzentrum erreicht.
„Wir gehen unter dem gelben Verbindungsbau hindurch“, schlug Meyer vor. „Dort ist die Wiese, die ich Ihnen zeigen möchte.“
Anne schaute bewundernd in die Runde. „Der Innenhof ist aber schön gestaltet“, meinte sie. „Ein runder Pavillon mit einer Pflanzenkrone zum Treffen in der Mittagspause ist doch etwas Schönes. Wenn es wirklich warm wird, dann ist dieser Platz sicher gut besucht.“
Meyer sah zum Himmel, wo graue Wolken entlangzogen. „Das späte Frühjahr hilft uns“, sagte er. „Sonst wäre die Pflanze, die ich Ihnen zeigen möchte, sicher schon verblüht.“
Anne folgte ihm neugierig. Sie gingen unter dem Verbindungsbau hindurch und standen dann an einer Wiese voller Habichtskräuter.
„Sehen Sie“, sagte Meyer, „die Wiese kann man kaum noch erkennen. Die Beschattung durch die hohen Bäume bringt für die Habichtskräuter den größten Vorteil. Die Wiese ist einschürig, das heißt, sie wird nur einmal im Jahr gemäht. Es ist ein seltener Magerrasen, denn natürlich wird sie nicht gedüngt. Aber nun kommen Sie. Die Pflanze, die ich Ihnen zeigen möchte, ist sehr klein.“
Er wandte sich nach Anne um. Sie war an einer der vierkantigen Säulen stehen geblieben, die überall in der Wiese standen. Auf den Säulen lagen Nachbildungen menschlicher Gehirne aus Stein. „Das sieht komisch aus“, meinte Anne. „So viele Gehirne und alle denken isoliert für sich allein. Es wirkt irgendwie unheimlich.“
„Das Gehirn ist nach der altägyptischen Vorstellung nicht das Wichtigste im menschlichen Körper“, sagte Meyer nachdenklich und zog die schwarzen Augenbrauen zusammen.
„‚Denklandschaft‘ hat der Künstler sein Kunstwerk genannt“, las Anne auf einem Schild vor.
„Wenn es danach ginge, müssten hier Herzen auf den Säulen liegen“, sagte Meyer, „denn nach der altägyptischen Heilkunst ist ja das Herz das Zentrum des Denkens und Fühlens und das Gehirn dient nur zu Kühlung des Blutes.“
Er schaute zu ihr hinüber, als erwarte er ein abschätziges Lächeln, aber Anne sagte ganz ruhig: „Dr.Meyer, wenn man mit Professor Scherrer zusammenarbeitet, dann lernt man auch die altägyptische Kultur kennen. Sie wissen doch um seine Vorliebe.“
„Lassen Sie die Gehirne ruhig weiterdenken“, sagte Meyer und schaute forschend zu Boden. „Hier ist Ihre Pflanze!“
Anne ging zu ihm und sah erstaunt auf eine kleine Pflanze, die deutlich zurückgesetzt hatte. Zwischen braunen Blättern ragte eine kleine Ähre nach oben, die Schötchen trug. Zwischen all den Habichtskräutern war sie kaum zu sehen.
„Das ist Ihre Pflanze“, sagte Meyer.
„Meine Pflanze?“, wunderte sich Anne. „Warum ist das meine Pflanze?“
„Vom Gefühl her weiß ich, dass diese Pflanze für Sie eine ganz besondere Bedeutung hat. Gestern war sie noch ganz grün und begann zu fruchten. Schade, dass sie heute abgestorben ist.“
„Vom Gefühl her“, lachte Anne, „und das sagen Sie hier zwischen all den Gehirnen.“
„Das Gehirn ist nicht das Wichtigste, sagten Sie selbst“, antwortete Meyer lächelnd. „Kennen Sie die Pflanze?“
„Sie kennen sie nicht?“, fragte Anne erstaunt.
„Doch“, sagte Meyer. „Ich kenne sie schon seit langer Zeit und habe sie überall gesucht. Mein Gefühl sagt mir, dass ich sie jetzt endlich gefunden habe.“
„Dann nehmen wir den Schatz mit“, schlug Anne vor. „Es ist Arabidopsis, die Ackerschmalwand. Sie hat größte Bedeutung für die Wissenschaft bekommen. Alle botanisch genetischen Institute arbeiten mit ihr, weil sie ein einfaches Genom hat und sich so gut verändern lässt.“
„Ich weiß“, sagte Meyer. „Aber dieses Exemplar hat für Sie eine ganz besondere Bedeutung. Nehmen Sie die Pflanze mit.“
„Soll ich sie herausziehen?“, fragte Anne. Sie bückte sich und zog das Pflänzchen aus dem Boden. Braun und welk lagen die Blätter in ihrer Hand und unscheinbar war auch die kleine Ähre mit den noch nicht ganz reifen Schoten.
„Sie ist abgestorben“, sagte Meyer.
„Aber Dr.Meyer, Sie sind ja richtig traurig“, wunderte sich Anne.
„So viele Jahre habe ich diese Pflanze gesucht“, sagte Meyer. „Nun ist sie an dem Tag verwelkt, an dem ich sie in Ihre Hände geben wollte.“
„Arabidopsis hat einen ganz festen Lebensrhythmus“, sagte Anne. „Das weiß ich von meinen Forschungen in Tübingen. Bei Scherrer musste man seine Diplomarbeit über Tomaten oder über Arabidopsis schreiben. Wir haben intensiv an der kleinen Pflanze geforscht. Angelika Richter und ich, wir hatten ein eigenes Labor. Es war eine schöne Zeit. Ich werde die Pflanze untersuchen und dann werden wir herausfinden, warum sie für mich so eine Bedeutung haben soll.“ Sie sah auf. Dr.Meyer strahlte sie an, wie Sie ihn noch nie hatten lächeln sehen. Ein bisschen verwundert sagte sie: „Jetzt müssen wir aber zum Institut zurück. Professor Scherrer wird uns schon vermissen.“
Anne nahm die Arabidopsis mit in ihr Labor und legte die welken Blätter unter das Mikroskop. Die Zellen in den Blättern waren fast alle abgestorben, nur wenige waren grün geblieben und schienen noch zu leben. Die haben den Befehl des Todes nicht bekommen, dachte Anne und sah vom Mikroskop auf. Sie hatte das Gefühl, nicht allein im Labor zu sein. Es war, als hätte ihr jemand dieses Wort vom Befehl des Todes zugeflüstert. Ja, sie kannte die Apoptose, den Zelltod, den eigenartigen Befehl, der von Zelle zu Zelle weitergegeben wurde und zum Absterben ganzer Gewebe führte.
Nachdenklich schaute sie aus dem Fenster. Im Spiegelbild glaubte sie eine Katze zu sehen. Keine Hauskatze, eher eine menschliche Gestalt mit dem Kopf einer Katze oder einer Löwin. Irritiert schaltete sie das Licht im Labor mit dem Schalter unter dem Tisch an und das seltsame Spiegelbild verschwand.
„Ein eigenartiger Tag“, sagte Anne vor sich hin. „Erst Meyer und seine Gedanken und nun meine Fragen … Arabidopsis wächst innerhalb von neunzig Tagen, kommt zur Fruchtreife und stirbt sehr schnell ab. Warum hat sich Meyer so gewundert? Sollte Arabidopsis ein Todesgen haben, das wie eine innere Uhr den Befehl zum Absterben von Zelle zu Zelle weitergibt? Was wäre, wenn die wenigen verbliebenen Zellen kein Todesgen hatten und deshalb den Befehl nicht verstehen konnten? Würden sie dann weiterleben? Sollten diese Zellen unsterblich sein? Würden sie sich immer weiter vermehren?“
Anne unterbrach das Selbstgespräch. Ich muss mit Professor Scherrer darüber reden, dachte sie und stellte das Mikroskop zur Seite. Dann sah sie sich im Labor um. Wir haben die nötigen Geräte, um die Zellen aus dem Zellverband zu lösen, dachte sie. Das Verfahren kenne ich von Angelika. Sie hat damals Kartoffelzellen isoliert und gereinigt. Das ließe sich auch hier mit den Arabidopsiszellen machen. Dann müsste man versuchen einen Kallus zu ziehen. Auch das war mit der Ausstattung hier möglich. Das gut eingerichtete Labor verfügte über Zentrifugen und Brutschränke mit Beleuchtung.
3. KAPITEL
Auf dem Schreibtisch häuften sich die Papiere. Scherrer nahm einen Brief auf, um ihn gleich wieder zur Seite zu legen. Das Telefon läutete. Scherrer sah den Apparat wie einen persönlichen Feind an, aber dann nahm er langsam ab. „Ja, bitte?“, fragte er in den Hörer.
„Ein Gespräch aus Luxor, Herr Professor. Dr.Nubi!“
„Danke, Anneliese, stellen Sie durch!“
Es rauschte einen Moment im Hörer, dann kam klar und deutlich die dunkle Stimme seines Freundes Nubi. „Edwin, bist du es?“
„Ja“, sagte Scherrer. „Welch eine Überraschung! Ich sitze hier am Schreibtisch und denke über neue Projekte nach. Dein Brief ist angekommen. Danke für deine Unterstützung.“
„Du hast lange nichts mehr von dir hören lassen, Edwin. Ich denke oft an die alten Zeiten und unsere interessanten Gespräche über die Unsterblichkeit. Du bist der Unsterblichkeit nun doch viel näher gekommen.“
„Wie meinst du das?“, fragte Scherrer irritiert.
„Man hört und liest viel von deinen Forschungen in der Gentechnik.“
„Ich hoffe, nur Gutes.“
„Leider nicht nur“, sagte Nubi. „Auch viel Kritisches. In den arabischen Ländern steht man den Experimenten der westlichen Welt sehr abwartend gegenüber. Die neuen Techniken greifen tief in das Geschehen am Lebendigen ein. Das weißt du selbst. Aber ich rufe aus einem anderen Grunde an. Wie du weißt, habe ich erreichen können, dass hier Versuchsfelder angelegt werden dürfen. Hättest du die Möglichkeit, dafür nach Ägypten zu kommen? Deine Anwesenheit würde dem Projekt mehr Bedeutung geben. Aber nicht nur deshalb! Ich würde mich freuen, wenn wir unsere alte Freundschaft auffrischen könnten. Es gibt auch neue sehr interessante Ausgrabungen. Kürzlich wurde das Grab eines Arztes entdeckt. Nein, nicht Imhoteb, ein bisher unbekannter Arzt. Trotzdem sehr interessant! An den Wänden sind viele Zeichnungen der alten Heilpflanzen. Das würde dich doch sicher interessieren. Du bist lange nicht mehr in Ägypten gewesen. Wirst du kommen?“
„Ich denke schon“, sagte Scherrer zögernd.
„Mein Freund“, sagte Nubi. „Ich habe das Gefühl, du könntest einen Urlaub von deinen Mikroskopen und Brutschränken gebrauchen. Hast du den Sarkophag und die Katzenstatue noch?“
Scherrer nickte, als könne sein Freund ihn sehen. „Und all die anderen Kunstschätze auch. Sie stehen in meinem Arbeitszimmer und inspirieren mich. Ich habe unsere Fahrt durch die Wüste nie vergessen. Auch unsere Gespräche nicht. Unsterblichkeit ist nicht gleichbedeutend mit ewiger Jugend! Weißt du noch, wie wir darüber diskutierten? Nun sind wir alt geworden. Dreißig Jahre ist es her. Das ist eine lange Zeit.“
„Die du gut genutzt hast, Edwin. Deine Forschungsjahre in Tübingen waren doch sehr erfolgreich.“
„Du hast sie besser genutzt, Nubi. Du hast einen Sohn, der inzwischen erwachsen ist. Der Schoß der Isis, weißt du noch?“
„Jeder hat seine Träume ein bisschen verwirklichen können. Dafür sollten wir dankbar sein“, sagte Nubi. „Gib mir Bescheid, wann du kommen kannst. Ist noch etwas? Du wirkst so nachdenklich!“
„Ich sehe gerade, dass meine Assistentin mit mir sprechen möchte. Ich melde mich bei dir, sobald ich mehr weiß.“
„Warte nicht zu lange mit deiner Antwort“, sagte Nubi. „Die Zeit vergeht. Wir werden älter und sind leider nicht unsterblich.“
Bei seiner Sekretärin wartete eine aufgeregte Anne Neidhardt darauf, endlich zum Herrn Professor vorgelassen zu werden.
„Frau Neidhardt“, begrüßte Scherrer Anne. „Haben Sie die Pflanze gesehen, die Dr.Meyer Ihnen so gern zeigen wollte? Der Mann war ganz aufgeregt.“
„Ja“, antwortete Anne. „Ich habe mich über sein Verhalten doch etwas gewundert. Die Pflanze wuchs am Forschungszentrum Umwelt.“
„Dr.Meyer sagte so etwas. Was für eine Pflanze ist das nun? Eine Bereicherung für den Botanischen Garten?“ Scherrer sah sie über die goldene Halbbrille amüsiert an. Er wirkte wie vor Jahren in Tübingen. Seine Haare waren grau geworden, aber noch immer hatte er seine Locken sorgfältig gelegt. Anne schüttelte ihren braunen Wuschelkopf. „Bitte setzen Sie sich doch“, schlug Scherrer vor. „Auch Sie wirken angespannt. Gibt es etwas Neues?“
Anne setzte sich, dann platzte sie heraus: „Eine Arabidopsis, sie wuchs in einem Magerrasen voller Habichtskräuter.“
„Arabidopsis? Die kennen wir doch hinreichend aus Tübingen. Deshalb machte Dr.Meyer so ein Aufheben?“
„Er sagte, es sei meine Pflanze“, erzählte Anne. „Ich habe sie mitgenommen, denn sie war bereits abgestorben.“
„Ja, Arabidopsis hat einen festgelegten Lebensrhythmus“, bestätigte Scherrer. „Das macht sie für die Forschung so interessant. Sie wächst sehr schnell und hat ein kleines Genom. Aber wem erzähle ich das? Sie wissen es selber. Das ganze Institut war doch voll mit diesen Pflanzen.“
„Deshalb ist uns auch bisher an dem Lebensrhythmus nichts Besonderes aufgefallen“, sagte Anne. „Könnte es sein, dass Arabidopsis ein Todesgen hat, das nach neunzig Tagen wirksam wird und den Zelltod, ich meine die Apoptose, von Zelle zu Zelle befiehlt? Normalerweise sterben bei einer Pflanze nur wenige Teile ab, aber hier endet das Leben der ganzen Pflanze ziemlich abrupt.“
Erstaunt bemerkte Anne, wie Scherrer blass wurde. „Ein Todesgen?“, fragte er mit belegter Stimme. „Das wäre möglich. Bei dem kleinen Genom dürfte es wohl nur ein Gen sein, das wie eine innere Uhr alles in Gang setzt. Andere Lebewesen, wie auch der Mensch, haben viele Todesgene, die den Tod bewirken.“ Er starrte auf die Wand, als sähe er einen Geist. Anne räusperte sich, um Scherrer wieder auf sich aufmerksam zu machen. „Haben Sie noch mehr herausgefunden?“, fragte Scherrer und sah sie wieder an. „Verzeihen Sie. Gerade eben habe ich mit meinem Freund Nubi aus Ägypten telefoniert, da sind meine Gedanken noch ganz woanders.“ Er lächelte entschuldigend.
„Ja, mir ist noch mehr aufgefallen“, fuhr Anne fort. „Einige Zellen in den Blättern leben noch. Sie haben den Befehl zur Apoptose entweder nicht bekommen oder ihn ignoriert. Ich möchte diese Zellen isolieren.“
„Zu welchem Zweck?“
„Um herauszufinden, warum sie nicht starben“, erklärte Anne. „Pflanzenzellen sind ja potentiell unsterblich. Vielleicht hat die Arabidopsis ein Todesgen.“
„Unsterblich?“, fragte Scherrer und sah sie nachdenklich an. „Darüber habe ich gerade mit meinem Freund gesprochen. Die Ägypter träumten von Unsterblichkeit. Mein Freund meinte, ich sei diesem Traum in meinem Forscherleben näher gekommen, was ich verneint habe. Nun kommen Sie und erzählen mir etwas von unsterblichen Zellen, die kein Todesgen haben.“
„Kann ich diese besonderen Zellen zur Kalluszüchtung vorbereiten?“, fragte Anne. „Ich würde gerne wieder forschen.“
„Natürlich“, antwortete Scherrer. „Forschen Sie! Ich bin froh, dass Sie nach Karlsruhe mitgekommen sind. Ich möchte selber wieder forschen. Meine Aufgabe mit dem Botanischen Garten lässt mir die Zeit dazu. Darf ich ganz spontan einen Vorschlag machen? Da Sie die Unsterblichkeit ansprechen, möchte ich Ihnen die Schwerpunkte in meinem Forscherleben erklären. Außerdem hätten wir dann auch Zeit, Ihre Arbeit zu besprechen. Ich habe das Gefühl, dass Sie auf etwas ganz Besonderes gestoßen sind. Darf ich Sie zu einem Gespräch in mein Haus einladen?“ Scherrer öffnete seinen Terminkalender. „Am Donnerstagabend hätte ich Zeit. Könnten Sie den Termin wahrnehmen?“ Dabei sah er sie fast bittend an.
Anne überlegte kurz. Doch, das wäre möglich. Der Professor schien ihre Pläne sehr ernst zu nehmen. „Ja“, antwortete sie mit fester Stimme, „ich komme gern.“
„19.00 Uhr?“, fragte Scherrer. „Ich würde mich sehr freuen.“
„Kann ich ab jetzt meine Zeit für die Forschung am Todesgen verwenden?“
„Forschen Sie, so viel Sie wollen“, sagte Scherrer. „Dr.Meyer und ich kommen mit der Arbeit am Botanischen Garten gut genug voran. Forschen Sie! Ihre Forschungen sind mir sehr wichtig. Ja, sie erfüllen sogar einen Traum von mir. Aber das erkläre ich Ihnen am Donnerstag.“
Sehr nachdenklich ging Anne in ihr Labor zurück und begann damit, die Zellen zu isolieren und für die Kalluszüchtung vorzubereiten.
Als Professor Scherrer und Dr.Meyer abends das Gebäude verließen, brannte in Annes Labor noch Licht. „Gute Nacht, Herr Professor“, sagte Meyer. „Unsere Frau Neidhardt arbeitet noch.“
„Ich danke Ihnen“, antwortete Scherrer und reichte ihm die Hand. „Sie haben uns sehr geholfen.“
Meyer ergriff die Hand des Professors. Scherrer spürte die Kälte der Hand und zuckte zusammen. Schnell ließ er Meyers Hand los und ging rasch hinüber zur Haltestelle der Straßenbahn.
Minuten später fuhr er mit der Bahn nach Durlach. Ich habe gar nicht gesehen, wo Meyer geblieben ist, dachte Scherrer. Er war plötzlich verschwunden.
Als Scherrer durch seinen Garten ging, war er froh, dass das Haus hell erleuchtet war. Diesmal zögerte er, die Katzenfigur anzufassen, denn es war ihm, als schaue ihn ein sehr lebendiges Tier an. Aber das beruhte nur auf seiner Einbildung und der ausgezeichneten Arbeit des ägyptischen Bildhauers.
In den nächsten Tagen sah Scherrer Anne nur kurz, wenn er in ihr Labor schaute. Sie war morgens schon an der Arbeit, wenn er kam, und abends noch an der Arbeit, wenn er das Institut verließ. Scherrer nutzte die Zeit in seinem Büro, um sich über den neuesten Stand der Forschung mit Arabidopsis zu informieren.