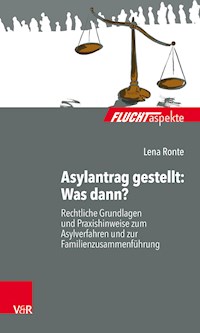
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Fluchtaspekte.
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Dieser kompakte Leitfaden versorgt alle, die geflüchtete Menschen haupt- oder ehrenamtlich durch ein Asylverfahren begleiten, mit wichtigem Hintergrund- und Praxiswissen. Lena Ronte, Fachanwältin für Migrationsrecht, erläutert die wichtigsten Verfahrensschritte des Asylverfahrens und die dazugehörigen Rechtsgrundlagen verständlich und praxisorientiert – von der Einreise bis zur Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Welche Hilfestellungen in den jeweiligen Verfahrensabschnitten erforderlich sein können und welche Rechtschutzmöglichkeiten im Falle einer (teilweisen) Ablehnung des Asylantrags insbesondere im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens bestehen, verrät dieser Band. Er klärt darüber auf, welche Entscheidung des Bundesamtes zu welchem Aufenthaltstitel führt und unter welchen Voraussetzungen eine Familienzusammenführung möglich ist. Mit dem Band liefert die Autorin den ersten instruktiven Leitfaden für die Begleitung eines Familienzusammenführungsverfahrens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 171
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Geflüchtete Menschen psychosozialunterstützen und begleiten
Herausgegeben von
Maximiliane Brandmaier
Barbara Bräutigam
Silke Birgitta Gahleitner
Dorothea Zimmermann
Gastherausgeberin: Ines Welge
Lena Ronte
Asylantrag gestellt:Was dann?
Rechtliche Grundlagenund Praxishinweise zumAsylverfahren und zurFamilienzusammenführung
Vandenhoeck & Ruprecht
Ich danke meinem Mentor, Kollegen und Freund Roman Fränkel, außerdem Andi, Astrid, Barbara, Helen und Stephan sowie den Herausgeberinnen für ihre Unterstützung und Geduld bei der Entstehung dieses Textes.
Mit einer Abbildung und 3 Tabellen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Umschlagabbildung: Nadine Scherer
ISBN 978-3-647-90088-9
© 2018, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,
Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage
www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Reihenredaktion: Silke Strupat
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datametics, Griesheim
Inhalt
Geleitwort der Reihenherausgeberinnen
1Einleitung
2Grundlagen des Asylrechts
2.1Rechtsquellen und Normenhierarchie
2.2Schutzformen im Asylrecht
2.2.1Asylberechtigung gemäß Art. 16a GG
2.2.2Flüchtlingsanerkennung gemäß § 3 AsylG
2.2.3Subsidiärer Schutz gemäß § 4 AsylG
2.2.4Abschiebeverbote gemäß § 60 Abs. 5–7 AufenthG
2.2.5Familienasyl gemäß § 26 AsylG
2.3Der Asylantrag
3Ablauf des Asylverfahrens
3.1Ankunft, Registrierung und Verteilung
3.1.1Wo hat sich ein Asylsuchender/eine Asylsuchende für die Antragsstellung zu melden?
3.1.2Welche Personen sind berechtigt, einen Asylantrag zu stellen, und in welcher Form hat der Antrag zu erfolgen?
3.1.3Wie läuft das Registrierungs- und Verteilungsverfahren ab?
3.2Wie lange besteht die Wohnpflicht in der Erstaufnahmeeinrichtung?
3.2.1Von der Erstaufnahmeeinrichtung in die Gemeinschaftsunterkunft
3.2.2Wie lange besteht die »Pflicht«, in einer Gemeinschaftsunterkunft zu leben?
3.3Die förmliche Asylantragstellung
3.3.1Auf was muss der Antragsteller/die Antragstellerin bei der förmlichen Asylantragstellung vorbereitet sein?
3.3.2Anhörung zur Person
3.3.3Anhörung zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates
3.4Aufenthaltsgestattung gemäß § 55 AsylG
3.4.1Räumliche Beschränkung gemäß § 56 AsylG
3.4.2Erwerbstätigkeit gemäß § 61 AsylG
3.4.3Integrationskurs und Sprachkurs
3.5Erste Hürde: Dublin-Verfahren
3.5.1Was ist ein Dublin-Verfahren?
3.5.2Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates
3.5.2.1Art. 8 Dublin-III-VO Minderjährigenschutz
3.5.2.2Art. 9, 10 und 11 Dublin-III-VO Schutz der Familieneinheit
3.5.2.3Art. 12, 13, 14, 15 Dublin-III-VO Verursacherprinzip
3.5.2.4Art. 16 und 17 Dublin-III-VO der sogenannte Selbsteintritt
3.5.3Durchsetzung der Zuständigkeit
3.5.4Pflichten des BAMF
3.5.4.1Frist für Übernahmeersuchen
3.5.4.2Frist für Überstellung/Abschiebung
3.5.5»Anerkanntenproblematik«
3.6Die persönliche Anhörung zu den Fluchtgründen – das Herzstück des Asylverfahrens
3.6.1Die Ladung zur Anhörung
3.6.1.1Ladung von Personen, die ihren Wohnsitz außerhalb der EAE haben
3.6.1.2Ladung von Personen, deren Wohnverpflichtung in der EAE fortbesteht
3.6.2Verfahrensgarantien
3.6.3Absehen von der Anhörung
3.6.4Ablauf der Anhörung
3.6.5Die Vorbereitung auf die Anhörung
3.6.5.1Aufklärung der Betroffenen über ihre Rechte im Asylverfahren
3.6.5.2Inhaltliche Vorbereitung auf den ersten Teil der Anhörung
3.6.5.3Inhaltliche Vorbereitung auf den zweiten Teil der Anhörung
3.7Die Entscheidung über den Asylantrag und die Zustellung des Bescheides
3.7.1Die Zustellung der Entscheidung § 10 AsylG
3.7.1.1Die Zustellung in einer Privatwohnung oder Gemeinschaftsunterkunft
3.7.1.2Die Zustellung in der EAE
3.7.2Die Entscheidung über den Asylantrag
3.7.2.1Die Anerkennung als Asylberechtigter/Asylberechtigte gemäß Art. 16a GG
3.7.2.2Die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft gemäß § 3 AsylG
3.7.2.3Die Zuerkennung des subsidiären Schutzes gemäß § 4 AsylG
3.7.2.4Abschiebeverbot gemäß § 60 Abs. 5 bis 7 AufenthG
3.7.2.5Der Asylantrag wird als unbegründet abgelehnt
3.7.2.6Der Asylantrag wird gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 3 AsylG als unzulässig abgelehnt
3.7.2.7Der Asylantrag wird gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 oder Nr. 4 AsylG als unzulässig abgelehnt
3.7.2.8Der Asylantrag wird gemäß § 29a AsylG in Verbindung mit § 30 AsylG als offensichtlich unbegründet abgelehnt
3.7.2.9Das Asylverfahren wird gemäß § 32 AsylG oder 33 AsylG eingestellt
4Alle Rechtsmittel sind gescheitert, die Abschiebung droht, was kann man tun?
4.1Sonstige mögliche Aufenthaltsrechte
4.2Liegen Duldungsgründe gemäß § 60a AufenthG vor?
4.3Asylfolgeantrag gemäß § 71 AsylG oder Zweitantrag gemäß § 71 a AsylG
4.3.1Folgeantrag gemäß § 71 AsylG
4.3.2Zweitantrag gemäß § 71a AsylG
4.4Kirchenasyl
4.5Härtefallkommission
4.6Petition
5Familienzusammenführung
5.1Rechtliche Grundlagen des Familiennachzugs zu Ausländern
5.2Familiennachzug zu Asylberechtigten und anerkannten Flüchtlingen
5.2.1Ehegatten und Kindernachzug
5.2.1.1Ehegattennachzug gemäß § 30 AufenthG
5.2.1.2Kindernachzug gemäß § 32 AufenthG
5.2.2Besonderheiten beim Elternnachzug gemäß § 36 Abs. 1 AufenthG
5.2.2.1Was ist bei einem drohenden Eintritt der Volljährigkeit im laufenden Visumverfahren zu tun?
5.2.2.2Können auch Geschwisterkinder mit den Eltern zusammen einreisen?
5.3Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten
5.4Nachzug zu Familienangehörigen mit sonstigen humanitären Aufenthaltsrechten
5.5Ablauf des Visumverfahrens
5.5.1Vorbereitung und Vorsprache bei der Botschaft
5.5.2Das Zustimmungsverfahren bei der Ausländerbehörde
5.5.2.1Wie kann das Vorliegen einer rechtmäßigen Ehe nachgewiesen werden?
5.5.2.2Nachweis der Abstammung und des Sorgerechts beim Kindernachzug
5.5.2.3Außergewöhnliche Härte beim Nachzug von sonstigen Familienangehörigen
5.5.3Zustimmung der Ausländerbehörde und Visumerteilung
5.5.4Was ist zu tun, wenn die Erteilung der Visa abgelehnt wird?
5.5.5Was ist nach der Einreise zu tun?
5.6Fazit
6Anhang
6.1Abkürzungsverzeichnis
6.2Ablauf des Asylverfahrens – grafische Darstellung
Geleitwort der Reihenherausgeberinnen
Der Band »Asylantrag gestellt: Was dann? Rechtliche Grundlagen und Praxishinweise zum Asylverfahren und zur Familienzusammenführung« stellt einen wichtigen Beitrag zur Buchreihe »Fluchtaspekte – Geflüchtete Menschen psychosozial unterstützen und begleiten« dar. Die Rechtsanwältin Lena Ronte erläutert in ihm Schritt für Schritt die einzelnen Phasen des Asylverfahrens und schafft es dabei, dieses Rechtsgebiet auch für juristische Laien verständlich und anregend aufzubereiten. Dabei greift sie auf ihre umfangreiche berufliche Erfahrung zurück und illustriert die einzelnen Vorgehensweisen sowie komplexe Rechts- und Sachverhalte durch zahlreiche Praxisbeispiele, an denen typische und Ausnahmefälle deutlich werden. Besonders knifflige Konstellationen und Problemstellungen sowie Fallstricke im Verlauf des Asylverfahrens werden durch eigene Praxishinweise besonders hervorgehoben. Lena Ronte erreicht damit eines der wichtigsten Ziele dieser Reihe, nämlich (psycho-)soziale Fachkräfte und ehrenamtlich Engagierte in ihrer Arbeit mit geflüchteten Menschen mit theoretischem Hintergrund- und nützlichem Praxiswissen zu unterstützen.
Der Band beginnt mit einer Einführung in die Grundlagen des Asylrechts, wobei gleich zu Beginn der strukturierte Überblick über die relevanten Rechtsquellen Orientierung in der häufig unübersichtlichen Rechtslage zum Thema Asyl bringt. Eine Darstellung der möglichen Schutzformen zeigt anschaulich, in welchen Fällen welche Art von Schutz in der Bundesrepublik Deutschland erhalten werden kann.
Der umfassendste Teil des Buchs beschäftigt sich detailliert und Schritt für Schritt mit den einzelnen Phasen des Asylverfahrens. Dabei wird deutlich, dass viele Hürden ab dem Zeitpunkt der Einreise gemeistert werden müssen, beginnend mit der Registrierung über die Regelungen zur Wohnverpflichtung sowie die förmliche Asylantragstellung. Die Autorin erläutert, welche Rechte Personen, die sich im Asylverfahren befinden, in den Bereichen Wohnen, Arbeiten und dem Besuch von Sprachund Integrationskursen zustehen. Aufgrund der Relevanz des Themas für die Praxis widmet sich ein eigenes Kapitel dem Dublin-Verfahren, wobei auch auf die Problematik von Menschen eingegangen wird, die in einem anderen EU-Staat eine Flüchtlingsanerkennung erhalten haben.
Das Buch kann für eine intensive Vorbereitung auf die Anhörung im Asylverfahren genutzt werden. Es gibt einen Überblick über die möglichen Ausgänge eines Asylverfahrens und die Konsequenzen für die Betroffenen. Angesichts der hohen Rate an Ablehnungen von Asylanträgen durch das BAMF ist der daran anschließende Überblick über mögliche Rechtsmittel im Falle eines negativen Bescheids sehr hilfreich. Besonders hervorzuheben ist der letzte Teil des Bandes, der einen instruktiven Leitfaden für die Begleitung eines Verfahrens zur Familienzusammenführung darstellt und Unterstützer/-innen dazu ermutigt und in die Lage versetzt, Geflüchtete bei diesen Schritten zu begleiten.
Wir freuen uns sehr, dass wir mit Lena Ronte eine Expertin auf dem Gebiet der asyl- und aufenthaltsrechtlichen Verfahren sowie der Familienzusammenführungen für diesen wichtigen Grundlagenband gewinnen konnten, und hoffen, dass die Lektüre Leserinnen und Leser bei der Herausforderung, eine geflüchtete Person durch das Asylverfahren und gegebenenfalls eine Familienzusammenführung zu begleiten, eine umfassende Orientierung bietet.
Maximiliane Brandmaier
Ines Welge (Gastherausgeberin)
Barbara Bräutigam
Silke Gahleitner
Dorothea Zimmermann
1Einleitung
Im Folgenden soll ein Überblick über den Ablauf des Asylverfahrens, von der Einreise bis zur endgültigen Entscheidung über den Asylantrag, erfolgen. Insbesondere sollen die rechtlichen Grundlagen in vereinfachter Weise dargestellt und »greifbar« gemacht werden. Zum besseren Verständnis werden zu Beginn zunächst die wichtigsten Rechtsnormen für das Asylverfahren und deren Verhältnis zueinander dargestellt. Sodann erfolgt eine Darstellung des Asylverfahrens anhand der einzelnen Verfahrensabschnitte. Anhand von Praxishinweisen soll verdeutlicht werden, was in der Beratung im jeweiligen Verfahrensabschnitt zu beachten ist und wie der/die Betroffene bestmöglich unterstützt werden kann. Abschließend werden die möglichen Entscheidungsformen im Asylverfahren dargestellt und beschrieben, mit welchen Rechtsmitteln (gerichtlichen Verfahren) die Entscheidungen angegriffen werden können.
Im vierten Kapitel erfolgt eine kurze Darstellung, welche aufenthaltsrechtlichen Möglichkeiten, auch nach unanfechtbarem negativen Abschluss des Asylverfahrens, noch zu einer Aufenthaltssicherung führen können. Im fünften Kapitel werden die rechtlichen Grundlagen der Familienzusammenführung dargelegt. Im Anschluss wird beschrieben, wie ein Familienzusammenführungsverfahren in der Praxis abläuft. Anhand von Praxisbeispielen, werden Unterstützungsmöglichkeiten für eine Begleitung in einem Familienzusammenführungsverfahren aufgezeigt.
2Grundlagen des Asylrechts
2.1Rechtsquellen und Normenhierarchie
Das Asylrecht ist verschachtelt und gegenüber anderen Rechtsgebieten eigen. Dies liegt zum einen daran, dass die Rechte von Asylsuchenden immer weiter eingeschränkt werden und es deshalb einer Vielzahl spezieller Regelungen bedarf, die das allgemeine Verwaltungsrecht nicht zulassen würde (verkürzte Rechtsmittelfristen etc.). Zum anderen spielen im Asylrecht nicht nur nationale Normen eine Rolle, sondern auch Regelungen auf europäischer Ebene, die aus der vor Jahren in Ansatz gebrachten Idee eines gemeinsamen europäischen Asylsystems resultieren. Darüber hinaus enthalten völkerrechtliche Verträge wie die Genfer Flüchtlingskonvention, die Europäische Menschenrechtskonvention und die UN-Kinderrechtskonvention Regelungen, die das Asylverfahren mitbestimmen bzw. die im Rahmen des Asylverfahrens Relevanz besitzen.
Die unterschiedlichen Normen stehen in einem strengen Rangverhältnis zueinander (sogenannte Normenhierarchie). Wie Tabelle 1 zeigt, sind hierbei drei Rangebenen zu beachten, die nachfolgend kurz näher erläutert werden.
Tabelle 1: Auswahl primärer Rechtsquellen zum Asylverfahren1
Erste Ebene: Grundgesetz (Art. 16a GG), Europarecht (Europäische Grundrechtecharta, Dublin-III-Verordnung, Qualifikationsrichtlinie, Aufnahmerichtlinie, Rückführungsrichtlinie etc.). Klar ist, dass das Grundgesetz auf der obersten Ebene anzusiedeln ist. Es mag zunächst verwundern, dass auch das Europarecht hier erscheint. Wir lernen bereits in der Schule, dass das Grundgesetz an oberster Stelle zu stehen hat. Dies ist jedoch juristisch nur bedingt richtig. Das Europarecht steht in der Rechtsordnung nämlich zunächst über dem Verfassungsrecht. Denn das Europarecht genießt einen sogenannten Anwendungsvorrang, das heißt, wenn es zu einem bestimmten Lebenssachverhalt sowohl eine nationale wie auch eine europarechtliche Norm gibt, hat die europarechtliche Norm Vorrang, auch wenn es sich hierbei um eine verfassungsrechtliche Norm handelt. Ohne den Anwendungsvorrang wäre das Europarecht letztlich wirkungslos, da die einzelnen EU-Staaten sich durch nationale Regelungen einem gemeinsamen und verbindlichen Konsens entziehen könnten.
Zweite Ebene: Bundesgesetze (AsylG, AufenthG), völkerrechtliche Verträge (GFK, EMRK, UN-KRK). Bundesgesetze sind Normen, die für das gesamte Bundesgebiet gelten, das heißt, wenn es auf Länderebene eine Regelung zum gleichen Lebenssachverhalt gibt, hat das Bundesgesetz Vorrang. Völkerrechtliche Verträge sind Vereinbarungen, die zwischen Staaten getroffen werden. Sie binden zunächst die unterzeichnenden Staaten untereinander. Sie regeln jedoch nicht zwingend, auf welche Weise der einzelne Staat seine Rechte und Pflichten aus dem Vertrag gegenüber dem Einzelnen (Bürger) zu gewährleisten hat. Um aus völkerrechtlichen Verträgen subjektive Rechte für den Einzelnen/die Einzelne ableiten zu können, bedarf es entweder einer Umsetzung in das nationale Recht (GFK wurde durch die Qualifikationsrichtlinie und das AsylG umgesetzt) oder einer ausdrücklichen Regelung in dem Vertragswerk selbst (EMRK, die eine unmittelbare Anwendung der Konvention zulässt). Die Kinderrechtskonvention wurde von der BRD bereits 1992 ratifiziert, allerdings mit dem Vorbehalt, dass ausländerrechtliche Vorschriften Vorrang vor der Konvention hatten. Erst im Jahr 2010 hat die BRD diesen Vorbehalt zurückgenommen, so dass die UN-KRK nunmehr auch unmittelbar anzuwenden ist.
Dritte Ebene: Landesrecht (Gesetze, Verordnungen, Erlasse). Bestimmte Regelungsbereiche können auf Länderebene normiert werden, zudem steht den Ländern in bestimmten Bereichen die Möglichkeit zu, Bundesgesetze durch Erlasse und Verordnungen zu konkretisieren bzw. vorzugeben, wie bestimmte Bundesgesetze im Verwaltungsverfahren umzusetzen sind. So kann zum Beispiel gemäß § 12a AufenthG (Bundesgesetz) eine sogenannte Wohnsitzauflage für Flüchtlinge erlassen werden. Mit Erlass vom 24. Juli 2017 hat das Hessische Innenministerium geregelt, unter Beachtung welcher Kriterien und auf welche Weise die Wohnsitzauflage zu verfügen ist.
Erläuterungen zum EU-Recht
EU-Verordnungen (wie z. B. die Dublin-III-VO) und EU-Richtlinien (wie z. B. die Qualifikationsrichtlinie, die Verfahrensrichtlinie und die Familienzusammenführungsrichtlinie) spielen in der weiteren Darstellung eine wichtige Rolle. Deshalb folgt eine kurze Erläuterung zu deren Rechtscharakter und Unterscheidung:
Eine Verordnung ist ein Rechtsakt mit allgemeiner Wirkung und Wirksamkeit. Regelungen aus EU-Verordnungen sind folglich unmittelbar anwendbar. Es bedarf somit keines weiteren Rechtsaktes und keiner Umsetzung in nationales Recht.
Eine Richtlinie ist ein Rechtsakt, der vorerst keine unmittelbare Anwendung findet. Mit einer Richtlinie wird zunächst ein gemeinsames Ziel der EU-Mitgliedstaaten formuliert. Die einzelnen Staaten haben dann die Möglichkeit, eigene nationale Rechtsnormen zu erlassen, mit der die Umsetzung dieses Ziels auf nationaler Ebene erreicht werden soll. Allerdings sehen EU-Richtlinien regelhaft eine bestimmte Frist vor, innerhalb der die Umsetzung in nationales Recht zu erfolgen hat. Nach Ablauf dieser Frist findet die Richtlinie dann unmittelbare Anwendung. Mitgliedstaaten können sich also durch eine Verweigerung der Umsetzung oder eine nur teilweise Umsetzung nicht entziehen. Für alle genannten Richtlinien ist die Umsetzungsfrist bereits abgelaufen, so dass sie auch dann gelten, wenn der nationale Gesetzgeber die Umsetzung »verschlafen« hat.
2.2Schutzformen im Asylrecht
Mit dem Asylantrag können die nachfolgend aufgeführten Schutzformen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zuerkannt bzw. festgestellt werden. Alle aufgeführten Schutzformen führen zu einem Aufenthaltsrecht in der BRD. Sie sind jedoch keinesfalls als gleichwertig anzusehen. Ein befreundeter fußballaffiner Kollege hat das in seiner Vorlesung wie folgt beschrieben: »Eine Asylberechtigung oder eine Flüchtlingsanerkennung sind wie ein 3:0. Ein subsidiärer Schutz ist wie ein 2:0, die Feststellung von Abschiebeverboten wie ein 1:0.« Mein Kollege hat recht, natürlich hat man erstmal »gewonnen«, wenn man grundsätzlich bleiben darf. Die Frage ist jedoch, unter welchen Bedingungen und mit welchen Möglichkeiten.
Maßgeblich dafür, wie hoch man gewonnen hat, um bei dem Fußballbeispiel zu bleiben, ist die Gültigkeitsdauer der ersten Aufenthaltserlaubnis, die Möglichkeit der Familienzusammenführung, der zeitnahe und unkomplizierte Zugang zu einem unbefristeten Aufenthaltsrecht (die sogenannte Niederlassungserlaubnis) sowie eine weitere Verfestigung des Aufenthalts (die Einbürgerung). Mit der Asylberechtigung wie auch der Flüchtlingsanerkennung erhalten die Betroffenen zudem einen GFK-Reiseausweis, dieser gewährleistet die größtmögliche Freizügigkeit.
Die Schutzformen sind in ihrer Rangfolge von »sehr gut« bis »okay« aufgeführt, in dieser Rangfolge hat das BAMF im Übrigen auch die Prüfung des Asylantrages durchzuführen.
2.2.1Asylberechtigung gemäß Art. 16a GG
Gemäß Art. 16a GG ist politisch Verfolgten Asyl zu gewähren. Eine politische Verfolgung wird in der Regel bei Gefahr für Leib oder Leben angenommen, bei einer Inhaftierung oder anderen Verletzungen der Menschenwürde aufgrund von Rasse, Religion, Nationalität, politischer Überzeugung oder bei der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe. Die Verfolgung muss zielgerichtet gegen eine bestimmte Person oder Gruppe gerichtet sein. Im Unterschied zum Flüchtlingsbegriff im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) muss eine politische Verfolgung grundsätzlich vom Staat ausgehen. Das Asylgrundrecht greift nicht, wenn eine sogenannte innerstaatliche Fluchtalternative besteht. Eine innerstaatliche Fluchtalternative liegt vor, wenn der/die Betroffene innerhalb seines/ihres Herkunftsstaats in einer anderen Region als seiner/ihrer Herkunftsregion Schutz vor der ihm/ihr drohenden Verfolgung erlangen kann und es ihm/ihr zugemutet werden kann, sich dort anzusiedeln. Es dürfen zudem keine Ausschlussgründe vorliegen. Da diese nicht gesetzlich geregelt sind, wird hierfür auf die Rechtsprechung sowie die Ausschlussgründe für die Flüchtlingsanerkennung und den subsidiären Schutz zurückgegriffen.
Bis 1993 wurde das Recht auf Asyl schrankenlos gewährt. Durch eine umstrittene Verfassungsänderung im Jahr 1993 wurde das Asylgrundrecht gemäß Art. 16a GG massiv eingeschränkt. Politisch Verfolgte können sich seitdem nur noch auf das Asylgrundrecht berufen, wenn sie nicht über einen sicheren Drittstaat (alle Mitgliedstaaten der EU sowie Norwegen und die Schweiz) eingereist sind. Da die Bundesrepublik Deutschland ausschließlich von sicheren Drittstaaten umgeben ist, findet das Asylgrundrecht nur noch Anwendung, wenn die Asylsuchenden über den Luftweg in die BRD eingereist sind und dies auch mit Nachweisen belegen können. Kann der Nachweis der Einreise über den Luftweg nicht geführt werden, greift § 3 AsylG (Flüchtlingsanerkennung). Da die Rechtsfolgen der Flüchtlingsanerkennung (§ 3 AsylG) und der Asylberechtigung (Art. 16 GG) identisch sind, macht es für die Betroffenen keinen Unterschied, welche Norm für sie greift.
Fallbeispiel
Ein türkischer Journalist, der bereits in der Türkei aufgrund seiner staatskritischen Veröffentlichungen Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt war (z. B. Haft), reist mit dem Flugzeug von Istanbul kommend in die BRD ein und stellt einen Asylantrag. Die Nachweise über seine direkte Einreise (Flugtickets etc.) legt er bei der Antragsstellung vor. Ist er nicht in der Lage seine Einreise über den Luftweg nachzuweisen, kann er sich nicht auf Art. 16a GG berufen.
Asylberechtigte nach Art. 16a GG erhalten nach ihrer Anerkennung eine Aufenthaltserlaubnis gemäß § 25 Abs. 1 AufenthG für drei Jahre, sie können unter privilegierten Bedingungen ihre Familie nachziehen lassen und ihren Aufenthalt erleichtert verfestigen. Zudem erhalten Sie einen Reiseausweis nach der GFK, den »blauen Pass«. Die Erwerbstätigkeit wird uneingeschränkt erlaubt.
2.2.2Flüchtlingsanerkennung gemäß § 3 AsylG
Asylantragstellenden wird die Flüchtlingseigenschaft gemäß § 3 AsylG zuerkannt, wenn sie sich aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe außerhalb ihres Herkunftslandes befinden. Die Verfolgung muss, wie auch bei der Asylberechtigung, zielgerichtet stattfinden. Sie kann im Gegensatz zu Art. 16a GG nicht nur vom Staat, sondern auch von sogenannten nichtstaatlichen Akteuren (z. B. von einer Bürgerkriegspartei oder auch von Familienangehörigen) ausgehen, wenn der Herkunftsstaat selbst nicht in der Lage oder nicht willens ist, die betroffene Person vor Verfolgung zu schützen. Wie auch bei Art. 16a GG darf dem Antragsteller/der Antragstellerin keine innerstaatliche Fluchtalternative zur Verfügung stehen.
Fallbeispiel
Ein somalischer Staatsangehöriger wurde von Milizionären der Al-Shabaab (radikal-islamische Miliz) zwangsrekrutiert. Er wurde in ein Lager gebracht, in dem er ausgebildet werden sollte, um in den Djihad zu ziehen. Nach einigen Tagen gelang ihm die Flucht. Er floh zunächst zu Verwandten aufs Land, von wo aus seine sofortige Ausreise organisiert wurde. Wenige Tage später floh er zunächst nach Äthiopien, dann weiter über den Sudan, die Sahara, Libyen, das Mittelmeer und Italien bis nach Deutschland. Dem Antragsteller droht im Falle einer Rückkehr nach Somalia eine Verfolgung durch die Al-Shabaab. In den Augen der Al-Shabaab gilt jede Person, die sich ihren Befehlen oder Dekreten widersetzt, als »ungläubig« und damit als Person, die es zu bestrafen bzw. zu eliminieren gilt. Personen, die sich der Zwangsrekrutierung entziehen, gelten als Deserteure. Die Verfolgung knüpft an die politisch-religiöse Einstellung des Antragstellers an, da er die radikal-islamische Ideologie der Al-Shabaab und deren »heiligen Krieg« ablehnt und sich nicht an diesem beteiligen will. Staatlichen Schutz kann er – aufgrund des Fehlens funktionierender staatlicher Strukturen – nicht erlangen. Da er auf dem Landweg eingereist ist, kann er sich nicht auf Art. 16a GG berufen.
Gleiches würde für eine somalische Frau gelten, die sich durch ihre Flucht einer Zwangsverheiratung mit einem Milizionär der Al-Shabaab entzogen hat oder aus einer bereits bestehenden Zwangsehe geflohen ist. Die geschlechtsspezifische Verfolgung (z. B. sexuelle Gewalt oder Zwangsverheiratung) fällt unter das Merkmal »bestimmte soziale Gruppe« und wird vom BAMF leider häufig außer Acht gelassen. Ein weiterer Fall der geschlechtsspezifischen Verfolgung ist die drohende Genitalverstümmelung.
Fallbeispiel
Ein Mädchen sollte in Somalia genitalverstümmelt werden. Die Verstümmelung von Mädchen und Frauen wird in Somalia landesweit praktiziert. Die Verstümmelungsrate liegt bei über 98 %. Weder ihre Eltern noch staatliche Stellen können die Antragstellerin vor einer Genitalverstümmelung schützen. Dem Staat fehlen die notwendigen staatlichen Strukturen. Die Eltern verstoßen mit der Entscheidung, die Antragstellerin nicht beschneiden zu lassen, gegen traditionelle bzw. gesellschaftliche Normen. Sie laufen selbst Gefahr von Familienangehörigen ausgegrenzt, diskriminiert oder von ihren (Clan-)Familien – deren Unterstützung lebensnotwendig ist – verstoßen zu werden. Es kommt zudem vor, dass Mädchen/Frauen von Familien- bzw. Clanangehörigen gegen den Willen der Eltern zwangsweise verstümmelt werden. Der Antragstellerin ist die Flüchtlingsanerkennung zuzuerkennen. Es handelt sich um einen klassischen Fall der geschlechtsspezifischen Verfolgung.
Es dürfen zudem keine Ausschlussgründe gemäß § 3 Abs. 2, 3, 4 AsylG oder § 60 Abs. 8 vorliegen. Die Flüchtlingsanerkennung ist demnach nicht zuzuerkennen, wenn der/die Betroffene im Verdacht steht, ein Verbrechen gegen den Frieden oder die Menschlichkeit, eine besonders schwere nicht politische Straftat, eine politische Straftat (Terrorismus) oder eine Zuwiderhandlung gegen die Grundsätze der Vereinten Nationen begangen zu haben oder auf andere Weise an einer dieser Taten beteiligt gewesen zu sein.





























