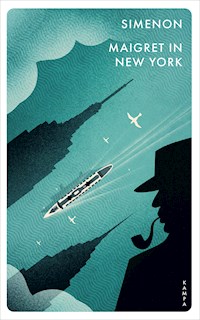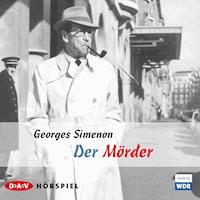Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Kampa Salon
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Fünf Ärzten gelang es 1956, Georges Simenon sieben Stunden lang zu befragen. Simenon, einer der produktivsten und meist gelesenen Autoren der Welt, galt selbst als genialer Psychologe. Das Innenleben seiner Figuren ist komplex, die analytischen Fähigkeiten seines Kommissars Maigret wurden auch von Spezialisten bewundert.In welchem geistigen und seelischen Zustand befand sich der Autor, als er seine Romane entwickelte? Welche Bedeutung haben seine Kindheitserinnerungen, seine Beziehungen und seine Persönlichkeitsstruktur für sein Schreiben? Wie hat sich seine große Sensibilität für Gerüche, Farben, Räume ausgeprägt? Welches Bild hatte der Autor von sich selbst? Dieses »Verhör« und zwei weitere berühmte Gespräche geben Einblick in die »Romanmanufaktur Simenon«, vor allem aber zeigen sie den Menschen hinter dem Schriftsteller.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georges Simenon
Auf der Couch
Fünf Ärzte verhören den Autor
Aus dem Französischen von Nicolaus Bornhorn
Kampa
Auf der Couch
Fünf Ärzte verhören den Autor
Anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums erschien am 5. Juni 1968 in der Zeitschrift Médecine et Hygiène ein Gespräch, das fünf Ärzte mit Georges Simenon auf seinem Anwesen in Epalinges geführt hatten: Charles Durand, Samuel Cruchaud, René Kaech, Jean-Jacques Burgermeister und Pierre Rentchnick. Im November desselben Jahrs erschien es im Verlag Presses de la Cité erstmals in Buchform.
Simenon hat Millionen von Lesern. Zusammen mit Victor Hugo und Jules Verne zählt er zu den am meisten übersetzten Autoren. Die außergewöhnliche Verbreitung dieser Leserschaft wirft Fragen auf. Die Maigret-Romane werden in der Tat sowohl in Europa, in Japan, in den Vereinigten Staaten als auch in der ehemaligen Sowjetunion geschätzt. Doch trotz dieser extremen Popularität sahen so anerkannte Literaten wie Gide, Martin du Gard und François Mauriac Simenon als Schriftsteller von sehr großem Talent.
Experten sagen ohne zu zögern, dass Simenon in der Literatur eine Ausnahmeerscheinung, vor allem aber ein schöpferisches Phänomen darstellt. Besonders Ärzte, von denen viele Simenons Werk bewundern, waren immer sensibel für eine bestimmte Art intellektueller Vorgehensweise des Schöpfers von Maigret, für die Beschreibung elementarster Wahrnehmungen (Geschmack, Geruch etc.), für seine einzigartige Art und Weise, sich an die Stelle des anderen, der Figur zu versetzen. In den Maigrets erzeugt nicht die Identität des Schuldigen die Spannung, sondern der psychologische Mechanismus, der zur Handlung, dem Schreiten zur Tat führt. Von daher besteht die Vorgehensweise Maigrets in einem Bemühen um ein phänomenologisches Verstehen, das oft vom Verständnis zur Sympathie führt und das der gesamten Vorgehensweise ein medizinisches, psychologisches Moment verleiht, und schließlich, im Augenblick des Dialogs oder der Begegnung, einen fast psychotherapeutischen Aspekt, der sich wie folgt zusammenfassen ließe: »Ich weiß alles über Sie, über Ihre Vergangenheit, Ihre Licht- und Schattenseiten, Ihre Wahrheit letztlich; ich weiß, was Sie getan haben und warum Sie es getan haben, und ich verstehe, liebe Sie weiterhin; ich weise Sie nicht zurück, beurteile Sie nicht, ich akzeptiere Sie, wie Sie sind.« Es ist offensichtlich, warum Mediziner keine Schwierigkeiten haben, sich in Maigret wiederzuerkennen.
Einige Mediziner, die das Werk Simenons nicht gut kannten, wurden von Die Glocken von Bicêtre überrascht, dessen Widmung vielsagend ist: »Für alle – Professoren, Mediziner, Schwestern und Pfleger –, die sich in Krankenhäusern und anderswo darum bemühen, diesem verwirrenden Wesen Verständnis entgegenzubringen und Linderung zu verschaffen: dem kranken Menschen.« Durch halbseitige Lähmung zur Bewegungslosigkeit verdammt, sieht die Figur dieses Romans die anderen Menschen anders als diese sich selbst sehen; sie hat nicht mehr dieselben Probleme wie sie, ist darüber hinausgegangen. Während der Gelähmte seine Umgebung beobachtet, stellt er sich fundamentale Fragen, für die ein gesunder Mensch in seiner Alltagsexistenz zweifellos nicht die Muße hätte, Fragen, die einen dazu bringen, spiralförmig in die tiefsten Tiefen des Menschen hinabzusteigen, zu einer Ebene, auf welcher der Mensch seine Identität verliert, denn diese Ebene ist allen Menschen gemein. Angesichts der Krankheit, die eine »universelle« Situation darstellt, angesichts dieser Prüfung, sind alle Menschen gleich oder zumindest weniger ungleich. Diese Lebenslage erzeugt das Bedürfnis, »eine Zwischenbilanz zu ziehen«, was Simenon erlaubt, eine Existenz in ihrer Gesamtheit zu überblicken, mit zahlreichen Rückblenden und ausgewählten Erinnerungen aus der Kindheit. Diese Bilanz bietet oft Gelegenheit oder wird zum Auslöser einer Wende und dann eines Aufbruchs in ein neues Leben … Jeder Mensch hegt das eine oder andere Mal den Wunsch, »aus seiner Haut heraus« zu können, um sich in einer anderen wiederzufinden, was den außergewöhnlichen Erfolg von Simenons Werk verständlicher macht.
Aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums von Médicine et Hygiène dachten wir, dass es interessant und aufschlussreich sein könnte, einen Tag mit Simenon auf seinem Landgut in Epalinges oberhalb von Lausanne zu verbringen. Diese Begegnung verlief in einer Atmosphäre herzlicher Freundschaft und Sympathie. Der außerordentliche Erfolg hat Simenon nicht zu einem affektierten, gekünstelten Wesen werden lassen: Wir sind einem Mann begegnet, der bescheiden, umgänglich geblieben ist, der sich beständig Fragen stellt und an sich selbst und seinem Talent zweifelt. Trotz seiner weltweiten Leserschaft braucht Simenon immer noch Bestätigung, was ihn sehr menschlich und sehr empfindsam für die Probleme anderer macht.
Wir danken Simenon sehr herzlich für seine Zustimmung zur Veröffentlichung dieser vertraulichen und zwanglosen Mitteilungen. Sie bilden ein psychologisches und literarisches Dokument, das wir den Schriften dieses Autors hinzufügen. Zu einem Zeitpunkt, da Simenon seinen fünfundsechzigsten Geburtstag feierte, hatte er somit Gelegenheit, die Bilanz eines Lebens zu ziehen, das überall starkes Interesse hervorruft.
Médicine et Hygiène
Sind Sie ein Romancier des Unbewussten?
Ja, sicherlich, ich muss Anflüge des Unbewussten ergreifen, und falls ich »den« Moment vorübergehen lasse, besteht das Risiko, dass dieses Unbewusste sich verflüchtigt. Wenn ich zum Beispiel im Verlauf der Ausarbeitung eines Romans krank werde und seine Fertigstellung um zehn Tage verschieben muss, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich ihn aufgeben muss, denn er ist mir gänzlich fremd geworden. Er berührt mich nicht mehr. Und dann frage ich mich: Warum bin ich von dieser Figur oder jenem Detail ausgegangen?
Man hat den Eindruck, als handle es sich um Filter, um Schleusen, die beizeiten zum Einsatz kommen müssen. Gibt es auch eine Frist für den Beginn?
Ich kann etwa vier bis fünf Tage mit dem Roman »schwanger gehen«, aber ich kann ihn nicht länger als fünfzehn Tage zurückhalten. Die Arbeit muss fortlaufend sein, und ich darf bei seiner Abfassung keinen Tag überspringen, sonst reißt der Faden.
Wenn ich einen Roman beginne, werde ich zur Hauptfigur, und mein ganzes Leben, vom Morgen bis zum Abend, vom Abend bis zum Morgen, wird von dieser Figur bestimmt: Ich stecke wirklich in ihrer Haut. Wenn ich vierundzwanzig Stunden lang wieder ich selbst bin, finde ich die Figur nicht mehr wieder, oder wenn ich sie wiederfinde, erscheint sie mir ein wenig konstruiert. Bevor ich einen Roman schreibe, muss ich in dem Augenblick, in dem ich mich in den von mir sogenannten »Zustand der Gnade« begebe, letztlich leer werden, mich freimachen von allem, was meine Persönlichkeit ausmacht, um ganz und gar empfänglich zu werden, um andere Figuren, andere Eindrücke in mich aufnehmen zu können. So sieht es grosso modo aus: Während der Arbeit an einem Buch geht es darum, so schnell wie möglich zu schreiben, dabei so wenig wie möglich zu denken und die Arbeit des Unbewussten so weit wie möglich zuzulassen. Im Grunde wäre ein Roman, den ich ganz bewusst schreiben würde, sehr wahrscheinlich von schlechter Qualität. Der Verstand darf bei seiner Abfassung nicht eingreifen. Ich arbeite ein wenig wie die Maler, denn die Mehrzahl von ihnen arbeitet so. Ein Maler beginnt ein Gemälde ohne zu wissen, worauf es hinausläuft, und in dem Maße, wie er am Gemälde arbeitet, verändert sich alles. So will Picasso etwa anfangs einen Baum darstellen, und dann wandelt sich das Bild zu einem Stier, obwohl er doch mit dem Gedanken an einen Baum begonnen hat. Das erste Bild war das eines Baums, und schließlich entsteht ein Stier daraus.
Das ist ja vielleicht nicht dasselbe. Picasso hat immerhin ein Thema gewählt, wobei es ihm nicht darauf ankommt, ob er es in der Form eines Baums oder eines Stiers zum Ausdruck bringt.
Ja, vielleicht. So wird das Thema meines nächsten Romans zum Beispiel verdrängte Gewalt sein. Ich habe die Figur, ich habe den Ausgangspunkt. Jetzt versuche ich, den Roman in Frankreich anzusiedeln. Aber es geht nicht: Damit meine Figur in Gang kommt, damit ein Anfangspunkt existiert, muss ich den Roman in den Vereinigten Staaten ansiedeln. Das ist der einzige Ort, den ich ausreichend gut kenne, um die Entwicklung des Themas zu ermöglichen. Wenn ich von diesem Thema spreche, bin ich mir nicht wirklich sicher, dass es das meines nächsten Romans ist, denn unterwegs wird es vielleicht von einem anderen Thema ersetzt. Das ist mehr als einmal vorgekommen.
Ist der Ausgangspunkt ein Thema oder eine Figur?
Eher die Figur als das Thema. Ich weiß zum Beispiel, dass sie die Gewalt in sich erstickt hat.
Ich kenne die Figur schon. Ich habe ihren Stammbaum erstellt. Der Charakter ihrer Großmutter, ihres Großvaters, ihrer Eltern, ihre gesamte Lebenssituation ist bekannt. Ich kenne ihre Krankheiten, jene ihrer Familie, was nicht besagen will, dass ich all diese anamnestischen Details im Roman selbst erwähne.
Müssen Sie sich jedes Mal dieser Mühe unterziehen, Ihrer Figur eine Identität und eine vollständige Persönlichkeit zu geben?
Ja, gewiss, und das ist der Tag, den ich bei der Vorbereitung meines Romans am wenigsten mag. Wenn meine Figuren ausgereift sind, aber noch keine genaue Adresse oder Telefonnummer haben, greife ich auf der Suche nach Namen zum Telefonbuch oder zum Littré. Ich zeichne auch einen schematischen Grundriss der Wohnung oder des Hauses, denn ich muss wissen, ob die Türen sich nach links oder rechts öffnen, ob die Sonne durch dieses oder jenes Fenster einfällt, ob sie ein Zimmer morgens oder spätnachmittags mit Licht durchflutet. All das ist notwendig; ich muss mich in diesem Haus bewegen können, als wäre es mein Zuhause. Das, und nichts anderes, ist mein Plan.
Erfinden Sie selbst die Lokalnachricht, die Stendhal in der Wirklichkeit suchte?
In der Tat. Aber das ist noch lange nicht alles. Der Ausgangspunkt mag ein Autounfall, ein Herzinfarkt oder eine Erbschaft sein. Es muss etwas eintreten, das plötzlich den Lebensweg der Figur verändert. Das ist durchaus glaubwürdig, denn in fast jedem Leben gibt es einen Wendepunkt, und wenn man nach den wahren Ursachen dieser Wende sucht, stellt sich heraus, dass sie unwesentlich sind, dass es sich dabei nicht um die wahren Gründe handelt. Der Vorfall ist ein Vorwand, der etwas tiefer Liegendes enthüllt oder aufzeigt. Wir packen einen Vorfall oder Unfall, eine Nebensächlichkeit beim Schopf, um unser Leben zu ändern. Auch kann es vorkommen, dass wir schon seit unserem zwanzigsten Lebensjahr das Verlangen danach verspürten, aber nicht den Mut dazu hatten.
Könnte man sagen, dass Ihre Figur sich bei dieser Gelegenheit selbst entdeckt?
Ja, der Zwischenfall ist gewissermaßen ein Entwickler.
Die Person sieht ihre Vergangenheit mit neuen Augen, und neue Möglichkeiten, die bisher verborgen waren, treten zutage.
In der katholischen Religion gibt es, wie Sie wissen, die sogenannten Exerzitien: man geht ein oder zwei Mal im Jahr in ein Kloster, und dort wird erwartet, dass man eine Zwischenbilanz der eigenen Existenz, aller Handlungen zieht. Mein Ausgangspunkt dient also in Wirklichkeit nur dazu, diese Exerzitien bei meiner Figur oder einer meiner Figuren in Gang zu setzen.
Das wird ihr somit auferlegt?
Gewiss, und hätte sie es nicht in diesem Moment getan, würde sie es zehn Jahre später tun.
Also ist der Vorfall oder Unfall, von dem Sie sprechen, nicht wesentlich?
Er ist dennoch notwendig. Er spielt die Rolle eines Katalysators.
Ich denke da insbesondere an Die Flucht des Monsieur Monde. Er steigt hinab in den Hof seines Gebäudes und entdeckt, dass sein Sohn homosexuell ist. Oder ein anderes Beispiel: in Die Komplizen ist es der Unfall. Ein idiotischer Unfall, der die beiden Menschen aneinander bindet.
Wir sind verblüfft über Ihr Anwesen, über die Ordnung, die hier herrscht.
In meiner Jugend war ich eher für Unordnung bestimmt, aber ich hatte gleichzeitig eine Sehnsucht nach Ordnung, nach einer bestimmten Solidität, und im Grunde habe ich mich mein ganzes Leben lang daran geklammert. Jedes der zahlreichen Häuser, die ich bewohnt habe, war gut gebaut, solide, um mich daran zu hindern, »mich aus dem Staub zu machen«. Es war ein Bedürfnis nach Sicherheit, denn meine eigentliche Versuchung (schon mit sechzehn schrieb ich das auf) war, als Clochard zu enden, und im Grunde verspürte ich immer die Anziehungskraft des Clochards. Ich würde fast so weit gehen, den Zustand des Clochards als Idealzustand anzusehen. Es ist offensichtlich, dass der wahre Clochard als Mensch vollständiger ist, als wir es sind.
Ja, eigentlich ist dieses Haus Ihr Heimathafen, Ihre Brüstung, die Sie daran hindert, sich den Clochards anzuschließen.
So ist es. Jedes Mal wenn ich mich an einem Ort niederließ, sagte ich mir, dass ich ein Haus ein wenig à la Bohème bauen würde, das ein Gefühl völliger Freiheit gäbe. Aber regelmäßig habe ich denselben Schutzkreis wiederhergestellt. Bevor ich dieses Haus hier in Epalinges baute, habe ich neunundzwanzig andere eingerichtet! Das habe ich mein ganzes Leben lang gemacht und Unsummen dafür ausgegeben, baufällige Schlösser und Bauernhäuser zu renovieren. Irgendwann hatte ich einmal einhundertfünfzig Kühe, Hunde und Wölfe. Die völlige Unordnung hat mich immer angezogen, aber eigenartigerweise hatte ich ab meinem sechzehnten Lebensjahr diese – man könnte sagen rettende – Reaktion, den Ausgleich selbst zu schaffen.
Können diese beiden Tendenzen nicht gleichzeitig oder nacheinander existieren?
Das schon, aber ich glaube, dass es bei mir ein Schutzmechanismus ist. Schauen Sie: ab dem Alter von acht Jahren war ich der Erste, der im Haus aufstand, um fünf Uhr dreißig morgens, vor meiner Mutter, vor allen anderen. Um sechs Uhr diente ich schon bei der Messe im Krankenhaus. Diese Disziplin, vor sechs Uhr aufzustehen, habe ich mein ganzes Leben lang beibehalten. Aber ich glaube nicht, dass das zwangsläufig mit einer Vorliebe für frühes Aufstehen zu tun hat, vielmehr stellt es eine Disziplin dar. An Tagen, an denen ich nicht früh aufstehe, habe ich Schuldgefühle, bin aus dem Gleichgewicht und muss manchmal meinen Arzt rufen.
Noch an ein anderes Detail kann ich mich erinnern. In der Pubertät begann ich auszugehen, ließ mich treiben, vernachlässigte die Schule, obgleich ich ein brillanter Schüler war, doch im letzten Moment machte ich die Sache jedes Mal wieder wett. Eines Tages, ich war siebzehn und arbeitete für die Gazette de Liège, lud ein Freund mich zu sich nach Hause ein, auf ein großbürgerliches, luxuriöses Anwesen (sein Vater war der reichste Weinhändler der Stadt). Seine Schwester war das getreue Abbild dieses Hauses. Am nächsten Tag sagte ich zu meinem Freund: »Ich frage mich, ob ich nicht gut daran täte, deine Schwester zu heiraten.« Ich habe es nicht getan, aber mit siebzehneinhalb war ich mit jener verlobt, die zu meiner ersten Frau werden sollte. Ich empfand es als nötig zu heiraten, um Dummheiten zu vermeiden. Ich habe geheiratet, um mich vor mir selbst zu schützen.
Das ist ein Schutzmechanismus, der in sehr jungem Alter einsetzte. Waren Sie sich dessen bewusst?
Was das Haus betrifft, so war ich mir dessen nicht bewusst, wohl aber, was die Heirat betrifft. Ganz gewiss hat diese erste Ehe mich gerettet. Doch in Wirklichkeit war es so, dass mich jedwede Unordnung interessierte. Es gab zum Beispiel anarchistische Gruppen in Lüttich. Ich verkehrte mit ihnen und wäre sicherlich bis zum Äußersten gegangen. Ich würde noch weiter gehen und sagen, dass es sich bei den Romanen ähnlich verhält. Wenn ich eine Disziplin einhalte und so viele Romane im Jahr schreibe, dann auch deshalb, weil es ein funktionierendes Alarmsignal gibt: Wenn es mir nicht gut geht, sage ich es meinem Arzt, und dieser erwidert: »Wann beginnen Sie mit Ihrem nächsten Roman?« Ich sage zu ihm: »in acht Tagen«, und er antwortet: »Nun, dann ist ja alles gut.«
Es ist ein wenig so, als würde er mir als Rezept verschreiben: »So bald wie möglich einen Roman schreiben.« Das ist die Therapie, die mir am ehesten zusagt.
Stimmen Sie, was die Schreibmotivation betrifft, mit Charlie Chaplin überein, der vor vielen Jahren zu Ihnen sagte: »Wenn man sich in seiner Haut nicht wohl fühlt, schreibt man einen Roman oder dreht einen Film. Das ersetzt im Übrigen den Psychoanalytiker; anstatt ihn zu bezahlen, bezahlt man uns.«
Ich glaube schon, dass an dem, was Chaplin mir damals gesagt hat, etwas Wahres ist.
Im Verlauf des großzügigen Essens, das Sie uns vorhin aufgetischt haben, sprachen wir von der aktuellen Moral, vom Bild des Menschen, das sich in den großen Epochen wandelt, von den Schwierigkeiten, die die Erziehung der Kinder mit sich bringt. Ich würde gern etwas vom Bild erfahren, das Sie sich als Kind vom Menschen gemacht haben.
Ich habe in meiner Familie den Menschen kennengelernt, der ein Produkt dessen war, was man als gesellschaftliche Organisation am Ende des vergangenen und Beginn des aktuellen Jahrhunderts bezeichnen könnte. Man brauchte Angestellte, Arbeiter, Bedienstete, und die Gesellschaft hatte sie auf ganz bewundernswerte Weise »domestiziert«. Sie waren überzeugt davon, ehrbare Menschen zu sein, und sie schritten alle hintereinander her wie im Prozessionszug. Mein Vater ging ins Büro, als würde er in den Himmel auffahren. Er war der Gerechte und alle meine Onkel ebenfalls. Er hatte das rituelle Verhalten des Gerechten. Er hatte einen Köhlerglauben, sowohl was die Religion als auch die gesellschaftliche Organisation betraf. Ich glaube, dass mein Vater ein glücklicher Mensch war. Trotz der Dürftigkeit unserer Existenz lebte er in Frieden mit sich und den anderen. Meine Mutter und einige ihrer Schwestern wollten stets mehr; sie hatten Vertrauen in die gesellschaftliche Organisation und wollten den sozialen Aufstieg. Die Organisation an sich war gut, aber sie sahen sich auf der falschen Stufe; mein Vater arbeitete in einem kleinen Versicherungsbüro, er hatte fünf Angestellte, die sich um die Geschäftsbereiche zweier Firmen kümmerten, insbesondere um die Générale und um Winterthur.
Befanden sie sich im selben Büro?
Ja.
Haben Sie nicht den Eindruck, dass Sie davon beeinflusst worden sind, dass dies Spuren hinterlassen hat bei der Gestaltung Ihrer Schreibtische, bis hin zu dem Punkt, dass man auf jedem von ihnen dieselbe Pfeifensammlung, denselben Satz Bleistifte wiederfindet, aber all diese Schreibtische fein säuberlich voneinander getrennt stehen?
Ja, daran hätte ich nicht gedacht, aber das ist durchaus möglich.
Als man meinem Vater vorschlug, sich um den neuen Zweig der Lebensversicherung zu kümmern, der eine ungeahnte Ausdehnung erfahren sollte, wies er dies Angebot zurück, er wollte auf seinem Flecken Erde seine Ruhe haben. Sein junger Kollege hingegen, der den Bereich der Lebensversicherung akzeptierte, erreichte sehr schnell eine brillante Stellung, kaufte bald Auto und Haus und schickte seine Tochter auf die beste Klosterschule Lüttichs, während mein Vater weiterhin einhundertachtzig Franc im Monat verdiente. Ich kann Ihnen versichern, dass meine Mutter ihn für den Rest seiner Tage gerüffelt hat. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wollte man ihn zum Firmensitz nach Brüssel versetzen, was ihm ermöglicht hätte, aufzusteigen und sein Gehalt zu verdoppeln. Mein Vater sagte dazu: