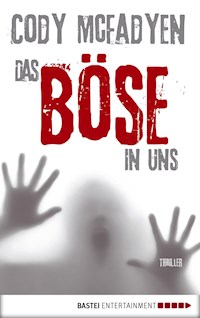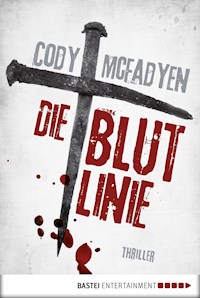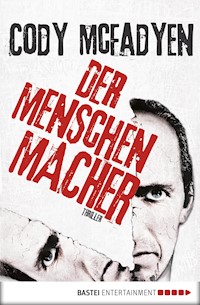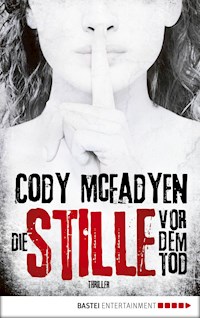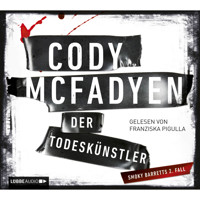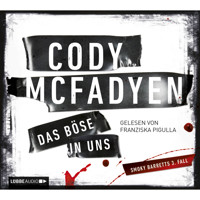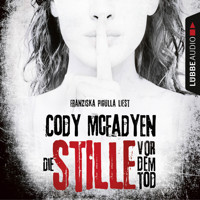8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Smoky Barrett
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Der Tod war bei dir, und du wünschst,
er hätte dich nicht am Leben gelassen ...
"Ich habe ein Geschenk für dich, Special Agent Barrett."
Smoky Barrett sieht von ihrem Handy auf. Die anderen Hochzeitsgäste blicken auf das Brautpaar vor dem Altar. Motorenheulen durchbricht die Stille. Ein Lieferwagen hält vor der Kirche, und eine Frau wird auf die Straße gestoßen. Ihr Kopf ist kahl geschoren; sie trägt ein weißes Nachthemd. Sie taumelt auf den Altar zu, fällt auf die Knie und stößt einen lautlosen Schrei aus. Smoky findet heraus, dass die Frau vor sieben Jahren verschwunden ist. Sie kann nicht über das reden, was ihr zugestoßen ist: Jemand hat eine Lobotomie an ihr durchgeführt und die Nervenbahnen ihres Gehirns durchschnitten. Sie ist nicht tot, vegetiert aber als leblose Hülle vor sich hin. Es wird weitere Opfer geben.
Mit dem mittlerweile vierten Fall für FBI-Agentin Smoky Barrett entführt Cody Mcfadyen den Leser erneut in die Tiefen menschlicher Abgründe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 608
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Teil 1: Die Sonne
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Teil 2: Der Mond
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Epilog
Danksagungen
Fallakte Smoky Barrett
Leseprobe – Der Menschenmacher
Cody Mcfadyen
Thriller
Aus dem Englischen vonAngela Koonen und Dietmar Schmidt
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der englischen Originalausgabe: »Abandoned«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2009 by Cody Mcfadyen
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2010 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Wolfgang Neuhaus / Jan F. Wielpütz
Umschlaggestaltung: Rolf Hörner
Einband- / Umschlagmotiv: © shutterstock/Gleb Semenjuk
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-0175-2
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Dieser Roman ist für meinen Vater,
David Mcfadyen, der mich gelehrt hat,
ein Mann zu sein. Ohne ihn hätte ich
nie mehr zurück ans Ufer gefunden.
KAPITEL 1
1974
»Ich werde das Leben sein«, sagte der Mann zu dem Jungen.
Der Junge deutete den Tonfall seines Vaters richtig und machte sich bereit.
»Ja, Vater.«
»Du wirst du sein, und ich werde das Leben sein.«
»Ja, Vater.«
Es war ein Rollenspiel.
Der Vater streckte die offene Hand aus. Es war eine große, harte Hand. Das wusste der Junge aus eigener Erfahrung, denn er hatte diese Hand häufig zu spüren bekommen.
»Gib mir einen Dollar«, verlangte der Vater.
»Ich habe keinen Dollar.«
Der Vater betrachtete den Jungen, und der Junge schaute seinen Vater an und wartete. Der Vater hatte ein derbes Gesicht, passend zu den Händen; sein ganzer Schädel war grob, als wäre er aus einem Betonblock oder aus Schlacke gehauen. Seine Augen waren eisblau und eiskalt – die Augen eines Philosophen und eines Mörders.
»Wird’s bald«, sagte der Vater. Er blickte auf den Tisch, tippte mit einem seiner dicken Finger darauf. »Na los. Ich frage nur noch einmal.« Er richtete den Blick wieder auf das Gesicht seines Sohnes. »Gib mir einen Dollar.« Wieder streckte er die Hand aus, schloss und öffnete sie, um seine Forderung zu unterstreichen.
»Aber ich habe keinen Dollar, das habe ich doch schon gesagt. Das ändert sich auch nicht, wenn du mich zweimal fragst.«
Der Vater entgegnete die Bemerkung mit einem stechenden Blick. Was der Junge gerade getan hatte, war gefährlich gewesen, aber auch mutig, und vor allem der Mut zählte.
»Und ich sagte, ich werde das Leben sein«, sprach der Vater gefährlich leise. »Wenn das Leben einen Dollar von dir verlangt, solltest du ihm diesen Dollar geben, oder das Leben bestraft dich so lange, bis du es tust.«
Der Tisch war klein, und die Arme des Vaters waren lang. Seine Hand zuckte vor und traf mit furchtbarer Wucht die linke Gesichtshälfte des Jungen, dem augenblicklich schwarz vor Augen wurde. Als er zu sich kam, lag er bäuchlings auf dem Fußboden. Der Stuhl war umgekippt, und die Handflächen des Jungen berührten den Boden dort, wo er seinen Sturz instinktiv abgefangen hatte. Ihm dröhnte der Schädel, und er schmeckte Blut.
»Steh auf, Sohn.«
Dem Jungen wurde schwindlig. Er suchte nach Worten.
»Ja, Vater«, sagte er schließlich.
Er war dankbar, so dankbar.
Der Junge war erst zehn, hatte aber schon ein bisschen von dem gelernt, wie die Welt funktionierte: Das Leben geht immer weiter und weiter – mit dir, wenn du stark bist, und ohne dich, wenn du schwach bist. Sein Vater wollte, dass er stark war. Konnte ein Vater seinem Sohn seine Liebe deutlicher zeigen?
Der Junge mühte sich noch. Er schwankte kurz, riss sich zusammen. Schwäche war das größte Vergehen, Feigheit das zweitgrößte.
»Du darfst niemals nur einstecken, Junge«, sagte sein Vater. »Du musst immer zurückschlagen. Immer. Wenn du einen Kampf zu verlieren drohst, lass den Gegner wenigstens für jeden Schlag, den er dir verpasst, teuer bezahlen.«
»Ja, Sir«, sagte der Junge artig. Er brachte die Fäuste hoch und staunte einmal mehr, wie klein seine Hände waren im Vergleich zu den riesigen Pranken seines Vaters.
»Das Leben will einen Dollar«, sagte der Vater und schlug zu.
Der Junge versuchte sich zu wehren, konnte aber keinen einzigen Treffer landen. Er blieb still, als sein Vater ihn bewusstlos schlug, und vergoss keine Träne.
Der Junge kam in seinem Bett zu sich, zitternd und von Schmerzen geplagt. Er wollte stöhnen, verkniff es sich aber, denn sein Vater saß neben ihm auf dem Bettrand, ein Koloss im Dunkeln, versilbert vom Mondlicht, das durch die Vorhänge sickerte.
»Ich bin das Leben, und das Leben will einen Dollar, Sohn«, sagte er. »Ich werde jede Woche nach diesem Dollar fragen, bis du ihn mir gibst. Hast du verstanden?«
»Ja, Sir«, sagte der Junge durch die aufgeplatzten Lippen und gab sich Mühe, seine Stimme kräftig und deutlich klingen zu lassen.
Sein Vater schaute aus dem Fenster, betrachtete den Mond, als hätten sie beide etwas zu bedauern. Vielleicht war es ja auch so.
»Weißt du, was Freude ist, Sohn?«
»Nein, Sir.«
»Freude ist alles, was nach dem Überleben kommt.«
Der Junge prägte sich das ein, legte es dort ab, wo er die großen und bedeutsamen Wahrheiten aufbewahrte. Dann wartete er, denn sein Vater war noch nicht fertig; er konnte es sehen.
»Wir haben in diesem Leben nur ein Ziel, und das ist der nächste Atemzug. Alles andere sind bloß Lügen. Man braucht Essen, man braucht einen Unterschlupf, man braucht einen Platz zum Schlafen und ein Loch zum Scheißen.« Der große, schwere Mann blickte den Jungen durchdringend an.
Der Junge hatte nie wirklich Angst vor seinem Vater gehabt. Bei all den brutalen und schmerzhaften Lektionen hatte er nie bezweifelt, dass der Mann, der ihm das Leben geschenkt hatte, es auch bewahren würde. Bis jetzt. Diesmal aber war es anders, und der Junge hielt den Atem an und die Zunge im Zaum und wartete, gebannt vom Blick zweier Augen, die so hell brannten wie sterbende Sterne.
»Warum will ich einen Dollar?«, sagte der Vater. »Weil Geld die Grundlage von allem ist. Das Leben will einen Dollar, Sohn. Es will ihn jeden Tag, von heute an, bis du unter die Erde kommst. Wenn du nicht zahlen kannst, dann kannst du auch nicht essen. Wenn du nicht essen kannst, kannst du nicht leben. So einfach ist das. Verstehst du, was ich meine?«
»Ja, Sir.«
»Ich bin mir da nicht so sicher, aber wir werden ja sehen. Das ist eine Prüfung. Ich gebe dir ein paar Versuche. Aber wenn du nicht bald einen Dollar anschleppst, schlag ich dich zu Brei.«
Nach einer schier endlosen Minute wandte der Vater sich ab. Er sah durch das Fenster zum Mond hinauf, und es schien beinahe so, als würde er mit ihm in ein stummes Zwiegespräch verfallen.
»Es gibt keinen Gott, Junge«, sagte er irgendwann. »Es gibt auch keine Seele. Es gibt nur Blut, Fleisch und Knochen. Du wurdest nicht von einer höheren Macht auf diese Erde gestellt. Du bist hier, weil ich mein Ding in deine Mutter gesteckt habe und dein Fleisch in ihr gewachsen ist. Dieses Fleisch muss gefüttert werden, und dazu brauchst du Dollars, und das ist alles, was wir sind und was wir immer sein werden.«
Der große Mann stand auf und ging ohne ein weiteres Wort. Der Junge lag auf dem Bett, betrachtete den Mond und dachte darüber nach, was sein Vater ihm gesagt hatte. Er stellte die Lehren seines Vaters nicht infrage, niemals, und nahm ihm die Schmerzen nicht übel. Das war seit langer Zeit vorbei. Der Junge erinnerte sich, dass er früher wütend und traurig gewesen war, doch inzwischen kam es ihm eher wie ein Traum vor, nicht wie eine echte Erinnerung. Diese Schwäche hatte sein Vater ihm mit den Fäusten ausgetrieben, so wie ein Hammer die Beulen aus einem Blech treibt. Sein Vater war sein Gott, und sein Gott lehrte ihn, wie man überlebte.
Er brauchte einen Dollar. Wenn er keinen Dollar anschleppte, würde er sterben. Das war alles, was zählte; nur darauf konzentrierte er sich.
Als er einschlief, hatte er einen Plan.
Der Junge war gerade in die fünfte Klasse gekommen. Sein Vater betrachtete die Schule als etwas Notwendiges.
»Du brauchst Wissen, um das Fleisch zu füttern, Sohn«, sagte er, »und die Schule kostet nichts. Nur ein Schwachkopf würde dieses Angebot ablehnen.«
Nun saß der Junge in seiner Klasse und wartete, dass die Schulglocke klingelte. Er hatte keine Freunde und wollte auch keine. Andere Menschen waren Gegner. Am besten, man blieb für sich, und daran hielt er sich.
Der Junge beobachtete Martin O’Brian, den Schulrowdy, maß ihn mit kritischem Blick. O’Brian war groß und ein brutaler Schläger. Er hatte ausdruckslose braune Augen und dünne braune Haare, die immer so aussahen, als wären sie ihm zu Hause geschnitten worden. Er trug ausgelatschte Schuhe, und seine Jeans hatten Löcher an den Knien. Manchmal kam er mit einem blauen Auge zur Schule oder zuckte bei jedem Schritt zusammen. Das waren dann immer schreckliche Tage für die Schwachen, denn an solchen Tagen war Martin O’Brian wie ein Raubtier.
Er wurde von allen gefürchtet, sogar von den älteren Sechstklässlern, denn er war gnadenlos. Man konnte nie sicher sein, wie weit er gehen würde. Darin lag das Geheimnis seiner Macht. Groß und kräftig waren viele, aber deshalb waren sie noch lange nicht furchterregend.
Martin O’Brian jedoch legte eine Art von Brutalität an den Tag, die Eltern einem Zehnjährigen gar nicht zutrauten (oder, wie im Fall von O’Brians Eltern, lieber ignorierten, da sie den Ursprung dieser Gewalttätigkeit bei sich selbst vermuteten). Von besiegten, schluchzenden Gegnern verlangte er, dass sie die eigene Mutter eine Hure nannten. Gehorchte man nicht, schlug und trat er weiter zu. Einem seiner Gegner hatte er sogar den Arm gebrochen.
Und was war die Folge? O’Brian wurde von den Lehrern getadelt, musste nachsitzen oder wurde vorübergehend vom Unterricht ausgeschlossen, mehr aber auch nicht. Das bedeutete, dass er sich weiter austoben konnte wie ein Elefant unter Pygmäen. Die Erwachsenen sahen das Dorf brennen, weigerten sich aber, den Rauch zu riechen.
Der Junge aber roch ihn. Und mehr als einmal hatte er gesehen, wie ein seltsames Leuchten in O’Brians Augen trat, wenn er sich mit einem Gegner befasste. Es waren die Augen eines Wahnsinnigen, der genoss, was er tat. Und sein verzerrtes, fiebriges Lächeln ließ ahnen, dass er viel über Schmerz und Tränen wusste, aber nichts über Fröhlichkeit und Lachen.
Das war Martin O’Brian.
Deshalb war er die Lösung für das Problem des Jungen.
Als die Glocke schellte, ging der Junge zu seinem Spind. Er legte seine Schulbücher hinein und ließ sie da; er hatte seine Hausaufgaben während des Unterrichts gemacht, damit er die Hände frei hatte. Nun nahm er aus dem Spind, was er am Morgen hineingelegt hatte, und ging durchs Schultor, ohne sich umzudrehen.
Ein Stück weiter setzte er sich auf den Bordstein und wartete. Es war ein schöner Tag. Die Sonne wärmte ihm die Schultern. Ein ungeduldiger Wind wehte, fuhr durch das Laub der nahen Bäume und streifte die Wangen des Jungen mit einem Kuss, bevor er weiterzog.
Fast zehn Minuten vergingen, bis Martin O’Brian erschien. Er pfiff vor sich hin, lächelte gedankenverloren und ballte unbewusst die Fäuste in permanentem Zorn. Der Junge sah Martin vorbeigehen. Dann stand er auf und folgte ihm in einigem Abstand.
Martin O’Brian blieb fünf Minuten auf der Straße, ehe er in eine Seitengasse abbog. Noch zwei Querstraßen, und O’Brian wäre zu Hause.
Jetzt oder nie.
Der Junge rannte los, den Gegenstand aus seinem Spind fest in der Hand. Sein Herz schlug langsam und gleichmäßig. Nach zehn Schritten hatte er O’Brian eingeholt und schwenkte den Arm.
Der Junge hatte den Besenstiel vor dem Unterricht durchgebrochen. Nun schlug er damit zu, drosch ihn gegen O’Brians linke Niere. Der Rowdy erstarrte; dann schrie er vor Schmerzen.
O’Brian ging in die Knie und rang nach Atem. Der nächste Hieb brach ihm die Nase, der übernächste kostete ihn ein paar Zähne.
Der Junge zerschlug O’Brian methodisch und mit erschreckender Ruhe, doch ohne Freude oder gar Genuss. Er war kein Sadist. Die Schläge waren Mittel zum Zweck, nicht mehr und nicht weniger. Sie waren nötig, um Martin O’Brian zu zerbrechen, und der Junge würde erst aufhören, wenn dieses Ziel erreicht war.
O’Brian fiel hin und krümmte sich, schützte Gesicht und Kopf mit den Armen, versuchte, dem Angreifer möglichst wenig Körperfläche zu bieten. Der Besenstiel sauste weiter herab. Wieder und wieder und wieder. Auf Arme, Beine, Rücken, Hintern. Nicht fest genug, um Knochenbrüche oder innere Verletzungen zu hinterlassen, aber so schmerzhaft, dass O’Brian in ein hilfloses Bündel verwandelt wurde.
Der Junge hörte auf, als O’Brian zu wimmern anfing.
»Sieh mich an, Arschloch.«
O’Brian sagte nichts, blieb zusammengekrümmt liegen, schluchzte, heulte und furzte hörbar, als er sich in die Hose machte.
»Wenn du mich nicht anschaust und mir nicht zuhörst, schlag ich dich tot«, sagte der Junge.
Das wirkte. Der Rowdy hob den Kopf, wobei sein ganzer Körper vor Angst und Schmerz zuckte. Seine Augen waren groß und weit aufgerissen, sein sonst so überheblicher Blick war furchtsam und unstet. Der Rotz lief ihm aus der Nase, vermischt mit Blut und Tränen. An einem Wangenknochen wuchs bereits eine Beule, die Lippen würden genäht werden müssen, und die abgebrochenen Zähne mussten raus. Sein Atem ging stoßweise, als er versuchte, seine Hysterie in den Griff zu bekommen.
»Martin.« Die Stimme des Jungen war beinahe gelangweilt, sein Blick leer und ausdruckslos. Er atmete ganz ruhig. »Du wirst etwas für mich tun. Wenn du gehorchst, passiert dir nichts. Gehorchst du nicht, muss ich dich bestrafen. Verstehst du?«
O’Brian starrte seinen Angreifer an, ohne zu antworten. Der Junge hob den Besenstiel.
»Ja! Ja!«, kreischte O’Brian. »Ich hab verstanden!«
Der Junge ließ den Besenstiel sinken. »Gut. Du wirst mir drei Dollar die Woche besorgen. Das wird dir nicht schwerfallen, denn ich hab dich beobachtet. Ich weiß, dass du klaust. Essensgeld, Taschengeld und so.«
»J-ja …«, wimmerte O’Brian, am ganzen Körper zitternd.
»Du brauchst also nur das zu tun, was du sowieso tust. Der einzige Unterschied ist, dass du mir drei Dollar die Woche gibst. Kapiert?«
O’Brian nickte. Er konnte nicht mehr sprechen, denn er klapperte zu sehr mit den blutigen Zähnen.
»Gut. Und was ich dir jetzt sage, ist besonders wichtig, also pass gut auf. Wenn du jemals einem erzählst, was ich mit dir gemacht habe, oder von den drei Dollar, oder wenn du mir das Geld nicht gibst, komme ich eines Nachts zu euch nach Hause, bringe zuerst deine Eltern um und dann dich. Und es wird lange dauern und verdammt wehtun.«
O’Brian hörte diese Worte, und die Zeit stand still. Etwas Seltsames geschah: Alles wurde deutlicher und unwirklich zugleich. O’Brian sah die Gegenwart und die Zukunft und wurde von einer Erregung erfasst, die alle Furcht wegfegte:
Die Sonne steht am wolkenlosen Himmel. Das Pflaster auf dem Bürgersteig ist warm, aber nicht heiß, und er ist nur fünf Minuten von zu Hause entfernt. Gleich wird er durch die Tür gehen, wird sich eine Cola und eins von Moms Plätzchen mit in sein Zimmer nehmen. Er wird sich die Tennisschuhe von den Füßen treten und das neuste Batman-Comic lesen. Später wird Mom ihn zum Essen rufen (wahrscheinlich Hackbraten). Dad wird wieder nicht dabei sein, denn er ist unterwegs und verkauft Sachen, und das bedeutet, er und Mom würden DIE FÄUSTE nicht spüren (so nannte O’Brian seinen Vater insgeheim). Vielleicht schauen sie sich später zusammen »Happy Days« an, und Mom wird vielleicht sogar lachen.
Martin O’Brian dachte an das alles, und für einen Augenblick hörte es sich albern an, was sein Angreifer soeben gesagt hatte. Umbringen? Blödsinn. Sie waren erst zehn! Die Sonne schien, und …
Der Junge starrte ihn an. Und als O’Brian in die Augen seines Bezwingers blickte, wurde ihn etwas bewusst – mit einer Klarheit, wie er es nie zuvor erlebt hatte.
O’Brian war nicht besonders schlau, aber klug genug, dass er wusste, was er von sich selbst zu halten hatte. Er tat anderen weh, beklaute sie, terrorisierte sie. Er brachte sie zum Schluchzen und zum Flehen, und er genoss es. Es verschaffte ihm Erleichterung. DIE FÄUSTE konnten ihm nicht erklären, warum er sich manchmal so gut fühlte, wenn andere weinten. Er war eine miese Ratte, doch er akzeptierte seine Verderbtheit genauso wie seine Unfähigkeit, etwas daran zu ändern.
Doch die Augen, die nun auf ihn hinunterstarrten, gehörten jemandem, der auf einer völlig anderen Stufe des Bösen stand. Es waren leere Augen, in denen weder Trauer noch Freude zu sehen war, keine unvergossenen Tränen und kein Lachen, das auf einen Anlass wartete. Das war kein Junge, der nach Hause ging, um Batman zu lesen, und seine Augen hatten noch nie eine Folge von »Happy Days« gesehen. Diese Augen musterten ihn nun von oben bis unten, warteten mit unerbittlicher Festigkeit.
Und in diesem Moment wusste O’Brian, dass es keine Rolle spielte, ob die Sonne schien und ob sie erst zehn waren. Er wusste, dass jedes Wort des Jungen eine Drohung gewesen war, die er wahrmachen würde.
»Ich hab verstanden«, flüsterte O’Brian.
Die Augen starrten ihn an, suchten nach der Wahrheit, während O’Brian jämmerlich zu schluchzen anfing und sich nichts anderes auf der Welt wünschte, als dass sein Bezwinger ihm glaubte. Irgendwann nickte der Junge und warf den abgebrochenen Besenstiel zur Seite.
»Erste Zahlung diesen Freitag«, sagte er.
Dann drehte er sich um und ging.
Der Junge kam zufrieden nach Hause, doch er pfiff nicht oder lächelte vor sich hin. Wozu auch? Es brachte nichts; es war völlig sinnlos. Doch der Junge war beruhigt: Er hatte sein Problem gelöst und sogar vorgesorgt. Denn was, wenn sein Vater demnächst mehr wollte als einen Dollar? Dieser Gedanke war dem Jungen in der Nacht zuvor gekommen, als er stumm die Schmerzen ertrug und nachdachte. Er war zu dem Schluss gelangt, dass es sehr gut möglich war: Wenn das Leben einen Dollar wollte, konnten es dann nicht auch zwei sein? Oder drei?
Das Einfachste war, von denen zu nehmen, die hatten. Das aber warf ein weiteres Problem auf: Wie konnte man vermeiden, dass man geschnappt wurde?
Alles hatte auf Martin O’Brian als Lösung des Problems hingedeutet: Er würde die Arbeit tun und den Ärger mit der Polizei kriegen, wenn es dazu käme. Und wenn O’Brian den Bullen von einem kleineren Jungen erzählte, der ihn, den gefürchteten Schläger, erpresste – wer würde ihm glauben?
Der Rest war eine Rechenaufgabe. Wie viel Schmerzen, wie viel Angst brachten wie viel Sicherheit? Menschliches Kalkül war die einfachste Mathematik überhaupt, wenn man den Bogen raus hatte. Und der Junge hatte ihn raus, das hatte er an diesem Tag erfahren.
Nicht alles Böse ist Zufall. Manches wächst in einem finsteren Keller unter einer finsteren Sonne heran, gehegt und gepflegt von einem finsteren Gärtner mit einer Hacke aus Knochen.
KAPITEL 2
Heute
Jeder ist eine Insel, das habe ich früh lernen müssen.
Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich liebe Tommy, und wenn ich nachts aufwache, und er liegt neben mir, sodass ich ihn anfassen, wecken, mit ihm reden und vielleicht mit ihm schlafen kann, gibt es nichts Schöneres für mich. Dieses Gefühl und die intime Kenntnis seines Körpers teile ich mit nur wenigen Frauen (ja, es gibt ein paar, aber nicht viele). Ich genieße meine eigene Begierde ebenso wie Tommys Verlangen nach mir, das mich mit einer Art egoistischem Stolz erfüllt. In solchen Augenblicken bin ich die Besitzerin geheimen Wissens und Hüterin verborgener Dinge.
Doch das ändert nichts an der Wahrheit: Trotz aller Intimität weiß Tommy nicht, was ich in meinem Innern empfinde – genauso wenig, wie ich es von ihm weiß. Bei aller Leidenschaft bleibt die Seele in der Dunkelheit verborgen.
Inzwischen komme ich damit zurecht, auch wenn es eine Zeit gab, in der ich mich gegen diesen Gedanken gewehrt habe, wie wahrscheinlich jeder von uns. Wir wollen alles über den anderen wissen, die kleinste Kleinigkeit. Wir wollen in ihm lesen wie in einem offenen Buch und selbst gelesen werden. Wir wollen eins mit ihm werden. Aber das geht nicht, jedenfalls nicht bei mir. Jeder ist eine Insel. Wie nahe wir uns auch kommen, eine gewisse Entfernung bleibt. Liebe, so habe ich begriffen, heißt nicht nur, sich mitzuteilen, sondern auch mit dem klarzukommen, was eben nicht mitgeteilt wird.
Ich drehe mich auf die Seite, die Wange an der Hand, und betrachte Tommy. Sein Gesicht mit der Narbe an der linken Schläfe ist nicht hübsch, aber sehr attraktiv, auf eine raue und männliche Art. Er ist groß, eins fünfundachtzig, und hat das dunkle Haar und die dunklen Augen eines Latinos. Er hat einen offenen und zugleich vorsichtigen Blick – einen Blick, wie man ihn nur dann bekommt, wenn man ein ehrlicher Mensch ist und zwei Leute getötet hat.
Tommy schläft tief und fest, den Mund geschlossen. Ich traue mich nicht, ihn zu lange anzustarren. Er könnte meinen Blick spüren und wach werden, denn er weiß wie ich, dass der Tod immer und überall lauert, und ist deshalb wachsam, selbst im Schlaf. Menschen wie Tommy und ich eignen sich einen leichten Schlaf an. Menschen, die Dinge tun, wie wir sie getan haben. Die sehen, was wir gesehen haben.
Ich drehe mich auf den Rücken und blicke durch die offene Balkontür in den Nachthimmel. Wir haben die Tür offen gelassen, damit wir das Meer hören können. Hier auf Hawaii ist es warm genug, um bei offener Tür zu schlafen. Wir machen hier fünf Tage Urlaub. Für mich ist es der erste Urlaub seit mehr als zehn Jahren.
Hawaii, Insel aus Feuer und Eis. Als Tommy und ich vom Flughafen Hilo zum Hotel fuhren, haben wir uns gefragt, ob wir bei der Wahl der Insel einen Fehler gemacht haben. So weit das Auge reichte, waren nur schwarzes Vulkangestein, dürre Bäume und spärliches Gras zu sehen, als wären wir auf einem unwirtlichen Mond gelandet. Doch als wir uns der Ferienanlage näherten, legten sich unsere Befürchtungen. In der Ferne konnten wir den schneebedeckten Mauna Kea sehen, über 4000 Meter hoch. Es war merkwürdig, auf Hawaii aus dem offenen Wagenfenster zu schauen und Schnee zu sehen, aber da war er und leuchtete weiß in der Sonne. Wunderschön, genau wie der Rezeptionsbereich der Ferienanlage. Wir hatten einen herrlichen Blick aufs Meer und den makellosen Strand, und ein warmer Wind küsste unsere Wangen, wie um uns willkommen zu heißen. »Aloha«, sagte der junge Mann an der Rezeption, und seine weißen Zähne leuchteten in seinem tiefbraunen Gesicht.
Wir sind jetzt seit vier Tagen hier, und unsere Hauptbeschäftigung ist das Faulenzen. Hawaii hat uns freundlich aufgenommen, hat das Blut an unseren Händen ignoriert, hat uns durch seine Schönheit überredet, abzuschalten und auszuruhen. Unser Zimmer ist im dritten Stock, und der Balkon ist nur fünfzig Meter vom Meer entfernt. Wir liegen den ganzen Tag in der Sonne, und abends gehen wir am Strand spazieren, beobachten die fantastischen Sonnenuntergänge und bewundern die Sternenpracht am außergewöhnlich klaren Himmel, der noch nicht von Smog getrübt ist.
Doch für uns ist es ein Paradies auf Zeit. Bald fliegen wir nach Los Angeles zurück, wo ich im dortigen FBI-Büro als NCVAC-Koordinatorin arbeite. Das NCVAC ist das US-Bundesamt zur Analyse von Gewaltverbrechen mit Hauptsitz in Washington, D.C., doch in jedem FBI-Büro gibt es einen örtlichen Repräsentanten des NCVAC. In Los Angeles mache ich diesen Job jetzt seit über zwölf Jahren. Ich leite ein vierköpfiges Team (mich eingerechnet), das immer dann gerufen wird, wenn die schlimmste Drecksarbeit getan werden muss – die Aufklärung von Morden, Verstümmelungen, Vergewaltigungen, Folterungen und dergleichen. Es sind Verbrechen, die meist auf das Konto von Psychopathen gehen. Die Täter, die wir jagen, handeln selten im Affekt. Ihre Taten sind keine Absonderlichkeiten eines Augenblicks, sondern die Befreiung von irgendeinem krankhaften Trieb. Die meisten morden aus Lustgewinn, geilen sich auf am Leid und Tod anderer.
Ich verbringe mein Leben damit, in die Dunkelheit zu schauen, in der diese Bestien hausen. Es ist eine kalte Schwärze, angefüllt mit Wimmern und huschenden Schatten, mit schrillem Gelächter, gellenden Schreien und dumpfem Stöhnen. Ich habe einige der Ungeheuer getötet, die in dieser Finsternis lauern, und wurde von anderen gejagt – in furchtbaren Träumen, aber auch in der Wirklichkeit, die manchmal schlimmer sein kann als der schrecklichste Alptraum. Doch ich habe mir dieses Leben selbst ausgesucht, also darf ich mich nicht beklagen.
Es kommt selten vor, dass ich zum Himmel schaue und die Schönheit der Sterne bewundere. Meist sind sie für mich stumme und gleichgültige Beobachter jener Welt, in der wir leben und sterben, wobei mich selbst eher das Sterben beschäftigt, weil mein Job das mit sich bringt.
Hier auf Hawaii habe ich mir endlich mal die Zeit genommen, die Sterne in Ruhe zu betrachten. Jede Nacht habe ich das Gesicht dem Himmel zugekehrt und mir von den Sternen sagen lassen, dass ihre Schönheit schon viel länger besteht als der Mensch und die Abscheulichkeiten, die er zu begehen imstande ist.
Ich schließe für einen Moment die Augen und lausche. Das Rauschen der Brandung hört sich an wie der unaufhörliche Atem eines Riesen. Oder wie der Herzschlag Gottes. Doch Gott und ich, wir haben so unsere Probleme miteinander. Obwohl wir uns inzwischen näher sind als noch vor ein paar Jahren, wechseln wir kaum ein Wort.
Etwas Gewaltiges, Ewiges schiebt die Wellen vor sich her auf den Sandstrand, im Takt mit dem Metronom der Welt. Das Meer ist unermesslich, so rein an Klang und Farbe, dass es kein Zufall sein kann. Ich bin mir nicht sicher, ob es uns wahrnimmt, aber vielleicht hält es die Welt für immer in Gang, während wir unsere nichtigen Entscheidungen treffen.
Ich mache die Augen auf und rücke von Tommy weg, ganz langsam und so leise ich kann. Ich will auf den Balkon, ohne Tommy zu wecken. Die Laken streichen sanft über meine Haut, und meine Füße berühren den Teppichboden. Der Mond leuchtet ins Zimmer, deshalb ist der Bademantel (den ich mitgehen lassen will, wenn wir abreisen) nicht schwer zu finden. Ich ziehe ihn über, binde ihn aber nicht zu. Ich werfe noch einen Blick auf Tommy und gehe nach draußen.
Der Mond überzieht alles mit schimmerndem Silber. Ich betrachte ihn mit stummer Bewunderung. Er ist nur eine gigantische Kugel aus Stein, die das kalte Licht der Sonne zurückwirft, doch sobald der Himmel dunkel wird, hat er immense Kraft. Ich strecke den Arm aus und tue so, als könnte ich mit den Fingern durch das Mondlicht greifen. Für einen Moment glaube ich sie tatsächlich zu spüren, die Ströme samtigen Lichts, die mir bei meiner Arbeit oft den Weg erleuchtet haben, der nicht selten ein Weg in eine Welt gewesen ist, in der unsägliche Schrecken lauern. Doch daran will ich jetzt nicht denken.
Auf dem Balkon ist es angenehm. Ich lasse den Blick über den Himmel schweifen. In Los Angeles sind die Sterne bloß trübe Lichtpunkte in einem Meer der Schwärze, während sie hier wie Brillanten auf schwarzem Samt aussehen; dieser viel strapazierte Vergleich trifft es ziemlich genau. Über mir kann ich den Gürtel des Orion sehen, und als ich den Blick schweifen lasse, entdecke ich den Großen Bären und den Polarstern.
»Stella Polaris«, flüstere ich und denke an meinen Vater. Er gehörte zu den Menschen, die sich für alle möglichen Dinge begeistern konnten. Er spielte ganz ordentlich Gitarre und schrieb Kurzgeschichten, die mir sehr gefielen, die aber nie veröffentlicht wurden. Und er liebte den Nachthimmel und Bücher über Astronomie.
»Der Polarstern«, hat er mir einmal in einer kalten Nacht erzählt, »wird auch Nordstern genannt. Er ist nicht der hellste Stern am Himmel, wie manche Leute glauben. Der hellste Stern ist Sirius. Aber der Polarstern ist einer der wichtigsten.«
Damals war ich neun und interessierte mich nicht allzu sehr für die Welt der Sterne, und schon gar nicht liebte ich sie, aber ich liebte meinen Vater; deshalb heuchelte ich Interesse und machte ein erstauntes Gesicht. Heute bin ich froh, dass ich es getan habe, denn es hat Dad glücklich gemacht. Er starb, bevor ich einundzwanzig war, und ich hege und pflege jede Erinnerung an ihn.
»Woran denkst du?« Die Stimme hinter mir ist belegt vom Schlaf.
»An meinen Vater. Er hat die Sterne geliebt.«
Tommy kommt zu mir und umfasst mich. Er ist nackt und warm. Ich lege den Kopf an seine Brust. Ich bin nur eins fünfzig, und es gefällt mir, dass er so viel größer ist als ich.
»Kannst du nicht schlafen?«, fragt er.
»Ich will nicht. Es ist schön, wach zu sein.«
Es ist, als könnte ich ihn lächeln hören. Das mag verrückt klingen, aber es ist die Wahrheit. Tommy und ich sind uns so nahe gekommen, dass wir die unsichtbaren Zeichen des anderen lesen können. Wir sind jetzt fast drei Jahre zusammen, und es war eine wunderschöne Zeit.
Tommys unerwartete Liebe hat mir damals das Leben gerettet. Vor dreieinhalb Jahren war ein Serienmörder namens Joseph Sands – ein Killer, den meine Leute und ich gejagt hatten – in mein Haus eingebrochen. Er folterte Matt, meinen Mann, vor meinen Augen zu Tode. Dann kam ich an die Reihe. Nachdem Sands mich vergewaltigt hatte, nahm er sich mein Gesicht vor und entstellte es so sehr, dass ich mich später selbst nicht wiedererkannte. Zum Schluss starb Alexa, meine damals zehnjährige Tochter. Sands benutzte sie als lebenden Schutzschild, als ich an eine Waffe kam und auf ihn feuerte.
Danach verbrachte ich sechs Monate in einer Welt aus Schmerz und Schock, an die ich mich kaum noch erinnern kann. Die Zeit ist zwar präsent, aber jeder Mensch besitzt eine Art Schutzmechanismus, der das Erinnern an solche Qualen verhindert oder sie zumindest schneller verblassen lässt. Ich weiß nur noch, dass ich damals sterben wollte und nahe daran war, mir das Leben zu nehmen.
Dann aber kamen Tommy und ich zusammen. Tommy war damals noch beim Secret Service. Bei einer meiner Ermittlungen kamen wir uns näher und landeten irgendwann im Bett, womit ich nun wirklich nicht gerechnet hatte – nicht nur, weil ich noch um Matt trauerte und weil Tommy ein so gut aussehender Bursche war, sondern wegen meines Aussehens.
Joseph Sands hatte mir mit einem rostigen alten Messer das Gesicht zerschnitten – methodisch, voller Hass und perverser Freude. Er hat sich in meinem Gesicht verewigt, hat mich mit Blut und Stahl gezeichnet. Die Narbe beginnt mitten auf der Stirn, am Haaransatz, verläuft zwischen den Augenbrauen hindurch und dann in einem Neunzig-Grad-Winkel nach links und über die Schläfe, wo sie eine schwungvolle Schleife auf der Wange beschreibt. Von dort führt sie wieder nach oben und über den Nasenrücken und dann über die Nasenwurzel hinweg, ehe sie wieder kehrtmacht, eine Diagonale über den linken Nasenflügel zeichnet und schließlich über den Kiefer hinunter bis zum Schlüsselbein führt. Die linke Augenbraue fehlt. Sands hat sie mir weggeschnitten, als er mit der Klinge in meinem Gesicht schnitzte, sabbernd vor perverser Erregung.
Ich weiß noch, wie er innehielt, als er mit dem Schneiden fertig war. Ich schrie, während er das, was mein Gesicht gewesen war, aus nächster Nähe betrachtete. Dann nickte er. »Ja«, sagte er, »so ist es gut. Gleich beim ersten Mal ist alles richtig geworden.«
Ich habe mich nie für schön gehalten, habe mich aber stets wohl in meiner Haut gefühlt. Nach dieser Nacht jedoch fürchtete ich mich vor dem Spiegel wie das Phantom der Oper. Auch wenn ich es geschafft hatte, am Leben zu bleiben, führte ich von nun an ein Leben im Dunkeln – ein Monstrum, verborgen in den Schatten.
Erst Tommys unbefangene Leidenschaft öffnete mich wieder für die Welt. Tommy war ein Mann – ein gut aussehender noch dazu –, und er wollte mich. Nicht um mich zu trösten, sondern weil er mich haben wollte, als Frau, trotz meines entstellten Gesichts.
Mittlerweile ist viel Zeit vergangen, und aus uns beiden ist ein Paar geworden. Wir leben zusammen, und wir lieben uns. Auch Bonnie, meine Adoptivtochter, hat Tommy ins Herz geschlossen. Unser Verhältnis ist ohne Schuldgefühle und gesegnet durch die Geister meiner Vergangenheit.
»Es ist wunderschön«, sagt Tommy nun und holt mich aus meinen Gedanken.
»O ja.«
»Es war eine gute Idee von mir, hier ein paar Tage zu verbringen. Eine geniale Idee.«
Ich muss lachen. »Pass auf dein Ego auf. Es war eine tolle Idee, das stimmt, aber wenn wir wieder in L.A. sind, ist dein Kredit aufgebraucht.«
Seine Hände schieben sich um meine Taille und unter den Bademantel. »Dann muss ich mich wohl auf den Sex verlassen.«
»Das könnte funktionieren …« Ich mache die Augen zu und lege den Kopf in den Nacken. Seine Lippen finden meine, während uns der Mond zuschaut. Tommys Berührung lässt mich vor Wonne schaudern.
»Ich will es hier«, flüstere ich und streiche mit den Fingern durch sein Haar.
Er löst sich von mir, richtet sich auf, um zu Atem zu kommen, und zieht eine Braue hoch.
»Auf dem Balkon?«
Ich zeige auf die Liege. »Genau da.«
Ich sehe, wie er suchend über den Rasen blickt, und ziehe seinen Kopf zu mir herunter.
»Da ist niemand. Es ist drei Uhr früh.«
Es braucht nicht viel Überredung. Wir machen Liebe unter dem Mond und dem Polarstern, während das Meer leise zu uns spricht. Irgendwann schlafen wir auf dem Balkon ein, zugedeckt mit dem Bademantel.
Ich erwache träge und ausgeschlafen. Ich habe eine verschwommene Erinnerung daran, wie Tommy mich irgendwann ins Zimmer getragen und ins Bett gelegt hat. Es ist früh, noch keine sechs Uhr, und gerade erst geht die Sonne auf und erfüllt unser Zimmer mit mildem Licht. Ich werfe mir den Bademantel über und gehe nach draußen. Tommy hat schon Kaffee gekocht und den Balkontisch gedeckt. Er trägt eine Jeans, sonst nichts, und es turnt mich schon wieder an, ihn so zu sehen.
Als ich mich hinsetze, höre ich das Zirpen meines Handys, das den Empfang einer SMS meldet.
»Das darf doch nicht wahr sein«, stöhnt Tommy.
Ich nehme das Handy, lese die Textnachricht und muss lächeln.
Du bist in deinem Inselparadies, und wir stehen hier im Regen von L. A. Eigentlich sollte ich sauer auf dich sein, aber solange du rund um die Uhr Sex hast, ist dir alles verziehen.
Als ich den Rest der Nachricht lese, vergeht mir das Lächeln.
Übrigens, wir haben gerade den Hurensohn geschnappt, der die toten Kinder in Dixieklos gestopft hat. Er heißt Timothy Jakes (für meine Freunde ›Tim-Tim‹, sagt er, aber ich glaube nicht, dass er Freunde hat, der Typ ist viel zu unheimlich). Er hat geplärrt wie ein Baby und sich die Hose vollgepinkelt, als die Handschellen zuschnappten. Das war ein sehr befriedigendes Erlebnis für uns alle. Genieß die Sonne, Süße. Lass dich aufgeilen und stoße auf Tim-Tim an, der von Bubba (oder wer sonst gerade das Begrüßungsvergewaltigungskomitee im Knast leitet) bald in neue sexuelle Praktiken eingeführt wird.
Ich schließe kurz die Augen, während mich Erleichterung durchströmt. Der Fall war bei meinem Urlaubsantritt noch nicht abgeschlossen und war mit uns gereist wie ein zusätzlicher Koffer mit einer Leiche darin. So schön es auf Hawaii ist – die toten Kinder standen die ganze Zeit in der Nähe und schauten mir zu, wie ich die Sterne beobachtete und vertrauliche Gespräche mit dem Mond führte. Jetzt endlich spüre ich, wie sie sich umdrehen und zufrieden davongehen ins Nichts.
»Was gibt’s?«, fragt Tommy vom Bett.
Ich klappe das Handy zu, hole tief Luft und hoffe, dass mein Lächeln ein bisschen lasziv ist, als ich mich umdrehe und den Bademantel fallen lasse.
»Das war Callie. Sie wollte sich vergewissern, dass wir reichlich Sex haben.«
Ich werde ihm die Einzelheiten irgendwann erzählen, aber jetzt nicht. Es würde uns nur die Stimmung kaputtmachen. Das mag egoistisch erscheinen, aber ich musste lernen, mich gegen Gefühle abzuschotten und mein Leben behalten zu können. Ich kann mir die Leiche einer vergewaltigten, verstümmelten Zwölfjährigen anschauen und eine Stunde später meine Tochter auf die Wange küssen.
Tommy grinst. »Ich würde sagen, für reichlich Sex haben wir schon gesorgt, aber lass uns ganz sichergehen.«
»Schade, dass wir morgen abreisen müssen.«
»Lass uns ein bisschen länger bleiben.«
»Hast du vergessen, dass ich Trauzeugin bei Callies Hochzeit bin? Wenn ich nicht aufkreuze, bringt sie zuerst dich um und dann mich.«
»Ja, wahrscheinlich.«
Ich beuge mich zu Tommy hinunter und hauche ihm ins Ohr: »Sei jetzt still und tue, was ich immer so gern habe.«
Und er tut es. Die Sonne steigt weiter, und das Meer rauscht auf den Strand. Ich genieße jede Sekunde, doch selbst als wir uns gegeneinander treiben lassen, weiß ich, dass dieser Frieden flüchtig ist. Ich schreie auf, als Tommy mich zum Höhepunkt bringt, und in der Stille danach sagt die Insel mir auf Wiedersehen. Wir gehören nicht hierher an diesen Ort, an dem es so viel Licht und Heiterkeit gibt. Ich sehe andere Kinder vor mir, tote und lebende, die auf meine Rückkehr warten.
KAPITEL 3
Ich wollte, ich hätte jetzt meine Waffe in der Hand, meine Neun-Millimeter-Glock, die ich so selbstverständlich trage wie eine Handtasche oder ein Paar gut sitzende Schuhe.
Ich bin eine ausgezeichnete Schützin, eine Fähigkeit, die ich anscheinend einem genetischen Erbe aus ferner Vergangenheit verdankte, denn meine Mutter und mein Vater können Schusswaffen nicht ausstehen. Einer von Dads Freunden hat mein Interesse für Waffen geweckt, als ich ungefähr acht Jahre alt war. Er war ein Waffennarr, und seitdem bin ich es auch. Eine Pistole in der Hand zu halten kam mir irgendwie richtig vor. Sie gehörte da hin.
Ich bin ein Naturtalent. Zwar habe ich mich nie mit jemandem gemessen, nehme aber an, dass ich eine der besten Schützinnen beim FBI bin. Diese Fähigkeit ist mir schon oft nützlich gewesen, und ich wünschte, jetzt könnte ich sie einsetzen.
»Dieses Kleid ist einfach zu warm!«, schimpfe ich.
Es ist Ende Februar in Los Angeles, und Callies Hochzeit findet am Strand statt. Die Luft ist frisch, doch aus irgendeinem Grund weht nicht der leichteste Windhauch, und die Sonne, die bei normaler Kleidung angenehm wäre, verwandelt mein Trauzeuginnenkleid in eine Sauna.
»Ich bin schweißgebadet«, flüstert Marilyn mir zu und kichert.
Marilyn ist Callies Tochter. Die beiden haben sich erst vor ein paar Jahren kennen gelernt, denn Callie war mit fünfzehn schwanger geworden und gab Marilyn auf Drängen ihrer Eltern zur Adoption frei, was sie stets bedauert hat – bis irgendein Dreckskerl, hinter dem wir her waren, diese Information ausgrub und Callie damit zu erpressen versuchte. Das Ergebnis war eine erzwungene Vereinigung von Mutter und Tochter, die sich glücklicherweise in eine echte Beziehung verwandelt hat.
»Pssst, Smoky«, raunt Bonnie mir zu.
Ich schaue auf Bonnie, die in ihrem sonnengelben Brautjungfernkleid neben mir steht. Sie hat sich die Haare hochgesteckt und ein gelbes Band darum gebunden. Sie ist sehr hübsch, und ich lächle sie an.
Bonnie ist dreizehn und sieht aus wie ihre Mutter: blondes Haar, makellose weiße Zähne und blaue Augen. Was Bonnie von ihrer Mutter unterscheidet, schlummert hinter diesen Augen. Bonnie ist erst dreizehn, doch ihre Augen sind die eines viel älteren Menschen, der zu viel gesehen hat.
Ich weiß, was diese Augen gesehen haben.
Bonnies Mutter, Annie King, war meine beste Schulfreundin. Wir hatten uns kennengelernt, als wir beide fünfzehn waren. Es scheint mir eine Ewigkeit her zu sein. Damals hatte ich noch keine Narben im Gesicht und auf der Seele.
Annie wurde von einem Verrückten verstümmelt und getötet, weil er auf diese Weise erreichen wollte, dass ich ihn jage, niemand sonst. Er zwang Bonnie, das langsame Sterben ihrer eigenen Mutter mit anzusehen, und fesselte sie dann an ihre Leiche. Es dauerte drei Tage, bis Bonnie gefunden wurde.
Ich erfüllte Annies Mörder seinen Wunsch: Ich habe ihn gejagt und getötet. Diese Jagd auf den Mörder meiner Freundin – und mein brennender Wunsch, sie zu rächen – war einer meiner beiden Rettungsanker. Der andere war Bonnie, denn Annie hatte sie mir anvertraut, wie sich herausstellte. Unsere Beziehung wäre normalerweise zum Scheitern verurteilt gewesen, denn ich war ein körperlicher und seelischer Krüppel, und Bonnie hatten die Schrecken, die sie durchstehen musste, die Sprache geraubt, sodass sie sich in eine Welt zurückzog, von der ich gar nicht erst wissen möchte, wie sie aussah. Doch Bonnie ist stark, und so fand sie mit der Zeit wieder zu sich.
Wir halfen uns gegenseitig. Zwei Jahre nach ihrem grauenvollen Erlebnis fand Bonnie die Sprache wieder, und ich bekam meinen Lebenswillen zurück.
Inzwischen sind wir wie Mutter und Tochter. Sie ist jetzt mein Kind – in jeder Hinsicht, auf die es ankommt.
Bonnie lächelt mich an. Der wachsame Ausdruck ihrer Augen verflüchtigt sich wie Nebel in der Sonne.
»Ist dir nicht heiß?«, frage ich.
Sie zuckt die Achseln. »Geht so. Ist ja nicht für lange.«
Ich blicke zu dem Mann hinüber, den Callie heiraten wird, Agent Samuel Brady, Chef des SWAT-Teams beim FBI in Los Angeles. Wer einen solchen Job macht, muss ein harter Mann sein – und genauso sieht Sam aus, trotz seines schwarzen Smokings. Er ist sehr groß, eins fünfundneunzig, und wie alle seine Kollegen trägt er die Haare militärisch kurz.
»Sam scheint gar nicht nervös zu sein«, flüstere ich Marilyn zu.
»Ich glaube, den kann nichts mehr schrecken«, flüstert sie zurück, »außer vielleicht Callie.«
Beinahe hätte ich losgeprustet. Callie Thorne ist meine Freundin und eine langjährige Kollegin, die zu meinem Team gehört. Sie ist eine schlanke, langbeinige Rothaarige mit einem Master in Forensik, Nebenfach Kriminologie. Callie ist bekannt für ihre Respektlosigkeit, die sie durch ihr Können und ihre Erfolge jedoch immer wieder wettmacht. Bei der Suche nach der Wahrheit ist sie rücksichtslos.
Neben Sam steht Tommy. Er fängt meinen Blick auf und zwinkert mir zu. Ich strecke ihm die Zunge raus, was mir einen Stupser und ein Stirnrunzeln von Bonnie einbringt.
»Seit wann spielst du die strenge Tante?«, flüstere ich ihr zu.
»Seit Kirby mich zu ihrer Stellvertreterin ernannt hat«, antwortet Bonnie.
Es gefällt mir gar nicht, was ich da höre.
Kirby Mitchell ist ein weiblicher Profikiller. Sie hat die Aufgabe als Callies »Hochzeitsorganisatorin« übernommen. Es gibt Gerüchte, sie habe Drohungen ausgestoßen – sogar die Waffe gezogen –, um einige Lieferanten zu bewegen, Callie bei ihrer Hochzeit preislich entgegenzukommen.
Die hübsche Kirby, das All-American Girl mit dem Aussehen eines kalifornischen Beach Bunnies. Schlank, blond, sexy, eins fünfundsiebzig groß, strahlend blaue Augen und ein ewiges Lächeln. Wenn man sie sieht, glaubt man Meerwasser, Surfwachs und Marihuana zu riechen. Sie ist die Sorte Frau, die im Bikini genauso sexy aussieht wie im kleinen Schwarzen.
Doch ihre Lebensgeschichte ist so düster, dass ich lieber darüber schweige. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass Bonnie sich mit ihr anfreundet, doch ich lasse es ihr durchgehen – nicht dass ich groß die Wahl hätte. Ich bin von Menschen umgeben, die so sind wie ich: Menschen mit sichtbaren und unsichtbaren Narben. Menschen, die andere getötet haben und es wieder tun werden. Das ist nicht die beste Umgebung, um ein Kind großzuziehen, ich weiß, aber es ist nun mal die, die ich mir ausgesucht habe und mit der ich klarkommen muss.
Neben Tommy stehen die beiden letzten Mitglieder meines Teams, Alan Washington und James Giron. Mit seinen fast fünfzig Jahren ist Alan der älteste und Erfahrenste von uns, ein ehemaliger Cop des Los Angeles Police Departments. Er ist Afroamerikaner mit der Statur eine Profiwrestlers – die Sorte Mann, bei der man von allein auf die andere Straßenseite ausweicht, wenn er einem entgegenkommt. Sein Smoking spannt sich bei jeder Bewegung bedenklich an den Nähten. Doch seine Größe und Massigkeit verbirgt seine wahre Begabung: Er hat schier endlose Geduld und kann sich stundenlang mit Detailfragen beschäftigen, ohne die Geduld zu verlieren. Das macht ihn zum besten Vernehmungsspezialisten, den ich kenne.
Der einunddreißigjährige James Giron ist der Jüngste in meinem Team. James ist beinahe schon ein Menschenfeind. Nicht, dass er die Menschen hasst – sie kümmern ihn einfach nicht. Was er in mein Team einbringt, ist sein messerscharfer Verstand. James ist ein Genie, und das meine ich so, wie ich es sage. Er hat die Highschool mit fünfzehn abgeschlossen und mit zwanzig seinen Doktor in Kriminologie gemacht. James hatte eine ältere Schwester namens Rosa. Sie wurde ermordet, als James zwölf war. Rosa brauchte drei Tage zum Sterben, nachdem sie mehrmals vergewaltigt und mit einem Gasbrenner gefoltert worden war. Am Tag ihrer Beerdigung beschloss James, zum FBI zu gehen und sein Leben der Jagd auf Mörder zu widmen.
Er hat die gleiche Gabe wie ich: die Fähigkeit, ins Dunkel vorzudringen, sich an die zischenden, glitschigen, mörderischen Kreaturen anzuschleichen und zwar verändert, aber halbwegs unversehrt aus einer Begegnung mit ihnen hervorzugehen. Sosehr ich James manchmal ablehne (und er mich): Wenn ich jemanden brauche, um mich in das Denken eines Mörders einzufühlen, ist er ein unschätzbarer wertvoller Kollege.
Und schließlich ist da noch Barry Franklin, ein Detective vom Los Angeles Police Department, mit dem wir des Öfteren zusammenarbeiten und der zu unseren Freunden zählt. Barry ist Mitte vierzig, massig, aber nicht dick, Brillenträger, fast kahlköpfig, mit unscheinbarem Gesicht. Doch trotz äußerlicher Defizite trifft er sich ständig mit den hübschesten jungen Frauen.
Mein Team und ich kommen selten freiwillig zu unseren Fällen. Zwar gibt es Bereiche spezifischer FBI-Zuständigkeit – Entführung und Bankraub zum Beispiel –, doch in den meisten Fällen, besonders bei Tötungsdelikten, müssen wir von den örtlichen Polizeidienststellen hinzugezogen werden. Barry ist einer der wenigen Kollegen, die sich in ihrem Denken nicht von Politik beeinflussen lassen, wenn es um Fortschritte bei einer Ermittlung geht. Wenn er meint, dass wir bei der Lösung eines Falles eine Hilfe sein können, ruft er uns an. Wir haben schon bei vielen Gelegenheiten zusammengearbeitet und schwierige Fälle gelöst. Wer am Ende den Ruhm einheimst, hat weder Barry noch mich und mein Team jemals gekümmert.
Ich schaue zu den übrigen Gästen, die auf ihren Plastikklappstühlen sitzen. Es sind nicht allzu viele. Callies Eltern sind nicht darunter; sie wurden nicht eingeladen. Sie hatten Callie damals gezwungen, Marilyn abzugeben, und das hat sie ihnen nie verziehen. Mein Blick schweift weiter zu Alans Frau, Elaina. Sie schaut zu mir, und ihre Lachfältchen kräuseln sich. Ich erwidere ihr Lächeln. Elaina ist einer der wenigen von Grund auf guten Menschen, die ich kenne. Zu viele Leute verbergen unschöne Geheimnisse hinter einer Fassade der Anständigkeit und einem Zahnpastalächeln. Auch Elaina ist nicht fehlerlos; das ist niemand. Aber sie war es, die mich nach Sands’ Blutorgie im Krankenhaus besucht hat, als ich mit Schmerzen und Entsetzen zu kämpfen hatte, während ich an die weißen Deckenplatten starrte und den unpersönlichen Piep- und Zischlauten der Geräte lauschte, die meine Körperfunktionen stützten. Elaina schob die protestierende Schwester beiseite, um mich in die Arme zu nehmen, sodass ich mich an ihrer Schulter ausheulen konnte. Ich habe buchstäblich bis zur Besinnungslosigkeit geweint, und als ich wieder zu mir kam, war Elaina immer noch da. Ich liebe sie. Sie ist wie eine Mutter für mich.
Neben ihr sitzt Assistant Director Jones, mein Chef. Er wirkt ein bisschen desinteressiert und schaut ständig auf die Uhr. Wahrscheinlich wird man so, wenn man zwei gescheiterte Ehen hinter sich hat. AD Jones ist lange Zeit mein Mentor gewesen, mein privater Rabbi sozusagen. Er ist zu sehr Führungspersönlichkeit, um ein Freund zu sein, aber er ist ein großartiger Chef.
Es ist eine Gesellschaft aus Jägern menschlicher Ungeheuer und den Opfern unvorstellbarer Gewalt. Manche Gäste sind beides zugleich. Es sind Menschen, die täglich mit Leid und Tod zu tun haben.
Mein Handy meldet den Empfang einer SMS. Ich klappe es auf und erstarre.
Ich bin ganz nah. Und ich habe ein Geschenk für Sie, Special Agent Barrett.
Ich lasse den Blick schweifen, schaue suchend über die Gäste hinweg. Ein Paar, das am Strand entlangspaziert, ist stehen geblieben, um die Hochzeit zu beobachten. Ein Surfer paddelt aufs Meer hinaus, obwohl das Wasser eiskalt sein muss. Vor dem Eingang des nahen Hotels gehen und kommen Leute. Doch außer dem Paar schaut niemand zu uns herüber.
Wer immer die SMS geschickt hat, könnte sich im Hotel ein Zimmer gemietet haben, überlege ich. Vielleicht beobachtet er uns genau in diesem Augenblick von einem Fenster aus …
Ich schaue nach oben, doch durch die Scheiben ist nichts zu erkennen. Außerdem hat das Hotel zehn Stockwerke. Ich klappe das Handy zu. Ich bin mehr ängstlich als zornig. Wer auch immer diese Nachricht geschickt hat, kennt meine Nummer und ist mir damit näher, als mir liebt ist.
Ich sehe Bonnie an und merke, dass sie mich mustert und mit ihren viel zu alten Augen meine Gefühlslage erkundet.
»Alles in Ordnung?«, fragt sie.
Ich streichle ihr über die Wange. »Ja, Schatz. Aber wo bleibt eigentlich Callie?«
Wir haben sie vor zehn Minuten allein gelassen. Sie trug bereits ihr Kleid, das Make-up war perfekt – sie brauchte bloß noch in die Schuhe zu steigen und sich auf den Weg zur ihrem Zukünftigen zu machen.
»Ob was mit Kirby ist?«, flüstert Marilyn.
Es stimmt: Dass Callie und Kirby gleichzeitig fehlen, ist ein bisschen beunruhigend. Ich schaue zum Priester, Pater Yates. Er lächelt mich an, ein Bild der Geduld. Ich habe ihn bei unserem letzten Fall kennengelernt und unsere Bekanntschaft aufrechterhalten.
Dann endlich setzt die Musik ein, und ich sehe Kirby durch den Gang an ihren Platz huschen. Sie macht einen verärgerten Eindruck.
»Das ist nicht das Lied, das Kirby ausgesucht hat«, flüstert Bonnie.
Gespielt wird »Let it be« von den Beatles, allerdings in der Originalversion, nur Paul und sein Piano. Ich finde es großartig.
»Welches Lied wollte Kirby denn?«, frage ich.
»Here Comes the Bride«, sagt Bonnie.
Stattdessen »Let it be«. Das passte. Konformität war noch nie Callies Ding.
Dann erscheint die Frau der Stunde, und die rätselhafte SMS tritt vorerst in den Hintergrund.
Callie ist wunderschön in ihrem schlichten langen Seidenkleid. Ihr rotes Haar trägt sie lang und mit Blumen umwickelt. Es sieht aus, als würden Feuerrosse über ihren Rücken galoppieren. Sie bemerkt meine staunenden Blicke und zwinkert mir zu. Es schnürt mir das Herz ab.
Ich hatte immer Angst, dass Callie allein bleibt. Ich bin jetzt einundvierzig, und Callie ist ungefähr in meinem Alter. Wir sind in den besten Jahren, aber ich habe die Zukunft gesehen, den sich nähernden Scheitelpunkt, hinter dem der Staub sich nach und nach legt und die Falten tiefer werden. Irgendwann werden wir die Aufgabe nicht mehr erfüllen können, der wir unser Leben gewidmet haben – die Jagd auf geisteskranke Verbrecher. Wir werden unsere Waffen niederlegen, weil wir zu alt geworden sind. Vielleicht werden wir jüngere Jäger unterrichten. Vielleicht werden wir zu Hause sitzen und unsere Enkel auf den Knien schaukeln. Doch was auch passiert, das Alter kommt herangaloppiert. Ich kann die Hufschläge schon viel deutlicher hören als damals, als ich noch knackige einundzwanzig war.
Ich habe mir Sorgen gemacht, meine beste Freundin würde allein alt werden müssen, deshalb bin ich jetzt froh und erleichtert. Callie liebt einen Mann, und er liebt sie. Sie werden zusammen sein, was auch passiert.
Für einen Moment wird meine Freude durch ein Bild aus der Vergangenheit getrübt. Ich sehe Matt und mich an unserem Hochzeitstag. Ich trug damals weiße Seide, genau wie Callie heute. Wir waren so unglaublich jung … eine Jugend, an die ich mich kaum noch erinnere. Vom Tag der Hochzeit weiß ich fast nichts mehr, doch drei Erinnerungen werden bleiben, solange ich lebe: unsere Liebe, unser Lachen, unsere Freude.
Callie tritt neben Sam, und er lächelt sie an. Es ist das Lächeln eines Jungen, was umso schöner ist bei diesem sonst so einsilbigen Mann. Es macht ihn zehn Jahre jünger. Callies Lächeln ist schüchtern, was nicht minder seltsam ist, und mindestens genauso schön. Pater Yates beginnt die Trauungszeremonie, die Callie sich selbst ausgedacht hat. Die Zeremonie ist ernst und feierlich, und das überrascht mich, denn es passt so gar nicht zu Callie.
Ich fühle die Sonne im Rücken, als ich zuschaue, wie meine Freunde sich ihrem Glück hingeben.
»Sie dürfen die Braut jetzt küssen«, sagt Pater Yates schließlich, und Sam tut es nur zu gerne. Endlich geht ein bisschen Wind, kalt, aber wohltuend, und die Sonne gibt ihr Bestes, den Tag zu verschönern.
Pater Yates sagt irgendetwas, doch er wird übertönt von einem schwarzen Mustang mit getönten Scheiben, der vielleicht dreißig Meter von uns entfernt auf den Parkplatz rast. Der Fahrer bremst, und der Mustang kommt in einer Rauchwolke aus verbranntem Gummi zum Stehen. Der Motor dröhnt. Die Tür schwingt auf. Eine Frau wird auf den Asphalt geworfen. Die Tür knallt zu, und der Wagen jagt davon. Er hat kein Nummernschild.
Die Frau müht sich auf die Beine. Ihr Schädel ist kahl rasiert, und sie trägt nur ein schmuddeliges Nachthemd. Sie taumelt ein paar Schritte in unsere Richtung, greift sich mit beiden Händen an den Kopf, hebt das Gesicht zum Himmel und schreit, schreit, schreit.
KAPITEL 4
Als die Frau zusammenbrach, stürzten Callie und ich zu ihr, um Erste Hilfe zu leisten, während Tommy und Sam die Notrufnummer wählten. Kirby nahm die Verfolgung des schwarzen Mustangs auf, jedoch vergebens, wie sich bald herausstellte.
Die Frau sah entsetzlich aus. Sie war abgemagert und ausgetrocknet. Die Lippen waren rissig, die Haut unter den Augen fast schwarz, als hätte sie Tage und Wochen nicht geschlafen, was umso gespenstischer wirkte, als ihr Gesicht so weiß war wie Papier. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Unwillkürlich musste ich an die blinden Albinoratten denken, die im Dunklen geboren und gehalten werden und nie Tageslicht sehen.
»Schürfwunden am Hals und an den Hand- und Fußgelenken«, sagte Callie.
Ich sah mir die betreffenden Stellen an. Callie hatte recht. Da waren sogar Narben, die darauf hindeuteten, dass diese Frau sehr lange Zeit in Fesseln verbracht hatte.
»Was ist mit dir passiert?«, murmelte ich, als endlich der Rettungswagen vorfuhr. Die Sanitäter sprangen aus dem Fahrzeug und kamen zu uns gerannt, ganz auf ihre Aufgabe konzentriert. »Ich werde sie begleiten«, sagte ich.
»Dann nehme ich Bonnie mit zu uns nach Hause«, erbot sich Elaina.
»Ich will mit ins Krankenhaus«, protestierte Bonnie.
»Nein, Schatz.« Es muss wohl irgendetwas in meiner Stimme gelegen haben, das Bonnie erkennen ließ, dass Widerspruch zwecklos gewesen wäre. Sie war nicht glücklich darüber, ging aber mit Elaina, ohne zu maulen.
»Wir treffen uns im Krankenhaus«, sagte Alan. »Tolles Ende für eine Hochzeitsfeier.«
Ich blickte Callie und Sam an. »Ihr wollt eure Flitterwochen auf Bora Bora verbringen. Ihr seid frisch verheiratet, also ab mit euch.«
»Ts-ts«, machte Callie kopfschüttelnd. »Du solltest mich besser kennen.«
Ich bekam keine Gelegenheit mehr, Callie zu antworten, denn die Sanitäter hatten die Frau nun in den Wagen geschoben. Als die Türen sich hinter mir schlossen, hing sie bereits am Tropf.
Ich musterte die Bewusstlose, während wir über den Highway jagten. Ich schätzte sie auf Anfang vierzig. Ungefähr eins fünfundsechzig groß, zierlich, längliches Gesicht. Die Lippen waren weder ausgeprägt noch schmal. Sie hatte nichts Auffälliges und sah aus wie hundert andere Frauen ihres Alters. Dennoch wurde ich das Gefühl nicht los, dass ich sie schon einmal gesehen hatte.
Ihre Fingernägel waren ein bisschen zu lang und ziemlich schmutzig, ebenso die Zehennägel und die Füße, deren Sohlen von einer dicken Hornhaut überzogen waren, als hätte sie nie Schuhe getragen. Die Narben an den Fußgelenken waren breiter, als mir zuerst aufgefallen war; sie sahen aus, als wären sie immer wieder aufgescheuert und verheilt.
Im Krankenhaus schaue ich den Ärzten und Schwestern zu. Die Frau kommt allmählich zu sich und wehrt die helfenden Hände ab. Sie schreit, starrt mit wirrem Blick um sich.
»Schnallen Sie sie fest«, ordnet der Arzt an, worauf die Frau sich noch heftiger aufbäumt.
Ich ziehe den Arzt an der Schulter zu mir herum. Er starrt mich an, verärgert über die Unterbrechung. Ich zeige ihm meinen Dienstausweis, sage ihm, was ich vermute, und deute dabei auf die Narben an den Gelenken. »Können Sie die Frau nicht einfach ruhigstellen?«, frage ich abschließend.
»Wir wissen ja nicht einmal, was sie hat«, erwidert der Arzt gereizt. »Ihr Herzschlag ist unregelmäßig. Möglicherweise wurde sie unter Drogen gesetzt. Es ist am sichersten, wir legen ihr Gurte an.«
»Wenn Sie die Frau festschnallen, richten Sie noch mehr Schaden an, glauben Sie mir. Ich sehe so etwas nicht zum ersten Mal.«
Ich weiß nicht, ob es an meinem Dienstausweis, meinem Narbengesicht oder meinem Tonfall liegt, aber der Arzt nickt.
»Vier Milligramm Ativan intramuskulär«, erteilt er Anweisung, »keine Gurte.«
Das Team gehorcht, ohne zu murren. Die Frau kreischt und windet sich, als man sie festhält und ihr die Nadel in den Arm drückt. Kurz darauf wimmert sie nur noch, und ihr Körper entspannt sich. Ihr Atem geht ruhiger, die Augen fallen ihr zu. Die Pfleger lassen sie vorsichtig los.
»Doktor«, sage ich, und der Arzt schaut mich an. »Entschuldigen Sie, aber da ist noch etwas. Die Frau muss auf Anzeichen sexueller Misshandlung untersucht werden.«
Er nickt und dreht sich wieder zu seiner Patientin um. In diesem Augenblick sehe ich, dass irgendetwas unter dem Bett liegt. Ich beuge mich hinunter und hebe es auf. Es ist ein Blatt Papier, weiß, Briefbogengröße, zweimal gefaltet. Ich schlage es auseinander. Da steht in schwarzer Maschinenschrift:
Wie versprochen, so geliefert. Folgen Sie den üblichen Ermittlungsschritten. Um Fragen zuvorzukommen: Ja, ich habe noch mehr in meiner Gewalt. Und ich werde sie töten, wenn Sie mich verfolgen. Seien Sie zufrieden mit dem, was ich Ihnen gegeben habe.
Ich werfe einen Blick auf das Nachthemd der Frau. Es hat eine Seitentasche. In dieser Tasche muss der Zettel gewesen sein. Ich falte ihn zusammen und stecke ihn ein.
Was ist das wieder für ein verrücktes Spiel? Was haben diese Irren davon, wenn sie einem anderen Menschen das Leben nehmen? Reicht es nicht, das Opfer zu vergewaltigen? Muss es die völlige Vernichtung sein?
Aber das sind müßige Fragen. Außerdem kenne ich die Antwort – wenn nicht verstandesmäßig, so doch tief in meinem Innern: Je größer die Erniedrigung, desto intensiver das sexuelle Erlebnis. In gewisser Weise ist es nicht anders als bei einem Amphetaminschlucker oder einem Heroinabhängigen. Viele Vergewaltiger und Serienmörder schildern ihre erste Tat als Höhepunkt. Der erste Höhepunkt ist der schönste; die späteren Taten sind nur der Versuch, diesen Höhepunkt zu wiederholen.
Ich bin an den Ermittlungen beteiligt, die von der Behavioral Analysis Unit, kurz BAU, vorgenommen werden. BAU ist die Abteilung für Verhaltensanalyse des FBI, die die Aufgabe hat, Verbrechen aus der Sicht des Verhaltensforschers zu untersuchen, insbesondere das Verhältnis von Täter und Opfer. Gefasste Täter werden aufgefordert, einen Fragebogen auszufüllen und sich einer Vernehmung zu unterziehen, die aufgezeichnet wird. Einige lehnen ab, doch die meisten sind einverstanden. Viele dieser Leute sind bösartige, selbstverliebte Irre – wie könnten sie da widerstehen, sich vor FBI-Leuten zu profilieren?
Einer der Täter, die ich verhört habe, nahm die Schreie seiner Opfer auf. Sonst nichts. Er hatte keine Fotos, keine Videos, keine Trophäen. Seine Befriedigung bezog er allein aus dem auditiven Nacherleben, dem »Hörerlebnis« sozusagen. Er war Anfang fünfzig. Ein kleiner, untersetzter Mann namens Bill Keats. Harmlos aussehend. Unscheinbar. Halbglatze. Brille mit altmodischem Horngestell. Ein Familientyp, wie viele dieser Verrückten. Ich hatte Fotos von ihm gesehen, die vor seiner Gefängniszeit aufgenommen worden waren. Auf einem der Bilder war er mit seiner verhärmten Ehefrau zu sehen. Er hatte den Arm um ihre Schultern gelegt und lächelte in die Kamera. Sie standen im Vorgarten, und es war ein sonniger Tag. Keats trug ein Chambray-Hemd, Jeans und Tennisschuhe. Über dem Hemd spannten sich ein Paar Hosenträger.
Drei Dinge fielen mir auf. Erstens das Datum: Das Foto war aufgenommen worden, noch während Keats sein vorletztes Opfer gefangen hielt. Er hatte alle seine Opfer entführt (Frauen mittleren Alters mit dunklen Haaren und großen Brüsten) und hielt sie in einer schalldichten Truhe in einem Lagerschuppen auf seinem Grundstück fest, einem gut vier Quadratkilometer großen Stück Land in Apple Valley.
Als Zweites fiel mir sein Lächeln auf. Es war wohlwollend. Nichts deutete darauf hin (außer vielleicht der niedergeschlagene Blick seiner Frau), dass man sich vor Keats in Acht nehmen sollte, zumal er nicht wie der Nachbar aussah, auf den man ein Auge haben musste. Er sah wie einer dieser Burschen aus, deren einziger Charakterfehler darin besteht, dass sie im unpassenden Augenblick einen schlüpfrigen Witz reißen, für den sie sich dann überschwänglich entschuldigen.