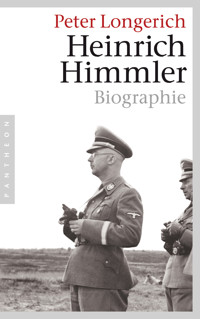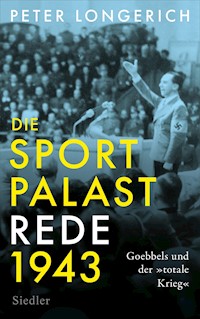Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Molden Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Hyperinflation, Staatskrise, Hitler-Putsch: Ohnmächtig wankt die junge deutsche Republik im Jahr 1923 Richtung Abgrund. Der Einmarsch französischer Truppen ins Ruhrgebiet treibt Extremisten von Rechts und Links auf die Barrikaden, das Land steht vor Bürgerkrieg und Diktatur. Es ist eine „Tollhauszeit“ (Stefan Zweig), in der sich Krisengewinner dekadenten Vergnügungen hingeben, während die Bevölkerung ins Elend stürzt. Kenntnisreich und gestützt auf reichhaltige Quellen erzählt Zeithistoriker Peter Longerich die Chronologie eines Staatsversagens. Dabei seziert der Bestsellerautor nicht bloß Ursachen und Abläufe, sondern auch die Folgen: das bis heute anhaltende Inflationstrauma – und den Aufstieg des Nationalsozialismus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 549
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Dieter Mayr Photography
Peter Longerich zählt zu den Experten für deutsche Zeitgeschichte, den Nationalsozialismus und seine Entstehung. Der Zeithistoriker war Professor am Royal Holloway College der University of London und lehrte an der Universität der Bundeswehr.
Internationale Anerkennung erfuhr er für den Bestseller »Davon haben wir nichts gewusst.« Die Deutschen und die Judenverfolgung (2006) sowie die Biografien Heinrich Himmler (2008) und Hitler (2015). 2021 wurde Antisemitismus. Eine deutsche Geschichte in die ZEIT-Sachbuch-Bestenliste und die Longlist des NDR-Sachbuchpreises aufgenommen.
Deutschland 1923: Das ist die Geschichte einer Krise, die in manchem fatal an aktuelle Ereignisse erinnert.
Unversehens löst der Einmarsch französischer Truppen ins Ruhrgebiet eine verhängnisvolle Kettenreaktion aus. Hilflos wird die völlig überforderte Regierung in Berlin von den Ereignissen mitgerissen, Industrielle und Militärs nutzen das Staatsversagen für ihre eigene Agenda, vereinnahmen Politik und Medien. Rechtsextreme und Teile des Establishments planen den Umsturz.
Das Land steht vor der Diktatur.
Traumatisch sind die Folgen der Hyperinflation: Ersparnisse werden schlagartig vernichtet, die Wirtschaft kollabiert, die Masse der Bevölkerung stürzt ins Elend. Profiteure kennt diese »Tollhauszeit« (Stefan Zweig) dennoch: Inflationskönige und Spekulanten häufen unfassbaren Reichtum an, während die Menschen in Heilsbotschaften von »Inflationsheiligen« oder radikalen Volksverführern flüchten. Im November wagt einer von ihnen in München den Putsch.
In klarer Sprache und anhand präziser Fakten erhellt Peter Longerich die Ereignisse, zieht Vergleiche mit Österreich sowie anderen Ländern und arbeitet so Ursachen und Zusammenhänge heraus. Und er zeigt nicht zuletzt, welche Erkenntnisse sich für das Heute ziehen lassen.
Prolog
1Der Vorraum der Krise: Besetzung des Ruhrgebiets
Die Staatsspitze: Ebert und Cuno• Der Industriemagnat: Hugo Stinnes• »Resistenz auf der ganzen Linie«• Propagandakampf
2»Aktiver Widerstand« und Mobilisierung der extremen Rechten
»Aktiver Widerstand« und Rechtsextremismus• Verschärfung der Lage an der Ruhr• »Ruhrkampf«: Die Reichswehr und die rechten Verbände
3Kampf um die Kohle, Radikalisierung in den Ländern
Vorstoß auf internationaler Ebene• Aufschwung des Rechtsextremismus in Bayern• Widerstand von Links in Sachsen und Thüringen• Gewaltspirale an Rhein und Ruhr
4Vor dem Scheitern
Die »Cuno-Streiks« und das Ende der Regierung• »Ruhrkampf«: eine Zwischenbilanz
5Das Verhängnis der Inflation
Auswirkungen der Geldentwertung• Die Not der geistigen Arbeiter• Schieber und Raffkes• »Der makabre Jux der Inflation«• »Zahlenwahnsinn«: Psychische und physische Folgen• Flucht in »verkappte Religionen«• Völkische Agitatoren
6Zuspitzung: Auf dem Weg in die Diktatur
Krisenherde in Sachsen und Bayern• Taktieren am Abgrund• Geheime Aufrüstung und Umsturzpläne• Ruf nach einem »Militärkanzler«• Ausnahmezustand in Bayern• Buchruckers Putsch• Erschütterung der Großen Koalition• Ringen um ein Direktorium• Alleingänge an der Ruhr• Ein neuer starker Mann• Erste Schritte zur Währungsstabilisierung• Widerstand in Sachsen, Aufmarsch in Bayern
7Eskalation: Vor dem Bürgerkrieg
Aufstand in Hamburg• Es brennt an Rhein und Ruhr• Seeckts Direktoriumspläne• Reichsexekution gegen Sachsen• Bruch der Koalition, Seeckt greift zur Feder• Bayern rüstet gegen Berlin• Direktorium oder offene Diktatur
8Entladung: Der Münchner Putsch
8. November 1923: Letzte Manöver• Der Hitler-Ludendorff-Putsch
Fazit: Die Krise des Jahres 1923 und ihre Folgen
Anmerkungen
Bibliografie
Namensregister
Bildnachweis,Abkürzungen
Prolog
1923 geriet die junge und ohnehin instabile Weimarer Republik in eine schwere Krise. Die Auseinandersetzungen um die Reparationen führten zur französisch-belgischen Besetzung des Ruhrgebietes und zum passiven Widerstand, der zum »Ruhrkampf« eskalierte. Als dieser Ende September 1923 wegen der Zerrüttung der deutschen Staatsfinanzen und angesichts einer allgemeinen Verelendung und Erschöpfung abgebrochen werden musste, befand sich Deutschland in einer Krise von nationaler Tragweite:
Die Inflation war zur Hyperinflation geworden und die Wirtschaft drohte zu kollabieren. Extreme linke und extreme rechte Kräfte bereiteten die gewaltsame Machtübernahme vor, während die rechtskonservativen Eliten das Parlament ausschalten und ein diktatorisches »Direktorium« einrichten wollten. Die Arbeitgeber versuchten mit aller Macht, die letzte der Arbeiterbewegung noch verbliebene Errungenschaft der Novemberrevolution, den Achtstundenarbeitstag, wieder abzuschaffen. Separatisten betrieben die Abtrennung des Rheinlands vom Reich. Das Reich trug gleichzeitig tiefgreifende Verfassungskonflikte mit Bayern, Sachsen und Thüringen aus. Es zeichnete sich ein militärischer Konflikt mit Frankreich ab. Als Ergebnis dieser komplizierten Konfliktlagen drohte die Demokratie zu zerbrechen und die Republik auseinanderzufallen bzw. im Bürgerkrieg zu versinken. Dass der Weimarer Staat diese Krise überhaupt überstand, ist bemerkenswert und erklärungsbedürftig.
Die Geschichtswissenschaft hat sich bereits ausführlich mit den verschiedenen Aspekten dieser Krise beschäftigt: In der Inflationsforschung der Achtzigerjahre1 ging es primär um die wirtschafts- und sozialgeschichtliche Analyse der Inflation und ihrer langfristigen Folgen für die deutsche Gesellschaft, während – davon relativ unabhängig und überwiegend kleinteilig – die politische Ereignisgeschichte des Jahres 1923 an ihren jeweiligen Brennpunkten aufgearbeitet wurde: »Ruhrkampf«,2 die Konflikte um die Linksregierungen in Sachsen und Thüringen,3 Hamburger Aufstand,4 separatistische Bewegung im Rheinland,5 »Buchrucker-Putsch« und »Schwarze Reichswehr«6 sowie vor allem die Entwicklung in Bayern mit dem spektakulären Hitler-Ludendorff-Putsch.7 In diesem Buch wird die Struktur- und Ereignisgeschichte zusammengeführt, um auf diese Weise die Krise des Jahres 1923 in ihrem Gesamtverlauf darzustellen und zu analysieren.
Die Anwendung des Krisenbegriffs auf die Weimarer Republik ist ubiquitär:8 So werden häufig die Jahre 1919 bis 1923 als Nachkriegskrise9 verstanden oder die Zeit seit Ende der Zwanzigerjahre als eine einzige große Krise dargestellt, die zum Ende der Republik führte;10 der Krisenbegriff wird aber auch auf die gesamte Geschichte der Weimarer Republik bezogen.11 Ja, in ihrer Krisenhaftigkeit erscheint die Weimarer Republik als Kernstück einer bereits Ende des 19. Jahrhunderts einsetzenden Krise der »klassischen Moderne«12 oder als eine den Zeitraum von der Reichsgründung bis zur Wiedervereinigung umfassende »Modernitätskrise«. Diese Perspektive lässt sich auch erweitern, indem man die gesamte Moderne seit Ende des 18. Jahrhunderts als krisenbehaftet, als eine Zeit des beschleunigten Wandels und Übergangs begreift, eine Ära also, in der sich Erwartungen an die Zukunft zunehmend von den verfügbaren Erfahrungen lösen, der Blick in die Zukunft offen und unsicher erscheint.13 Krise wird damit zum Dauerzustand und alles ist krisenhaft: Der Kapitalismus, die Religion, der Nationalstaat usw. Krise dient also häufig – nicht nur in der Weimarforschung – »als quasi magischer Begriff, der überall dort zum Einsatz gebracht wird, wo man mit dem Erklären sonst nicht weiterkommt«.14
Je weiter aber der Krisenbegriff gefasst wird, desto geringer ist seine analytische Kraft, er wird eher zu einer Beschreibung eines zwar als unbefriedigend empfundenen Zustands, in dem man sich durchaus einrichten kann; doch er verliert seine Dynamik und Spannung.
Im bewussten Gegensatz zu der ausufernden Verwendung des Begriffs soll »Krise« hier nun in einem sehr engen Sinne verstanden werden, nämlich als ein Prozess: Krisen wären demnach, im Anschluss an eine klassische Definition von Rudolf Vierhaus, »Prozesse, die durch Störungen des vorherigen Funktionierens politisch-sozialer Systeme entstehen und dadurch gekennzeichnet sind, daß die systemspezifischen Steuerungskapazitäten nicht mehr ausreichen, sie zu überwinden, bzw., nicht mehr zur Anwendung gebracht werden«. Diese allgemeine Definition lässt sich mithilfe einer Reihe von Kriterien (die teilweise auch schon von Vierhaus genannt wurden), weiter einengen und zuspitzen:
• Krisen sind eher Erschütterungen denn Dauerzustände, sie umfassen den kritischen Zeitraum, in dem die Störungen eines Systems so gravierend werden, dass Entscheidungen über die Fortexistenz des Systems selbst zu treffen sind.
• Krisen sind somit – abgegrenzt von Funktionsstörungen in Subsystemen – als substanzielle, existenzbedrohende Phänomene zu sehen. Krisen sind Zeiträume, in denen es darum geht, schwerwiegende Gefahren, ja die drohende Katastrophe abzuwehren.15
• Von einer Krise kann nur dann gesprochen werden, wenn die jeweiligen Zustände auch in der Wahrnehmung der Zeitgenossen als krisenhaft empfunden werden und gleichzeitig in der Rückschau objektiv abbildbar sind.
• Krisen sind Zeiten beschleunigter, häufig dramatischer Entscheidungen in einer sich dynamisch verändernden Situation; sie stellen »eine Entscheidungssituation dar, in der sich die Möglichkeit, zu handeln und zu entscheiden, in naher Zukunft zu verschließen droht. Daraus resultiert der Zeitdruck für all jene, die zu bestimmten Handlungen und Entscheidungen bewegt werden sollen oder – im Sinne einer diskursiven Strategie – sie als alternativlos durchzusetzen suchen«.16
• Wenn Krisen besondere, abgrenzbare Zeiträume darstellen, so ist es zugleich auch notwendig, sie in einem zeitlichen Kontinuum zu sehen. Es geht immer auch um das Davor und das Danach: Denn Krisen sind relativ kurze Zeitspannen zwischen einer (meist längeren) Phase, in der Problemlagen sich auftürmen, sowie, nachdem die Krise ihren Höhepunkt erreicht hat, der Entladung, die entweder zu einer katastrophalen Entwicklung oder auch zur Auflösung der Krisensituation führen kann.
Große Krisen lassen sich am besten in einem Vier-Phasen- oder -Stufenmodell darstellen. In der ersten Stufe handelt es sich um die strukturellen Konflikte, die den Ausgangspunkt der Krise bilden. Diese Konflikte liegen für den Fall der frühen Weimarer Republik auf der Hand und sind oft geschildert worden.17 Wesentlich ist zunächst die tiefe Spaltung der Gesellschaft in unterschiedliche Milieus, die jeweils in spezifischen politischen Teilkulturen und Mentalitäten verhaftet waren:18 das sozialistische Arbeitermilieu, das jedoch politisch in Sozialdemokratie und Kommunisten gespalten war;19 das schichtübergreifende katholische Milieu mit dem politischen Arm der Zentrumspartei; das vorwiegend agrarische und ostdeutsche konservative Lager, repräsentiert durch die Deutschnationale Volkspartei; und schließlich das weniger klar abgegrenzte und durchorganisierte mittelständisch-städtische Milieu mit der linksliberalen Demokratischen Partei sowie der nationalliberalen Volkspartei.
Vor diesem Hintergrund wurde die Innenpolitik der Weimarer Republik dominiert von einer großen Zahl tiefgreifender, oft mit erheblicher Aggressivität ausgetragener Konflikte zwischen großen Teilen organisierter Bevölkerungsgruppen. Entscheidend für die Fragilität der Weimarer Republik war aber nun, dass die drei Parteien, die das demokratische System vorbehaltlos unterstützten (SPD, Zentrum und DDP) nur bei den Wahlen zur Nationalversammlung 1919 eine Mehrheit besaßen, danach nie wieder. Der Republik war also eine Demokratie ohne demokratischen Basiskonsens. Aus dieser Konstellation, aber auch wegen der mangelnden Vertrautheit vieler Abgeordneter mit der Vorstellung einer dem Parlament verantwortlichen Regierung ergaben sich große Schwierigkeiten bei der Bildung handlungsfähiger Kabinette.20 Einen Ausweg aus diesen Kalamitäten bot die starke Stellung des Reichspräsidenten, der nach Artikel 48 das Recht besaß, selbstständig Verordnungen mit Gesetzeskraft zu erlassen.21 Dieser Ausweg musste aber eine weitere Schwächung des Parlaments und eine Stärkung autoritärer Politikansätze zur Folge haben.
Daneben waren Konflikte zwischen dem Reich und den Ländern durch die Verfassung vorgegeben. So blieb der Dualismus zwischen dem Reich und Preußen, das etwa zwei Fünftel der Fläche und der Einwohnerschaft Deutschlands umfasste, ebenso ungelöst22 wie der Konflikt mit Bayern, das seine mit der Gründung der Republik verlorenen Sonderrechte zurückforderte.23 Die Republik war zudem nicht nur durch die harten Bedingungen des Versailler Vertrags schwer belastet, sondern auch dadurch, dass es der politischen Rechten mit erheblichem Erfolg gelungen war, die moralische »Schuld« an Niederlage und »Versailler Diktat« auf diejenigen Kräfte abzuwälzen, die den Krieg liquidiert und die Republik aus der Taufe gehoben hatten.24
Die Niederlage, die Novemberrevolution von 1918/19 und die als demütigend empfundenen Friedensbedingungen führten zu einer Welle eines extremen, sehr stark ethnisch fundierten Nationalismus und zu einer Stärkung der schon im Kaiserreich entstandenen völkischen Bewegung.25 Belastend für die Demokratie wirkte sich aber auch die nahezu uneingeschränkte Kontinuität der antidemokratisch geprägten Eliten des Kaiserreichs aus, an den Spitzen der Verwaltung, in Justiz, Militär, Diplomatie und an den Hochschulen, im Großgrundbesitz und in der Schwerindustrie.26 Die ungeheure Gewalterfahrung des Krieges prägte auch die Nachkriegsgesellschaft: Gewalt erschien als legitimes Mittel der innenpolitischen Auseinandersetzung, Millionen von Männern gehörten paramilitärischen Formationen an.27 Die Kette bewaffneter Auseinandersetzungen riss nicht ab.28
Als schwerwiegende Hypothek der Kriegsfinanzierung wurde bereits die Inflation erwähnt; hinzu kam die Schwäche der Industrieproduktion, die im Jahre 1923 nur 46 Prozent des Standes von 1913 erreichte.29 Auf dieser schwachen Basis war es einfach nicht möglich, das in der Verfassung postulierte Sozialstaatsprinzip auch nur annähernd durchzusetzen und den Menschen in der Krise einen Rettungsschirm zu bieten.30
Die zweite Phase des Krisenmodells beinhaltet die Zuspitzung dieser strukturell angelegten Konflikte hin zur aktuellen Krise. Diese Phase, der »Vorraum der Krise«, ist in unserem Fall etwa gleichbedeutend mit dem »Ruhrkampf«, der durch die französisch-belgische Besetzung des Ruhrgebiets ausgelöst wurde und maßgeblich infolge der Politik der Regierung Cuno zwei Konsequenzen hatte: ökonomisch die völlige Zerrüttung der Währung und der sich nun abzeichnende Zusammenbruch der Volkswirtschaft; politisch führte der durch die Regierung geförderte Aufmarsch der Rechtsextremisten mit Schwerpunkt in Bayern zu einer entsprechenden Gegenreaktion auf der äußersten Linken (Schwerpunkt Sachsen/Thüringen sowie Hamburg), insgesamt also zu einem Bürgerkriegsszenario. Dieser Entwicklung in den Monaten Januar bis August/September sind die ersten Kapitel von Außer Kontrolle gewidmet.
Bevor aber die nächste Phase, die eigentliche Krise, betrachtet wird, gilt es, sich in einem Querschnitt den Stand der Inflation und die kumulative Wirkung der fast schon ein Jahrzehnt voranschreitenden Geldentwertung zu vergegenwärtigen, also ihre wirtschaftlichen, sozialen, politischen, vor allem aber ihre sozialpsychologischen Folgen nachzuzeichnen: Denn der Verlust des Wertmaßstabes Geld führte zu einer veränderten Wahrnehmung der Realität, die ihrerseits Auswirkungen auf den Verlauf der Krise haben musste.
Die schließlich finale Phase, die ab Kapitel 6 eingehend dargestellt und analysiert wird, betrifft folglich die eigentliche Krise, die Phase äußerster Anspannung, in der die Erwartung vorherrschte, die überhandnehmenden Konflikte würden sich kurzfristig in einer finalen Auseinandersetzung entladen, sei es nun in einer Hungerkatastrophe mit den zu erwartenden Überlebenskämpfen aller gegen alle, in einem Bürgerkrieg, im Auseinanderfallen des Deutschen Reiches oder – um dies alles abzuwenden – in der Errichtung einer Diktatur, die das Ende der Republik besiegelt hätte. Diese Phase zeichnet sich mit dem Rücktritt der Regierung Cuno im August 1923 ab und setzt mit dem Abbau des sogenannten Ruhrkampfes durch die Große Koalition unter Kanzler Stresemann im September 1923 ein.
Auf den ersten Blick erscheint diese Krise als ein chaotisches, nicht mehr steuerbares Gewirr kaum lösbarer Probleme innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne. In Außer Kontrolle wird versucht, das komplexe Ereignisbündel zu entwirren und den Verlauf der Krise im Detail nachzuzeichnen. Dabei konzentriert sich die Darstellung auf einige Entscheidungsträger und auf fünf geografische Zentren: Berlin, Bayern/München, Dresden für Sachsen/Thüringen, Hamburg sowie das Rhein-Ruhr-Gebiet. Da Krisen Zeiten beschleunigter Entscheidungsprozesse sind, wird – meist im Abstand von wenigen Tagen – der Fokus auf jeweils ein oder zwei dieser Zentren gelegt und im ständigen Perspektivwechsel die Interaktion zwischen diesen Zentren, das gegenseitige Aufschaukeln in der Krise, nachvollzogen.
Dabei wird sich herausstellen, dass die Situation des Jahres 1923 nicht einfach durch den Zusammenprall verschiedener Konfliktlagen zur Krise eskalierte, sondern entscheidend durch die – infolge der nationalistischen Aufbruchsstimmung während des »Ruhrkampfes« gestärkte – politische Rechte vorangetrieben wurde. Die wollte die Krise weiter radikalisieren und letztlich nutzen, um durch die Errichtung einer Diktatur die Weimarer Republik zu beenden und die relativ starke Stellung der Linksparteien (des »Marxismus«) endgültig zu beseitigen. Für diese Diktatur gab es zwei Modelle: Den rechtsextremen Putsch und die von rechtskonservativer Seite propagierte Diktatur durch ein vom Reichspräsidenten einzusetzendes Direktorium, vorgeblich im Rahmen der Verfassung. Es wird allerdings deutlich werden, dass die Grenzen zwischen beiden Modellen fließend waren und die zweite, die »legale« Variante auf einen kalten Staatsstreich und letztlich eine erhebliche Veränderung der Verfassung in einem autoritären Sinne hinausgelaufen wäre.
Die Krise mündet im Herbst 1923 schließlich in der vierten Stufe: Der missglückte Hitler-Ludendorff-Putsch diskreditierte alle Staatsstreich- und Diktaturpläne und verhinderte das schon eingeleitete frühe Ende der Weimarer Demokratie. Gleichzeitig sorgte die überraschend zustande gekommene Währungsstabilisierung und die durch eine Veränderung der internationalen Konstellation plötzlich möglich erscheinende Neuregelung der Reparationen für eine allmähliche allgemeine Stabilisierung der Situation. Andere Probleme jedoch, wie die Zukunft des besetzten Rhein-Ruhr-Gebiets und der Konflikt mit Frankreich, vor allem aber das große Potenzial der Republik-Gegner auf der äußersten Linken sowie in der gesamten Rechten, blieben ungelöst. Damit war die Krise beendet, ohne dass die strukturellen Probleme, die ihr zugrunde lagen, beseitigt worden wären. Zehn Jahre später sollten sich diese Versäumnisse bitter rächen. •
Eine französische Militärmaschine während eines Kontrollflugs über einer Industrieanlage im besetzten Ruhrgebiet.
1 DER VORRAUM DER KRISE: Besetzung des Ruhrgebiets
Am 11. Januar 1923 rückten französische und belgische Truppen, kriegsmäßig unterstützt von Artillerie und Panzerfahrzeugen, in das Ruhrgebiet ein und brachten zunächst die Stadt Essen vollständig unter ihre Kontrolle. Nach und nach dehnten sie die Besatzung aus, sie sollte auf knapp 100 000 Mann anwachsen. Aus ihrer Position absoluter Übermacht bedeuteten die Besatzer der Bevölkerung gleich zu Beginn, sie solle weiterhin ruhig ihrer Arbeit nachgehen, Störungen oder Veränderungen des normalen Lebens seien nicht zu erwarten. Um die Bevölkerung in Schach zu halten und die deutschen Behörden zur Kooperation zu zwingen, wurde der Belagerungszustand verhängt, den französische Militärgerichte mit drakonischen Strafen sichern sollten.31
Die Machtdemonstration kam nicht unerwartet. Alliierte Truppen hielten bereits seit Ende des Ersten Weltkriegs das linke Rheinufer sowie einige Brückenköpfe auf der anderen Rheinseite besetzt. Die Okkupation nun auch auf die Industrieregion an der Ruhr auszudehnen, um so die dem Reich im Versailler Vertrag auferlegten Verpflichtungen durchzusetzen, war von den Alliierten in der Vergangenheit schon mehrfach angedroht worden. Im März 1921 rückten tatsächlich Truppen in Düsseldorf und Duisburg ein.32 Die unmittelbar bevorstehende Ausdehnung der Besatzung auf den Kern des Ruhrgebiets mit den wichtigsten Zechen, für die insbesondere 1921/22 bereits militärische Pläne vorlagen,33 zeichnete sich deutlich seit Ende November 1922 ab, als ein entsprechender Beschluss des französischen Ministerrats gezielt an die Öffentlichkeit gelangte.34 Einen Anlass für den Einmarsch boten der französischen Regierung Rückstände bei den Reparationen: Die aus Vertretern der Siegermächte gebildete Reparationskommission, die die deutschen Leistungen überwachte, stellte am 26. Dezember 1922 aufgrund eines französischen Antrags Fehlmengen bei den vereinbarten Holzlieferungen fest und am 9. Januar 1923 – nachdem eine Konferenz in Paris zur Regelung der Reparationsfrage gescheitert war – zusätzlich bei der Kohlezufuhr aus Deutschland. Der französische Beschluss war im Übrigen gegen britischen Einspruch erfolgt.35
Tatsächlich nutzte die französische Regierung unter Ministerpräsident Raymond Poincaré die Situation, um durch die Ausdehnung der Besetzung auf die industrielle Schlüsselregion des besiegten Nachbarn weiterreichende Ziele zu verfolgen, nämlich die Zugehörigkeit des gesamten Rhein-Ruhr-Gebiets zum Reichsverband zu lockern, es gegebenenfalls aus Preußen herauszulösen und in einen autonomen oder halbautonomen Zustand zu überführen. Ob und wie der Status dieses Gebiets mittel- und langfristig geändert werden sollte, darüber hielt man sich mehrere Optionen offen. Zum einen sollte der künftige Kohlebedarf der französischen Schwerindustrie dauerhaft gedeckt werden, zum anderen ein Wiedererstarken Deutschlands verhindert und die politisch-strategische Vormachtstellung Frankreichs auf dem Kontinent gefestigt werden.36
In Deutschland herrschte demgegenüber die Auffassung vor, Ziel der französischen Politik sei – ganz in der Tradition französischer Rheinpolitik – die Annexion des gesamten Gebiets. Dabei handelte es sich im Wesentlichen um Spekulationen, aussagekräftige Belege lagen nicht vor.
Im Gegenteil: Der deutsche Botschafter in Paris, Leopold von Hoesch, ging jedenfalls Ende Februar 1923 davon aus, dass Frankreich keine Annexion des Ruhrgebiets und auch keine Einverleibung des linken Rheingebiets anstrebe; zu sehr würden negative internationale Reaktionen und der als gefährlich angesehene wirtschaftliche und politische Einfluss einer künftigen starken deutschen Minderheit in Frankreich befürchtet. Hoesch hielt auch das Projekt eines selbstständigen Staates Rheinland-Westfalen nicht für wahrscheinlich, da ein solcher Staat entweder eng an Frankreich gebunden (was einen zu starken deutschen Einfluss befürchten ließe) oder ausgebeutet und unterdrückt werden müsste (was auf die Dauer zu aufwendig wäre). In jedem Fall ginge die Aussicht auf Reparationen aus dem restlichen Deutschland verloren. Auch eine Internationalisierung des Ruhrgebiets läge nicht im französischen Interesse.
Eigentliches Ziel der Besatzung sei vielmehr, so Hoesch, die »Mürbmachung Deutschlands für Verhandlungen«. In Deutschland sei man, das habe er bei der Lektüre der deutschen Presse festgestellt, in »irriger Auffassung« befangen, »Frankreich sei in annexionistischer Absicht in das Ruhrgebiet einmarschiert«. Dies träfe aber nicht den Kern der Sache: »Die Aktion wurde vielmehr unternommen, um Deutschland in seinem Lebensnerv zu treffen und ohne hemmende Einwirkung der Alliierten das Reparationsproblem in einer Form zu lösen, die einerseits die französischen Bedürfnisse so weit wie möglich befriedigt, andererseits aber Deutschland der französischen Zugriffsmöglichkeit nicht entschlüpfen soll und einen Wiederaufstieg des Deutschen Reiches zu Reichtum und Macht ausschließt.«37
Einen Monat später berichtete Hoesch, »Frankreich befindet sich auf der einen Seite in einem gewissen Rausch im Gefühl seiner gegenwärtigen Macht«, zumal die befürchteten negativen Folgen des Einmarsches – Widerspruch seitens Großbritanniens und der USA – nicht eingetreten seien. »Auf der anderen Seite steht dem französischen Machtdünkel gegenüber ein Gefühl eigener Schwäche angesichts der geringen Bevölkerung des Landes, seiner kläglichen Finanzlage sowie seiner Abhängigkeit von den angelsächsischen Gläubigerstaaten«. In Anbetracht dieser durchwachsenen Stimmungslage kam Hoesch zu der Schlussfolgerung, bezüglich der »Ziele der Aktion herrscht bei der französischen Regierung ein heilloses Durcheinander«.38
Im Oktober 1923, nach dem Abbruch des deutschen »passiven Widerstands«, hatte Hoesch seine Einschätzung der französischen Politik nicht geändert, wie Harry Graf Kessler, durch das Auswärtige Amt (AA) zur Erkundung der Lage nach Paris geschickt, von ihm erfuhr. Poincaré wolle, so Hoesch, »nicht die Zertrümmerung Deutschlands«, sondern produktive Pfänder an der Ruhr, eine unbegrenzte Besetzung des Rheinlandes später »vielleicht auch zusammen mit anderen Truppen« sowie die Internationalisierung der rheinischen Eisenbahnen. Eine Ablösung des Rheinlandes oder eine rheinische Republik gehörten nicht zu seinen Zielen.39 Die Haltung des Botschafters wurde aber sowohl seitens der deutschen Regierung wie auch von der öffentlichen Meinung während des gesamten »Ruhrkampfes« vollkommen ignoriert. Stattdessen konzentrierte man sich in Deutschland auf eine Mobilisierung nationalistischer Emotionen gegen den raubgierigen »Erzfeind«.
Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, dass die deutschen Reparationsrückstände den Franzosen nicht nur einen willkommenen Vorwand für einen weiteren Zugriff auf deutsches Territorium lieferten, sondern die Ruhrbesetzung auch realpolitisch begründet war: Belgier und Franzosen waren wegen der erheblichen Zerstörungen, die deutsche Truppen während des Krieges in ihren Ländern angerichtet hatten, auf die deutschen Reparationslieferungen angewiesen: Gerade auf die Kohle, die man infolge der Überflutung der Bergwerke während der Besatzung nicht in ausreichender Menge im eigenen Land fördern konnte. Dass der Einmarsch also auf eine Notlage zurückzuführen war und nicht nur auf imperialistische Gelüste, wurde auf deutscher Seite nicht wahrgenommen; ebenso, dass das martialische Auftreten der Besatzer und ihre unnachgiebige Haltung gegenüber der Bevölkerung nur vor dem Hintergrund der brutalen deutschen Okkupation in Belgien und Nordfrankreich zu verstehen war.40
Was aus belgisch-französischer Sicht als notwendige und angemessene Antwort auf die Verwüstungen während des Krieges erschien, war aus deutscher Sicht reine Willkür, äußerste Demütigung und eine eklatante Verletzung des Völkerrechts. Auf die französische Herausforderung reagierte die deutsche Seite mit der Waffe des »passiven Widerstands«. Die seinerzeitige Ruhrpropaganda und die anschließende nationalistische Verklärung der Resistenz von Eisenbahnern, Beamten, Arbeitern und Unternehmern im Ruhrgebiet hat dieses Vorgehen zu einer großen, die ganze Nation erfassenden gemeinschaftsstiftenden Leistung,41 zu einem zweiten August 1914 erhoben und als moralischen Sieg über einen überlegenen und brutal vorgehenden Militärapparat gefeiert – Legendenbildung mit lang anhaltender Wirkung. Eine nüchterne Analyse des sogenannten Ruhrkampfes ergibt jedoch ein anderes Bild: Abgesehen davon, dass das Nichtbefolgen von Anordnungen der Besatzungsmächte durch die eigenen Landsleute häufig mit erheblichem Druck erzwungen wurde, war von Anfang an klar, dass diese Maßnahmen französische Gegenreaktionen auslösen würden. Das vor allem, weil sie von organisierter und höchst aktiver Gewaltanwendung gegen die französisch-belgischen Besatzer flankiert war und in eine Spirale der Gewalt münden musste.
Allein: Der »passive Widerstand« war weder das Ergebnis einer bewussten Entscheidung der politischen Führung für einen Akt nationalen Aufbegehrens, noch wurde er aus der Empörung einer plötzlich geeinten Bevölkerung geboren. Vielmehr ergab sich diese Antwort auf die Besetzung im Laufe des Januars aus einzelnen Maßnahmen und Festlegungen auf der deutschen Seite im Verein mit französischen Gegenreaktionen. Dem »passiven Widerstand« lag weder eine Konzeption zugrunde, die seinen gewaltfreien Charakter nachhaltig hätte sichern können, noch machte man sich auch nur entfernt Vorstellungen über seine volkswirtschaftlichen, politischen und sozialen Folgen und die sich daraus ergebenden Kosten. Es handelte sich im wahrsten Sinne des Wortes um Katastrophenpolitik (wie ein Insider aus dem Auswärtigen Amt angesichts des sich formierenden Widerstands formulierte42), die schließlich zu einer spektakulären Niederlage und der schweren Krise des Herbstes 1923 führte.
Französische Panzerautos fahren während der Besetzung des Ruhrgebiets vor dem Hauptbahnhof in Essen auf.
Der französische Ministerpräsident Raymond Poincaré vertrat eine strikt antideutsche Haltung.
Die Besatzer traten in den okkupierten Gebieten betont martialisch auf.
Mülheim an der Ruhr: Um das Rathaus vor Marodeuren zu schützen, übernachteten Magistratsbeamte in ihren Amtsräumen.
Die Verantwortung für diese von ihm ursprünglich nicht konzipierte Politik trug der amtierende Reichskanzler Wilhelm Cuno, während der Präsident Friedrich Ebert, der Cuno im November 1922 ernannt hatte, die Politik des »passiven Widerstands« zumindest in ihrer Anfangsphase mit seiner ganzen Autorität stützte. Auf die Persönlichkeiten dieser in den kommenden Monaten wichtigsten politischen Entscheidungsträger auf deutscher Seite soll zunächst etwas näher eingegangen werden, der Prämisse folgend, dass zwar die Ursachen der Krise von 1923 wesentlich strukturell bedingt waren, sich also vor allem aus den Folgen des Krieges und den hierdurch verschärften innenpolitischen Frontlinien ergaben, aber der Verlauf des gesamten Krisen jahrs 1923 entscheidend durch das Handeln und die Interaktion von Personen in Schlüsselpositionen geprägt wurde.
Die Staatsspitze: Ebert und Cuno
Friedrich Ebert, 1871 unmittelbar nach der Reichsgründung in Heidelberg geboren und dort in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, hatte den Beruf des Sattlers erlernt, sich aber seit Ende der 1880er-Jahre vorwiegend gewerkschaftlich sowie politisch in der Sozialdemokratie betätigt. Ebert durchlief eine mustergültige Funktionärskarriere, die ihn von der Position eines Arbeitersekretärs bei den Bremer Gewerkschaften über verschiedene Zwischenstationen 1913 zum Parteivorsitz der SPD geführt hatte. Aus den innerparteilichen Flügelkämpfen und theoretischen Auseinandersetzungen hielt er sich weitgehend heraus: Ihm ging es stets um die Geschlossenheit der Partei und darum, deren hochgesteckten sozialistischen Ziele durch eine pragmatische Reformpolitik näherzukommen.43
Beim Zusammenbruch des Kaiserreichs 1918 war dem ausgezeichnet vernetzten Ebert eine zentrale Rolle zugefallen, die er nutzte, um als Vorsitzender einer provisorischen, aus den beiden sozialistischen Parteien gebildeten Regierung, dem »Rat der Volksbeauftragten«, eine weitere Radikalisierung der in Gang gekommenen revolutionären Bewegung zu verhindern und Deutschland möglichst rasch in eine parlamentarische Demokratie umzuwandeln. Die bereits im Januar 1919 gewählte verfassungsgebende Nationalversammlung vertraute ihm am 11. Februar das Amt des Reichspräsidenten an, dessen Kompetenzen allerdings noch durch die neue Verfassung festzulegen waren. Sie verlieh ihm schließlich erhebliche Machtbefugnisse: Ernennung und Entlassung des Kanzlers, die völkerrechtliche Vertretung des Reiches nach außen, den Oberbefehl über die Streitkräfte sowie das Recht, eigenständig Notverordnungen zu erlassen (der berühmte Artikel 48).44
In seiner Amtszeit bis zu seinem Tod 1925 hat Ebert diese Machtstellung vor allem genutzt, um eine an den realen Machtverhältnissen orientierte Politik des innenpolitischen Ausgleichs und demokratischer Reformen zu betreiben mit dem Hauptziel, ein Auseinanderbrechen der krisengeschüttelten Republik zu verhindern. Angesichts dreier Reichstagswahlen in den Jahren 1920 bis 1925 mit erheblichen Mehrheitsverschiebungen und bei rasch wechselnden Regierungen stellte Ebert tatsächlich ganz wesentlich die Kontinuität des Staatshandelns sicher. Ebert war jedoch keine charismatische Führungsfigur und er war auch über den sozialdemokratischen Anhang hinaus wohl nicht wirklich in breiten Volksschichten populär. Vor dem Hintergrund des pompösen Repräsentationsstils Kaiser Wilhelm II. fiel es vielen Deutschen schwer, sich an den als Durchschnitt-Typus wahrgenommenen, bescheiden auftretenden und rhetorisch zurückgenommenen Präsidenten im Gehrock mit Zylinder zu gewöhnen.45
Aus der politischen Rechten schlugen ihm hingegen offener Hass und Verachtung entgegen: Hier konnte man sich nicht damit abfinden, dass der Anführer der Sozialdemokratie, der »Reichsfeinde« des kaiserlichen Deutschlands, nun an der Spitze des Staates stand, ein Mann mit proletarisch-handwerklicher Herkunft, der sich in den 1890er-Jahren sein erstes politisches Engagement als Wirt finanziert hatte. Bezeichnend ist der Skandal um ein anlässlich seiner feierlichen Vereidigung auf die Verfassung im August 1919 in der bürgerlichen Presse veröffentlichtes privates Foto, das ihn – nach damaligem Verständnis ein ungeheurer Stilbruch – in Badehose am Ostseestrand zeigte. Während seiner gesamten Amtszeit hatte er Verleumdungsprozesse zu führen, bei denen es neben Angriffen auf sein Privatleben insbesondere um seine Rolle in Kriegs- und Revolutionszeiten ging.
Stand bei der Rechten der Vorwurf des »Landesverrats« im Vordergrund, galt er links von der Mehrheitssozialdemokratie wegen seines Ausbremsens der Revolution als »Arbeiterverräter« und wegen des von ihm zu verantwortenden Einsatzes von Truppen gegen revolutionäre Kräfte um die Jahreswende 1918/19 in Berlin gar als »Arbeitermörder«. Innerhalb der SPD geriet er wiederum zunehmend in die Kritik, weil er sein Amt nicht primär für die Durchsetzung sozialdemokratischer Vorstellungen nutzte, sondern seine Amtsführung als überparteilich verstand.46
In der Tat sah sich Friedrich Ebert nicht als Gegenpol zu den Verfassungsorganen Reichsregierung und Reichstag, sondern als Mediator, der versuchte, Regierung und Parlamentsmehrheit auf möglichst eine Linie zu bringen. Typisch für seinen Regierungsstil waren sein stets hoher Informationsstand, meist konziliante Umgangsformen und die Angewohnheit, bei wichtigen Regierungsentscheidungen selbst den Vorsitz im Kabinett zu übernehmen. Das bedeutete aber nicht, dass er gegenüber Kanzlern und Ministern grundsätzlich und permanent eine Führungsrolle beanspruchte, ihm ging es in erster Linie um Interessenausgleich und praktische Ergebnisse. Auch der häufige Einsatz des präsidialen Notverordnungsrechts in den ersten Jahren der Republik ist nicht primär auf seinen persönlichen Machtwillen zurückzuführen, sondern es handelte sich in erster Linie um eine durch die Regierungen (in Absprache mit dem Parlament, autorisiert durch den Präsidenten) benutzte Abkürzung des Gesetzgebungswegs in schwierigen Zeiten. Erheblichen Einfluss nahm Präsident Ebert allerdings auf die jeweilige Regierungsbildung.47
So auch im Falle des Reichskanzlers Wilhelm Cuno. Der war in der Tat, wie dessen Nachfolger Stresemann schrieb, Eberts »eigenstes Werk«.48 Der Präsident setzte Vertrauen in den Hamburger Reedereimanager, weil er ihn für geeignet hielt, als »Mann der Wirtschaft« mit sehr guten Beziehungen in die angelsächsische Welt, den deutschen Außenhandel in Schwung zu bringen und die komplizierte Währungs- und Reparationsproblematik Deutschlands aufzulösen.
Cuno, der zunächst eine beachtliche Karriere als kaiserlicher Beamter gemacht hatte, war 1917 vom Reeder Albert Ballin in den Vorstand seiner Hapag-Reederei geholt worden. 1918 war er, nach Ende des Krieges und dem Suizid Ballins, als Generaldirektor Nachfolger seines Mentors geworden und hatte die Schiffsflotte, die durch den Krieg und den Versailler Vertrag verloren gegangen war, wieder neu aufgebaut. Seit November 1922 war er nun Kanzler in einem Kabinett, das sich nicht als Koalitionsregierung verstand, sondern nach dem Scheitern einer parlamentarischen Mehrheitsbildung aus »Fachleuten« zusammengestellt wurde, von denen sieben den bürgerlichen Parteien Deutsche Volkspartei (DVP), Deutsche Demokratische Partei (DDP), Zentrum und Bayerische Volkspartei (BVP) angehörten und fünf parteilos waren. Ohne verbindliche parlamentarische Absicherung war die Regierung bei Abstimmungen nicht nur auf das Wohlwollen der genannten Parteien angewiesen, sondern zusätzlich auch auf die Tolerierung durch die SPD bzw. die Deutschnationale Volkspartei (DNVP).49
Cuno war zwar in den letzten Jahren mehrfach vom Auswärtigen Amt als Sachverständiger bei internationalen Verhandlungen hinzugezogen und auch verschiedentlich als Kandidat für einen Ministerposten gehandelt worden. Ende 1922 betrat er den politischen Berliner Betrieb jedoch als Quereinsteiger ohne feste Anbindung oder Anhang. Mit seiner politisch konservativen und wirtschaftsliberalen Einstellung hatte er sich ursprünglich der DVP angeschlossen. 1920 war er aber aus der Partei ausgetreten und wurde von zeitgenössischen Beobachtern irgendwo zwischen DVP, DNVP und dem rechten Zentrumsflügel stehend eingeordnet – bezeichnenderweise divergierten die Ansichten hierüber.50 In jedem Fall aber bedeutete die Bildung des Kabinetts Cuno einen kräftigen Rechtsruck.
In seinem Auftreten und in seinem Habitus entsprach der in Thüringen geborene Katholik der landläufigen Vorstellung vom erfolgreichen und honorigem Hamburger Kaufmann alter Schule: höflich und gewandt, vorsichtig und zurückhaltend, ja kühl distanziert, im Grunde aber, wie ein Mitarbeiter der Reichskanzlei über seinen Chef resümierend festhielt, »schon ein Sohn der Vergangenheit«.51 Dies galt aber nicht nur für seinen Umgangsstil, sondern auch für sein Amtsverständnis. Als ehemaliger Ministerialbeamter und erfolgreicher Generaldirektor vertraute Cuno auf die Überzeugungs- und Durchsetzungskraft einer »sachlich« begründeten und an ökonomischen »Tatsachen« orientierten Politik. Dabei unterschätzte er, wie sehr gerade eine Regierung ohne feste parlamentarische Mehrheit unter dem Einfluss der Parteienkämpfe und den Ausschlägen der öffentlichen Meinung stand.
Cunos Ernennung stieß unter Insidern sogleich auf große Skepsis. So schrieb der linksliberale, in der deutschen pazifistischen Bewegung führende Hellmut von Gerlach im November 1922, Cuno werde »wahrscheinlich nicht imstande sein die wachsenden wirtschaftlichen, finanziellen und politischen Schwierigkeiten Deutschlands zu meistern. Politische Sachkenner geben seinem Kabinett eine Lebensdauer von nur vier bis fünf Monaten.«52 Der renommierte Nationalökonom Moritz Julius Bonn schrieb, Cuno sei »Eberts größter Fehlgriff« gewesen, denn er habe ein geringeres Verständnis von Politik besessen als ein »mittelmäßig begabter Gewerkschaftssekretär, der auf einen Ministersitz gepurzelt ist«.53 Ähnliche negative Einschätzungen Cunos weiterer zeitgenössischer Akteure lassen sich ohne große Mühe zusammenstellen. So meinte etwa der britische Boschafter Lord D’Abernon, Cuno sei »plötzlich wie Lohengrin mitten im politischen Betrieb« aufgetaucht, er habe zwar »vernünftige Ideen und kluge Absichten« könne sie »jedoch weder in Rede noch Schrift entsprechend zum Ausdruck« bringen. Der weltläufige und linksstehende Harry Graf Kessler, sowohl im Kulturbetrieb wie in der Politik engagiert, sah den Hauptvorteil des Kabinetts Cuno darin, »daß es auch dem Auslande beweise, ohne Linksparteien und Arbeiter sei keine für das Ausland brauchbare Regierung in Deutschland möglich«.54
Hugo Stinnes: Der allmächtige Ruhrindustrielle, Politiker und Zeitungsherausgeber war eine der Schlüsselfiguren der Krise von 1923.
Der französische und belgische Vormarsch zielte direkt ins Herz der deutschen Schwerindustrie, nicht zuletzt auf die Kruppwerke in Essen. (Aufnahme vom 18.1.1923).
Reichspräsident Friedrich Ebert (re.) und sein »größter Fehlgriff«: der zögerliche, letztlich machtlose Reichskanzler Wilhelm Cuno.
In der Tat sollte sich der Quereinsteiger alsbald in nahezu jeder Beziehung als Fehlgriff erweisen, unfähig, auf die mit Jahresbeginn 1923 einsetzende schwere Krise eine Antwort zu finden.
Befasst man sich näher mit Cunos ersten Reaktionen auf die Besetzung, so fällt zunächst einmal das erstaunliche Faktum ins Auge, dass für den Fall einer Besetzung der Ruhr auf Regierungsseite keine Vorbereitungen getroffen worden waren, obwohl die französische Regierung ihren Beschluss zum Einmarsch Ende November gezielt an die Öffentlichkeit hatte durchsickern lassen.55 Gegenüber der deutschen Öffentlichkeit brachte die Reichsregierung ihre Überrumpelung durch den »Ruhreinbruch« auf die Formel, er sei »längst vorhergesehen und unerwartet« zustande gekommen.56 Diese konfuse Formulierung entsprach der Hilfs- und Planlosigkeit der Regierung: Sie befasste sich erstmalig in einer Sitzung unter Leitung des Reichspräsidenten am 9. Januar mit der ursprünglich für den nächsten Tag vorgesehenen Besetzung. Aus einer für Cuno verfassten Vorlage aus der Reichskanzlei, die wohl für diese Sitzung bestimmt war, ergibt sich, dass zu diesem Zeitpunkt Proteste und Solidaritätskundgebungen vorgesehen waren, nicht jedoch (passive oder gar darüber hinausgehende) Widerstandshandlungen.57
Auf einer Besprechung im Reichsverkehrsministerium am 10. Januar folgten die Vertreter von AA, Innen- und Wehrministerium dem Vorschlag des Staatssekretärs des gastgebenden Hauses, »daß die Eisenbahn keinen Widerstand, auch keinen passiven, den Franzosen leisten solle«.58
Am 11. Januar, am Tag des Einmarschs, erließen Reichspräsident und Reichsregierung an die Ruhrbevölkerung sowie an das deutsche Volk Aufrufe, in denen jeder Gedanke an irgendeine Form von Widerstand sorgsam vermieden wurde; stattdessen war die Rede vom solidarischen »Zusammenstehen« und »eiserner Selbstbeherrschung«. Die Aufrufe machten im Übrigen die Machtlosigkeit der Regierenden gegenüber dem französisch-belgischen Vorgehen deutlich.59 Sie trugen nicht zuletzt der weitverbreiteten Resignation und Indifferenz Rechnung, die in der Bevölkerung in den vergangenen Wochen angesichts der immer wahrscheinlicher werdenden Besetzung vorgeherrscht hatten, eine Grundhaltung, an der auch die Okkupation selbst zunächst nichts änderte.60 Bei der Besprechung mit den Ministerpräsidenten der Länder am 12. Januar ging es ebenfalls nicht um Widerstand, sondern der Innenminister trug unter anderem geplante Maßnahmen gegen »Luxus und die Schlemmerei in öffentlichen Lokalen«, den Kampf gegen Alkoholmissbrauch sowie die Einschränkung ausschweifender Vergnügungen vor.61 Auch die Reichstagsresolution vom 13. Januar begnügte sich mit einem feierlichen Protest gegen die Besetzung und kündigte die Unterstützung der Regierung »mit allen Kräften« an.62
Der Industriemagnat: Hugo Stinnes
Entscheidend für die Auslösung des Widerstands war vielmehr das Handeln der Zechenbesitzer, die das größte Interesse daran hatten, die an die Siegermächte zu liefernde »Reparationskohle«, die das Reich bisher bei ihnen aufgekauft hatte, dem direkten französischen Zugriff zu entziehen.
Unter den Zechenbesitzern ragte wiederum eine Figur heraus, die als beherrschende Persönlichkeit der deutschen Wirtschaft der frühen Zwanzigerjahre über immensen politischen Einfluss verfügte und nun auch rasch das Heft des Handelns in die Hand nahm: der Großindustrielle und »König« der Inflationswirtschaft Hugo Stinnes, neben Ebert und Cuno der dritte wichtige Player in der sich entfaltenden Krise.
Der 1880 geborene Stinnes hatte nach dem frühen Tod seines Vaters und einem Bergbauingenieurstudium bereits mit zwanzig Jahren eine leitende Stellung in dem familieneigenen Mülheimer Bergbau- und Handelskonzern eingenommen, war aber drei Jahre später eigene Wege gegangen. Stinnes sollte es bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs gelingen, ein gigantisches Wirtschaftsimperium aufzubauen. Die bloße Aufzählung seiner wichtigsten Geschäftsaktivitäten demonstriert bereits die Grundidee seiner Wirtschaftstätigkeit: vertikale Konzentration, das heißt, der Aufbau ineinandergreifender, leistungsstarker Produktions-, Dienstleistungs- und Handelsketten. Ausgehend von der Kohlegewinnung kamen nach und nach hinzu: die Produktion von Brikett und Koks, Kohlehandel, Holzwirtschaft, Schifffahrt, Werften, Hafenanlagen; Kraftwerke, Elektrizitätsversorgung, Straßen- und Nebenbahnen, Gaswerke; Erzeugung von Eisen und Stahl, die Weiterverarbeitung der hierbei gewonnenen Produkte und ihre Vermarktung; internationaler Handel mit einem weltweiten Netz an Niederlassungen. Dabei gelang es Stinnes, Synergieeffekte zwischen den verschiedenen Zweigen seines Wirtschaftsimperiums zu nutzen.
Während des Krieges stieg der Großindustrielle außerdem in großem Umfang in die profitable Rüstungsproduktion ein, während er andererseits einen großen Teil seiner Auslandsunternehmungen verlor. Mit kühlem Realitätssinn stellte er sich auf die neuen politischen Bedingungen nach Niederlage und Revolution ein. Er initiierte maßgeblich das nur sechs Tage nach dem Regimewechsel abgeschlossene, nach ihm und dem Führer des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB) benannte Stinnes-Legien-Abkommen: Die Arbeitgeber konzedierten die Anerkennung der Gewerkschaften, Tarifverträge und die Senkung der Arbeitszeit auf maximal acht Stunden, blockten damit aber zugleich den drohenden revolutionären Zugriff der Arbeiterschaft auf die Unternehmen ab. In der gleichzeitig geschaffenen »Zentralarbeitsgemeinschaft« versuchte man sich dafür in den folgenden Jahren am Interessenausgleich zwischen Unternehmer und Gewerkschaften.
In den ersten Nachkriegsjahren nutzte Hugo Stinnes die inflationäre Entwicklung rückhaltlos aus, indem er zahllose weitere Unternehmen mithilfe mühelos zurückzahlbarer Papiergeld-Kredite aufkaufte. Dabei betrieb er die Politik der vertikalen Konzentration konsequent fort, indem er – bei steigenden Rohstoffpreisen – die schwerindustrielle Basis seines Wirtschaftsimperiums ebenso wie die nachgelagerten Produktionsstufen weiter ausbaute und sie in großen Einheiten zusammenband. Zudem hatte er bereits im Mai 1920 die Norddeutsche Buchdruckerei und Verlagsanstalt aufgekauft und damit die konservative und als regierungsnah geltende Deutsche Allgemeine Zeitung (DAZ) unter seine Kontrolle gebracht, die er nun zu seinem Sprachrohr machte. Gleichzeitig hatte er ein Reichstagsmandat der DVP inne und beherrschte weitgehend den rechten Flügel dieser in besonderem Maße industriellen Interessen verpflichteten Partei.
Auf seine Zeitgenossen machte Stinnes den Eindruck eines durch und durch auf seine Arbeit konzentrierten, äußerst machtbewussten Menschen. Ein schwarzer Vollbart unterstrich das insgesamt düstere Erscheinungsbild. Auf den zahlreich erhaltenen Porträtfotos versuchte er nicht einmal den Anflug eines Lächelns, sondern scheint den Betrachter mit Blicken durchbohren zu wollen. Kessler, der Auftreten und Umgangsformen seiner prominenten Zeitgenossen sehr aufmerksam beobachtete, hielt über eine Begegnung fest, der »unelegant« gekleidete Stinnes (das war quasi sein Markenzeichen) wirke auf ihn wie »ein Mittelding zwischen einem Gewerkschafts-Sekretär und dem Fliegenden Holländer«; in »seinen Augen und seinem ganzen Wesen liegt Etwas Verschleiertes, Geheimnisvolles, man glaubt: irgendeine große Passion, vielleicht die Leidenshaft zur Vermehrung seines Besitzes«.63
Um die Sonderrolle zu verstehen, die Hugo Stinnes in Wirtschaft und Politik in den frühen Zwanzigerjahren einnahm, muss man einige seiner machtvollen Interventionen in diesem Zeitraum näher betrachten.
So trat er etwa im Juli 1921 bei der Konferenz von Spa, zu der die deutsche Delegation ihn als Wirtschaftsfachmann hinzugezogen hatte, in einer äußerst herrischen Art und Weise auf (er selbst nannte es »freimütig«): Die alliierte Forderung nach deutschen Kohlelieferungen – der eigentliche Kernpunkt der Konferenz – wies er brüsk als in dieser Höhe »unannehmbar für uns als Unternehmer« zurück und sprach bereits damals klar aus, dass ihn die von der Gegenseite angedrohte Sanktion, die Besetzung des Ruhrgebiets, nicht schrecke, da sie zu einer Lähmung der Kohleproduktion zum Schaden ganz Europas führen werde. Sein Auftritt löste Entsetzen bei den Alliierten und eine enthusiastische Zustimmungswelle bei den deutschen Nationalisten aus.64
Als in der zweiten Jahreshälfte 1920 unter dem Schlagwort »Sozialisierung der Kohleproduktion« eine Debatte entbrannte, ob man diese für die gesamte Volkswirtschaft essenzielle Grundstoffindustrie in irgendeiner Form in öffentlich-rechtliches Eigentum überführen sollte, schaltete sich Stinnes autoritativ mit dem Vorschlag ein, die von seinem Wirtschaftsimperium beispielhaft betriebene »vertikale Konzentration« auf die gesamte Volkswirtschaft auszudehnen. Seine Initiative trug nicht unerheblich dazu bei, dass die Sozialisierungsdebatte ihren ursprünglichen Fokus verlor und 1921 versackte.65
In der Reparationsfrage ging der Industrielle seit 1920 auf Konfrontationskurs zu der bürgerlichen Regierung Fehrenbach, der auch seine eigene Partei, die DVP, angehörte, weil er deren Verhandlungsführung für zu nachgiebig hielt. Im Zuge der folgenden Auseinandersetzungen spielte er eine Hauptrolle bei der Auflösung des Kabinetts. Die von ihm angestrebte Regierung auf der Grundlage eines Bündnisses mit den Deutschnationalen kam jedoch nicht zustande.66 Stinnes gelang es im Oktober 1921 auch ohne Weiteres, die Ernennung Walther Rathenaus zum Außenminister für einige Monate zu blockieren.67
Als der Reichsverband der Deutschen Industrie (RDI) Ende September 1921 der Regierung das Angebot machte, ihr Devisen zur Begleichung der Reparationsforderungen zur Verfügung zu stellen (»Kreditaktion«), setzte Stinnes durch, dass diese Offerte an die Bedingung geknüpft wurden, Staatsbetriebe zu privatisieren. Vor allem die Reichsbahn sollte so durch Massenentlassungen68 profitabler gemacht und danach als Sicherheit für ausländische Anleihen angeboten werden.69 Diesen seinen Plan, wie eine privatisierte deutsche Eisenbahn zur Finanzierung der Reparationen genutzt werden sollten, präsentierte er im November 1921 eigenmächtig dem britischen Premierminister Lloyd George bei einem London-Besuch und konterkarierte so die offizielle deutsche Außenpolitik.70
Am 9. November 1922, dem vierten Jahrestag der Revolution, ging Stinnes auf einer Sitzung des Reichswirtschaftsrates mit seiner Forderung nach einer Aussetzung des Achtstundentages an die Öffentlichkeit. Ferner wandte er sich dort gegen eine »Stabilisierung der Währung um jeden Preis« (sie solle auf niedrigem Niveau erfolgen), verlangte einen Verzicht auf Streiks und forderte, den Alliierten deutlich zu machen, sie könnten von Deutschland nur Reparationen erwarten, wenn der Versailler Vertrag neu ausgehandelt werde. Da er diese Auffassungen zwei Tage später auf der Sitzung der Zentralarbeitsgemeinschaft vor Gewerkschaftsvertretern wiederholte, trug er maßgeblich dazu bei, dass die Sozialdemokraten nun die von Reichskanzler Joseph Wirth gewünschte Aufnahme der DVP in die Regierung, die dadurch mehrheitsfähig geworden wäre, ablehnte und Wirth daraufhin den Weg für Cuno freimachte.71
Hugo Stinnes trat also sowohl in der deutschen Innen- wie Außenpolitik massiv und selbstbewusst an, durchaus auf Augenhöhe mit den Regierenden und mit einer eigenen Agenda. Mittelfristig verfolgte er dabei das Ziel, zunächst die deutsche Wirtschaft grundlegend zu sanieren: durch Beendung der aus der Demobilmachungsphase stammenden staatlichen Regulierungen, Privatisierung der staatlichen Betriebe sowie die Aufhebung des Achtstundentages und die Rückkehr zu den Vorkriegsarbeitszeiten. Erst wenn dies alles gelungen war, könne man an eine Stabilisierung der Währung herangehen, die aber noch von einer zweiten wesentlichen Bedingung abhing: einer für Deutschland günstigen Einigung mit den Alliierten in der Reparationsfrage.72 Im Kern ging es ihm also darum, die Voraussetzungen, den Zeitpunkt und die Konditionen der Währungsstabilisierung entscheidend mitzubestimmen. Hatte er bisher als »König der Inflation« die Gegebenheiten der inflationären Konjunktur konsequent ausgenutzt, so strebte er nun an, die Bedingungen mitzugestalten, unter denen er sein Wirtschaftsimperium zu neuen Ufern führen wollte. Diese Verbindung von Wirtschaftsreformen im Interesse des Kapitals, von Währungsumstellung, Neuregelung der Reparationsfrage und der Durchsetzung seiner eigenen Interessen als Lenker des größten deutschen Wirtschaftsimperiums war ohne Zweifel groß gedacht und hätte ihn zum »Kaiser« in einer Wirtschaft unter stabilen Währungsbedingungen gemacht. Zwar hat sein Tod im Jahr 1924 verhindert, dass er dieses neue Kapitel aufschlagen konnte, es wird sich jedoch noch zeigen, dass dieser Krisenmanager in eigener Sache die Ereignisse des Jahres 1923 immer wieder auszunutzen suchte, um seine Vorstellungen umzusetzen – einschließlich seiner Beteiligung an den Plänen zur Errichtung einer Rechtsdiktatur.
Es war vor allem Stinnes, der zum massiven Handeln gegen die Ruhr-Besatzer drängte, da er sich – entsprechend seiner politisch-ökonomischen Gesamtstrategie – von einer effektiven Abwehr des französischen Eingriffs eine Stärkung der deutschen Verhandlungsposition in der gesamten Reparationsfrage erhoffte. Diese wiederum wollte er für eine umfassende Neuordnung der deutsch-französischen Industriekooperation (möglichst unter deutscher Führung) nutzen.73
Aus diesem Grund setzte er darauf, den französischen Ambitionen im Ruhrgebiet von Anfang an einen Riegel vorzuschieben, indem er ihnen die Ressourcen des Rheinisch-Westfälischen Kohlensyndikats entzog. Dieses in Essen residierende Verkaufskartell legte die Fördermengen der beteiligten Zechen sowie die Kohlepreise fest. Es handelte sich also um jene zentrale Einrichtung des Ruhrbergbaus, bei der alle relevanten Informationen über die Leistungsfähigkeit der Zechen zusammenliefen. In der Tat zielte das französische Vorgehen darauf, eine »Ingenieurskommission« mit der Kontrolle über das Syndikat zu beauftragen und so die Entnahme aus den Zechen zu steuern. Der Truppenaufmarsch wurde mit dem »Schutz« dieser Kommission begründet. Doch als die Franzosen am 11. Januar Essen besetzten, fanden sie ein in aller Eile ausgeräumtes Gebäude vor. Zwei Tage zuvor hatten die im Syndikat vertretenen Zechenbesitzer auf Initiative von Stinnes hin beschlossen, den Sitz des Kartells nach Hamburg zu verlegen, was in der darauffolgenden Nacht mithilfe eines eigens eingesetzten Sonderzugs auch geschah. Damit war ein Kernstück des französischen Plans weggebrochen – und die Besatzer waren gezwungen, selbst in die Kohleindustrie einzugreifen. In den herrenlosen Räumen richtete sich die von den Besatzungsmächten neu geschaffene Kontrollbehörde, die Micum, ein.74
Aus dem Haus Stinnes wurde indes verlautet, wie man sich die weitere Strategie gegenüber den Besatzern vorstellte. Bereits am Vorabend des Einmarsches veröffentlichte die DAZ, das Sprachrohr Stinnes, einen Leitkommentar des Chefredakteurs Paul Lensch (»Stark aber dumm«), der in instruktivem Ton das Grundkonzept des später sogenannten passiven Widerstands erläutert: Die Besetzung des Ruhrgebiets »ist Gewalt und zerreißt alle zwischen beiden Ländern bestehenden Verträge«; deutsche Beamte dürften nicht mit »Funktionären der französischen Republik« zusammenarbeiten, deutsche Eisenbahnen dürften keine Angehörigen der Besatzungsmächte oder von ihnen veranlasste Transporte befördern. Ziel sei es aber keineswegs, den Besatzern auf friedliche Weise klarzumachen, dass sie keine Chancen hätten, die geforderten Kohlemengen selbst aus dem Ruhrgebiet herauszuholen; vielmehr ging es darum, eine Spirale der Gewalt auszulösen.
»Die positive Rechtspolitik Deutschlands hat das Ziel«, so verlautbarte Lensch, »Frankreich zu zwingen, die Bestialität seiner Politik zu enthüllen und sich offen als Raub- und Gewaltstaat zu bekennen … Den Feind ins Unrecht setzen, ihn zwingen, überall Gewalt anzuwenden, neben jedem Zivilfranzosen eine Rotte Militär aufzustellen, auf dem Wege des Rechts und des Friedens nie zur Ruhe kommen lassen, ihn zwingen, jeden Gewaltakt durch eine noch schamlosere Gewaltaktion zu übertrumpfen und so sich immer mehr in die Suhle der allgemeinen Verachtung der Welt hineinwühlen zu lassen, in die der Friedensbrecher und Straßenräuber gehört; das ist das Ziel der deutschen Politik.« Dass dabei das Blut vieler Unschuldiger vergossen werden würde, unterstellte der Artikel als selbstverständlich.
Man muss davon ausgehen, dass dieser Kommentar, der die Grundstrategie des sich dann entfaltenden »Ruhrkampfes« enthielt, mit dem Besitzer der DAZ, Hugo Stinnes, abgestimmt war. In jedem Fall aber wurde der Artikel von den Zeitgenossen als Aufforderung des Konzernherrn an die Regierung gelesen, durch eine konsequente Verweigerungshaltung von Beamtenschaft und Eisenbahnern eine Gewaltpolitik der Besatzungsmächte mit unabsehbaren Folgen auszulösen. Auf der Seite der Kohlewirtschaft hatte Stinnes den einzuschlagenden Weg bereits mit dem Verschwinden des Kohlesyndikats vorgezeichnet. Dass die Besatzungsmächte nun die einzelnen Zechen und ihre Belegschaften unter Druck setzen und sich hieraus eine Lawine weiterer Konflikte ergeben würde, war ebenfalls abzusehen. Aufgrund von Erfahrungen mit fünf Jahren Rheinlandbesetzung war nicht davon auszugehen, dass die Besatzungsmächte der Verweigerungshaltung der deutschen Seite untätig zusehen würden. Am Tag nach dem Erscheinen des Artikels, also dem Tag, als die Besetzung begann, hatte Stinnes im Übrigen Gelegenheit, die gesamte Situation mit Kanzler Cuno, dem Außen- sowie dem Wirtschaftsminister und anschließend mit Reichspräsidenten Ebert zu besprechen. Dabei drängte er darauf, der Kanzler solle sich vom Reichstag ein eindeutiges Vertrauensvotum für seine Politik ausstellen lassen.75 Fünf Tage später fand sich Hugo Stinnes in Begleitung der einflussreichen Ruhrindustriellen Fritz Thyssen und Paul Reusch bei Hans von Seeckt, dem Chef der Heeresleitung der Reichswehr, ein.76
Die nächste deutsche »Abwehrmaßnahme«, die den Konflikt weiter eskalierte, erfolgte am 11. Januar. Der Reichskohlenkommissar erteilte den Zechen die Anordnung, die Lieferung von »Reparationskohle« an Belgien und Frankreich einzustellen.77 Drei Tage später verbot er die von den Zechenbesitzern inzwischen – wohl nur zum Schein – angebotene78 Lieferung von Kohlen gegen Bezahlung, und zwar unter Androhung von Haftstrafen.79 Und das, ohne dass die Berliner Regierung Vorsorge für die Konsequenzen getroffen hatte, die sich aus dieser Verweigerungshaltung ergaben. Als nun die Franzosen den Zechenbesitzern den ultimativen »Befehl« zur Kohleablieferung erteilten und diese ihre Loyalität gegenüber der eigenen Regierung erklärten, spitzte sich der Konflikt zu.80
Wirtschaftsminister Johann Becker, von Albert Vögler, einem führenden Ruhr-Manager und engen Vertrauten von Stinnes, über die Situation informiert, hielt fest: »Die Ruhrindustriellen sind entschlossen, den äußersten passiven Widerstand zu leisten.« Damit war noch einmal klargestellt, bei wem die Initiative zur Auslösung der passiven Resistenz lag. Im gleichen Telefonat äußerte Vögler massives Unverständnis über das bisher gefügige, von der Regierung am 10. Januar gebilligte Verhalten der Reichsbahn gegenüber der Besatzungsmacht und forderte auch hier eine schärfere Gangart ein – mit einem absehbaren Ergebnis: »Herr V. ist der Ansicht, man solle die Franzosen den Betrieb übernehmen lassen, dann wäre in ganz kurzer Zeit der ganze Betrieb gestört.«81
»Resistenz auf der ganzen Linie«
Während also die Arbeitgeber darauf setzten, durch passiven Widerstand die Franzosen zu zermürben und so eine Basis für eine Neuverhandlung der Reparationen und darüber hinaus für eine Revision des Versailler Vertrags zu schaffen,82 versuchten die Franzosen gleichzeitig, auf die Gewerkschaften einzuwirken: Die Besetzung richte sich ja gar nicht gegen die deutschen Arbeitnehmer. Doch die Gewerkschafter machten bei einem Treffen am 17. Januar deutlich, dass sie weitere Gespräche für zwecklos hielten,83 und begannen nun, die Zurückhaltung, die sie in den vergangenen Tagen in ihren öffentlichen Aufrufen noch geübt hatten, aufzugeben und sich auf Widerstand einzustellen.84
Die Reichsregierung hatte mittlerweile dem Druck der Zechenbesitzer nachgegeben und am Abend des 16. Januar, also nach den ergebnislosen Gesprächen in Essen, beschlossen, dass bei der Reichsbahn im besetzten Gebiet »passive Resistenz geübt werden soll«.85 Am 19. Januar verbot der Reichsverkehrsminister, der sich ursprünglich gegen solche Maßnahmen zur Wehr gesetzt hatte,86 dem Personal von Reichsbahn und der Wasserstraßenverwaltung, die Mitwirkung an einer Beförderung von Kohlen nach Frankreich und Belgien. Wie sollte sich aber das deutsche Personal konkret gegenüber Zumutungen der Besatzungsmacht verhalten? Es war die Eisenbahnergewerkschaft, die zwei Tage später ihre Mitglieder dazu aufrief, bei Eingriffen der Besatzungsmacht in den Eisenbahnverkehr den Dienst einzustellen und ihre Posten zu verlassen.87
Ebenfalls am 19. Januar richteten die Regierungen des Reiches, Preußens und der übrigen von der Besatzung betroffenen Länder einen Erlass an die Beamten im gesamten besetzten Gebiet, Anordnungen der Besatzungsmacht grundsätzlich nicht zu befolgen.88 Dieser Erlass betraf auch das »altbesetzte« Rheinland, das die Micum am 13. Januar ebenfalls ihrer Kontrolle unterstellt hatte.89 Hier allerdings sollten nur solche Anordnungen nicht befolgt werden, die gegen das Rheinlandabkommen,90 also die von Deutschland vertraglich anerkannte rechtliche Grundlage der Besatzung, verstießen. In der Praxis musste diese Vorgabe natürlich auch im Rheinland, wo sich seit 1918 ein gewisser Modus Vivendi zwischen Besatzern und deutschen Behörden herausgebildet hatte, zu unübersehbaren Konflikten mit der Besatzungsmacht und damit zu einer weiteren Eskalation der Gesamtkrise führen.
Allerdings erreichten die Maßnahmen im Rheinland nicht die gleiche Intensität wie an der Ruhr. So berichtete der ehemalige Reichsminister Erich Koch am 12. Februar nach einer Reise ins besetzte Rheinland, dort habe die »Abwehr« nicht mit »derselben Wucht eingesetzt« wie an der Ruhr. Die Bevölkerung lebe hier weniger massiert und sei weniger auf »politischen und wirtschaftlichen Kampf gerichtet und eingeübt als der Arbeiter des Ruhrbezirks«; vor allem aber habe man sich hier daran gewöhnt, die Anordnungen der Rheinlandkommission zu befolgen und wolle den eingespielten Status quo selbst dann nicht infrage stellen, wenn die Kommission ihre Kompetenzen überschreite.91
In der entscheidenden Ministerbesprechung vom 19. Januar machten sich sowohl der Reichskanzler wie der anwesende preußische Innenminister Carl Severing das nicht von ihnen erfundene Konzept zu eigen: Es müsse »Resistenz auf der ganzen Linie« herrschen, so Cuno, und man müsse doch »die passive Resistenz der Zechenbesitzer und Arbeiter nach allen Kräften« unterstützen, so Severing.92 Die Besprechung der Regierung mit Gewerkschaftsvertretern am 23. Januar stellte Cuno unter die Parole, es gäbe nur »passive Resistenz als Abwehrmittel«.93 Und am 24. Januar sprach er den Vertretern der Beamtenorganisationen, die zu einer Besprechung mit seiner Regierung in Berlin erschienen waren, für ihr »mannhaftes Verhalten« den »Dank des Vaterlandes« aus.94
Die Besatzungsmächte wollten dieser deutschen Verweigerungshaltung natürlich nicht tatenlos zusehen. Sie reagierten mit Verhaftungen zweier hoher Beamter sowie einiger Bergwerksdirektoren, darunter Fritz Thyssen. Bereits am 24. Januar verurteilte ein französisches Militärgericht in Mainz die Zechenbesitzer wegen Nichtbefolgen einer militärischen Requisitionsforderung zu Geldstrafen. Die Beamten, zu Gefängnisstrafen verurteilt, die zwar auf Bewährung ausgesetzt wurden, wurden aus dem besetzten Gebiet ausgewiesen.95
Die Verhaftungen und die Mainzer Prozesse lösten im gesamten besetzten Gebiet eine Protest- und Streikwelle aus, in der nationalistische Töne dominierten. Die Rückreise der verurteilten Bergwerksdirektoren ins Ruhrgebiet nahm die Form eines Triumphzuges an und wurde an der gesamten Zugstrecke von chauvinistischen und antifranzösischen Kundgebungen begleitet.96
Auch diese Proteste erfolgten keineswegs spontan, sondern standen bereits unter dem Eindruck einer stark nationalistisch akzentuierten Propagandakampagne, die von amtlicher Seite, aber auch von privaten Organisationen sowie insbesondere von der rechtsstehenden Presse als Antwort auf die Besatzung losgetreten wurde. Bereits am 9. Januar hatte die Reichskanzlei die Position vertreten, es sei die zu erwartende »starke nationale Welle … dem Staat dienstbar zu machen, sie nicht sich selbst zu überlassen und nicht etwa unter das Zeichen des Hakenkreuzes, auch nicht der schwarzweiß-roten Flagge kommen zu lassen«.97 Es sollte zwar keine »Hurrabegeisterung« herrschen, doch war, wie sich nach dem Mainzer Prozess zeigte, eine strikte Abgrenzung von patriotischen Kundgebungen zu chauvinistischem Geschrei nicht möglich. Vielmehr musste die Regierungspropaganda, gerade weil sie sich in einem Konkurrenzverhältnis mit den politischen Rechtsgruppierungen sah, einen zügellosen Nationalismus verstärken. So wurde am auf den Einmarsch folgenden Sonntag überall im Reich Halbmast geflaggt und es wurden Massenkundgebungen abgehalten, auf denen, wie auf dem Berliner Königsplatz, »flammender Protest« gegen die Besatzung zum Ausdruck gebracht wurde und von der ergriffenen Menge vaterländische Lieder gesungen wurden. In Berlin versuchte ein Teil der Menge anschließend, in das Hotel einzudringen, wo die französischen Offiziere der Interalliierten Kontrollkommission untergebracht waren, was die Polizei jedoch verhindern konnte.98
Nach den Bestimmungen des Versailler Vertrags stand ein Großteil des Rheinlands sowie das Saargebiet unter alliierter Verwaltung.
Gewerkschaften und Sozialdemokratie, die sich von dieser nationalistischen Kundgebungswelle ferngehalten und eigene Veranstaltungen organisiert hatten, drohte nun der Vorwurf, sich den nationalen Verteidigungsanstrengungen entziehen zu wollen. Aus Sicht von Gewerkschaften und Sozialdemokratie bestand durchaus die Gefahr, dass die nationalistische Propaganda auch in der Arbeiterschaft verfing und ihre eigene Führungsrolle untergrub. Denn mittlerweile richtete sich auch die Stimmung der Arbeiterschaft, die in den ersten Tagen eher indifferent gewesen war, eindeutig gegen die Besatzungsmächte. Verantwortlich hierfür waren der härtere Kurs von Franzosen und Belgiern, die Anordnungen aus Berlin zum »passiven Widerstand«, aber auch eine abrupte Steigerung der Lebensmittelpreise. Schließlich heizten nicht nur die nationalistischen Parolen, sondern auch die Kommunisten mit ihrer Forderung nach einem Generalstreik die Situation weiter auf.99
Unter dem Eindruck dieses Stimmungsumschwungs wechselten nun auch die sozialistischen Gewerkschaften zur Linie des »passiven Widerstands«. Sie erschien als das angemessene Kampfmittel, um die Arbeiterschaft in den Betrieben und damit unter gewerkschaftlichem Einfluss zu halten, während eine Streikwelle bzw. offene Konfrontationen mit der Besatzungsmacht zu einem schwer kontrollierbaren Radikalisierungsprozess mit unabsehbaren Folgen geführt hätte. So reihten sich auch die Gewerkschaften bis Ende Januar in die entstehende »nationale Einheitsfront« ein.100
Die folgenden Bemühungen auf deutscher Seite konzentrierten sich nun darauf, die Gewerkschaften vollständig in die »Einheitsfront« der »Abwehr« zu integrieren und die für die Durchführung des »passiven Widerstands« notwendigen Strukturen aufzubauen.
Koordiniert wurden die Maßnahmen vor allem in einer Zentralstelle Rhein-Ruhr in der Reichskanzlei und durch das Arbeitsministerium, das drei Gewerkschafter als Leiter von »Abwehrzentralen« in Dortmund, Köln und Mannheim einsetzte. Durch ein bis zu den Gemeinden hinunterreichendes, auf täglichen Meldungen beruhendes Berichtssystem wurde das Oberpräsidium Münster präzise über Truppenbewegungen sowie die verschiedenen Auswirkungen der Besetzung informiert.101 Auf lokaler Ebene bestanden paritätisch aus Arbeitnehmern und Arbeitgebern gebildete »Abwehrausschüsse«. Im gesamten besetzten Gebiet bauten die unterschiedlichen Behördenzweige, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Wirtschaftskammern, Firmen, Parteien und andere Stellen ein organisatorisches Geflecht zur Steuerung des »passiven Widerstands« auf, das schwer zu überschauen war und nicht immer in die gleiche Richtung arbeitete, sich aber im Prinzip der Berliner Führung unterordnete. Abschirmung und Geheimhaltung dieser Arbeit gegenüber den Besatzungsmächten erschwerten die Kommunikation mit der Zentrale, die im Wesentlichen durch Kuriere geleistet wurde.102
Essenziell für die Umsetzung dieser Pläne war die schon früh erklärte Bereitschaft der Reichsregierung, die gesamte Abwehrarbeit bei entsprechendem Bedarf aus Sondermitteln, durch eine eigens aufgebaute »Rhein-Ruhr-Hilfe« zu finanzieren.103 Dies geschah insbesondere durch die »Lohnsicherung«,104 also die Fortzahlung von Löhnen (in der Regel zwei Drittel des Tarifs bei Produktionseinschränkungen), durch Kredite an Unternehmungen, sodass es möglich war, auch mit nichtproduktiven Arbeiten die Belegschaften in den Betrieben zu halten. Hinter den unproduktiven Arbeiten verbargen sich aber häufig lange aufgeschobene innerbetriebliche Sanierungen, und im Laufe der Zeit sollte es vor allem der Schwerindustrie gelingen, sich zusätzlich Produktionsausfälle direkt vom Reich erstatten zu lassen.105 Hinzu kamen für die tatsächlich arbeitslos gewordenen Arbeiter eine relativ großzügig bemessene Erwerbslosenfürsorge sowie öffentliche Notstandsarbeiten (für die aber, so zeigte sich bald, nicht genügend Mittel bereitgestellt werden konnten),106 ferner die Entschädigung von Beamten, die aufgrund ihrer widerständigen Haltung aus ihren Stellungen verdrängt bzw. ausgewiesen wurden, und Kredite für Klein- und Mittelbetriebe.
Was die regulär beschäftigten Arbeitnehmer anbelangte, so verfolgten Reichsregierung und Arbeitgeber den Kurs, Löhne und Gehälter, möglichst auch die Preise, auf dem in der zweiten Februarhälfte erreichten Niveau zu halten.107 Gleichzeitig leitete die Reichsbank auf Drängen der Regierung im Februar eine Sonderaktion zur Währungsstabilisierung ein, indem sie auf den internationalen Finanzmärkten deutsches Papiergeld aufkaufte und damit den ins Rutschen gekommenen Dollarkurs (10. Januar: 10.000 Mark, 30. Januar: 44.000 Mark) wieder nach unten und dort für einige Zeit halten konnte (Mitte Februar: 20.000 Mark). Dass dies nur für eine begrenzte Zeitspanne möglich wäre, war den Beteiligten klar. Das Beispiel zeigt jedoch, dass man keine konkreten Vorstellungen vom zeitlichen Horizont des Widerstands hatte und daher mit Ad-hoc-Maßnahmen und Notbehelfen arbeitete.108
Die währungstechnisch abgesicherte, großzügige finanzielle Förderung sorgte dafür, dass die Träger des Widerstands zunächst keine ökonomischen Risiken eingingen. Sie setzte aber mittelfristig eine Spirale in Gang, durch die »Abwehr« ohne Rücksicht auf die Kosten bis zum Zusammenbruch der Währung und schließlich bis zum volkswirtschaftlichen Kollaps vorangetrieben wurde.
Der »passive Widerstand« nahm also rasch an Fahrt auf, ungeachtet der massiven französischen Gegenmaßnahmen. Diese erfolgten auf verschiedenen Ebenen: Zum einen dehnte Frankreich die Besetzung immer weiter aus. Nicht nur wurde die besetzte Zone an der Ruhr mehrfach arrondiert, sondern es rückten am 24. Januar französische Truppen auch in die von den Amerikanern verlassene Koblenzer Rhein-Zone ein. Anfang Februar besetzten sie die badischen Städte Offenburg, Appenweier und Bühl und konnten so die Oberrhein-Bahnstrecke kontrollieren. Ende Februar wurden außerdem die »Lücken« zwischen den drei rechtsrheinischen Brückenköpfen Köln, Koblenz und Mainz geschlossen und im März wurden die Häfen von Mannheim und Karlsruhe unter Kontrolle genommen.109
Die Besatzer verschärften außerdem ihre Politik: Sie begannen nun damit, selbst Kohlelager und -transporte sicherzustellen.110 Sie beschlagnahmten die Einnahmen aus der Kohlensteuer (die sie zum Teil bei den Zechen eintrieben111), ferner Zölle und Exportdevisen sowie die Erträge der Staats- und Gemeindeforste. Und sie führten für die Ein- und Ausfuhr von Waren zwischen dem besetzten und dem unbesetzten Gebiet ein Genehmigungsverfahren sowie Abgaben ein. Diese Maßnahmen wurden auch auf das »altbesetzte« Rheinland ausgedehnt.112
Propagandakampf
Begleitet wurde die französische Besatzung von einer intensiven Propagandakampagne, wie von deutscher Seite aufmerksam registriert wurde.113 Die einheimische Bevölkerung versuchte man insbesondere über Flugblätter sowie in großer Zahl an Häuserwände geklebte Plakate zu erreichen, während ein eigens eingesetzter Pressechef der französischen Besatzungsmacht die Auslandskorrespondenten betreute, die sich im Essener Hotel Kaiserhof versammelt hatten.114
Hauptthemen der französischen Propaganda waren die Rechtmäßigkeit der Besatzung, die einen nichtkriegerischen Charakter habe und ausschließlich der Erfüllung des Friedensvertrags diene. Im Kontrast dazu wurden die deutschen Zerstörungen und Gewalttaten gegen die Zivilbevölkerung im besetzten Nordfrankreich und Belgien herausgestellt. Ferner wurde der Bevölkerung die Aussichtslosigkeit jedweder gegen die Besatzungsmächte gerichteten Aktionen vor Augen geführt. Die Menschen würden wie im Weltkrieg mit Illusionen gespeist und müssten, von »Berlin« und dem unbesetzten Deutschland im Stich gelassen, für die Interessen der Schwerindustrie große Leiden auf sich nehmen.
Die deutsche Gegenpropaganda wurde von der Presseabteilung der Reichsregierung geleitet, die zusammen mit weiteren amtlichen Stellen (und mit Unterstützung aus der Industrie gegründeten privaten Büros115) ein umfassendes Netzwerk aufbaute. In Köln, Essen und Münster (im unbesetzten Gebiet) unterhielt die Presseabteilung Außenbüros, getarnte Nachrichtenbüros in Köln, Bochum und Dortmund versorgten die einheimische Presse, eine Agentur in Münster lieferte Presseartikel;116 propagandistische Kleinmittel wie Flugblätter und Handzettel wurden im besetzten Gebiet selbst hergestellt.117
Dabei sah man sich mit erheblichen Behinderungen seitens der Besatzungsmächte konfrontiert, die zum Beispiel systematisch Wandplakate übermalten, Zensur für einheimische Zeitungen ausübten und Verbote für Blätter aus dem übrigen Reich aussprachen sowie die Arbeit der deutschen amtlichen Pressevertreter erschwerten. Generell versuchte man, die deutsche Gegenpropaganda in die Nähe von Sabotage an der Arbeit der Besatzungsbehörden zu rücken. So wurde etwa der Vertreter der Presseabteilung in Essen, Walter Zechlin, im April festgenommen und dann ausgewiesen (allerdings nahm schon bald ein Nachfolger seine Arbeit auf).118 Und es gab zahlreiche Strafprozesse gegen Journalisten. Zeitweilige Sperrungen des Telefon- und Telegrammverkehrs und der zeitraubende Kurierdienst zwischen Westdeutschland und Berlin stellten weitere Erschwernisse dar.119
Neben der Arbeit im besetzten Rhein- und Ruhrgebiet waren natürlich die Pflege der »Einheitsfront« im restlichen Reichsgebiet sowie die Beeinflussung der Auslandspresse wichtige Themen der deutschen Propaganda.