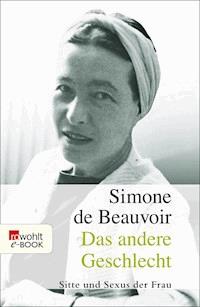8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Promedia Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Ungleiche Geschlechterverhältnisse sind noch immer tief in unsere Gesellschaft eingeschrieben. Der Kampf für die Befreiung der Frau von patriarchaler Unterdrückung, wirtschaftlicher Abhängigkeit und Sexismus sowie für soziale Gleichheit steht nach wie vor auf der Tagesordnung jeder wahrhaften emanzipativen und progressiven Bewegung. Die Wiener Forscherin Julia Harnoncourt versammelt in ihrem Band "Für die Befreiung der Frau" Schriften und Analysen von Aktivistinnen und Theoretikerinnen aus zwei Jahrhunderten des Kampfes. Von den Kämpferinnen der ArbeiterInnenbewegung bis zu den Feministinnen nach dem Zweiten Weltkrieg, von der afroamerikanischen Frauenbewegung bis zu den Vertreterinnen des Globalen Südens, von Clara Zetkin und Simone de Beauvoir bis zur Zweiten Frauenbewegung der 1970er Jahre wird versucht, möglichst viele verschiedene Analyse- und Lösungsansätze zu Wort kommen zu lassen. So zum Beispiel die Frage nach biologischem und sozialem Geschlecht oder nach gerechter Verteilung. Ein weiteres wichtiges Thema ist das Verhältnis von Frauen zur Arbeit, wobei Haus- und Pflegearbeit besonders kontrovers diskutiert wird. Der Slogan "Das Private ist politisch" betrifft nicht nur die Hausarbeit, sondern auch den weiblichen Körper, Liebe und Sexualität. Im Kampf gegen die Ungleichheit stellt sich schließlich auch die Frage, mit wem überhaupt zusammen gekämpft werden kann. Können Männer die Interessen von Frauen vertreten? Und können von Rassismus oder globaler Ungleichheit betroffene Frauen mit weißen Frauen aus dem Norden gemeinsam um ihre Rechte kämpfen, wenn alle unterschiedliche Erfahrungen machen? Das Buch "Befreiung der Frau" versammelt verschiedene Perspektiven und Antworten aus unterschiedlichen feministischen Kämpfen und Regionen der Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 298
Ähnliche
Julia Harnoncourt (Hg.)Befreiung der Frau
© 2021 Promedia Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H., Wien
978-3-85371-894-0(ISBN der gedruckten Ausgabe: 978-3-85371-493-5)
Umschlaggestaltung: Gisela Scheubmayr
Der Promedia Verlag im Internet: www.mediashop.atwww.verlag-promedia.de
Über die Autorin
Julia Harnoncourt, geboren 1985 in Wien, studierte Geschichte an der Universität Wien und arbeitet an der Universität Luxemburg. Wissenschaftlich beschäftigt sie sich mit verschiedenen Faktoren der ungleichen Verteilung von Ressourcen, wie Arbeit, Migration, Rassismus, Sklaverei, Kolonialismus und der Rolle der Frau. Im Promedia Verlag ist von ihr erschienen: „Unfreie Arbeit. Trabalho escravo in der brasilianischen Landwirtschaft“ (2018).
Editorische Notiz:
Einige der Texte wurden von der Herausgeberin für dieses Buch erstmals ins Deutsche übertragen. Weitere Dokumente wurden in ihrer originalen Schreibweise übernommen, das betrifft vor allem die Anwendung der zum Zeitpunkt der ursprünglichen Publikation gängigen deutschen Rechtschreibung.
Julia Harnoncourt: Einleitung
„Wie der Arbeiter vom Kapitalisten unterjocht wird, so die Frau vom Manne.“ (Clara Zetkin)
Das vorliegende Buch vereint unterschiedliche Texte, die sich mit der Theorie und Praxis von Frauen und ihren Erfahrungen in feministischen (und anderen) Kämpfen und Bewegungen befassen. Ungleiche Geschlechterverhältnisse sind noch immer tief in unsere Gesellschaft eingeschrieben. Der Kampf für die Befreiung der Frau von patriarchaler Unterdrückung, wirtschaftlicher Abhängigkeit und Sexismus sowie für soziale Gleichheit steht nach wie vor auf der Tagesordnung jeder tatsächlich emanzipativen und progressiven Bewegung. Die unterschiedlichen Tatbestände wirken auf alle Bereiche des privaten und öffentlichen Lebens ein, auf die Ökonomie, transnationale Verhältnisse, die Politik, auf Religion, auf kulturelle Produktion und auf die Sprache, aber auch auf Liebesbeziehungen, Sexualität, Freundschaften, Selbstwahrnehmung und persönliche Ziele. Sie betreffen nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Diese sich real auswirkenden Ungleichheiten werden gleichzeitig als Evidenz für die Unterschiedlichkeit von Männern und Frauen betrachtet. Sie stehen in einem wechselseitigen Verhältnis zu einem Diskurs, der diese Ungleichheiten legitimiert und verfestigt.
Die historische Verankerung und globale Ausbreitung dieser Diskurse – die zeitliche und regionale Spezifika aufweisen – sowie ihre Verflechtung mit menschlichen Realitäten und ihre multiple Ursächlichkeit macht es extrem schwierig, einen Anfang zu finden, diese zu entwirren und dem System dieser Ungleichheitsverhältnisse entgegenzuwirken. Feministische Theorien versuchen genau dies zu tun.
Doch auch unter der weltumspannenden Kategorie „Frauen“ finden sich massive Unterschiede entlang sozioökonomischer Grenzen, religiöser, politischer und kultureller Zugehörigkeitsgefühle, sexueller Ausrichtung und körperlicher Fähigkeiten. Auch diese Ungleichheiten sind mit lokal- und/oder global-flächendeckenden Machtsystemen verknüpft und beeinflussen die konkreten Erfahrungen und Blickwinkel feministischer Bewegungen und Frauenkämpfe. So wird die Wurzel dieser Ungleichheiten und Lösungsansätze an unterschiedlichen Stellen gesucht und gefunden. Die Bewertung der wichtigsten Themen fällt ebenso unterschiedlich aus, wie der grundsätzliche Zugang, der wissenschaftlich ist oder von persönlichen Erfahrungen im Kampf gegen Unterdrückung ausgeht. Weil Feminismus und Frauenkämpfe kein Monolith sind, sondern lebendig und dadurch in ständiger Bewegung, gibt auch dieser Band eine Vielzahl von Analysen, Fragen und Kämpfen wieder. Dabei wurde versucht, möglichst viele verschiedene Analyse- und Lösungsansätze zu Wort kommen zu lassen. Als Herausgeberin liegen mir vor allem Texte aus konkreten Kämpfen in Form von Grundlagenwissen, Reflexionen, Theorienbildung und Anleitungen am Herzen. Außerdem sollen hier Klassiker zur Frauenbefreiung mit im deutschsprachigen Raum weniger bekannten Texten aus dem globalen Süden verknüpft werden. Ein solcher Band darf auf keinen Fall lediglich die üblichen Stimmen weißer, westlicher, heterosexueller Feministinnen reproduzieren. Denn selbst wenn die meisten Leser*innen sich in Europa befinden, wollen wir „unseren“ Feminismus nicht nur in unserer eigenen Suppe weiterverkochen: Wir wollen andere Perspektiven hören, uns davon bereichern lassen und daraus lernen.
Viele der Entscheidungen der Textauswahl waren nicht leicht zu treffen. Besonders im Gedächtnis sind mir die Glorifizierung der Sozialdemokratie als Partei der Frauen durch Alexandra Kollontai (und bis zu einem gewissen Grad auch durch Clara Zetkin), die unhinterfragte Verwendung des Begriffs Prostitution als absolutes Zeichen amoralischer Konventionen durch Madeleine Vernet genauso wie ihr Ausblenden von Liebe und Verlangen abseits der Heterosexualität oder die stark religiösen Elemente in Zhora Drifs Memoiren geblieben. Ich persönlich finde diese spezifischen Standpunkte schwierig, aber sie sind Teil der historischen Realität dieser Persönlichkeiten und müssen darum, da keine Geschichtsklitterung betrieben werden soll, Teil der veröffentlichen Texte sein. Ich hoffe deshalb, dass darüber nicht die anregenden Fragen und Überlegungen, die diese Schriften eröffnen, ignoriert werden oder zu kurz kommen. Schließlich halte ich die Dokumente, Kämpfe und Lebensrealitäten dieser Frauen für wichtige Beiträge zum Feminismus und zu Frauenkämpfen.
Schließlich soll diese Ausgabe linker Texte andere Feministinnen dazu anregen, sich weitere und neue Fragen zu stellen, nach neuen Perspektiven zu suchen, möglicherweise ihre Strategien und einige ihrer Einstellungen zu überprüfen. Ein Wunsch hinter dieser Ausgabe ist, nicht nur beim Bilden von Theorien, sondern auch bei konkreten Herausforderungen und Kämpfen eine Unterstützung zu sein. Manche der Aufsätze widersprechen sich oder finden entgegengesetzte Antworten auf ähnliche Fragen. Einige der Texte beziehen sich auch explizit aufeinander, entweder in ablehnender Weise wie Angela Davis, die Dalla Costa und Selma James kritisiert, oder zustimmend, wie Zohra Drif, die in einem ihrer Untertitel „Man kommt nicht als Kämpferin zur Welt, man wird es“ den Satz von Simone de Beauvoir verändert zitiert. Die Texte sprechen also miteinander.
In dem Kapitel „Sex und Gender“ unterhält sich Simone de Beauvoir mit Kimberlé Crenshaw. Während Simone de Beauvoir in ihrem 1949 veröffentlichtem Buch „Das andere Geschlecht“ über die Unterscheidung zwischen biologischem Geschlecht und sozialer Prägung schreibt, also darüber, wie die Gesellschaft Menschen zu Frauen macht, prägte Kimberlé Williams Crenshaw 40 Jahre später den Begriff der Intersektionalität, der die Überschneidung verschiedener Marginalisierungs-, Unterdrückungs- und Diskriminierungsstrategien, vor allem in Bezug auf Geschlecht, zugeschriebener Rasse und ökonomischen Verhältnissen beschreibt. Beide Autorinnen prägten massiv die weitere feministische Theorienbildung.
Simone de Beauvoir war eine der wichtigsten sozialistischen Intellektuellen ihrer Zeit. „Das andere Geschlecht“ ist bis heute eines der wesentlichsten Referenzwerke der feministischen Bewegung und Theorie. Ihre hier veröffentlichte Einleitung hätte wohl auch dieser Edition als Einleitung dienen können, da sie in ihrem Werk bereits viele der Fragen anspricht, die wir uns heute noch stellen. Gleichzeitig beschreibt sie akkurat die Ungleichverteilung von Macht und Ressourcen zwischen Frauen und Männern und diesbezügliche Legitimationsstrategien. Vor allem aber versucht sie zu bestimmen, was eine Frau ausmacht und wie das Frausein definiert werden kann. Dafür stellt sie zuerst fest, dass es Frauen gibt und dass sie sich anhand sozialer Merkmale von Männern unterscheiden. Die Frau werde also durch soziale Praktiken zu dem gemacht, was sie heute ist. Ein Teil dieses Prozesses besteht darin, dass sich der Mann als „normal“ und absolut und die Frau als seine Abweichung setzt, die somit zu „dem Anderen“ wird. Warum aber, fragt sie, akzeptieren die Frauen diese Behandlung im Gegensatz zu Menschen in anderen ungleichen Verteilungsverhältnissen. Auch die Weißen setzen sich als absolut und dunkelhäutigere Menschen als „die Anderen“, auch die Bourgeoisie mache dies gegenüber der Arbeiterklasse. Gründe, warum die Frau dies im Gegensatz zu diesen anderen Gruppen akzeptiere, lägen darin, dass die Gruppe der Frauen zwangsläufig mit der der Männer verbunden sei, aber auch die unterschiedlichen Solidaritäten und Gruppenzugehörigkeitsgefühle, die die Frauen voneinander trennen. Genau hier setzt auch Kimberlé Crenshaws Entwurf der Intersektionalität an.
Crenshaw beschäftigt sich als Juristin vor allem mit institutionalisiertem Rassismus und feministischer Rechtstheorie. Ihre Idee der Intersektionalität entwirft sie vorerst vor allem anhand US-amerikanischer Antidiskriminierungsfälle in dem Artikel „Demarginalizing the Intersection of Race and Sex“.1
In der hier abgedruckten Schrift „Mapping the Margins“ aus dem Jahr 1991 wird diese Theoriebildung weitergeführt. Crenshaw beschreibt, warum es wichtig ist, sich mit Identitäten zu befassen und nicht so zu tun, als gäbe es sie nicht. Diese seien aber nicht unilineare, sondern multiple Zugehörigkeiten. Denn wenn Identitäten nur entweder dunklere Hautfarbe oder das Geschlecht der Frau betonen, werden Schwarze2 Frauen sowohl aus feministischen als auch aus antirassistischen Diskursen ausgeschlossen. Doch nicht nur das, der Theoriebildung in beiden Diskursen wird damit die volle Dimension genommen und die Unterdrückung der jeweils anderen Identität reproduziert. Ähnlich wie Simone de Beauvoir besteht Crenshaw sowohl darauf, dass Kategorien wie Rasse und Geschlecht sozial konstruiert sind, aber gleichzeitig auch Realitäten in unseren Gesellschaften darstellen, die von Bedeutung sind. Es ist ihr aber trotzdem wichtig, eine Unterscheidung zwischen der Kategorisierung als Machtinstrument und der ungleichen Verteilung von Macht, die auf dieser Kategorisierung basiert, zu treffen. Identität kann schließlich auch als Ort des Widerstandes benutzt werden und Marginalisierte können sich die Kategorien als selbstermächtigende Bezeichnungen aneignen. Schließlich betont Crenshaw, dass es zumindest im Moment notwendig sei, mit Identitäten zu arbeiten, verschiedene Marginalisierungen hervorzuheben und diese als Mittel der Koalitionen verschiedenartig Marginalisierter im Kampf für die Aufhebung ungleicher Machtverteilung zu nutzen.
Das Kapitel „Haus- und Lohnarbeit“ behandelt bezahlte und unbezahlte Haus- und Pflegearbeit, sowie andere prekäre Arbeit, die zumeist von Frauen durchgeführt wird. In feministischen Diskussionen stellt sie ein besonders umstrittenes Thema dar. Fragen danach, warum sie vor allem von Frauen durchgeführt wird, ob sie aufzuwerten, zu bezahlen oder abzuschaffen ist, welche Funktionen sie auf dem globalen Markt erfüllt und ob und in welcher Form die von Crenshaw beschriebenen Intersektionalitäten hier eine Rolle spielen, stellen einige der wichtigsten Punkte in diesem Diskurs dar. Das Thema ist nicht nur breit, sondern hat auch eine lange Geschichte. So schlug zum Beispiel bereits 1900 die US-Amerikanerin Charlotte Perkins Gilman in „Women and Economics“3 eine Professionalisierung der Hausarbeit vor, verzichtete dabei aber darauf, den gegenderten Charakter der Hausarbeit an sich infrage zu stellen und ging auch nicht auf Klassenverhältnisse oder Rassismus ein – obwohl bereits 1832 die Afroamerikanerin Maria W. Stewart in „Why sit here and die“4 die schlechteren Chancen Schwarzer Frauen am Arbeitsmarkt kritisiert hatte.
Aufgrund der historischen und ideologischen Reichweite des Themas kommen in diesem Kapitel andere spannende Themen zu kurz, wie zum Beispiel weibliche Lohnarbeit in männerdominierten Berufen, warum Frauen noch immer weniger verdienen als Männer oder Themen wie Sexarbeit,5 dessen Kategorisierung als Arbeitsverhältnis auch in feministischen Kreisen immer wieder umstritten ist.
Den Anfang des Abschnitts bestreiten Mariarosa Dalla Costa und Selma James, beide wichtige Vertreterinnen der in den 1970er-Jahren gegründeten „Wages for Housework“-Kampagne. Diese Kampagne war international angesetzt und machte ihren Anfang in Italien (Dalla Costa) und England (James). Mit der Zeit breitete sie sich global aus und vereinte zum Beispiel auch Gruppen, die die Rechte von Schwarzen und Lesben in diesen Belangen vertraten, genauso wie Männergruppen und Gruppen zur Entkriminalisierung von Sexarbeit.
Das Werk „Die Frauen und der Umsturz der Gesellschaft“ von 1972 legte den Grundstein für die „Wages for Housework“-Kampagne. Eine der bedeutendsten Errungenschaften des Textes ist, dass er die Hausarbeit nicht als abseits des kapitalistischen Systems, sondern als ihm inhärent und als essenziell für sein Überleben betrachtet. So wird die häusliche Reproduktionsarbeit als Grundlage der industriellen Arbeit angesehen und die Hausfrau als Pendant zum Arbeiter hervorgehoben. Durch den Kapitalismus seien das Heim und die Arbeitsstätte voneinander getrennt und damit auch die Aufteilung in bezahlte Männerarbeit und in die von Frauen durchgeführte Hausarbeit, die im Privaten stattfindet, nicht bezahlt und dadurch unsichtbar wird, geschaffen. Lediglich das Produkt ihrer Arbeit – der Arbeiter – bleibt somit sichtbar. Mit der Verdrängung der Frau in den privaten Bereich wurde ihr auch jegliche Möglichkeit der Erfahrung von politischer Organisation genommen. Selbst wenn sie die Lohnarbeiter beim Streik oder bei Arbeitsverlust unterstützt, werden ihre Belange in der Arbeiterbewegung nicht ernst genommen. Die Lösung des Problems durch Beschaffung von Lohnarbeitsmöglichkeiten für Frauen lehnen die Autorinnen mit der bekannten Aussage ab, dass „die Sklaverei des Fließbands […] keine Befreiung von der Sklaverei des Spülbeckens“ ist. Arbeit müsse anders organisiert werden. Um dies zu bewerkstelligen und ihre Stellung zu heben, sollten vor allem die Hausfrauen neue politische Organisationsformen finden, sie sollten die Hausarbeit verweigern, die Hausfrauenrolle zerstören, sich innerhalb und außerhalb des Hauses organisieren und Fraueninteressen in bereits vorhandene Kämpfe hineintragen. Außerdem sollten sie sich untereinander organisieren und das sei weltweit und über verschiedene Klassen möglich, da alle Frauen (auch die lohnarbeitenden) bis zu einem gewissen Grade Hausfrauen seien.
Der Text der österreichischen Feministin Veronika Bennholdt-Thomsen „Auch in der ‚Dritten Welt‘ wird die Hausfrau geschaffen – warum?“ geht ebenso davon aus, dass der Hausfrauenstatus zum kapitalistischen System gehört. Die Lebenssituationen der meisten Frauen im globalen Süden seien ein Ergebnis der modernen Entwicklung und kein Zeichen der Rückständigkeit. Der Hausfrauenstatus wäre dabei keine Ansammlung bestimmter Tätigkeiten – da diese historisch und global gesehen zu divers seien –, sondern ein spezifisches Verhältnis, das über schlechteren Zugang zu Geld und damit auch sozialer Wertigkeit definiert wird. Der Idealtypus des männlichen Lohnarbeiters und der „Nur-Hausfrau“ existiert weltweit und historisch allerdings kaum. Frauen haben unter dem Kapitalismus fast immer auch Erwerbsarbeit geleistet, doch auch diese sei meist spezifisch weiblich, also „prekär, sporadisch, schlecht bezahlt und ungeschützt“. Dabei sei es gerade die Verantwortung der Frauen in der Haus- und Pflegearbeit, die Frauen in diese Arbeitsverhältnisse drängt. Die immer wieder reproduzierte Vorstellung des Idealtypus des männlichen Brotverdieners macht nicht nur die Hausfrauenarbeit, sondern auch die weibliche Erwerbsarbeit unsichtbar. Koloniale Prozesse, weltweite Machtverhältnisse, aber auch spezifische Formen der Entwicklungsarbeit – oft sogar solche, die sich das Wohl der Frauen auf ihre Fahnen schreiben – verstärken diesen Prozess der „Hausfrauisierung“ im globalen Süden weiter. Vor allem aber existiert das Modell der Hausfrau deswegen überall, weil es profitabel ist.
Angela Davis ist die vielleicht berühmteste kommunistische, Schwarze Feministin und Bürgerrechtlerin. In dem hier veröffentlichten Text „Das nahende Ableben der Hausarbeit: Aus Sicht der Arbeiterklasse“ (1981) beschäftigt sie sich mit Hausarbeit und übt vor allem an der „Wages for Housework“-Kampagne Kritik. Ähnlich wie Dalla Costa und James beschreibt auch sie den Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Hausarbeit und stellt die Frage, ob der Kapitalismus die Hausfrau wirklich so dringlich brauche. Dabei geht sie viel empirischer vor als die beiden anderen Autorinnen und argumentiert gegen die Bezahlung der häuslichen Tätigkeit. Zum einen würde Geld die Rolle nur noch weiter einzementieren und andererseits hätten es die bereits bezahlten Hausarbeiterinnen – in den USA vor allem Schwarze Frauen – auch nicht viel besser: sie werden schlecht entlohnt und ähnlich der unbezahlten Hausarbeit leidet auch ihre Arbeit an mangelnder Wertschätzung. Außerdem sei es unrealistisch, dass sich die Frauen in der Isolation des Heimes organisieren würden und Gehälter, sagt Davis, würden den Charakter der Hausarbeit nicht verändern. Darum plädiert sie vor allem für die Forderungen nach sozialen Einrichtungen, die den Frauen einen Großteil dieser Arbeit abnehmen würden, wie zum Beispiel subventionierte Kindergärten und Arbeitsplätze für Frauen unter der Voraussetzung der Gleichberechtigung.
„Precarias a la deriva“ nennt sich eine Gruppe von Frauen, die ihre Arbeits- und Lebensverhältnisse als prekär bezeichnen und die sich in Spanien an der Schnittstelle zwischen Aktivismus und Forschung diesbezüglich organisiert. Dabei ist es ihnen wichtig, die Veränderungen der sozialen Strukturen zu verstehen und eine Gemeinschaftlichkeit zu finden, die sich aus der Multiplizität heraus versteht. In ihrem Text aus dem Jahr 2003 gehen sie von einer Pflegekrise aus, die gerade durch die von Angela Davis bereits 30 Jahre zuvor beschriebene Krise der Hausfrauenarbeit hervorgerufen wurde. Ein Großteil der Pflegearbeit wird nun für Geld verrichtet, vor allem von Migrantinnen. Diese generiert sich durch „globale Zuneigungsketten“, die die Pflegearbeit nach internationalen Machtverhältnissen verteilen und sie wird weiterhin hauptsächlich von Frauen durchgeführt, die sich an unterschiedlichen Punkten der Kette befinden: Frauen, die im Herkunftsland der Migrantinnen bleiben und sich bezahlt oder unbezahlt um den Haushalt jener kümmern; Migrantinnen, die nach Europa kommen, um im Haushalt einer anderen Frau zu arbeiten; und die Frauen, die diese Migrantinnen anstellen. Daraus ergeben sich spezifische Machtbeziehungen und Abhängigkeitsverhältnisse unter Frauen. Am Ende des Texts wird direkt aus der Praxis über aktivistische Lösungsansätze reflektiert, die einen Anfang für den Kampf um eine Gesellschaft darstellen, die nicht auf Profit, sondern auf die Nachhaltigkeit des Menschenlebens fokussiert.
Dass das Private politisch ist, ist für Feministinnen nicht nur aufgrund der ins Private gedrängten Hausarbeit wichtig, sondern auch bezüglich Liebesbeziehungen, Sexualität und unseren Körpern. Im Kapitel darüber werden vor allem drei wichtige Fragen besprochen: Wie können Liebesbeziehungen so gelebt werden, dass sie für Frauen und Männer frei sind? Warum schadet es uns, wenn die Politik so tut, als gäbe es keine Körper? Und wie geht die Gesellschaft mit Vergewaltigung um und was macht das mit uns?
Den Anfang bestreitet Madeleine Vernet, eine französische pazifistische Anarchistin. Der hier veröffentlichte Text von 1907 handelt von der freien Liebe. Dieser Aufsatz wurde nicht nur in Frankreich gelesen, da er zum Beispiel auch von der puerto-ricanischen Anarchistin Luisa Capetillo in einem ihrer Bücher6 veröffentlicht wurde. Anarchistischer Feminismus existierte schließlich nicht nur in Europa, sondern unter anderem auch in vielen Teilen Lateinamerikas.7
„Die freie Liebe“ zeigt nicht nur für 1907 radikale und fortschrittliche Überlegungen in Bezug auf Liebesbeziehungen auf. In diesem Text formuliert Madeleine Vernet ihre Überzeugung, dass Liebe keine Pflichten oder Rechte mit sich bringen darf, da jegliche Form der Unterdrückung wahrhaftige Liebe abtötet. Auch Lust ohne Liebe sei natürlich und damit vertretbar. Die Frau empfände diesbezüglich genauso wie der Mann, auch wenn das Gegenteil behauptet würde: dass sie keine Gelüste und keine sexuelle Autonomie habe. Besonders die Frau müsse von all diesen Zwängen – unter anderem der Ehe – befreit werden, da sie unter der Verformung ihrer Sexualität durch die sozialen und rechtlichen Normen leide.
Allerdings geht der Text lediglich von heterosexueller Liebe und Sexualität aus. Ein Blickwinkel, der Maria Galindo nicht vorzuwerfen ist. Sie ist Mitgründerin8 von mujeres creando, einem bolivianischen, anarchistischen Feministinnenkollektiv, das sich den Kampf gegen Homophobie und Sexismus zur Aufgabe gemacht hat. Der hier unter dem Titel „Ohne sexuelle Freiheit gibt es keine Demokratie“ veröffentlichte Text stammt aus einem ihrer gleichnamigen Bücher und beschreibt, wie Politik den Körper und Sexualität als wichtiges gesellschaftsbildendes und soziales Element negiert. Sie plädiert dafür, beides als politisch anzuerkennen, vor allem auch, weil Sexualität zwar als privat betrachtet und doch vom Staat überwacht wird. Auch der Antidiskriminierungsdiskurs befände sich in einem solchen scheinheiligen Widerspruch. Hierbei geht sie vor allem auf Homosexualität ein: Der Staat und seine Institutionen stellen Homosexuelle pauschal unter Verdacht und erschweren ihnen das Leben. Durch den Antidiskriminierungsdiskurs würde ihnen schließlich von demselben Ort der Macht, von dem aus sie zuvor ausgeschlossen und unterdrückt wurden, Toleranz angeboten. Wer dieses Angebot nicht annimmt, werde als aggressiv abgestempelt. Den Marginalisierten bleibe dabei angesichts der staatlichen Institutionen, die aus diesem Diskurs resultieren, lediglich die Performanz einer Opferrolle. Dadurch würden Machtstrukturen verschleiert und dazu beigetragen, den Status quo zu erhalten. Maria Galindo glaubt nicht an den Staat und seine Institutionen als Instrumente der Antidiskriminierung und schlägt vor, Lösungen außerhalb der konventionellen Politik zu finden.
Virginie Despentes, eine französische feministische Autorin und Filmemacherin, ehemalige Gelegenheitsprostituierte und Punkerin, schreibt in dem Kapitel „Impossible de violer cette femme pleine de vices“ ihres Buches „King Kong Theory“ über Vergewaltigung und sowohl theoretisch als auch persönlich über ihren Umgang mit dem Erlebten. Vergewaltigung werde nie als solche ausgesprochen, weder von den Vergewaltigern noch von den Opfern. Die Männer fänden immer einen Weg, das Geschehen nicht als solche zu definieren. Frauen, die eine Vergewaltigung überlebt haben, würden pauschal verdächtigt – von sich selbst und der Gesellschaft – und müssten beweisen, dass sie mit dem Akt nicht einverstanden waren. Gleichzeitig würde Frauen beigebracht, dass ihnen Gewalt nicht zustünde und die Unversehrtheit des Männerkörpers wichtiger sei als die des Körpers einer Frau. Virginie Despentes beschreibt, wie ihr die umstrittene Feministin Camille Paglia9 endlich ein neues Instrument gab, ihre Vergewaltigung zu denken: Als Frau müsse man auf eine Vergewaltigung gefasst sein, darum mache Frauen das Auf-die-Straße-gehen – in einen Raum, der nicht für sie bestimmt sei – bereits zu Kriegerinnen. Dies entließe die Frauen endlich ihrer Verantwortung. Denn Vergewaltigung ist keine Randerscheinung und steht nicht alleine, sie ist Teil des Ausdrucks der männlichen Macht, die Frauen zum „Geschlecht der Angst“ macht.
Wie bereits bei der Intersektionalität dargelegt, gibt es verschiedene Faktoren, die Menschen marginalisieren, diese drücken sich nicht nur in Arbeitsverhältnissen, persönlichen Beziehungen usw. aus, sondern auch in den politischen Kämpfen selbst: Frauen wurden und werden bei Kämpfen um gerechtere Verteilung oft ausgeschlossen oder zumindest weniger ernst genommen. In der Ersten und Zweiten Frauenbewegung, um die Jahrhundertwende und in den 1960er- bis 1970er-Jahren, kämpften sie um Anerkennung, schlossen aber gleichzeitig andere aus: zum Beispiel Schwarze Frauen in den USA, die sich seit der Ersten Frauenbewegung auch dagegen zur Wehr setzten, wie Sejouner Truth in „Ain’t I a Woman?“10 bereits 1851 zeigt. Können wir mit den sich immer wieder reproduzierenden Machtverhältnissen umgehen und gemeinsam kämpfen? Oder ist das unmöglich? Worum genau sollen wir kämpfen? Gibt es Interessen, die an erster Stelle stehen? Gibt es die eine Wurzel der Ungleichheit oder den einen Faden, an dem angezogen werden muss, damit sich ihr gesamtes Gewebe auflöst oder sollen wir Ungleichheit, im Sinne von Audre Lorde,11 lieber anderes denken: „There is no Hierarchy of Oppression“?12 Oder müssen wir vielleicht erst verstehen, wie diese Ungleichheiten miteinander zusammenhängen, um konkrete Strategien zu entwickeln?
Der erste Text in dem Kapitel „Haupt- und Nebenwidersprüche“ von Olympe de Gouges stellt sich inmitten der Französischen Revolution, die für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit kämpfte, den Männern gegenüber und verlangte 1791, auch die Rechte der Frauen festzuhalten. Olympe de Gouges spricht zuerst die Männer an und wirft ihnen vor, sie hätten sich über die Frauen gestellt. Sie wollten durch die Revolution in den Genuss gleicher Rechte kommen, sich aber darüber hinaus keine Fragen stellen. Dann geht sie in ihrer Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin auf die einzelnen Artikel ein, die die Frau mit dem Mann rechtlich gleichstellen würden. In der Postambel ruft sie die Frauen dazu auf, sich zu wehren, geht auf die gesellschaftliche Doppelmoral ihrer Zeit ein und verurteilt nicht nur den Umgang mit Frauen und unehelichen Kindern, sondern auch die Sklaverei in den französischen Überseegebieten.
Die deutsche feministische Sozialistin Clara Zetkin, die unter anderem auch durch ihre Antikriegshaltung bekannt wurde, erklärt im Gegensatz dazu über ein Jahrhundert später, dass Gesetze für Frauen nicht die Lösung des Problems darstellen würden, denn diese könne letztendlich nur durch die Änderung des ökonomischen Systems geschehen. Clara Zetkin war vor allem aufgrund ihres internationalen sozialistischen Engagements viel in Europa unterwegs, so auch 1908 in Wien, wo sie im Arbeiterheim eine Rede über Frauen und Sozialismus hielt. In dieser beschreibt sie zuerst, wie der Kapitalismus die alten Familienstrukturen verändert und die Arbeitsweise zerstört hatte, in der Frau und Mann gleich gewesen seien. Danach ging sie auf die Interessen der Frauen der einzelnen Klassen unter dem Kapitalismus ein. Die Frauen der oberen Klassen und des Bürgertums hätten vor allem ein Interesse am gleichen Zugang zu Bildung und der Berufstätigkeit für beide Geschlechter, wenn auch aus anderen Gründen. Die Arbeiterin aber teile ihre Interessen mit dem Arbeiter, denn bei ihnen ginge es vor allem um materielle Not und um das, was wir heute als Doppelbelastung beschreiben würden. Die Arbeiterin würde zu schlechten Löhnen in die Arbeit gedrängt und hätte nicht mehr die Wahl, hauptsächlich Mutter und Gattin zu sein, eine Position, die gerade das Proletariat zu schätzen wisse. Doch auch der Mann sollte die Möglichkeit haben, seine Verantwortung als Vater zu übernehmen und die Frau solle ebenso im öffentlichen Raum kämpfen und über die gleichen politischen Rechte, wie zum Beispiel das Wahlrecht, verfügen. Die Arbeiterin teile also ihre Interessen mit dem Arbeiter und solle an seiner Seite kämpfen.
Die Feministin und russische Revolutionärin Alexandra Kollontai kam in ihrem 1909 erstmals veröffentlichtem Text „Die soziale Basis der Frauenfrage“ zu einem ähnlichen Schluss: Gleiche Rechte würden nur den bürgerlichen Frauen etwas bringen und es mache für proletarische Frauen auf keiner Ebene Sinn, mit diesen eine Allianz einzugehen, denn nur der Sozialismus befreie die Frauen wirklich. Dafür geht sie zuerst auf die Frage der Arbeit ein und meint, dass hierbei die proletarischen Frauen die eigentlichen Vorreiterinnen der Frauenbewegung seien, denn diese hätten schon immer gearbeitet. Danach befasst sie sich mit der Familien- und Ehefrage. Hier gesteht sie den bürgerlichen Frauen zu, große Fortschritte gemacht zu haben. Zumindest einzelne dieser Frauen hätten mutig der existierenden Doppelmoral getrotzt und „freie Liebe“ nicht nur eingefordert, sondern auch gelebt. Dies könne, den bürgerlichen Frauen folgend, allen Frauen als Vorbild dienen. Doch dieses Modell hätte kaum Auswirkungen auf die Frauen der Arbeiterklasse, da es die äußeren Umstände, wie die ökonomische Situation, ausblende. So würde zum Beispiel die Mutterschaft mit der Abschaffung der formellen Ehe noch mehr auf den Frauen alleine lasten, ein Problem, das unter den Anarchistinnen, die ebenso Anfang des Jahrhunderts um freie Liebe kämpften, kaum Erwähnung fand.13
Sowohl für Alexandra Kollontai als auch für Clara Zetkin muss es durch ein Bekennen zur Arbeiterbewegung auch für nicht proletarische Frauen möglich sein, in der proletarischen Frauenbewegung zu kämpfen. Sie selbst wären schließlich beide Beispiele dafür.
Die amerikanische Feministin bell hooks, die sich vor allem mit Sexismus, Rassismus und Klassismus befasst, spricht sich 75 Jahre nach Kollontai ebenso für einen Kampf gegen Sexismus aus, der gemeinsam mit Männern geführt werden soll, nun aus der Perspektive einer Schwarzen US-amerikanischen Feministin. Ihr Text „Männer. Genossen im Kampf“ postuliert zu Beginn, dass der Kampf gegen Sexismus nicht nur Frauenarbeit sein darf. Die anti-männliche Haltung der vor allem weißen und bürgerlichen Feministinnen hätte nicht nur Männer, sondern auch arme und Schwarze Frauen abgeschreckt. Denn sie hätten schließlich auch Solidarität mit Männern im gemeinsamen Kampf erfahren. Frauen aus ärmeren Schichten würden durch separatistische Vorstellungen ausgeschlossen, denn für diese Frauen wäre Separatismus ökonomisch gar nicht möglich. Ähnlich wie Clara Zetkin und Alexandra Kollontai meint auch hooks, dass dieser Feminismus die Frage der Klasse aber auch den Rassismus ausgeblendet habe und dass es seinen Vertreterinnen hauptsächlich um ihre eigenen Privilegien ginge. Schließlich geht sie auf das Dilemma ein, dass Männer einerseits tatsächlich Sexismus reproduzieren würden, aufgrund einer Sozialisation, die uns alle geprägt habe, dass sie aber andererseits auch selbst unter manchen Aspekten des Sexismus leiden würden. Nicht alle Männer besäßen dieselben Privilegien und manche der unterprivilegierten Männer würden gerade durch die Dominanz über Frauen die „Verletzung“ darüber ausdrücken, dass sie die ihnen zugeschriebene männliche Rolle nicht erfüllen können. Feminismus müsse am täglichen Leben eines Großteils der Frauen ansetzen und Lösungen dafür anbieten und er solle Männer dazu aufrufen, ebenso Verantwortung für die Beendigung des Sexismus zu übernehmen. Männer, die dazu bereit wären, seien Teil der feministischen Bewegung und Genossen im Kampf.
Das letzte Kapitel befasst sich mit Frauen in konkreten Kämpfen. Hier finden sich unterschiedliche Textformen: Ein Auszug aus Zohra Drifs Memoiren über ihre Teilnahme am Kampf um Algier, ein Aufruf der österreichischen Künstlerin Valie Export für Frauen in der Kunst, ein Forderungspapier der Aktion Unabhängiger Frauen (AUF), ein Vorschlag eines Gesellschaftsentwurfs von Julieta Paredes und schließlich ein historischer Erfahrungsbericht der Frauen der mexikanischen Guerilla EZLN. An diesen Textkorpus können verschiedene Fragen gestellt werden. All diese Texte sind nicht nur auf unterschiedliche Weise emanzipatorisch, sondern haben auch gesellschaftspolitische Ziele, die über die Frauen hinausreichen. Die Antworten darauf, wie diese erreicht werden können, fallen sehr unterschiedlich aus. Die Aktion Unabhängiger Frauen befindet, dass unter derzeitigen Verhältnissen ohne Männer gekämpft werden muss. Die Frauen im Kampf um die Unabhängigkeit Algeriens oder in der EZLN zeigen durch ihre Praxis, dass sie sich als Teil der Gesellschaft, der Öffentlichkeit und der Politik sehen und machen somit auf der praktischen Ebene bereits einen Schritt in Richtung Ermächtigung. Trotzdem sind diese Kämpfe nicht frei von Geschlechterstrukturen und werfen darum auch auf dieser Ebene Fragen auf, die in den folgenden Texten zumindest mitschwingen: Wie viel Feminismus ist in solchen Bewegungen möglich? Inwieweit kann verlangt werden, Frauen ihre Räume zu geben, ihre Autonomie und Gleichbehandlung, ohne den Kampf um das größere Ziel zu bremsen? Und ist es wichtig, neben diesem Kampf auch alleine als Frauen zu kämpfen, damit die Fraueninteressen nicht untergehen? Und unabhängig von dem Verhältnis zwischen Männern und Frauen: Können überhaupt alle Frauen miteinander kämpfen, wenn auch sie nicht dieselben Interessen haben?
Welche Forderungen sollen wir stellen und an wen? Wie sollen wir sie stellen? Durch Texte, durch Kunst oder Demonstrationen? Im Parlament? Oder wollen wir die zukünftige Gesellschaft lieber abseits des existierenden Systems aufbauen? Oder stellen wir uns dem existierenden System mit Gewalt gegenüber und stürzen es? Und ab wann ist es gerechtfertigt, welche Formen von Gewalt anzuwenden?
Die österreichische Frauenbewegung der 1970er-Jahre beschäftigte sich mit diesen Themen. Valie Export beschreibt 1972, wie sich Frauen- und die Kunstbewegung wechselseitig beeinflussen könnten und dass sich die Frauen aller Medien bedienen sollten, vor allem auch der Kunst als Medium der Selbstbestimmung, um das von den Männern geprägte Bild der Frau zu zerstören und ihr eigenes zu schaffen.
Die Erklärung der Aktion Unabhängiger Frauen (AUF) wirft viele der in den vorhergehenden Texten vorkommenden Forderungen wieder auf: Auch die Aktivistinnen der AUF sind der Meinung, dass eine echte Befreiung der Frau nur durch eine umfassendere kulturelle, sexuelle und wirtschaftliche Revolution verwirklicht werden kann, und fordern neben der Abschaffung des Kapitalismus auch die Abschaffung der bürgerlichen Familie als einzig anerkannter Möglichkeit und die Sozialisierung von Hausarbeit und Kinderbetreuung. Für ihre konkrete Praxis schlagen sie vor, diese vorerst ohne Männer zu bestreiten, da es notwendig sei, dass Frauen sich ihre persönlichen Probleme erzählten, um diese als politisch erkennen und analysieren zu können.
Die Frage der Gewalt stellt sich besonders in den Memoiren von Zohra Drif, die 1956 im Zentrum des europäischen Stadtteils von Algier eine Bombe legte und somit die europäische Zivilbevölkerung angriff. Ich möchte auf diese Frage hier nicht eingehen, da sie ihre Erklärungen dafür spätestens im Abschnitt „Den Krieg in das Territorium des Feindes tragen“ selbst gibt. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass dieser Text auch darum besonders spannend ist, weil er den Unabhängigkeitskampf auf eine neue Weise beschreibt. Es geht nicht um kolonisierte Männer, die gegen das männliche System des Kolonialismus kämpfen und Frauen, die im besten Fall zur Verfügung stehen. Was Zohra Drif beschreibt, sind Frauenbünde und Frauennetzwerke in diesem Kampf, die nicht theoretisiert werden und einfach da sind. Ihr Text weist auf andere Unterschiede hin, als die zwischen Männern und Frauen, die manchmal viel stärker wiegen, wie die zwischen Kolonisierten und Kolonisator*innen und dass diesbezüglich auch die Ungleichheiten unter Frauen mehr Bedeutung haben. Der Bericht deutet aber anhand des Themas der Religion ebenso an, dass Allianzen zwischen Frauen mit unterschiedlichen Vorstellungen geschlossen werden können.
Julieta Paredes, ein weiteres Gründungsmitglied von mujeres creando, zeigt mit ihrem Text, der sich von jenem Maria Galindos abhebt, dass ein Frauenkollektiv auch mit unterschiedlichen Vorstellungen und unterschiedlicher Herkunft – Julieta Paredes ist Indigene, Maria Galindo nicht – funktionieren kann. Sie entwirft ihren feminismo comunitario anhand ihrer eigenen Erfahrungen in der indigenen Gemeinschaft. Zuerst aber verweist sie darauf, dass es auch vor dem Kolonialismus in Bolivien ein Patriarchat gegeben hat und es einen spezifischen indigenistischen Machismo gibt. Auch sie will den Feminismus des globalen Nordens hinterfragt sehen, der viele Realitäten von Frauen unsichtbar macht und fühlt sich mit anderen marginalisierten Feminismen verbunden. Wie auch bell hooks vorschlägt, will sie einen Feminismus entwerfen, der den konkreten Realitäten der Frauen in Bolivien entspricht: Das bedeutet, sich nicht im Gegensatz zu den Männern, sondern in Beziehung mit der Gemeinschaft zu denken. Frauen und Männer seien in der Gemeinschaft beide wichtig und Unterschiedlichkeit stelle ein Potenzial dar. Eine Gruppe der anderen unterzuordnen, würde der Gemeinschaft einen Teil ihres Potenzials nehmen. Danach stellt sie fünf Kampffelder vor, mit denen sich der feminismo comunitario beschäftigt – Körper, Raum, Zeit, Bewegung und Erinnerung – und lädt alle feministischen Frauen und Männer dazu ein, sich am Ungehorsam zu beteiligen.
In einem weiteren Dokument beschreiben die ebenso indigenen, zapatistischen EZLN-Frauen das Verhältnis von Mann und Frau zur Gemeinschaft ähnlich: Für den Aufbau einer neuen Gesellschaft werden alle Mitglieder gebraucht, also sowohl Frauen als auch Männer, alle hätten nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, sich daran zu beteiligen. Würde der Beitrag einer Gruppe marginalisiert, wäre das vor allem ein großer Schaden für die politische Bewegung.14 In dem hier abgedruckten Prolog, der im Original als Einleitung zu Julieta Paredes „Filando Fino“ dient, beschreiben die EZLN-Frauen historisch-chronologisch wichtige Punkte ihres Kampfes, beginnend mit den 1990er-Jahren und ihrem Revolutionären Gesetz für Frauen. Sie schreiben über starke Frauengruppen aber auch einzelne Genossinnen, wie Comandanta Ramona, Feli und Bety Cariño, die von Vertretern der Regierung ermordet wurden, über transnationale Treffen, politische Repression, über ihr wiederständisches Radio und die Ausbreitung der Bewegung. Der Bericht endet im April 2011.
Die hier versammelten Texte haben meine Emotionen und Gedanken aufgerüttelt, manche sogar immer und immer wieder. Ich hoffe, dass sich all dies, die Emotionen, der Drang sich über einzelne Fragen Gedanken zu machen, aber vor allem auch der Spaß an der Arbeit, auf die Leser*innen überträgt, denn der Kampf für soziale Änderung und das Nachdenken darüber soll nicht nur anstrengend sein, sondern auch Freude bereiten.
Thionville (Frankreich), im August 2021 Julia Harnoncourt
1 Crenshaw, Kimberlé (1989): Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics, in: University of Chicago Legal Forum.
2 „Schwarz“ großgeschrieben als Selbstbezeichnung, die die emanzipatorische Widerstandspraxis betonen soll.
3 Gilman, Charlotte Perkins (1900): Women and economics. A study of the economic relation between men and women as a factor in social evolution. London: Putnam.
4 Z. B. hier: https://www.blackpast.org/african-american-history/1832-maria-w-stewart-why-sit-ye-here-and-die/ (geprüft 4. 7. 2021)
5 Sie wird übrigens mindestens von zwei der hier vorkommenden Autorinnen an anderer Stelle in sehr interessanter Form bearbeitet: von Precarias a la deriva (2004): A la deriva por los circuitos de la precariedad femenina. Madrid: Traficantes de Sueños und Despentes, Virginie (2018): King Kong Theorie. Unter Mitarbeit von Barbara Heber-Schärer und Claudia Steinitz. 1. Auflage. Köln: Kiepenheuer & Witsch (KiWi, 1611).
6 Capetillo, Luisa (1911): Mi opinión. Sobre las libertades, derechos y deberes de la mujer. San Juan, P. R.
7 So z. B. in Argentinien, siehe Molyneux, Maxine (1986): No God, no boss, no husband. Anarchist feminism in nineteenth-century Argentina. In: Latin American Perspectives, 13 (1), S. 119−145.
8 Eine weitere Mitbegründerin ist Julieta Paredes (ebenso in dieser Edition vertreten).
9 Camille Paglia bringt ähnliche Argumente in: Paglia, Camille (1992): Sex, art, and American culture. Essays. 1. ed. New York: Vintage Books.
10https://www.nps.gov/articles/sojourner-truth.htm, (geprüft 4. 7. 2021)
11Eine weitere wichtige Schwarze, lesbische, US-amerikanische Feministin.
12 In: Byrd, Rudolph P.; Lorde, Audre (Hg.) (2009): I am your sister. Collected and unpublished writings of Audre Lorde. Oxford, New York: Oxford University Press (Transgressing boundaries), 219−220.
13 Molyneux 1986.
14 Mehrmals in: EZLN (2014): Participación de las mujeres en el gobierno autónomo. Escuelita Zapatista. Cuaderno de texto de primer grado del curso „La libertad según l@s zapatistas“.
Kapitel 1: Sex und Gender
Simone de Beauvoir: Das andere Geschlecht – Einleitung (1949)
Ich habe lange gezögert, ein Buch über die Frau zu schreiben. Das Thema ist ärgerlich, besonders für die Frauen; außerdem ist es nicht neu. Im Streit um den Feminismus ist schon viel Tinte geflossen, zur Zeit ist er fast beendet: reden wir nicht mehr davon. Man redet aber doch davon. […] Besteht hier übrigens ein Problem? Und welches ist es denn? Gibt es überhaupt Frauen? Sicher hat die Theorie vom Ewigweiblichen noch ihre Anhänger; sie flüstern einander zu: „Selbst in Rußland bleiben sie noch Frauen“; aber andere Leute, die es ganz genau wissen – es sind sogar manchmal dieselben –, seufzen: „Die Fraulichkeit geht verloren, es gibt keine Frauen mehr.“ Man weiß nicht mehr recht, ob es noch Frauen gibt, ob es sie immer geben wird, ob man es wünschen soll oder nicht, welche Stellung sie auf dieser Welt einnehmen und welche sie einnehmen sollten. […] Aber zunächst einmal: Was ist eine Frau? Tota mulier in utero: