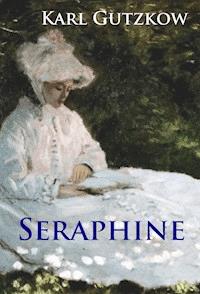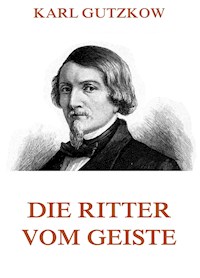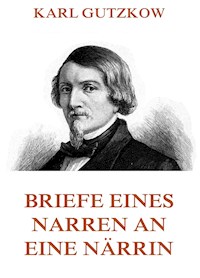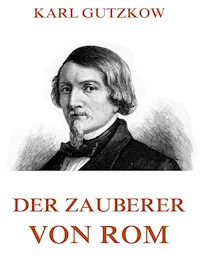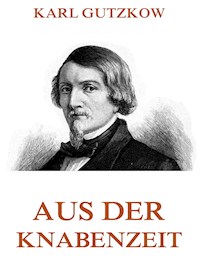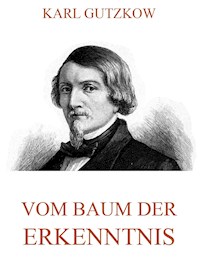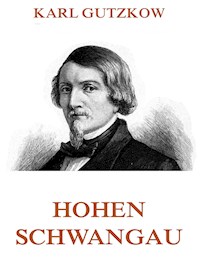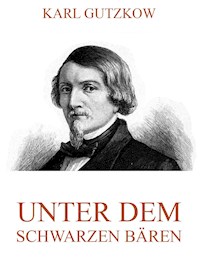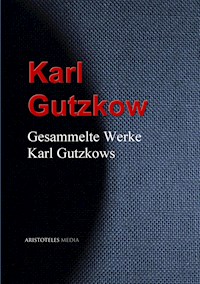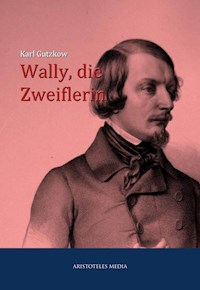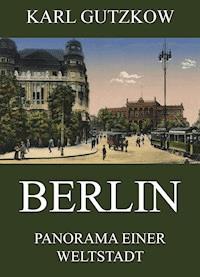
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Dieses Buch ist ein Fest für alle, die sich für Berliner Anekdoten und Geschichte interessieren. Gutzkow erzählt aus seiner Heimatstadt und von Begebenheiten und Personen des 19. Jahrhunderts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Berlin—Panorama einer Weltstadt
Karl Gutzkow
Inhalt:
Karl Ferdinand Gutzkow – Biografie und Bibliografie
Berlin—Panorama einer Weltstadt
I. "Weltstadt"—Panorama
Café Stehely (1831)
Cholera in Berlin (1831)
Alte Bauten—neue Bauten (1832)
Dom, Schauspielhaus—"Sechserbrücke" (1840)
Blumenausstellung in Stralow (1840)
Notizen (1841)
Berlins sittliche Verwahrlosung (1843)
Geist der Öffentlichkeit (1844)
Mystères de Berlin? (1844)
Ein Frühgottesdienst für Briefträger.
Impressionen—z.B.: Borsig (1854)
Quatsch, Kroll und "Satanella" (1854)
Neues Museum—Schloßkapelle—Bethanien (1854)
Zur Ästhetik des Häßlichen (1873)
II. Für und Wider Preußens Politik
Über die historischen Bedingungen einer preußischen Verfassung (1832)
Drei preußische Könige (1840)
Das Barrikadenlied (1848)
Landtag oder Nicht-Landtag (1848)
Preußen und die deutsche Krone (1848)
Abwehr einer Verleumdung (1850)
Varnhagens Tagebücher (1861)
Vorläufiger Abschluß der Varnhagenschen Tagebücher (1862)
III. Drei Berliner Theatergrößen
Ernst Raupach (1840)
Ludwig Tieck und seine Berliner Bühnenexperimente (1843)
Madame Birch-Pfeiffer und die drei Musketiere (1846)
IV. Aus dem literarischen Berlin
Der Sonntagsverein (1833)
Cypressen für Charlotte Stieglitz (1835)
Diese Kritik gehört Bettinen (1843)
Ein preußischer Roman (1849)
Eine nächtliche Unterkunft (1870)
Zum Gedächtnis Wilhelm Härings (Willibald Alexis') (1872)
Lyrisches aus dem Zeitungsviertel (1873)
Louise Mühlbach und die moderne Romanindustrie (1873)
Berlin—Panorama einer Weltstadt, K. Gutzkow
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849626648
www.jazzybee-verlag.de
Karl Ferdinand Gutzkow – Biografie und Bibliografie
Dichter und Schriftsteller, geb. 17. März 1811 in Berlin, gest. 16. Dez. 1878 in Sachsenhausen bei Frankfurt a. M., Sohn eines Bereiters des Prinzen Wilhelm, der später eine niedere Amtsstellung im Kriegsministerium bekleidete, studierte auf der Berliner Universität Philosophie und Theologie und widmete sich, ergriffen durch die Eindrücke der Julirevolution, frühzeitig der Publizistik. Er gewann die Teilnahme Wolfgang Menzels und wurde Mitarbeiter an dessen »Literaturblatt« (1832 bis 1834), weshalb er für einige Zeit nach Stuttgart übersiedelte. Auch mit umfangreichern selbständigen Arbeiten trat er bald hervor, zunächst mit novellenartigen Zeitbetrachtungen in den »Briefen eines Narren an eine Närrin« (Hamb. 1832), sodann mit einem nur wenig Zeitanspielungen enthaltenden Roman »Maha-Guru, Geschichte eines Gottes« (Stuttg. 1833, 2 Bde.) und mit geistvollen politisch-literarischen Essays: den »Öffentlichen Charakteren« (Hamb. 1835). Obgleich G. in einzelnen seiner ersten »Novellen« (Hamb. 1834, 2 Bde.) und mit dem (unausführbaren) Drama »Nero« (Stuttg. 1835) poetisches Talent bekundete, so fühlte er sich doch in diesen Jahren (bis etwa 1839) mehr journalistisch als künstlerisch zu schaffen angeregt. Er wurde ungesucht einer der Stimmführer des Jungen Deutschland, das seit Beginn der 1830er Jahre die Aufgabe der neuen Literatur vornehmlich in der Weckung eines politischen Bewußtseins und in der Verbreitung liberaler Anschauungen erblickte; die Literatur sollte hinter der Zeit, in der sich gewaltige Umwälzungen auf materiellem und sozialem Gebiet vorbereiteten, nicht zurückbleiben. In diesem Sinne schrieb G., der inzwischen in Heidelberg und München Rechts- und Staatswissenschaften studiert und 1834 in Frankfurt a. M. die Leitung des »Literaturblattes« zum »Phönix« übernommen hatte, seine Vorrede zu Schleiermachers »Briefen über Schlegels Lucinde« (Hamb. 1835), seine »Soireen« (Frankf. a. M. 1835, 2 Bde.) und den Roman »Wally, die Zweiflerin« (Mannh. 1835; spätere Umarbeitung u. d. T.: »Vergangene Tage«, Frankf. 1852). Einige sinnliche Schilderungen und religiös freisinnige Betrachtungen des im ganzen wenig bedeutenden Romans boten Wolfgang Menzel erwünschte Gelegenheit zu gehässigen Anklagen gegen G., mit dem er sich inzwischen überworfen hatte, und diese Angriffe hatten den Erfolg, daß »Wally« konfisziert und G. in Baden zu einer dreimonatigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde, die er 1835 in Mannheim abbüßte. Zugleich wurde seine ganze Zukunft durch das bundestägliche Verbot aller seiner (wie der andern Jung-Deutschen) frühern und künftigen Schriften und durch die Entziehung des Rechtes, innerhalb des deutschen Bundesgebiets eine Redaktion zu übernehmen, in Frage gestellt. G. überwand zwar mit männlicher Energie und Überzeugungstreue den Schlag, den er durch diese (übrigens bald gemilderten) Maßnahmen des Bundestages erfuhr, aber das dadurch geweckte Mißtrauen gegen die Menschen, eine hochgradige Hypochondrie, die überall Verfolger und Feinde witterte, wirkte in seinem folgenden Leben verhängnisvoll nach. Seit 1836 verheiratet, siedelte er 1837 zur Leitung der von ihm begründeten Zeitschrift »Der Telegraph« nach Hamburg über, wo er bis 1842 verweilte, hauptsächlich gefesselt durch die Freundschaft der geistvollen Frau Therese v. Bacheracht, die er aber nach dem Tode seiner Gattin (1848) nicht heiratete. In diesen Jahren war G. literarisch-publizistisch überaus tätig; es erschienen die in der Hast zu Mannheim geschriebene Schrift: »Zur Philosophie der Geschichte« (Hamb. 1836; vgl. R. Fester, Eine vergessene Geschichtsphilosophie, das. 1890); »Zeitgenossen, ihre Tendenzen, ihre Schicksale, ihre großen Charaktere« (Stuttg. 1837, 2 Bde.); die gegen Görres gerichtete Broschüre: »Die rote Mütze und die Kapuze« (Hamb. 1838); »Götter, Helden und Don Quixote« (das. 1838); die gegen Menzel, den verblendeten Goethe-Hasser, gerichteten Aufsätze: »Goethe im Wendepunkt zweier Jahrhunderte« (Berl. 1836) und das panegyrische Werk. »Börnes Leben«, mit einem gegen Heine gerichteten Vorwort (Hamb. 1840). Doch nahm G. schon die Wendung zu mehr dichterischen Arbeiten im Roman »Seraphine« (Hamb. 1838), in der satirischen Zeitgeschichte in Arabesken: »Blasedow und seine Söhne« (Stuttg. 1838–39, 3 Bde.) und eröffnete mit dem Trauerspiel »Richard Savage« (1839) eine sehr fruchtbare und auch Werke von bleibendem Wert schaffende dramatische Periode, in der er eine große Popularität erreichte. 1842 vertauschte er Hamburg mit Frankfurt a. M., 1846 dieses wiederum mit Dresden, wo er in frischer und glücklicher Schaffenslust bis 1861 wohnte. 1847–49 war G. Dramaturg des Dresdener Hoftheaters, 1850 heiratete er zum zweitenmal, 1852–62 leitete er die von ihm begründete Zeitschrift: »Unterhaltungen am häuslichen Herd«. 1861 siedelte G. als Generalsekretär der Deutschen Schillerstiftung, um deren Zustandekommen er sich große Verdienste erworben hatte, nach Weimar über; doch legte er schon im November 1864 das Amt nieder: gekränkt, überreizt und so tief verstimmt, daß er im Februar 1865 in Friedberg einen Selbstmordversuch machte. Er wurde gerettet und nahm neugekräftigt seine literarische Tätigkeit wieder auf; 1868–73 lebte er in Berlin. Wiederkehrende Nervenleiden veranlaßten einen Winteraufenthalt (1873/74) in Italien, 1874–77 lebte er in Heidelberg. Zuletzt ließ sich der in seiner körperlichen Kraft Gebrochene, geistig mehr und mehr Isolierte in Sachsenhausen nieder. Zwischen seinen dichterischen Werken veröffentlichte G. indes noch immer halb journalistische Schriften, so die »Briefe aus Paris« (Leipz. 1842, 2 Bde.), »Deutschland am Vorabend seines Falles und seiner Größe« (Frankf. 1848), »Vor- und Nachmärzliches« (Leipz. 1850), »Lebensbilder« (Stuttg. 1870, 3 Bde.), eine Spruchsammlung: »Vom Baum der Erkenntnis« (das. 1873) und »In bunter Reihe«, Briefe und Skizzen (Berl. 1877). Seine letzte polemische Schrift: »Dionysius Longinus, oder über den ästhetischen Schwulst in der neuern deutschen Literatur« (Stuttg. 1878), war der Ausfluß der leidenschaftlichen Verbitterung, die sich in ihm angehäuft hatte, und die schon, wenn auch minder stark, in dem autobiographischen Buch »Rückblicke auf mein Leben« (Berl. 1875), der Fortsetzung seiner frisch-liebenswürdigen Aufzeichnungen: »Aus der Knabenzeit« (Frankf. a. M. 1852), sich äußerte. – Die bleibende Bedeutung Gutzkows in der deutschen Literatur beruht in den größern Dramen und Romanen, die er schuf. Er hat der deutschen Bühne einige Stücke gegeben, die sich noch heute auf dem Repertoire behaupten: das treffliche historische Lustspiel »Zopf und Schwert« (1844), ferner »Das Urbild des Tartüffe« (1847) und in demselben Jahre die in alle europäischen Sprachen übersetzte Tragödie der Gewissensfreiheit: »Uriel Acosta« (vgl. W. Volkmann, Uriel Acosta, Bresl. 1893). Viel Beifall fand auch das Lustspiel »Der Königsleutnant« (1849), doch ist hierin die Figur des jungen Goethe ganz verzeichnet, und der große Beifall, den das Stück fand, ist vor allem durch die von schauspielerischen Virtuosen gepflegte Paraderolle des Grafen Thorane zu erklären. Von andern Dramen Gutzkows, die trotz mancher Vorzüge weniger durchschlugen, z. T. aber auch ganz verfehlt sind, nennen wir: »Werner, oder Herz und Welt«, Schauspiel (1840), »Die Schule der Reichen«, Schauspiel (1841), »Patkul«, Trauerspiel (1842), »Der 13. November«, Trauerspiel (1842), »Ein weißes Blatt«, Schauspiel (1843), »Pugatscheff«, Tragödie (1846), »Jürgen Wullenweber«, Tragödie (1848), »Liesli«, Volkstrauerspiel (1852), »Philipp und Perez«, Tragödie (1853), »Ottfried«, Schauspiel (1854), »Lenz und Söhne, oder die Komödie der Besserungen«, Lustspiel (1855), »Ella Rosa«, Schauspiel (1856), »Lorbeer und Myrte«, Lustspiel (1856), »Der Gefangene von Metz«, Schauspiel (1870), »Dschingischan«, Lustspiel (1876). Eine Sammlung seiner Stücke erschien u. d. T.: »Dramatische Werke« (Leipz. 1842–57, 9 Bde.; neue umgearbeitete Ausg. 1861–63, 20 Bdchn.; 4. Aufl., Jena 1880). Noch unmittelbarer an die Zeit schloß sich G. in den beiden großen Romanen an: »Die Ritter vom Geiste« (Leipz. 1850–52, 9 Bde.; 6. umgearbeitete Aufl., Berl. 1881, 4 Bde.) und »Der Zauberer von Rom« (Leipz. 1858–61, 9 Bde.; 4. völlig umgearbeitete Aufl., Berl. 1872, 4 Bde.), die bei ihrem Erscheinen außerordentliches Interesse erregten. »Die Ritter vom Geiste« schildern die Reaktionsepoche nach 1848 in scharf und geistvoll gezeichneten Typen, »Der Zauberer von Rom« die Ultramontanen und das katholische Deutschland, dessen politische Bedeutung G. früh erkannte. Außer kleinern Erzählungen schrieb G. noch mehrere große Romane: »Hohenschwangau« (Leipz. 1867–68, 5 Bde.; 3. umgearbeitete Aufl., Bresl. 1880), ein Bild der Reformationszeit; den Memoirenroman »Fritz Ellrodt« (Jena 1872, 3 Bde.); »Die Söhne Pestalozzis« (Berl. 1870, 3 Bde.); »Die neuen Serapionsbrüder« (Bresl. 1877, 3 Bde.; 2. Aufl. 1878), die jedoch bei vielen geistreichen Einzelheiten reizlos in der Form wurden. Eine Sammlung seiner »Schriften« hatte G. schon früh begonnen (Frankf. a. M. 1845–56, 13 Bde.); später erschien eine die gesamte Tätigkeit des Autors in sich fassende Ausgabe: »Gesammelte Werke« (Jena 1873–78, 12 Bde.; 2. Serie: »Dramatische Werke«, 20 Bdchn., davon die 4. Gesamtausgabe 1899 ff.); die »Meisterdramen« gab Eug. Wolff (Berl. 1902) mit Einleitung heraus. Vgl. Joh. Prölß, Das junge Deutschland (Stuttg. 1892); F. Wehl, Zeit und Menschen (Altona 1889); K. Frenzel, Erinnerungen und Strömungen (Leipz. 1890); Adolf Stern, Zur Literatur der Gegenwart (das. 1880); Houben, Studien über die Dramen K. Gutzkows (Jena 1899) und G.-Funde (Berl. 1901); Caplmann, K. Gutzkows Stellung zu den religiös-ethischen Problemen seiner Zeit (Augsb. 1900); F. Dresch, G. et la jeune Allemagne (Par. 1904).
Berlin—Panorama einer Weltstadt
I. "Weltstadt"—Panorama
Café Stehely (1831)
Ob man bei Stehely einen Begriff von der Verberlinerung der Literatur bekommen kann—ganz gewiß, oder man müßte sich täuschen in dieser stummen Bewegungssprache, die einen Haufen von Zeitschriften mit wilder Begier und neidischem Blick zusammenträgt, ihn mit der Linken sichert und mit der Rechten eine nach der andern vor die starren, teilnahmslosen Gesichtszüge hält. Die Eisenstange und das Schloß des Journals scheint mit schwerer Gewalt auch seine Zunge zu fesseln—wer würde hier seinen Nachbar auf eine interessante Notiz aufmerksam machen? Ein feindliches Heer könnte eine Meile von Berlin entfernt sein, kein Mensch würde die Geschichte vortragen, man würde auf den Druck warten und auch dann noch ein Exemplar durch aller Hände wandern lassen—fast in der Weise, wie in Stralow die honetten Leute vor jeder lebhafteren Gruppe vorbeigehen mit dem tröstenden Zuruf, man würd' es ja morgen gedruckt lesen.
Stehelys Besucher bilden natürlich zwei Klassen, die Jungen und die Alten, mit der näheren Bezeichnung, daß die Jungen ans Alter, die Alten an die Jugend denken. Jene sind Literaten in der guten Hoffnung, einst sich so zu sehen, wie man jetzt die Klassiker sieht, weihrauchumnebelt; diese sind Beamte, alte Offiziers, die in einem Atem von den politischen Stellungen des preußischen Staats, den Füßen der Elsler, den Koloraturen der Sontag, dem Spiel der Schechner sprechen! Nichts Unerbaulicheres! Vor dem Gespräch dieser alten Gecken möchte man sich die Ohren zuhalten, oder in die einsamere Klause des letzten Zimmers flüchten. Schon wenn sie angestiegen kommen, zumal jetzt im Winter; diese dummen, loyalen Gesichter, diese Socken und Pelzschuhe, deren Tritt nicht das leiseste Ohr erspähen könnte. Triumphierend rufen sie um die "Staatszeitung", forschen nach den privatoffiziellen Erklärungen eines H., v. R., v. Wsn. Hierauf lesen sie die Berliner Korrespondenzen in der "Allgemeinen Zeitung", die ja wohl der Ausdruck der Berliner öffentlichen Meinung, als wenn es eine solche gäbe, sein sollen, und wenn sie sich dann noch an den logischen Demonstrationen der Mitteilungen aus der "Posener Zeitung" gestärkt haben, fallen sie übers Theater her und man muß sie verlassen. Ihnen am nächsten stehen einige langgestreckte Gardeleutnants und Referendare, die sich dadurch unterscheiden, daß die einen viel sprechen und wenig denken, die andern wenig denken und viel sprechen. Diese geben den Übergang zu den schon vorhin bezeichneten Jüngeren, auf die wir unten des breiteren zurückkommen müssen.
Es fehlt hier also durchaus nicht an den Mitteln und Elementen, sich ein Bild der Berlinerei vorzuführen. Man verlasse das Lokal und bei jeder Aussicht wird man für sein Bild noch immer treffendere und bezeichnendere Züge finden. Sogleich die Ansicht einer Kirche, die außerdem, daß sie eine Kirche ist, auch keine ist. Wie ein Luftball, der unten einen Fallschirm zur Sicherheit trägt, erhebt sich die stolze Vorderseite dieses Domes, leere Steinmassen und hohler Prunk, und hinten dann das geschmackloseste Anhängsel einer kappenförmigen Kuppel, die doch das Wahre an dem ganzen Lärm ist in ihrer sonntäglichen Bestimmung. Wiederum vom Opernplatz aus furchtbare Steinmassen, Urkunden des Ungeschmacks aus dem 16ten und 17ten Säkulum, Hunderte von Fenstern erinnern an die Zeiten der Aufklärung und der Illuminaten, die kahlen Kulturversuche finden sich wieder in diesen leeren Wänden, die sich ohne Unterbrechung 80-90 Fuß in die Höhe glätten. Gilt dies freilich mehr gegen eine vergangene Zeit, so hält es doch nicht schwer, das alles wiederzufinden in der Galanteriewarenmanier der neuesten Bauten, wo der Ernst nur ein übertünchter ist …
Cholera in Berlin (1831)
… Im gegenwärtigen Augenblick beschäftigt uns am meisten die seit dem ersten d. M. hier wirklich angekommene Cholera: Auf der Frankfurter Journalière erwartet und auf die Kontumazanstalt verwiesen, hat sie einen anderen Weg genommen, durch den Finowkanal. Die näheren Umstände des ersten Cholerafalles sind in der Tat tragikomisch, der Schluß fast balladenartig. An die Möglichkeit, daß die Cholera nach Charlottenburg (eine halbe Meile von Berlin) käme, hatte man nicht gedacht, der Hof hatte sich im dortigen Schlosse absperren wollen und eine Anzahl Proviantwagen war schon dahin abgegangen. Da erscholl plötzlich von dorther die Kunde von einem an der Cholera gestorbenen Schiffer. Polizeibeamte und die wachslinnenen, steifen Harnischmänner, die zur Wartung der Cholerakranken eigens errichtete Garde, eilen hinaus und in dem stolzen Bewußtsein, im Kampfe die ersten zu sein, tun sie sich ein wenig zu Gute. Der Tote wird eingesargt, und des Nachts sollen ihn die Wärter auf einem Kahne vom Schiffe abholen; doch am andern Morgen erfuhr man, daß bis auf einen ans Ufer getriebenen Mann alle untergegangen, und die Fischer bei Spandau einen Sarg im Netze gefangen hatten. Da nun dieser mit der Spree in Berührung gekommen ist, will man weder Fische noch Krebse essen. Jene Proviantwagen sind auch wieder zurückgekehrt, und soviel man weiß, wird sich der König auf die Pfaueninsel bei Potsdam begeben.
Der erste Erkrankungsfall in Berlin selbst war der eines Schiffers, gerade in der Mitte der Stadt. Bis jetzt sollen 29 erkrankt und 21 gestorben sein. Man klagt über die Mutlosigkeit und Unbeholfenheit der hiesigen Ärzte: Wir hatten gehofft, erfahrene Männer aus den infizierten Gegenden hieher gezogen zu sehen; doch ist von einer solchen Sorgfalt noch nichts bekannt geworden. Die öffentliche Stimmung ist bis jetzt noch so ziemlich gemäßigt, doch sind Vergnügungsörter gegenwärtig weniger besucht, und das Raffen nach Präservativen, Leibbinden, Harzpflastern ist allgemein; Dienstboten werden entlassen, manche Nahrungszweige stocken gänzlich. Es lassen sich die Folgen des kommenden Elends noch nicht berechnen.
Alte Bauten—neue Bauten (1832)
… In den langweiligen Zeiten der Restauration, vor den militärischen Rüstungen und den Verheerungen der Cholera, waren die Kassen des Staats reicher gefüllt als gegenwärtig. Berlin war in zunehmender Verschönerung begriffen; die Aufführung vieler öffentlicher Gebäude ließ ebensosehr den Geschmack bewundern, in dem sie angelegt und vollendet wurden, als die Vorsicht loben, die einem großen Teile unserer Proletairs eine reichliche Nahrungsquelle sicherte. Diese Baulust ging damals auch auf Privatleute über, deren Geld und Unternehmungsgeist Berlin um ein prachtvoll gebautes Stadtquartier vergrößerte. Aber auch von dieser Seite stehen alle Plane gegenwärtig still. Die beiden öffentlichen Bauten, an die in diesem Augenblick allein gedacht wird, sind die völlige Umgestaltung des sogenannten Packhofes, eines Stapelplatzes und Warenlagers für die ankommenden Kaufmannsgüter, und ein künftiger Neubau der Bauakademie. Wer in Berlin gewesen ist, weiß, daß er, um vom Schloßplatze nach der Jägerstraße zu kommen, sich durch die lebhafteste, aber zugleich auch engste Passage, die Werderschen Mühlen, die Schleusenbrücken, die Verbindung unserer Alt- und Neustadt, durchwinden muß. Später wird diese unbequeme Gegend gelichtet werden. Dicht an der genannten Brücke wird rechts ein freier Platz beginnen, der die Aussicht nach dem Packhofgebäude und der Werderschen Kirche frei macht. Gewinnen werden bei einem solchen Projekt die Besitzer jenes Häuserwinkels von der Niederlagstraße bis zur Brücke, verlieren aber muß die kleine, winzige Werdersche Kirche, deren Unbedeutendheit bei einer großartigern und freiern Umgebung nur deutlicher hervortreten wird.
Der Bau der obengenannten Akademie hat noch nicht begonnen, aber es kann auch noch lang mit ihm anstehen, da der gegenwärtige Zustand dieses Instituts einen so bedeutenden Kostenaufwand nicht vergilt. Diese einst so blühende Anstalt ist gegenwärtig durch die Eröffnung neuer Provinzialbauschulen und die Gewerbeakademie, die sich unter der Leitung des Hrn. Beuth, unsers künftigen Handels- und Gewerbeministers, immer mehr hebt, in die tiefste Zerrüttung gesunken, so daß die Zahl der an ihr angestellten Lehrer der der Schüler gleichkommen mag. Darum bleibt vielleicht dieses Bauprojekt einstweilen noch unausgeführt….
Dom, Schauspielhaus—"Sechserbrücke" (1840)
Von meiner Wohnung aus ist mir ein Blick auf die Umgebungen des Schlosses gewährt, auf eine Überfülle von großen Gebäuden, die die Gegend von dem Anfang der Linden bis zum Dom zu einem der merkwürdigsten Plätze Europas machen. Störten mich nur nicht am Dom die beiden Zwillingsableger des großen Turms! Neben einer großen Kuppel, die schon an sich unwesentlich ist, da sie für das Innere der Kirche gar keinen Wert hat, sondern nur als bloße architektonische Verzierung dient, haben sich noch zwei kleine Schwalbennester wie zwei Major-Epauletts niedergelassen. Man hatte dabei wahrscheinlich die Isaakskirche in Petersburg vor Augen; aber dort gehören diese kleinen Türme zum Kultus, indem sie auf einzelne Kapellen Licht fallen lassen, sie sind so zahlreich bei den russischen Kirchen angebracht, daß sie schon dadurch etwas für die dortige heilige Architektur Wesentliches vorstellen. Hier in Berlin, wo man so viel Russisches in der Politik und den Militäruniformen nachahmte, wollte man auch der Hauptkirche der Stadt eine russische Perspektive geben und Schinkel war schwach genug, die beiden kleinen Vogelbauer neben den größern Turm der Kirche zwecklos und unschön hinzustellen. Überhaupt würden die Gebäude der Residenz mehr künstlerischen Wert haben, wenn Schinkel, ein so reicher, erfinderischer, sinniger Kopf, jenen echten Künstlerstolz besäße, der ihn verhindert hätte, Änderungen seiner ursprünglichen Baupläne hinzunehmen. Eine höhere Hand, deren Munifizenz allerdings ruhmvoll anerkannt werden muß, strich ihm bei vielen seiner vorgelegten Baupläne meist immer das Charakteristische und Kecke weg. Alles Hohe, Hinausspringende, Hinausragende (z.B. dreist aufschießende Türme an den Kirchen) wird von einem an sich ganz achtbaren, aber in Kunstsachen unbequemen Sinn für das Bequeme, Bescheidene, Zurückhaltende weggewünscht. Es ist nicht rühmlich für Schinkel, daß er bei seinen zahlreichen Baugrundrissen dem Künstlerstolz so viel vergeben hat.
Schinkel hat in seinen geistvoll geschriebenen Erläuterungen zu seinen Bauten auch alle die Umstände angeführt, die ihn bewogen, dem Schauspielhause seine jetzige Gestalt zu geben. Wenn an einem öffentlichen Gebäude die Fassade nicht einmal als Ein- und Ausgang benutzt wird, wenn man auf einer großen Freitreppe Gras wachsen sieht, so regt sich unwillkürlich das Gefühl, das Unbenutzte auch für eine Überladung zu halten. Doch mögen die Kenner über den äußern architektonischen Wert des Schauspielhauses entscheiden! Das Innere dieses Theaters, wiederum nicht ausgehend von der speziellen Ansicht Schinkels, hat ganz jenen gedrückten Miniatur- und Privatcharakter, den ein Haus, das früher Nationaltheater hieß, nicht haben sollte. Es wäre vielleicht nicht nötig gewesen, dies Theater größer, als für 1200 Menschen zu bauen; aber warum dieser wunderliche Charakter der Isolierung in der Anlage des Ganzen? Ein Rang ist dem andern unsichtbar. Das Parterre und die Parkettlogen sehen nichts von den Rängen. Man weiß an einer Stelle des Hauses nicht, ob es an der andern besetzt ist. Eine Übersicht des Ganzen ist nur auf dem Proszenium und Podium möglich, so daß man, um zu wissen, ob das Haus besetzt war, die Schauspieler fragen muß. Jedenfalls geht durch dieses Privatliche, das dem Hause aufgedrückt ist, zweierlei verloren. Einmal eine größere gesellschaftliche Annehmlichkeit. Da sich das ganze Publikum nicht beisammen sieht, da der eine dem Auge des andern entzogen ist, so fällt der Charakter einer geselligen Zusammenkunft, der so oft für eine schlechte Vorstellung Ersatz geben könnte, in diesem Theater gänzlich weg. Man kann Bruder und Schwester im Theater haben und sieht sie nicht. Das zweite Unangenehme dieser winkeligen Bauart ist, daß sich das Publikum nicht als solches bildet. Publikum heißt eine Masse, die sich ihrer Kraft ansichtig ist und das Bewußtsein einer Korporation dem Spiel gegenüber zu behaupten weiß. Wo man im Parterre nicht sehen kann, welche Mienen der zweite Rang macht, wo ein Besucher des Theaters nur immer auf den Rücken des andern angewiesen ist, da kann auch keine Totalität des Urteils stattfinden; jeder ist auf sich angewiesen und der Schauspieler bleibt ohne die richtige Würdigung seiner Leistung. Mir haben viele Schauspieler gesagt, daß Berlin kein Publikum mehr hat. Der Grund liegt darin, daß die Lokalität dieses Publikum verhindert, sich als solches kennenzulernen und auszubilden….
Noch eine Bemerkung will ich hier machen. Von meinem Gasthofe führt eine Brücke auf den Schloßplatz. Diese Passage ist nur für ein kleines Brückengeld gestattet, welches von einer Gesellschaft, die diese Verbindung auf eigene Kosten anlegte, erhoben wird. Jeder Bürgerliche zahlt am Ende der Brücke eine Kleinigkeit. Das Militär ist frei. Warum? Ich denke, weil die gemeinen Soldaten in Berlin herumzuschlendern pflegen und von der Bedeutung dieses Brückengeldes schwerlich eine Vorstellung haben. Es würde ein ewiges Zurückweisen sein, Händel geben und deshalb läßt man Soldaten frei passieren. Wie aber nun die Offiziere? Wird man nicht annehmen, daß diese eine so kleine Vergünstigung verschmähen und mit echtem point d'honneur da nicht frei vorübergehen werden, wo eben eine arme alte Frau oder ein Handwerker seinen Sechser bezahlt? Nein, ein General geht mit einem Bürgerlichen hinüber: Der Bürgerliche bezahlt, der General nicht. Ich denke nun jeden Morgen und Abend nach, wie ein so achtbarer, auf das Feinste seines Ehrgefühls wahrender Stand, das preußische Garde-Offizier-Korps, sich daran gewöhnen kann, von einer winzigen Steuer, die ihm allerdings erlassen ist, sich so loszusagen, daß er in der Tat von jener Vergünstigung Gebrauch macht. Wär' ich Offizier, ich würde es für beleidigend halten, wollte man mir zumuten, von einer Steuer dieser Art, die den Ärmsten trifft, mich zu befreien.
Ich schließe daraus, wie wenig das, was wir Ehre nennen, doch als etwas Ursprüngliches im Menschen ausgebildet ist; denn sehen wir hier nicht, daß eine in diesem Punkte sehr zartfühlende Menschenklasse dennoch in einer Ehrensache ganz von der Sitte und der Gewöhnung abhängen kann und wie leicht wir über etwas, das sich der Einzelne nicht gestatten würde, hinweggehen, wenn es von allen angenommen wird?
Blumenausstellung in Stralow (1840)
Was rennt das Volk? Was strömt es durch die Gassen? Alles eilt hinaus in die Gegend des lieblichen Stralow: In die Blumenausstellung, nach dem Hyazinthen-Flor. Eine halbe Stunde mußt' ich mit meinem Wagen Queue machen, eh' ich vor dem Eingang zu Faust und Moewes aussteigen konnte. Schon aus weiter Entfernung, mehre Straßen vorher, riecht man die von Hyazinthen parfümierte Luft. Tausende von Menschen drängen sich in großen, feldähnlichen Gärten und bewundern ungeheure Anlagen von Hyazinthenbeeten, die auf den Effekt hin gepflanzt sind, sich in den buntesten Schattierungen ablösen, ja sogar große, riesige Figuren zu bilden, z.B. einen Floratempel, ein "eisernes Kreuz" und dergleichen Zusammenstellungen. In Harlem können nicht größere Blumenmassen beisammenstehen. Indessen gerade dies Holländische ist abstoßend. Man wird gegen den Reiz der Blumen unempfindlich, wenn man sie in Massen versammelt sieht. Nun gar zur Bildung von allerhand Symbolen mißbraucht, hat die Blume nur noch den Wert der Farbe, und das Freie, Selbständige, das Duftige derselben geht mit dieser Bestimmung verloren.
Hier sind meine Berliner recht in ihrem Element. Eine Anlage ohne Schatten schreckt sie bei der glühendsten Hitze nicht ab. Ein dumpfes Musikgedudel nennen sie musikalische Unterhaltung. Vorn an der Kasse zieht man ein Los, zahlt dafür 5 Silbergroschen und gewinnt gewöhnlich nur einen Strauß, den man auf dem Gensdarmenmarkt für 4 Pfennige kauft. Was ließe sich unter dem Titel "Die Blumenverlosung" nicht für eine hübsche Lokalposse schreiben. Hier laufen in Berlin soviel "volkswitzige" Schriftsteller herum, warum erfinden diese Leute nicht dergleichen Späße für die Königsstädter Bühne? Herr Glaßbrenner schreibt kleine Broschüren, worin er Berliner sogenannte Volkscharaktere sich im geschraubtesten und gemeinsten Berliner Jargon über das Hundertste und Tausendste unterhalten läßt; nein; auf der Bühne, im sinnigen Arrangement solcher Lokalscherze bewährt sich der Beruf zum Volksschriftsteller. Beckmann z.B. ist ein so willkommnes Menschengerüst, auf welches man die drolligsten Erfindungen hängen kann. In der Blumenverlosung denk ich mir ihn mit der grünen Gärtnerschürze am Eingang eines Treibhauses und die Gewinste austeilend. Er entfaltet die Nummer: "Sie erhalten, Madame, einen kleinen Ableger einer neuerfundenen Pflanze, die erst kürzlich auf der Pfaueninsel entdeckt und aus Amerika hier eingeführt wurde." Die Dame sagt: "Mein Gott, das ist ja nichts als eine Maiblume mit einem Salatblatt." Darauf müßte Beckmann replizieren und seine botanischen Kenntnisse entwickeln. Zum Schluß könnte durch die Blume noch eine Heirat zustande kommen. Warum schreibt Herr Cerf keine Konkurrenzpreise aus?
Notizen (1841)
Ein Pietist Unter den Linden
Nach einigen sehr staubigen, schwülen Tagen hatte es endlich geregnet. Der schönste Sonntagmorgen lockte unabsehbare Menschenscharen unter die Linden. Am Palais des verstorbenen Königs tritt mich ein Mann mit einem Orden im Knopfloche an: "Schönes Wetter." "Schönes Wetter." "Das macht Gott mit einem Wort. Unser Menschenwitz hätte das nicht machen können." "Schwerlich." "Und der Herr ist allerwegs mächtig und groß ist sein Name, ja groß in Ewigkeit." "Amen!" Der Fremde begann hierauf mit kräftiger Stimme und vielem Redetalent eine Auseinandersetzung über die angeborne Sündhaftigkeit des Menschen. Da ich ruhig und fast teilnahmslos neben dem mir gänzlich unbekannten Manne herging, frug er mich mit fast zorniger Ungeduld: "Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen?" "Vollkommen!" "Halten Sie mich für einen Schwärmer?" "Ich höre den Lärm, sehe aber kein Licht." Diese Antwort von dem schlichten Spaziergänger war dem Bekehrer unerwartet. Er sah mich groß an und ging. Zu Hause fand ich in der Rocktasche einen Bußtraktat. (Gedruckt bei Wohlgemuth.)
Die Kandidaten der vakanten Ämter
Einen rührend-komischen Anblick gewährt an jedem Morgen in den ersten Frühstunden ein Spaziergang durch die oberen Linden und die Wilhelmstraße bis zur Leipziger Straße hin. Das ist nämlich die Zeit, wo die Kandidaten aller vakanten und nicht vakanten Ämter, die Kandidaten aus allen möglichen geistlichen, Schul-, Justiz- und Regierungsfächern den mächtigen Ministern und Räten ihre Aufwartung machen. Schwarz gekleidet, mit weißer Binde um den Hals, schießen sie an dir vorüber, plötzlich stehen sie still, überlegen eine erhaltene Antwort oder ein zu stellendes Gesuch, probieren die eingelernte Rede noch einmal, nähern sich der verhängnisvollen Tür, haben nicht das Herz, kehren noch einmal um, um sich zu erholen, und wagen es erst dann mit einem mutigen Entschluß. Andere wollen eben von der Rechten an die Tür eines Hotels treten, da begegnet ihnen ein anderer von der Linken. Und doch ist nur eine Stelle vakant! Jeder bildet sich ein, so früh zu kommen, daß er den mächtigen Mann, der sie vergibt, allein trifft, aber—entsetzliche Täuschung—schon ist das ganze Vorzimmer gefüllt und die eine Lebensfrage, auf deren Lösung eine seit sieben Jahren verlobte Braut und ein nachgerade ungeduldig werdendes Schwiegerelternpaar harrt, verschwimmt in den Lebensfragen von dreißig anderen Menschen, in den Hoffnungen von ebensoviel anderweitigen Bräuten! Geöffnet ist hier die geheime Werkstatt unserer Existenz, offen liegen sie da, die Gruben und Gänge, die der Fuchs oft schneller durchgräbt, als der still arbeitende Bergmann—ein Anblick, zugleich komisch und zum Weinen!
Sommertheater in Steglitz