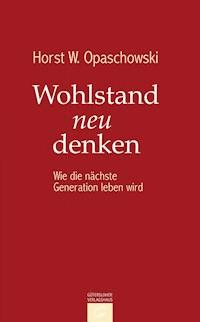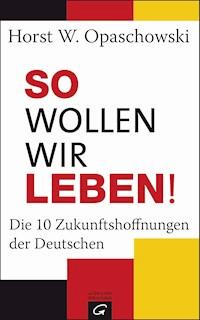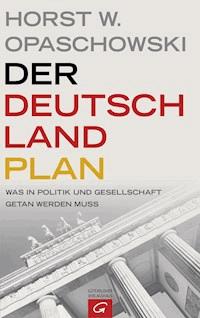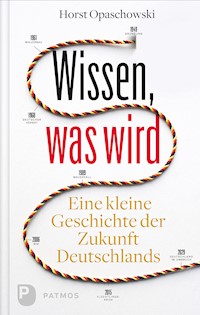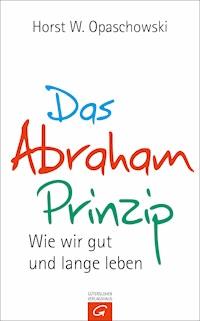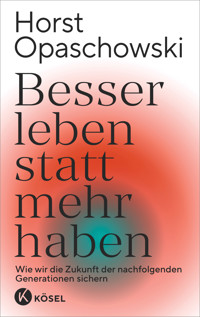
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Die Chance für einen Neubeginn: »Ein Wandel vom Waren-Wohlstand zum wahren Wohlstand zeichnet sich ab«
Wirtschaftliches Wachstum gilt heute als Gradmesser für gesellschaftlichen Fortschritt, für Wohlstand und Zufriedenheit. Doch gerade in unsicheren Zeiten leidet die Konsumlaune und
materielle Werte treten zunehmend hinter der Frage zurück, was wirklich zählt im Leben. Wenn unsere Mentalität des »immer-mehr« an Bedeutung verliert, müssen wir uns nach nachhaltigeren Bezugsgrößen für ein besseres Leben umsehen: Jetzt muss das immaterielle Wohlstandsniveau wiederentdeckt werden.
›Mr. Zukunft‹, Prof. Dr. Horst Opaschowski, skizziert anhand seiner aktuellsten Studien ein zukunftsfähiges Fortschrittskonzept, in dessen Zentrum wieder das persönliche und soziale Wohlergehen steht. Eine vom Wunsch nach besserem Leben geleitete Wertehierarchie, die auch kontrovers diskutierte Themen wie bedingungsloses Grundeinkommen, soziales Pflichtjahr oder Arbeiten im Alter aufgreift.
Als einer der wohl renommiertesten Zukunftsforscher entwirft dieser ›neue Opaschowski‹ sein Generationenvermächtnis, seine Vision für eine sinnerfüllte gesellschaftliche Zukunft – und zeigt auch, was auf dem Spiel steht, wenn sich nichts ändert. Denn »Wohlstandssteigerung ohne Steigerung der Lebensqualität darf nicht als sozialer Fortschritt gelten.«
- Das Generationenvermächtnis von Zukunftspapst Horst Opaschowski
- Ganz nah am Lebensgefühl und unserer drängendsten Perspektivfrage: Was macht gutes Leben für uns aus?
- Für Leser*innen von Matthias Horx, Daniel Dettling oder Maja Göpel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 228
Ähnliche
Über das Buch:
Wir sehen wirtschaftliches Wachstum gerne als Gradmesser für Wohlstand und Zufriedenheit, doch gerade in unsicheren Zeiten treten materielle Werte zunehmend hinter der Frage zurück, was wirklich zählt im Leben.
In seinem neuesten Buch skizziert Prof. Dr. Horst Opaschowski seine Vision für eine sinnerfüllte gesellschaftliche Zukunft, in deren Zentrum wieder das persönliche und soziale Wohlergehen steht. Ein starker Appell, der auch kontroverse Themen wie bedingungsloses Grundeinkommen, soziales Pflichtjahr oder Arbeiten im Alter neu diskutiert und aufzeigt, was auf dem Spiel steht, wenn sich nichts ändert.
Das große Generationenvermächtnis des renommierten Zukunftsforschers.
Über den Autor:
Prof. Dr. Horst Opaschowski, geboren 1941, ist Publizist, berät Wirtschaft und Politik und lehrte über 30 Jahre an der Universität Hamburg. In Kooperation mit dem IPSOS-Institut erstellt der von der Presse auch »Mr. Zukunft« genannte Wissenschaftler seit 2012 regelmäßig den Nationalen WohlstandsIndex für Deutschland (NAWI-D). 2014 gründete er das Opaschowski Institut für Zukunftsforschung, das sich die Entwicklung von wertorientierten Konzepten zur Förderung von Wohlstand und Lebensqualität auch für die nachkommenden Generationen zur Aufgabe macht.
Horst Opaschowski
Besser lebenstattmehr haben
Wie wir die Zukunft der nachfolgenden Generationen sichern
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © 2023 Kösel-Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlag: zero-media.net, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-29963-7V001
www.koesel.de
Inhalt
Vorwort
Ganz nah am Lebensgefühl:
Die Welt im Wandel – der Mensch im Mittelpunkt
BESSERLEBENWOLLEN
Vom Waren-Wohlstand zum wahren Wohlstand
Das neue Wohlstandsdenken
Wege aus der Krise:
Was wirklich zählt im Leben
Wende zum Weniger:
Abschied vom Immer-Mehr
Die »fetten Jahre« sind vorbei:
Wohlstand neu denken
Nationaler Wohlstandslndex für Deutschland (NAWI-D):
Das Vier-Säulen-Modell als Fortschrittsmaßstab
»Ich vermisse nichts«:
Höherwertiges zählt mehr als Materielles
Wandel der Konsummoral:
Die neuen Wertsucher
Eine bessere Gesellschaft schaffen – wollen!
Mehr Solidarität in der direkten Demokratie
Warum wir besser leben – müssen!
Deutschland zukunftsfest machen
ÖKONOMISCHERWOHLSTAND
Für die Erhaltung des Lebensstandards
Von der Vorsorge bis zur Versorgung
Die Deutschen werden ärmer:
Wachsende Sorgen um die persönliche wirtschaftliche Lage
Die ungleiche Verteilung des Wohlstands:
Die Kluft zwischen Arm und Reich wird größer
Wohnungsnot eskaliert in Krisenzeiten:
Immer weniger bezahlbarer Wohnraum in Stadt und Land
Leistung so wichtig wie Gegenleistung:
Das Grundeinkommen bleibt eine soziale Utopie
Mehr Zeit zum Leben:
Zeit wird so wertvoll wie Geld
Die Flexirente auf freiwilliger Basis:
Sicherung des Wohlergehens in einer Gesellschaft des langen Lebens
Gemeinwohlökonomie als Zukunftsaufgabe:
Wirtschaft weiter denken
GESELLSCHAFTLICHERWOHLSTAND
Für ein besseres Miteinander
Frei und in Frieden leben
»Einigkeit und Recht und Freiheit« sind keine Glücksgarantie mehr:
Sicherheit wird so wichtig wie Freiheit
Zukunftsrisiko I:
Hass, Hetze und Gewaltbereitschaft
Zukunftsrisiko II:
Kontaktarmut, Einsamkeit und Pflegebedürftigkeit
Gefährdung des sozialen Friedens:
Der Sozialstaat muss sich bewähren
Gemeinsamkeit als soziale Dividende:
Hilfsbereitschaft wächst in der Krise
Anwender-Demokratie:
Engagement bekommt Erlebnischarakter
Junge Generation befürwortet soziales Pflichtjahr:
Anzeichen für eine neue Ära der Verantwortung
ÖKOLOGISCHERWOHLSTAND
Für eine bessere Umweltqualität
Naturnah und nachhaltig leben
Der Klimawandel als größte Bedrohung:
Abschied vom »Feindbild Umwelt«
Grenzen des Naturerlebens:
Die Natur versteht keinen Spaß
»Travel« und »Travail«:
Mobilität als Lebensprinzip
Kluft zwischen Moral und Verhalten:
Der lange Weg »zur guten Gewohnheit«
Konzepte für die Mobilität von morgen:
Nahverkehrspolitik neu denken
Umweltbewusst leben:
Vom Umweltdenken zur ökologischen Lebensweise
Klimaschutz zur Herzenssache machen:
Die emotionale Verankerung ist unverzichtbar
INDIVIDUELLERWOHLSTAND
Für eine bessere Lebensqualität
Gesund und ohne Zukunftsängste leben
Das Wunschbild von Ruhe und Geborgenheit:
Die nahe Zukunft ist angstbesetzt
Gesundheit gilt als höchstes Gut:
Der Megamarkt der Zukunft
Die Familie hält die Gesellschaft zusammen:
Die Wagenburg des 21.Jahrhunderts
Freunde und Nachbarn werden zur zweiten Familie:
Soziale Konvois als lebenslange Begleiter
Work-Life-Balance wird Wirklichkeit:
Digitalisierungsschub in der Arbeitswelt
Ehrlichkeit führt die Wertehierarchie an:
Leben in der Verantwortungsgesellschaft
Vertrauen wird die neue soziale Währung:
Die Basis für den Zusammenhalt
MEINGENERATIONENVERMÄCHTNIS
Für eine bessere Zukunft
Was ich aus fünfzig Jahren Forschung gelernt habe
Wird es nie wieder so werden, wie es war?
Die ewige Wiederkehr des Gleichen
Politikberatung vom Kanzleramt bis zum Schloss Bellevue:
Aufzeigen möglicher Lösungswege
»Wir hoffen, Sie behalten recht«:
Szenarien über die Lebens- und Arbeitswelt von morgen
»Take it or leave it«:
Die Hälfte der Ökonomie ist Psychologie
Vorausschauend vorbereitet sein:
Nie war ein Nein so Zukunft!
Nachwort
Dank
Quellenverzeichnis
Für Elke, mit der meine Zukunft begann
»Es ist nicht unsere Aufgabe, die Zukunft vorauszusagen, sondern auf sie gut vorbereitet zu sein.«
Perikles (um 490 – 429 v.Chr.),Politiker und Staatsmann in Athen
Vorwort
»Wirtschaftswachstum ist das Ergebnis der Anstrengungen der Menschen, es besser zu machen als bisher.«1
Ganz nah am Lebensgefühl:Die Welt im Wandel – der Mensch im Mittelpunkt
Von Voltaire stammt die Aussage: »Le mieux est l’ennemi du bien«2(»Das Bessere ist des Guten Feind«). Das Gute muss weichen, wenn etwas Besseres möglich ist. Dies kann nur der Anspruch sein: Gut ist nicht gut genug. Lasst uns besser werden! Dies lässt sich auch historisch begründen und belegen. 1798 stellte Immanuel Kant erstmals die Frage: »Welchen Ertrag wird der Fortschritt zum Besseren dem Menschengeschlecht abwerfen?«3 Er bezog sich dabei auf Jean-Jacques Rousseau4, für den »progrès« zur »notre véritable félicité«, also zur wahren Glückseligkeit beitragen sollte. Rousseau war seinerzeit nicht der Erfinder, wohl aber der erste Kritiker der Fortschrittsidee. Seither gelten technologische, ökonomische und gesellschaftliche Errungenschaften nur noch dann als Fortschritt, wenn sie das Leben besser machen helfen.
Eine solche Option eint die Deutschen derzeit bei der aktuellen Bewältigung permanenter Krisen: »Besser leben statt mehr haben ist ein erstrebenswertes Lebensziel«, sagt die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung mit wachsender Tendenz. Der Wunsch nach einem besseren Leben ist das Gefühl der Stunde in anhaltend unsicheren Zeiten – verbunden mit der Vorstellung »Weniger ist mehr«. Was verbirgt sich hinter diesem Wunschdenken? Eine vorübergehende Realitätsflucht oder eine grundlegende Verhaltensänderung in Richtung auf eine bessere Zukunft für sich und kommende Generationen?
In mehreren Befragungswellen habe ich im Rahmen meiner Grundlagenforschung im OIZ/Opaschowski Institut für Zukunftsforschung in den Jahren 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 repräsentativ jeweils 1000 Personen ab 14 Jahren in Deutschland mit gleichlautenden Fragestellungen nach ihrem persönlichen und sozialen Wohlergehen befragt. Die Ergebnisse sind ein Spiegelbild der Gefühls- und Lebenslage der Deutschen im Zeitverlauf der letzten Jahre.5 Sie zeigen empirisch nachweisbare Veränderungen in den Einstellungen und Verhaltensweisen der Menschen »vor« und »in« der Krise. Die in diesem Buch dargestellten Aussagen sind mehrheitsfähig, weil ihnen – repräsentativ ermittelt – jeweils eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland zustimmt. Negativ betrachtet ist auf diese Weise eine Art Risikomonitor entstanden, positiv gesehen ein Chancenmonitor für die Zukunft. Die Befragten sagen, wie sie trotz bzw. nach der Krise leben wollen.
Doch wie verlässlich können solche Aussagen und Prognosen sein? Um es deutlich zu machen: Aufgabe der Zukunftsforschung ist es nicht, die Zukunft präzise vorauszusagen, sondern auf mögliche Zukünfte gut vorzubereiten. Im Jahr 2004 veröffentlichte ich beispielsweise die Zukunftsstudie Deutschland 2020. Darin wurde prognostiziert dass um 2020 zwei Lebenskonzepte dominieren werden: Erstens das gesundheitsorientierte Lebenskonzept, in dem Gesundheit als das wichtigste Lebensgut angesehen wird, und zweitens das sozialorientierte Lebenskonzept, in dem Partnerschaft, Familie und Kinder wieder mehr zum Lebensmittelpunkt werden.6 Das waren positive Zukunftsprognosen aus der Sicht von 2004.
Zugleich aber wurden auch mögliche negative Szenarien (»worst cases«) aufgezeigt, die aus der Sicht von damals »ziemlich unwahrscheinlich« waren, aber »weitreichende Folgen für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft haben können – wenn sie eintreten«.7 Dazu zählte ich seinerzeit unter anderem »Krieg als Außenpolitik: das Ende der Diplomatie«, »Klimawandel wie Überschwemmungen, Erdbeben und Vulkanausbrüche« sowie die »Verseuchung der Erde durch Bakterien und Viren«.
Inzwischen ist es tatsächlich so weit: Krieg, Klimawandel und Pandemie halten und haben uns voll im Griff. Die Folgen bleiben nicht aus.
Zusätzlich und zeitgleich führe ich seit 2012 gemeinsam mit dem Ipsos-Institut den Nationalen Wohlstandsindex für Deutschland (NAWI-D) durch.8 Jeweils in den Monaten März, Juni, September und Dezember werden 2000 Personen ab 14 Jahren je Erhebungswelle befragt. Die Datenerhebung erfolgt mittels persönlicher Interviews in den Zielhaushalten. Ipsos ist weltweit die Nummer drei in der Marktforschungsbranche mit mehr als 18.000 Mitarbeitern in neunzig Ländern. Auf diese Weise werden auf breiter Ebene die Meinungen und Motivationen der Bevölkerung erforscht. In Deutschland sind rund sechshundert Mitarbeiter in den sechs Standorten Hamburg, Mölln, Berlin, Frankfurt, Nürnberg und München aktiv, die den Interviewerstamm betreuen.
Die Befragten machen bei den Interviews konkrete Angaben zu ihrem subjektiv empfundenen Wohlergehen. Dazu gehören nicht nur wirtschaftliche Faktoren wie Arbeitsplatz- und Einkommenssicherheit. Auch individuelle, gesellschaftliche und ökologische Faktoren fließen in die persönliche Gesamtbewertung mit ein. So erklärt sich ein Anspruch dieser Zukunftsstudie: Ganz nah am Lebensgefühl der Menschen – in Vorkrisenzeiten genauso wie in Krisenzeiten. Und je länger die Krisenzeiten anhalten, desto nachhaltiger wird der Einstellungswandel zum Lebenswandel werden.
Wenn nicht anders vermerkt (zum Beispiel bei Jahresvergleichen mit Vor-Coronazeiten), beziehen sich die angegebenen Prozentzahlen auf die OIZ-Repräsentativumfragen im Zeitraum von 2019 bis 2023, schließen also Vor-Coronazeit und Ukrainekrieg mit ein. In dieser Zeit hat eine neue Ära der Wohlstandsentwicklung in Deutschland und der Welt begonnen. Seit Kriegsbeginn sind wir nach den Worten von Außenministerin Annalena Baerbock »in einer anderen Welt aufgewacht«, was Bundeskanzler Olaf Scholz drei Tage nach Russlands Überfall auf die Ukraine eine »Zeitenwende« nannte.
Wird die Zeitenwende zur Wohlstandswende? Wohlstandswende muss keineswegs Wohlstandsverlust bedeuten, kann auch eine Wende zum Besseren sein. Während in der modernen Trendforschung ein Sound der Hoffnungslosigkeit vorherrscht und eine Epidemie des Zynismus beschrieben wird, die angeblich in der Bevölkerung eine »Angst vor besseren Optionen«9 entstehen lässt, bleibt für die wissenschaftliche Zukunftsforschung das »Prinzip Hoffnung« (Ernst Bloch)10 fundamental: die Pflicht zum (Zukunfts-)Optimismus. Die Menschen wollen und fordern es so. Insbesondere die junge Generation im Alter bis zu 24 Jahren meldet nach den OIZ-Erhebungen positiven Zukunftshunger an: »Ich wünsche mir mehr Optimismus in unserer Gesellschaft.« 93 Prozent der jungen Generation haben Lust auf Zukunft. Mehr geht wirklich nicht. Zukunft ist ein anderes Wort für Hoffnung. Die Jugend wird zum wichtigsten Hoffnungsträger.
Horst Opaschowski
BESSERLEBENWOLLEN
Vom Waren-Wohlstand zum wahren WohlstandDas neue Wohlstandsdenken
Frühe Forderung aus den Siebzigerjahren
»Das faszinierte Starren auf die durch Arbeit und Fleiß hervorgebrachten Wachstumsraten hat uns für nicht-ökonomische Wertvorstellungen blind gemacht. Wir müssen jetzt genug Phantasie und vor allem Mut aufbringen, um die weitere gesellschaftliche Entwicklung qualitativ zu steuern. Die ausschließliche Konzentration auf Wachstumssteigerung und die Einführung technischer Neuerungen sind abzulehnen, wenn schwerwiegende sozial und ökologisch nachteilige Folgen zu erwarten sind.«11
Wege aus der Krise:
Was wirklich zählt im Leben
Als ich diese Zeilen 1974 im Rahmen eines »Plädoyers für eine Neubewertung von Arbeit und Freizeit« schrieb, befand sich Deutschland inmitten eines Wertewandels.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte es hierzulande einen schnellen wirtschaftlichen Aufschwung gegeben, der bis etwa 1972/73 andauerte, lediglich unterbrochen von einer Rezession im Jahr 1967. Beginnend mit den Studentenprotesten der 1968er-Jahre, bildeten sich neue soziale Bewegungen, die sich auf alle Bereiche des gesellschaftlichen wie politischen Lebens auswirkten. Hinzu kam die sogenannte Ölkrise, die bereits im Jahr 1973 die Abhängigkeit der Industriestaaten vom Erdöl aufzeigte und eine Wirtschaftskrise sowie steigende Arbeitslosigkeit nach sich zog. Ein herber Schlag für das deutsche Wirtschaftswunder, das, wie jedes wirtschaftliche Wachstum, gerne als Gradmesser für Wohlstand und Zufriedenheit angesehen wurde. Doch wie in Krisen üblich, treten materielle Werte nach einer Phase der Angst und Unsicherheit zunehmend in den Hintergrund. Die Menschen beschäftigen sich damit, was wirklich im Leben zählt.
Angesichts einer neuerlichen Krisensituation der 2020er-Jahre stellt sich die Frage: Zeigen wir heute vergleichbare Reaktionsweisen wie die Generationen vor uns in Kriegs- und Nachkriegszeiten? Wird es nach dem Nachkriegsboom in naher Zukunft einen Nachkrisenboom geben, eine Art zweites Wirtschaftswunder? Wird mit dem allmählichen Abebben der Krisenangst in Deutschland das Tor zu einem wirtschaftlichen und auch gesellschaftlichen Neubeginn weit aufgestoßen? Kommt nach der Ebbe die Flut?
Als Zukunftsforscher kann ich keine Kriege und globalen Konflikte voraussagen, wohl aber Erkenntnisse liefern, wie Menschen auf Krisen und kritische Ereignisse reagieren. Es gibt psychologisch begründbare Grundsätze menschlichen Verhaltens – von Alltagsritualen bis zu statistisch erfassbaren Regelmäßigkeiten.
Unbestritten prägen solche Erfahrungen die Menschen auf lange Zeit und manchmal auch ein ganzes Leben. Werden also die jungen Menschen, die während der Coronakrise, der Ukrainekrise und der Energiekrise aufwachsen, zu einer neuen »Generation Krise« oder »Postkrise« – wie die Kriegs- und Nachkriegsgenerationen nach 1945 auch, die nachweislich lebensprägende Krisenerfahrungen gemacht und mit Notzeiten zu leben gelernt haben?
Wende zum Weniger:
Abschied vom Immer-Mehr
Die Zweifel am Immer-Mehr, am Konsum als Indikator für ein gutes, gelingendes Leben, haben weltweit eine lange Geschichte. Sie leben in den permanenten Krisenzeiten der letzten Jahre neu und heftig wieder auf. Erinnert sei an Robert F. Kennedys historische Rede vom 18.März 1968 in der Universität von Kansas.12 Darin kritisierte er die gedankenlose Anhäufung materieller Werte zulasten der Gemeinschaftswerte (»community values«) und auch der persönlichen Vervollkommnung (»personal excellence«). Luftverschmutzung, Gefängnisse, Atomsprengköpfe und Panzerwagen erhöhen nachweislich das Bruttonationaleinkommen, das alles misst – außer dem, was das Leben lebenswert macht, wie Kennedy hervorhob.
Auch in Deutschland gilt das Bruttoinlandsprodukt (BIP) weiterhin als Maßstab für Wohlstand und Lebensqualität, obwohl es mittlerweile veraltet und zu einseitig materiell fixiert ist: Ressourcenverbrauch und Artensterben bleiben ausgeblendet, das Wohlergehen der Bürger auch. Eine solche Betrachtungsweise spiegelt mehr Bürgerferne als Bürgernähe wider. Schließlich ist aus der Sozialforschung seit Jahren bekannt, dass »Bürger und Politiker in völlig unterschiedlichen Wertewelten leben«13: Politiker präferieren vor dem Hintergrund des bereits angesprochenen sozialen Wandels Werte wie Toleranz und Gerechtigkeit. Bürger finden hingegen persönliche Freundschaften und Lebenstugenden wie Ehrlichkeit und Verlässlichkeit besonders wichtig. Die Bürger denken an mitmenschliche Nähe und Emotionalität, die Politiker mehr an gesellschaftliche Anforderungen und Vernunft. Kurz: Die Bürger fühlen, die Politiker fordern.
Die Bezugssysteme und Wertehierarchien beider Gruppen sind alles andere als deckungsgleich. So kann es nicht weiter verwundern, dass in regierungsamtlichen Verlautbarungen Werte wie »Nachhaltigkeit« und »ökologischer Fußabdruck«, »soziale Integration« und »politische Partizipation« favorisiert werden. Das subjektive Wohlergehen und die Zufriedenheit der Menschen scheinen dagegen fast zweitrangig zu sein.
Robert F. Kennedy konnte sich seinerzeit noch auf den amerikanischen Nationalökonomen John Kenneth Galbraith mit seinem Buch Die moderne Industriegesellschaft14 stützen, wonach die qualitativen Aspekte des Lebens im Wettlauf um die Produktivitätssteigerung verloren zu gehen drohten. Die Unwirtlichkeit der Industriegesellschaften und Industriestädte seien die unausweichliche Folge. Bildhaft formulierte Galbraith die Konsequenzen: Der letzte Wohlstandsbürger, im Verkehrsstau an Abgasdämpfen erstickend, werde vom vorletzten Bürger noch die frohe Nachricht erhalten, dass das Bruttosozialprodukt wieder um fünf Prozent gestiegen sei.
Zehn Jahre später untersuchte der amerikanische Ökonom R. A. Easterlin in seiner intertemporalen Studie »Does Economic Growth Improve the Human Lot?«15 den Zusammenhang von Einkommen und Glück bzw. Lebensstandard und Lebensqualität. In dem seither nach ihm benannten Easterlin-Paradox wurde nach Vergleichen in neunzehn Ländern im Zeitraum von 1946 bis 1970 der Nachweis erbracht, dass die Lebenszufriedenheit trotz steigender Einkommen nicht gewachsen sei. 2010 wiederholte er die Untersuchung in siebenunddreißig Ländern – und kam zum selben Ergebnis.16
Ebenfalls in den Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts ging der Ökonom Tibor Scitovsky in seiner Veröffentlichung The Joyless Economy17 einer Frage nach, die bis dahin nicht als Bestandteil der Wirtschaftswissenschaft galt. Scitovsky versuchte das Verbraucherverhalten und dessen Motivation zu erklären und schrieb eine erste »Psychologie des Wohlstands«. Auch er kam zu dem Ergebnis, dass im Zeitvergleich von fünfundzwanzig Jahren das Pro-Kopf-Einkommen teilweise zweistellige Zuwächse aufwies, die Lebenszufriedenheit der Menschen sich aber nicht verbessert hatte.
Zugleich räumte er mit dem Irrglauben auf, dass Einkommen gut und mehr Einkommen besser sei. Ganz selbstverständlich hatten bis dahin Wirtschaftswissenschaftler einen höheren Lebensstandard mit einem höheren Maß an Lebenszufriedenheit gleichgesetzt. Ein grundlegendes Missverständnis. Denn was glücklich und zufrieden macht, ist zunächst nur subjektiv erklärbar – vergleichbar mit der angenehmen Innentemperatur eines Raumes, die eine höchst subjektive Empfindung ist. Auch eine Begründung dafür, warum die Gewährung individueller Sicherheit und Sorglosigkeit »teuer« sein kann – je nachdem, welchen »Preis« man für das subjektive Wohlbefinden zu zahlen bereit ist.
Erfahrungsgemäß wird zu wenig Neues schnell als langweilig empfunden. Andererseits kann zu viel Neues verwirrend und zu viel des Guten schlecht sein. Die größte Zufriedenheit liegt zwischen den Extremen des Zuviel und des Zuwenig. Auf die aktuelle Wohlstandsdiskussion bezogen, bedeutet dies: Ständige Lebensstandardsteigerungen zerstören auf Dauer die Hierarchie der Lebensfreuden. Die Wirtschaftswissenschaft hat bisher zu wenig zur Kenntnis genommen, was seit jeher die wichtigste Antriebskraft menschlichen Verhaltens ist: Das Streben nach neuen Dingen und Ideen ist der »Ursprung allen Fortschritts«18 – in der Gesellschaft genauso wie im ganz persönlichen Leben. Wer im Leben nicht mehr neu-gierig ist, wird alt. Dies gilt auch für die Gesellschaft als Ganzes.
Werfen wir einen Blick zurück: Im biblischen Verständnis und aus jüdisch-christlicher Sicht geht es bei Wohlstand in erster Linie um das individuelle Wohlergehen – und zwar physisch im Sinne von Gesundheit und psychisch im Sinne von Lebensglück. Wer gesund und glücklich lebt, ist nach der biblischen Verheißung im »gelobten Land« angekommen. Die materielle Dimension im Sinne von Geld und Gütern ist zwar für Glück und Gesundheit förderlich, hat aber keinen Eigenwert: »Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon« (Matthäus 6,24). Die bloße Gier nach Geld lässt Gottes- und Nächstenliebe verkümmern.
Es ist schon bemerkenswert: Das deutsche Wort »Wohlstand« fand erst im 16.Jahrhundert weite Verbreitung. Es hatte seinerzeit eine dreifache Bedeutung, wie das Deutsche Wörterbuch der Gebrüder Grimm seit 1854 nachweist:
Erstens hieß »in Wohlstand leben« so viel wie »gut und glücklich leben«. Gemeint war das ganz persönliche Wohlergehen (»wenn es uns nach wunsch und willen gadt«).
Zweitens war Wohlstand ein Synonym für Gesundheit und körperliches Wohlbefinden: Wer im besten Wohlstand lebte, war bei bester Gesundheit. Gesundsein galt als höchstes Lebensgut.
Drittens wurde Wohlstand auch moralisch im Sinne von Anstand bewertet: Was wohl der Sitte entsprach. »Wohlständigkeit« rückte in die Nähe von Ehrbarkeit und Tugendhaftigkeit. Man achtete es »für eine ehre und wolstandt«, sich nach den Regeln der Höflichkeit zu verhalten.
Erst im 18. und 19.Jahrhundert kam es zu einer Bedeutungsverengung des Wohlstandsbegriffs. Weil man das Gutgehen von Menschen nicht selten schon an Äußerlichkeiten erkennen konnte – wie zum Beispiel an der Kleidung, der Wohnungseinrichtung oder der Größe des Hauses –, wurde daraus abgeleitet: Wer so leben kann, muss einfach »wohlhabend« sein, also über Geld und Güter verfügen. Diese auf das Materiell-Wirtschaftliche verengte Sichtweise hat sich seither durchgesetzt und die physischen, psychischen und moralischen Aspekte weitgehend in den Hintergrund gedrängt oder vergessen gemacht.
So entstand im 20.Jahrhundert der Begriff Wohlstandsgesellschaft. Er bezeichnete eine Gesellschaft, die den Bürgern die Befriedigung materieller Bedürfnisse ermöglichte, die weit über dem Existenzminimum lagen. Es ging um Konsum, auch um Geltungs- und Erlebniskonsum, und schloss Luxusgüter mit ein. Werbeagenturen agierten zugleich erfolgreich nach dem Grundsatz: Für uns fängt der Mensch beim Konsumenten an! Das war nachvollziehbar, denn davon lebten sie, während Probleme wie Arbeitslosigkeit und soziale Ungerechtigkeit weitgehend ausgeblendet blieben. Bis zur Jahrhundertwende vom 20. zum 21.Jahrhundert definierte die Brockhaus Enzyklopädie noch ganz selbstverständlich Wohlstand als »die Verfügungsmöglichkeit einer Person, einer Gruppe oder einer Gesellschaft über wirtschaftliche Güter«. Wohlstand war gleichbedeutend mit gehobenem Lebensstandard oder großem Reichtum. Das Wohlstandsniveau wurde nur in Geldwerten und Einkommensgrößen »gemessen«.19
2006 stellte ich im Rahmen meiner Grundlagenforschung am BAT Freizeit-Forschungsinstitut erstmals das dominante ökonomische Wohlstandsmodell in Deutschland infrage. Im Rahmen einer Repräsentativumfrage von 2000 Personen ab 14 Jahre konnte ich nachweisen, dass emotional-soziale Indikatoren das bestimmende Bezugsmuster für das Wohlstandsverständnis der Deutschen sind:
Keine Zukunftsängste haben (78 Prozent)In Frieden leben können (72 Prozent)Sich frei fühlen (68 Prozent)Keine Sorgen haben (67 Prozent)Glücklich sein (67 Prozent)Das tun können, was ich will (64 Prozent)Gute Freunde haben (64 Prozent)Viel Zeit haben (63 Prozent)In einer toleranten Welt leben (61 Prozent)Stressfrei leben (61 Prozent).Hingegen hatte das materiell-monetäre Argument »Viel Geld haben/reich sein« nur für eine Minderheit der Bevölkerung (46 Prozent) eine große Bedeutung.
Das Um- und Neudenken begann also bei den Deutschen schon nach der Jahrtausendwende – blieb aber in Wirtschaft und Politik weitgehend unbeachtet und folgenlos. Meine Forderung »Wohlstand neu denken«20 mündete seinerzeit in die offene Frage: Lernt die nächste Generation, »mit weniger materiellem Wohlstand genauso gut und glücklich zu leben – inmitten starker Familien, verlässlicher Generationenbeziehungen und nachbarschaftlicher Netzwerke«? Ich hielt den Traum von einem »guten Leben« und einer »besseren Welt« durchaus für zukunftsfähig. In einer krisengeschüttelten Gegenwart werde die nächste Generation weiterhin das Beste aus ihrem Leben machen wollen. Die nächste Generation, so war meine Hoffnung, werde lernen müssen, weniger zu haben und bescheidener zu leben. Da stehen wir heute.
Die Krisenzeit wird zur Chance für einen Neubeginn. Mit überwältigender Mehrheit sprechen sich die Deutschen während der Pandemie und des Ukrainekriegs für einen grundlegenden Wandel des Lebens aus. Sie wollen Ernst machen mit dem Abschied vom Immer-Mehr. Die Bevölkerung ist davon überzeugt:
»Besser leben statt mehr haben wird in Zukunft ein erstrebenswertes Lebensziel.«
(2021: 76 Prozent - 2023: 77 Prozent)
Die Menschen erwarten einen Neubeginn:
Vom Waren-Wohlstand zum wahren Wohlstand
Weitgehend deckungsgleich ist das Votum der Generationen. Der sich ankündigende Einstellungswandel ist für die 14- bis 34-Jährigen genauso relevant wie für die 55 plus-Generationen (je 76 Prozent Zustimmung). Auch bei den einzelnen Bildungsschichten sind kaum Unterschiede erkennbar. Bei Hauptschulabsolventen ist die Bereitschaft zur Änderung des Lebensstil fast ebenso hoch (78 Prozent) wie bei den Befragten mit Abitur und Universitätsabschluss (79 Prozent). Der Wunsch, anders, also besser zu leben, eint die Bevölkerungsmehrheit.
Nach der Pandemie, so die Hoffnung der Deutschen, soll alles anders werden. Für fast zwei Drittel der Bevölkerung (62 Prozent) ist nach den OIZ-Repräsentativumfragen die persönliche Zukunft mit guten Vorsätzen versehen: »Nach der Krise werde ich anders leben.« Dabei soll das persönliche Glückserleben eine zentrale Rolle spielen. Die Bevölkerung sagt auch ganz konkret, was sie unter »anders leben« versteht: »Mehr Momente des Glücks wahrnehmen und genießen«, was wohl im Vor-Krisen-Stress zu kurz gekommen ist. Frauen (65 Prozent) denken darüber ernsthafter nach als Männer (58 Prozent). Das Umdenken hat mittlerweile auf breiter Ebene begonnen. Knapp drei Viertel der Bevölkerung (72 Prozent) geben offen zu, während der Krise »öfter über mich und mein Leben nachgedacht« zu haben. Aus dem Nachdenken heute kann morgen ein Vorausdenken für verändertes Handeln in Zukunft werden.
Die »fetten Jahre« sind vorbei:
Wohlstand neu denken
Nach dem gemeinsam mit dem Ipsos-Institut durchgeführten Nationalen Wohlstandslndex für Deutschland (NAWI-D)21 in den Jahren 2012 bis 2023 ist Wohlstand für die Deutschen mittlerweile ein Synonym für den Wert, angstfrei, glücklich und gesund zu leben. Im Wohlstandsvergleich ist beispielsweise feststellbar: Je mehr Menschen im Haushalt zusammenwohnen, desto glücklicher und gesünder fühlen sie sich. Nur jeder dritte Alleinlebende (33 Prozent) kann von sich sagen: »Ich bin glücklich«; das Glücksgefühl liegt bei Vier-Personen-Haushalten deutlich höher (57 Prozent). Auch bei der Aussage »Ich fühle mich gesund« rangieren Singles (43 Prozent) hinter einer Vier-Personen-Familie (65 Prozent).
NAWI-D weist nach, dass das Wohlstandserleben maßgeblich die Zufriedenheit von Menschen beeinflusst. Wer den Ursachen wachsender Unzufriedenheit (und damit auch Politikverdrossenheit) auf den Grund gehen will, muss das Wohlergehen des Landes und der Menschen fördern. Nur so kann Wohlstandspolitik zu einer Wohlergehenspolitik werden, in deren Zentrum die Förderung von Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität steht.
Dies erklärt auch, warum der individuelle Wohlstand so hoch bewertet wird: Die Bundesbürger wollen keine Angst vor der Zukunft haben. Gesundheit gilt dabei als höchstes Lebensgut. Unabhängig von bestehenden oder drohenden Krankheiten will sich die Mehrheit der Bevölkerung subjektiv gesund fühlen. Dazu allerdings muss sie sich auch eine gute medizinische Versorgung leisten können. Ein verlässliches und bezahlbares Gesundheitssystem trägt wesentlich zum Wohlergehen der Bevölkerung bei. Die Chance, sich gesund fühlen zu können, stellt für die Deutschen den größten individuellen Wohlstand dar. Das ist Lebensqualität (und nicht nur Lebensstandard). Das ist gesellschaftlicher Fortschritt (und nicht nur wirtschaftliches Wachstum).
Im Vergleich zum ökonomischen, gesellschaftlichen und individuellen Wohlstandserleben führt der ökologische Wohlstand beinahe ein Schattendasein. Die Umweltpolitik hat es bisher versäumt, den Begriff »Nachhaltigkeit« positiv mit Zukunftsdenken im Sinne von Vorausschau und Vorsorge zu umschreiben. Stattdessen erscheinen ökologische Belange den Bürgern meist als bedrohliche Szenarien: Der Wald stirbt. Die Klimakatastrophe kommt. Die Welt geht unter. Hinter der Aufforderung zur Nachhaltigkeit stehen Drohungen mit fast apokalyptischem Charakter. Es fehlt zuweilen eine emotionale Nähe. Während beispielsweise Mobilität und Fahrspaß vielen Menschen geradezu am Herzen liegen, spricht die Umweltpolitik eher von »unnützem Hin- und Herfahren« oder naturzerstörerischen Folgen. Hier laufen Gefühls- und Verstandesebenen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen aneinander vorbei.
In diesem Zusammenhang ist Wachstum auch kein Selbstzweck, sondern ein Fortschrittsinstrument, um Wohlstand und Lebensqualität für die Menschen und das Land zu erreichen. Es soll dazu verhelfen, besser zu leben als bisher. Das Wachstum verlagert sich im 21.Jahrhundert zusehends auf immaterielle Bereiche wie Gesundheit und soziale Sicherheit, die genauso wichtig werden wie die Ansammlung von Geld- und Vermögenswerten. Die Verbesserung der persönlichen Lebensqualität der Bevölkerung steht auf der gesellschaftlichen Tagesordnung, weil weitere materielle Wohlstandssteigerungen im Sinne von Immer-Mehr den Menschen immer weniger möglich erscheinen.
Die Wirtschaft mag in Zukunft weiter wachsen: Doch Wohlstand und Wohlergehen stellen sich für die Bürger erst dann ein, wenn die Frage »Wie und wovon sollen wir in Zukunft leben?« glaubwürdig und zufriedenstellend beantwortet wird. Im ganzheitlichen Wohlstandsdenken der Bevölkerung greifen einseitig quantitative Wachstumsversprechen zu kurz.
Denn: Arbeitsplatzgarantien werden tendenziell wichtiger als Einkommenserhöhungen. Eine lebensstandardsichernde Rente mit 67 zählt mehr als ein Vorruhestandsleben mit 58 an der Armutsgrenze. Und das garantierte Recht auf Meinungsfreiheit trägt mehr zur Lebensqualitätsverbesserung bei als die bloße Steigerung und Erfüllung materieller Wünsche.
Die Wohlstandsgesellschaft entlässt die nächste Generation in eine relativ unsichere Zukunft. Noch vor zehn Jahren hatte der Ökonom Bert Rürup den Deutschen »fette Jahre« vorausgesagt und Deutschland eine »glänzende Zukunft« versprochen.22 Doch die Entwicklung ist ganz anders verlaufen. Die Wohlstandswende ist im Lebensalltag der Bevölkerung angekommen. Die Wohlfahrtsbedingungen ändern sich grundlegend. Die Menschen spüren dies, zugespitzt in der Erkenntnis: Die fetten Jahre sind vorbei – das Schlaraffenland ist abgebrannt. Der Traum vom materiellen Immer-Mehr ist für die meisten Deutschen ausgeträumt. Nicht einmal ein Drittel der Bevölkerung kann sich nach dem NAWI-D »materielle Wünsche erfüllen« (29 Prozent) oder gar »alle Reiseträume erfüllen« (29 Prozent).
Bereits vor Corona zeichnete sich ab: Für die junge Generation ist es in Zukunft viel schwieriger, ebenso abgesichert und im Wohlstand zu leben wie die heutige Elterngeneration. Vor allem das Lager der »gefühlten« Wohlstandsverlierer wird größer. Selbst Wohlhabende fühlen sich als Wohlstandsverlierer. Das subjektive Gefühl breitet sich aus: Die Zeiten im warmen Bad des Wohlstands sind bald vorbei.
Die Folgerung für die internationale Wohlstandsforschung lautet seither: Wenn die menschlichen Grundbedürfnisse (»basics«) befriedigt sind, führt mehr materieller Wohlstand nicht zu mehr Glück (»happiness«), nicht zu mehr Lebenszufriedenheit (»life satisfaction«) und nicht zu mehr subjektivem Wohlbefinden (»subjective well-being«). Die Bevölkerung setzt neue Prioritäten des Lebens. In diesen Priorisierungen sind nach wie vor ökonomische Aspekte dominant – allerdings inhaltlich ganz anders begründet. Es geht nicht mehr um das Immer-Mehr: Die Deutschen wollen in unsicheren Zeiten auf Nummer sicher gehen. Sie wollen ihren erarbeiteten, verdienten und erworbenen Wohlstand in Sicherheit bringen und sich gegen Lebensrisiken absichern – vom gesicherten Arbeitsplatz über das sichere Einkommen bis zur sicheren Rente. Wohlstand im 21.Jahrhundert hat seine »Luxus«-Komponente weitgehend verloren. Wohlhabend ist, wer sicher, sorgenfrei und ohne Zukunftsangst leben kann.
Frauen und Männer leben dabei laut Umfragen (NAWI