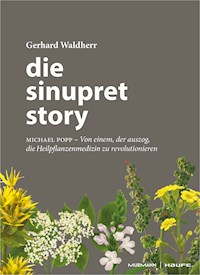21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Kräne für die Zukunft Es begleitet uns in allen Lebenslagen, vom ersten bis zum letzten Moment unseres Daseins: Bauen bestimmt unsere Lebensqualität, Wirtschaftsleistung und Zukunftsfähigkeit. Wohnen, Mobilität, Energiewende, Klimaschutz, Bildung, Wissenschaft, Freizeit, Entertainment – alle relevanten Themen dieser Zeit sind damit verbunden. Dennoch löst Bauen oft Kritik und Widerstand aus. Das Image der Branche ist ambivalent. Warum der Bau und sein Beitrag zu unserer Zukunft mehr Begeisterung verdient hat, erzählt dieses Buch. Es enthält Geschichten über große Projekte, spannende Innovationen und die Menschen dahinter. Und einen Exkurs über den Werkstoff des Jahrhunderts, ohne den nichts möglich wäre: Beton.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 293
Ähnliche
Gerhard Waldherr
Beton und Bytes
Gerhard Waldherr
Beton und Bytes
Wie Bauen das Fundament für unsere Zukunft schafft
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
1. Auflage 2021
© 2021 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
D-80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Dieses Buch entstand mit Unterstützung des Vereins für Bauforschung und Berufsbildung des Bayerischen Bauindustrieverbandes e.V. (BBIV), 80331 München, aus Mitteln der Stiftung Bayerisches Baugewerbe.
Projektmanagement und Lektorat: Evelyn Boos-Körner, Schondorf am Ammersee
Umschlaggestaltung: Karina Braun, München; Daniel Schwaiger, München
Umschlagabbildung: Ryzhi/ Shutterstock
Satz: Helmut Schaffer, Hofheim a. T.
Druck: Florjancic Tisk d.o.o., Slowenien
eBook by tool-e-byte
ISBN Print 978-3-86881-825-3
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96267-275-1
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96267-276-8
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.redline-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhalt
PrologBaustelle Deutschland
1 Bauwelten
BauwirtschaftEin besonderer Markt (von Thomas Bauer)
StraßeDie Mobilitätsoffensive
SchieneMit Milliarden aus der Krise
EnergiewendeDie Zukunftswerkstatt
Best PracticeOperieren im Grenzbereich
WohnungsbauVier Wände zum Glück
GewerbebauDas Erfolgssystem
DigitalisierungWahrheit, Probleme, Prognosen (von Mathias Obergrießer)
2 Beton
Graues GoldVon Zement bis CO2
InspirationDas Wunder von Blaibach
InnovationCarbon, Poren, Bakterien
3 Baugeschichten
UnternehmerMit Herz und Verstand
IngenieureBaumeister 2.0
ArchitektenVision und Widerspruch
AusbildungBerufe mit Zukunft
HandwerkGut gemacht
BürokratieDie Schreibstubenherrschaft
PolitikWissen wohin
ImageZeigt euch! (von Philip Beushausen und Rebekka Csizmazia)
EpilogWir können auch anders
Über den Autor
Bauunternehmerfamilie Geiger mit Josef Geiger (2. v. l. oben)
Foto: Geiger Unternehmensgruppe
PrologBaustelle Deutschland
Es steckt in allem, es begleitet uns überall, jeden Tag, in jedem Moment. Bauen bestimmt Lebensqualität, Wirtschaftsleistung und Zukunftsfähigkeit jeder Gesellschaft. Das macht die Bauwirtschaft zu einer der wichtigsten Branchen des Landes.
Wer die Bauwirtschaft verstehen will, muss ins Allgäu, genauer nach Oberstdorf in die Wilhelm-Geiger-Straße 1. Dort steht ein mit Holz verkleidetes, ellipsenförmiges Bürogebäude, das von Weitem aussieht wie ein Ufo: der Firmensitz der Geiger Unternehmensgruppe. Der Parkplatz davor ist vollgestellt mit Steinkörben, das Panorama dahinter grandios. Die Berge ringsum heißen Nebelhorn, Fellhorn, Rubihorn und Söllereck, zu ihren Füßen liegen die legendären Skischanzen am Schattenberg.
In einem Konferenzsaal im dritten Stock sitzt Josef Geiger und schwärmt vom Bauen. Von der Faszination, die jeder aus dem Sandkasten kenne. »Jedes Kind hämmert gern«, sagt Geiger, »jedes Kind möchte mal auf einer Straßenwalze sitzen.« Stimmt schon, wer stand nicht hypnotisiert am Bauzaun, während der Bagger baggerte und gleichzeitig spekuliert wurde, wohin der Mann im Kran wohl geht, wenn er mal muss? Und als der Betonmischer kam, lief die halbe Nachbarschaft zusammen und guckte. Zwei Drittel aller Deutschen halten Haus- und Straßenbau für eine typisch deutsche Eigenschaft, was erklärt, warum die Baumärkte am Samstagvormittag zuverlässig überfüllt sind. Respekt, wer’s selber macht.
Unten im Foyer hängen Ölgemälde. Eines zeigt einen Mann mit markantem Gesicht und Trachtenhut: Wilhelm Geiger, der Firmengründer. Daneben Gemälde seiner drei Söhne, die nach dessen Tod 1968 die Geschäfte übernahmen. Josef Geiger verkörpert die dritte Generation. Er trat 1990 in die Geschäftsleitung ein und vergrößerte, diversifizierte und modernisierte das Unternehmen zusammen mit seinen Cousins Pius und Johannes. 2018 gab er die Geschäftsführung und seine Gesellschaftsanteile an Sohn Josef ab. Seither fungiert er als Beiratsvorsitzender. Pius und Johannes Geigers Söhne werden demnächst folgen. Was die vierte Generation mitbringen muss? »Ein Bauunternehmer«, sagt Geiger, »muss soziale und kaufmännische Fähigkeiten haben, er braucht technisches Verständnis, muss die Vorschriften kennen, stressresistent und krisenfest sein, er muss marktorientiert denken und die Zeichen der Zeit verstehen.«
Wilhelm Geiger begann 1923 mit einer Holzhandlung und einem Fuhrwerksbetrieb. Nach und nach kamen Kohlehandel, Brennstoffhandel, Kies- und Betonwerke und beinahe alle Disziplinen des Baugeschäfts dazu: Hochbau, Tiefbau, Straßenbau, sogar ein Reiseunternehmen wurde zwischenzeitlich geführt. Heute hat die Geiger Unternehmensgruppe 50 Standorte in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Frankreich, Italien, Ungarn und Rumänien, 43 Tochterfirmen und Beteiligungen. Mit 3.000 Mitarbeitern macht sie in den Geschäftsbereichen Baustoffe und Logistik, Immobilien, Infrastruktur und Umwelt mit Liefern, Bauen, Sanieren und Entsorgen etwa 600 Millionen Euro Umsatz. Tendenz steigend, passend zu einem ihrer Leitsätze: »Besser sein. Geiger.« Wenngleich Josef Geiger sagt, Geld sei nie sein Motiv gewesen: »Ich wäre auch ohne die Familie Bauingenieur geworden, Bauen ist die schönste Beschäftigung der Welt.«
Das ist die Geschichte. Bauen steckt in jedem. Bauen bleibt ein Leben lang. Und es ist – wie bei der Geiger Unternehmensgruppe – ein weites Feld. Mit dem Unterschied, dass die meisten von uns es nicht aktiv betreiben. Umgeben sind wir trotzdem davon, besser von den Ergebnissen. Rund um die Uhr. In den Wohnungen, in denen wir leben. In den Büros und Fabriken, in denen wir arbeiten. Auf den Wegen, die wir dazwischen benutzen, und den Einrichtungen, in denen wir unsere Freizeit verbringen. Bauen ist überall, beim Einkauf, bei jedem Amüsement und Toilettengang. Vom Kreißsaal bis zur Leichenhalle ist der Mensch umgeben von Bauwerken. Wo kein Bauen ist, lässt sich nicht leben.
Bauwerke und Infrastrukturen entscheiden über die Lebensqualität von Menschen, die Leistungsfähigkeit von Volkswirtschaften und deren Zukunftsfähigkeit. Kein Volk demonstrierte das eindrucksvoller als die Römer, deren Imperium auf einer Bautechnik basierte, die das moderne Betonieren vorwegnahm und aus dem sich das Wort Zement ableitet: Opus Caementitium. Investitionen in die Bauwirtschaft sind aber nicht nur die Basis für Prosperität und Macht, sie definieren Gesellschaften und Zeitalter. Die Pharaonen wären nicht denkbar ohne Pyramiden, New York nicht ohne Wolkenkratzer, Dubai nicht ohne Burj Khalifa und Palm Island und Deutschland nicht ohne Autobahn. Wer Golden Gate und Gotthard hört, denkt nicht zuletzt an San Francisco und einen Tunnel, und bei Eiffel ist es ganz sicher nicht Wuppertal.
Bauen prägt und verändert die Welt. Aber auch umgekehrt. Die Bevölkerungsentwicklung der Welt beeinflusst den Wohnungsbau, die Urbanisierung erfordert neue Mobilitätskonzepte. Der demografische Wandel verlangt nach seniorengerechten Unterkünften, der Klimawandel nach Anlagen, die nachhaltige Energie produzieren, und womöglich schon bald nach Deichen gegen den steigenden Meeresspiegel. Die Digitalisierung wiederum hat dafür gesorgt, dass auf dem Bau zunehmend mit 3D-Modellen, Drohnen und mobilen Endgeräten in Baumaschinen gearbeitet wird. Dass die Geiger Unternehmensgruppe Anfang der Neunzigerjahre in die Umwelttechnik investierte, etwa die Beseitigung von Altlasten und die Verwertung von mineralischen Abfällen, hatte mit der wachsenden Bedeutung des Umweltschutzes zu tun. Neues Denken schafft neue Märkte. »Alle gesellschaftlich relevanten Themen«, sagt Josef Geiger, »sind Bauthemen.«
Deshalb wird die Bauwirtschaft gerade hierzulande dringend gebraucht. »Bröckelland« titelte Die Zeit vor einigen Jahren. Die Berliner tageszeitung ätzte: »Dieses Land ist unmodern.« Berechtigte Klagen. Laut einer internationalen Studie sind die Straßen in Namibia oder Malaysia nicht schlechter als in Deutschland. 10.000 Kilometer Autobahn sind in schlechter bis sehr schlechter Verfassung. Jede dritte Brücke an Bundesfernstraßen muss renoviert werden. Gleiches gilt für 2.000 Eisenbahnbrücken, dazu fehlen 1.800 Kilometer Schiene und 1.900 Weichen. Allein in Bayern müssen jährlich 2.000 Kilometer Kanalisation saniert werden. Der Süden der Republik wartet auf Stromtrassen für nachhaltige Energie aus Windparks in der Nordsee und Ostdeutschland. Der Ausbau des 5G-Netzes ist überfällig. Und in Großstädten fehlen zwei Millionen Wohnungen, vor allem bezahlbarer Wohnraum.
Doch das ist längst nicht alles. Insbesondere bei den Kommunen ist der Investitionsrückstand in den letzten Jahrzehnten dramatisch angewachsen. Schulen, Krankenhäuser und Behörden sind veraltet. Auf dem Land fehlt es an Öffentlichem Personennahverkehr. »Um Deutschland zukunftsfähig zu halten und grundlegend zu modernisieren, ist die öffentliche Hand gefordert, verstärkt in Bau und Infrastruktur zu investieren«, schreibt Claus Michelsen in einer Studie des Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Die Politik hat in den vergangenen Jahren reagiert: mit der Reformkommission Bau von Großprojekten, mit dem Bundesverkehrswegeplan 2030 und einer neuen Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) für die Bahn. Zig Milliarden werden in den nächsten zehn Jahren in die Infrastruktur fließen. Geiger, der als Präsident des Bayerischen Bauindustrieverbandes die Details gut kennt, meint: »Selten war das Verständnis auf beiden Seiten größer, dass jetzt nur noch eines hilft: den Investitionshochlauf für die nächsten Jahrzehnte zu sichern.«
Das deutsche Bauhauptgewerbe machte 2020 mit etwa 900.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 150 Milliarden Euro, was etwa sechs Prozent der Bruttowertschöpfung des Landes entspricht. Das liegt in etwa in der Größenordnung der Lebensmittelindustrie und dem Inlandsumsatz der Automobilindustrie. Ein Fünftel dieses Umsatzes wird in Bayern erwirtschaftet, zusammen mit Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg deckt Bayern ein Drittel des Bauvolumens ab. Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern kommen zusammen auf etwa ein Zehntel, was auch damit zu tun hat, dass auf ostdeutsche Bundesländer und Gemeinden entsprechend geringe Investitionen entfallen.
Bauen ist in Deutschland immer noch ein regionales Geschäft. Wer sich in Flensburg ein Haus bauen will, sucht nicht nach einem Bauunternehmen im Schwarzwald, auch nicht für einen Wohnblock. Die nötige Expertise findet sich auch vor der Haustüre. Schließlich ist Bauen in Deutschland eine Domäne der Familienbetriebe und Mittelständler, die sich immer noch gerne über Werte definieren.
Die Geiger Unternehmensgruppe hat sich acht Leitsätze verordnet. Die ersten drei lauten: »Mensch sein. Fair sein. Partner sein.« Im Allgäu gilt noch der Handschlag. Im Unternehmensverbund werden aktuell 85 junge Menschen in 22 Berufen und drei dualen Studiengängen ausgebildet. Wer einmal bei Geiger landet und will, kann sein ganzes Erwerbsleben lang bleiben. Mehrfach gab es für Geiger die Auszeichnung Great Place to Work.1
Das Institut für Demoskopie Allensbach hat vor einigen Jahren herausgefunden, dass die Mehrheit der Deutschen die Bauwirtschaft als wichtige Branche sieht, sie mit guten Verdienstchancen und Modernität assoziiert, ihr Image insgesamt aber nicht über Mittelmaß hinauskommt. »Früher war im Krimi der Mörder der Butler«, sagt Josef Geiger, »heute ist es der Bauunternehmer.« Aber daran kann es nicht liegen. Auch Schwarzgeld und Korruption sind längst Vergangenheit. Mit wenigen Ausnahmen wird Tarif gezahlt. Der Bau hat als erste Branche den freiwilligen Mindestlohn eingeführt. Compliance und Wertemanagement sind in Zeiten von Fachkräfte- und Nachwuchsmangel fast schon Pflichtprogramm. Kaum eine Branche hat seit 2015 die Integration von Geflüchteten besser hinbekommen als die Bauwirtschaft.
Es muss an etwas anderem liegen. Dass in den Medien häufig nicht differenziert wird und Immobilienhaie und Grundstücksspekulanten als Bauunternehmer bezeichnet werden, belastet das Ansehen. Aber am Ende liegt es auch in der Natur der Sache. Bauen macht Lärm, Dreck und sonstige Emissionen; es sorgt für Riesenlöcher und aufgewühltes Erdreich, für Gerüststangen vor dem Fenster, geschlossene Geschäfte, abgesagte Veranstaltungen. Wer Bauen begegnet, trifft häufig auf Unannehmlichkeiten: Staus, Umleitungen, Verspätungen. Dazu die Debatten über die CO2-Belastung durch Zement und Beton, die Ausbeutung von Sand- und Kiesvorkommen, die Bedrohung von Flora und Fauna, die Versiegelung des Bodens. Und wenn mal was in der Zeitung steht, dann, dass etwas nicht funktioniert, zu teuer ist, zu spät fertig wird, sei es ein ambitioniertes Konzerthaus im Hamburger Hafen oder ein Flughafen, der zur Lachnummer der Republik mutiert.
»Wir stellen kein Massenprodukt her wie BMW, Apple oder die Bekleidungsindustrie«, sagt Josef Geiger, »wir bauen Unikate, die mit klassischem Konsum nichts zu tun haben. Diese Unikate sind oft groß und komplex und entsprechend schwer zu kalkulieren. Da ist es immer möglich, dass man Risiken nicht richtig einschätzt, häufig sind die Planungen nicht durchdacht und das, was der Bauherr konkret will, wird zu spät definiert.« Dadurch geraten Bauunternehmen auch dann in die Kritik, wenn sie keine Schuld trifft. So geschehen bei Großprojekten wie dem Flughafen Berlin Brandenburg, der Elbphilharmonie oder Stuttgart 21. »Die Wahrnehmung, dass hier die Bauunternehmen versagt haben, ist völlig falsch«, so Geiger, »in allen Fällen lag das Problem in der Planung, im Projektmanagement oder bei der Politik, die nicht wusste, was sie wollte und ständig neue Vorgaben machte.«
»Wir haben es nicht leicht«, sagt Peter Hübner, Vorstandsmitglied bei STRABAG und Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie. »Wir kommen bei der Planung von Bauobjekten und beim Baurecht einfach nicht voran.« In den Behörden fehlt das Personal, während die Vorschriften ständig zunehmen. »Nur ein Beispiel: Der Planfeststellungsbeschluss der Frankfurter Startbahn West von 1971 hatte 23 Seiten, der gleiche Beschluss für die Startbahn Nord 2007 hatte 2.700 Seiten.« Der Mehraufwand durch die Bürokratie kostet Bauunternehmen jährlich etwa zehn Milliarden Euro. Schlimm genug, was ihm aber größere Sorgen bereite, so »Deutschlands oberster Bauarbeiter« (Hessische/Niedersächsische Allgemeine), sei die »zunehmend kritische Haltung der Bevölkerung gegenüber neuen Infrastrukturprojekten.«
Was Hübner meint, lässt sich mit ein paar Klicks im Internet recherchieren, sagen wir, mit den Suchworten »Brücke« und »Klage« oder »Autobahn« und »Protest«. Was die Algorithmen ausspucken, ist besorgniserregend. Besonders heftig ist der Widerstand gegen den geplanten Ausbau der A49 in Hessen. Insgesamt müssen dafür 85 Hektar Wald gerodet werden, davon 27 Hektar im Dannenröder Wald; etwa drei Prozent des gesamten Waldgebietes. Naturschutzverbände und Bürgerinitiativen sehen dadurch die Trinkwasserversorgung für Frankfurt am Main und schützenswerte Vogelarten bedroht. Barrikaden und Baumhäuser wurden errichtet, es gab Attacken auf die Polizei, Unfälle mit Schwerverletzten. Anderes Beispiel: Weil die geplante A44 zwischen Helsa Ost und Hessisch Lichtenau das Habitat von 5.000 Kammmolchen durchtrennt, muss laut Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) ein Tunnel für 50 Millionen Euro gebaut werden. Macht 10.000 Euro pro Lurch. »Wir brauchen einen Kulturwandel«, sagt Hübner, »wir müssen wieder zur sinnvollen Abwägung der Interessen finden, sonst wird Bauen zunehmend unmöglich.«
Ein weiterer Bereich, mit dem die Bauwirtschaft seit Langem hadert, ist die Geschäftspraxis der öffentlichen Hand, die auf der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) basiert. In aller Regel erhält dabei der billigste Anbieter den Zuschlag. Kriterien wie Qualität oder Termintreue – wie in anderen europäischen Ländern durchaus üblich – werden meist nicht berücksichtigt. Auch Sondervorschläge, die das Bauen erleichtern, beschleunigen, sogar günstiger machen könnten, werden von der ausschreibenden Stelle nur selten zugelassen. Hinzu kommt, dass Infrastrukturprojekte wie Straßen, Brücken oder Kanäle nach den Bestimmungen des Vergaberechts häufig in Dutzende Gewerke zerlegt und getrennt ausgeschrieben werden. Das führt häufig zu Kompetenzwirrwarr auf der Baustelle, Zeitverzögerungen und Kostensteigerungen. Auftragsvergaben, die auf fehlerhaften oder unvollständigen Ausschreibungen beruhen, können von Mitbewerbern juristisch angefochten werden. Konfliktpotenzial ohne Ende. Die Bauwirtschaft fordert daher schon lange eine Reform der VOB und mehr partnerschaftliche Modelle, etwa eine Einbindung der Baukompetenz in der Planung oder Öffentlich-Private Partnerschaften.
Die Qualität der deutschen Bauwirtschaft ist unbestritten. Zu welchen außergewöhnlichen Leistungen sie imstande ist, demonstriert sie nicht nur hierzulande. Das Unternehmen Max Bögl hat beispielsweise in Thailand einen Windenergiepark mit 90 Hybridtürmen aus eigener Produktion errichtet. Der Bielefelder Gewerbebauspezialist Goldbeck baut Hallen in ganz Europa. Der Tiefbauspezialist Bauer aus Schrobenhausen war in China für die Unterbauten der längsten Seebrücke der Welt und in Dubai für das Fundament des Burj Khalifa zuständig. Am Bau des mit 828 Metern höchsten Gebäudes der Welt waren insgesamt 30 deutsche Unternehmen beteiligt, ihre Beiträge reichten von Dübeln über Edelstahlfassaden bis zu Hochdruckpumpen für den Beton. Über eine Firma in Sachsen-Anhalt gelangte sogar Recyclingstahl aus Ostberlin an den Persischen Golf; er stammte aus dem abgerissenen Palast der Republik. Auf dem Bau gilt Made in Germany weiter als Gütesiegel. Die Unternehmensgruppe Geiger etwa ist seit Langem in Rumänien tätig.
»Wir brauchen wieder mehr Begeisterung für das Bauen«, sagt Werner Sobek, der mit seinem Ingenieurbüro die Tragwerksplanung des Bahnhofsgebäudes von Stuttgart 21 betreut. Sobek spricht von »einer Architektur, die einem den Atem raubt«, von der »größten Komplexität«, die jemals in einem Bauwerk umgesetzt worden sei. Doch wer stehe in der Öffentlichkeit? »Scharenweise selbsternannte Fachleute und Gutachter, die im Schnellverfahren zu großen Aussagen gelangen.« Meist negativen. »Wir reden vom Berliner Flughafen, vom eingestürzten Kölner Stadtarchiv oder von zusammengebrochenen Autobahnbrücken, aber was das Bauwesen tatsächlich an Positivem bewirkt, wird nicht kommuniziert.«
Das findet auch Josef Geiger bedauernswert, weil damit neben der Technik, der Leidenschaft und Leistung aller Beteiligten eine ganz entscheidende Botschaft nicht ankommt: »Ich freue mich immer über Kräne und Baustellen, denn wo Kräne und Baustellen sind, entsteht Zukunft.«
1 Great Place to Work ist ein unabhängiges Forschungs- und Beratungsinstitut, das jährlich ein Prädikat an Unternehmen verleiht und ein Ranking mit den besten Arbeitgebern einer Branche oder Region erstellt.
1Bauwelten
BauwirtschaftEin besonderer Markt(von Thomas Bauer)
Auf Märkten werden üblicherweise Leistungen ausgetauscht. Im Normalfall gibt eine Partei ein Produkt ab und die andere bezahlt dafür Geld. Der Preis entsteht dabei durch Angebot und Nachfrage. Ein Volkswirt würde sagen: »Der Preis bildet sich am Schnittpunkt der Angebots- und der Nachfragekurve.« So funktioniert – vereinfacht gesagt – unsere gesamte Marktwirtschaft.
Wenngleich: Ganz so einfach ist es nicht. Speziell in der Bauwirtschaft lassen sich die Marktmechanismen nur schwer nachvollziehen und nicht immer schlüssig erklären. Ist man aber mit einem Unternehmen im Markt der Baubranche tätig, ist es sehr wichtig, dessen Funktion zu verstehen, um richtige Entscheidungen treffen zu können.
Um die Preisbildung einigermaßen verstehen und erklären zu können, haben die Volkswirte ein vereinfachtes Basismodell definiert: den sogenannten vollkommenen Markt. In diesem idealtypischen Markt sind alle Güter gleich, also homogen – so wie, sagen wir, Stahl einer bestimmten Güteklasse. Alle Güter werden gehandelt, wie an einer Börse; alle Marktteilnehmer haben die gleiche Information, sodass sie gleichberechtigt handeln können. Und: Alle Marktteilnehmer handeln vernünftig, das heißt, die Verkäufer verkaufen so teuer wie möglich, die Käufer kaufen so billig wie möglich.
Unter diesen Bedingungen lässt sich nachweislich auf Dauer kein Geld verdienen. Der Preis ist unter Druck, der Gewinn tendiert gegen null. Entspräche die reale Marktwirtschaft genau dieser Theorie, könnte kein Unternehmen überleben.
Die Realität sieht bekanntermaßen anders aus. Die Anbieter bemühen sich, die Vorstellung des vollkommenen Marktes mit allen Mitteln auszuhebeln, indem sie die Produkte anders gestalten als die Konkurrenz und auch durch Werbung Präferenzen schaffen, die das Vernunfthandeln ersetzen. Größer, schneller, farbiger, prestigeträchtiger, moderner sind gängige Merkmale der Produktdifferenzierung.
Bei den meisten Produkten im Konsumgüterbereich, aber auch bei Investitionsgütern oder im Handel, definiert der Verkäufer das Produkt und damit sein Angebot. Dementsprechend entwickelt, produziert und vermarktet er es. Gelingt ihm ein Angebot, das den Kunden gut gefällt, also stark nachgefragt wird, kann er in der Regel einen guten Preis erzielen. Dies gilt auch, weil der Preis mit den Kosten nur bedingt zusammenhängt.
Etwas flapsig ausgedrückt kann man auch sagen, dass auf Märkten nur deshalb gutes Geld verdient wird, weil alle Marktteilnehmer ständig mit allen ihren Möglichkeiten versuchen, den idealtypischen Markt auszutricksen. So funktionieren die meisten Märkte, und die meisten Lehrer für volkswirtschaftliche Zusammenhänge orientieren sich daran. Doch es gibt, neben einigen anderen Bereichen, eine große Ausnahme: den Bau. Hier laufen die Dinge nach anderen Prinzipien ab.
Der Bauherr will ein Gebäude. Er bittet einen Architekten, unter Mithilfe anderer Fachleute dafür einen Plan zu erstellen. Dieser Plan wird ausgeschrieben. Die Baufirma hat also mit der Produkt-definition nichts zu tun. Sie kann deshalb keine Produktdifferenzierung betreiben, sie hat keinen Einfluss auf das Produkt. Die Baufirma kann nur die Leistung, das Gebäude nach den Wünschen des Bauherrn zu erstellen, anbieten. Bei diesem Leistungswettbewerb unterscheiden sich die Angebote der anbietenden Bauunternehmen, was das Endprodukt angeht, nicht. Alle bieten exakt das Gleiche an: ein homogenes Produkt, alle am gleichen Platz, alle mit der gleichen Information, die vom Bauherrn zur Verfügung gestellt wurde. Schließlich handelt der Bauherr nach dem Vernunftprinzip – er kauft zum billigsten Preis.
Die Bauwirtschaft ist folglich in einem System tätig, das der Theorie des vollkommenen Marktes sehr nahekommt. Dieses Modell bietet jedoch – wie bereits erwähnt – wenig Möglichkeit, Gewinn zu erzielen. Bauunternehmen bieten Leistungsfähigkeiten an, und Leistungsfähigkeiten manifestieren sich durch die Leistungserbringer, nämlich das Personal der Bauunternehmen. Extrem ausgedrückt, verkauft ein Bauunternehmen die Arbeitsstunden seiner Mitarbeiter, die für den Bauherrn eine Bauleistung nach dessen Vorgabe erbringen.
Das führt zu einem Wettbewerb, der sich erheblich an den Personalkosten orientiert. Diese Konkurrenzsituation führt zwangsläufig zu einem schlechten, häufig nicht kostendeckenden Preis. Der Bauunternehmer muss aber nicht nur Personal vorhalten, sondern auch Maschinen, Geräte und einen Verwaltungsapparat. Er wird daher aus betriebswirtschaftlichen Gründen lieber einen schlecht bezahlten Auftrag annehmen, als keinen Auftrag zu haben. Bei einem Blick auf die Bauwirtschaft lässt sich über viele Jahrzehnte statistisch belegen, dass Bauen eine Tätigkeit ist, bei der nur sehr mäßige Gewinne erzielt werden. Durch das nach langer Krise entstandene Unterangebot am Baumarkt und die gute Konjunktur der letzten Jahre ist die Situation derzeit etwas besser. Die Mechanismen des Marktes sind jedoch im Wesentlichen gleich geblieben.
Man könnte nun sagen: Das stimmt doch gar nicht! Allein schon, weil sich Bauwerke massiv unterscheiden. Es gibt große und kleine, luxuriöse und einfache. Das muss auf dem Baumarkt doch eine Rolle spielen! Das tut es aber bei der Preisbildung nicht, da alle anbietenden Unternehmen immer ein Angebot für genau das gleiche Projekt machen, egal, ob es groß oder klein, luxuriös oder einfach ist.
Das wirft die Frage auf: Welche Möglichkeiten hat die Bauwirtschaft, um sich aus diesem schwierigen Marktmechanismus zu befreien? Die Lösung ist grundsätzlich vergleichbar mit der in anderen Branchen: Es muss ihr gelingen, sich dem Wettbewerb in vollkommenen Marktstrukturen zu entziehen.
Wie das geht? Wenn am Bau überdurchschnittlich gut verdient wird, dann mit dem Handel des Produkts Bauwerk als Ergebnis des Bauprozesses. Wer Immobilien entwickelt, verkauft nicht mehr nur die Bauleistung, sondern das fertige Gebäude oder die fertige Wohnung. In diesem Fall hat der Bauunternehmer Einfluss auf das Produkt und alle Möglichkeiten der Produktdifferenzierung: Lage, Architektur, Ausstattung, Design, Werbung und vieles mehr. In Zeiten des Mangels an Wohnimmobilien können dabei sogar herausragende Gewinne erzielt werden. Dies ist auch der Grund, warum viele Bauunternehmen einen wesentlichen Teil ihres Geschäfts auf Immobilienentwicklung umgestellt haben.
Zwischen Funktionen der reinen Leistungserbringung, also der Bauproduktion, und der Immobilienentwicklung gibt es natürlich viele Zwischenstufen, die Produktdifferenzierung ermöglichen, so zum Beispiel das Angebot von Sondervorschlägen oder von Komplettleistungen inklusive Planung und Ausführung, der Verkauf von Fertighäusern und von Standardlösungen – beispielsweise Gebäude, die in Werkstattfertigung vorbereitet werden können. Diese Möglichkeiten können von einem Großteil der Bauunternehmen jedoch nicht genutzt werden.
Die meisten Brücken, U-Bahnen, Bahnhöfe, Schulen und Hochhäuser sind typische Einzelentwürfe, bei denen die Baufirmen nicht in der Lage sind, ihre Leistungen zu produktisieren. Die Unternehmen bleiben Leistungsanbieter mit nur wenigen Differenzierungsmöglichkeiten, die sich insbesondere auf ihr Qualitäts- und Termintreueversprechen reduzieren.
Ein überwiegend leistungsanbietendendes Unternehmen muss für seinen ökonomischen Erfolg weiter auf Kostenoptimierung setzen. Das ist auch eine interessante und spannende unternehmerische Herausforderung, die Unternehmensleitung muss sich aber auch bewusst sein, dass speziell diese Aufgabe für diese Struktur den Erfolg ermöglichen kann. Bei der Kostenoptimierung spielt der Faktor Personal die größte Rolle. Hier gibt es positive Faktoren wie Ausbildungs- und Weiterbildungsqualität, aber auch teilweise negative wie die Lohnkosten selbst, die durch gute und schlechte Verhaltensweisen beeinflusst werden können. Es ist daher kein Wunder, dass am Bau die meisten Arbeitskräfte aus Niedriglohnländern tätig sind.
Auch der Gesetzgeber und die Branchenverbände sind gefordert, die Rahmenbedingungen für einen fairen Baumarkt anzupassen. Das neue Baurecht im BGB war ein guter Anfang einer in den vergangenen Jahren einsetzenden Neuorientierung. Auch die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) muss an diese Vorgabe des Gesetzgebers angepasst werden. Außerdem müssen partnerschaftliche Bauverträge Standard werden. Nur so werden Bauherren und Bauunternehmen in die Lage versetzt, von der gewohnten Streitkultur in eine Partnerschaftskultur zu wechseln. Beide Seiten würden davon profitieren – es wäre eine Win-win-Situation für alle Beteiligten am Bau.
Prof. Dr.-Ing. E.h. Dipl.-Kfm. Thomas Bauer war von 1984 bis 2018 Vorstandsvorsitzender der BAUER AG. Inzwischen fungiert er als Aufsichtsratsvorsitzender des börsennotierten Unternehmens, das 2019 eine Gesamtkonzernleistung von rund 1,6 Milliarden Euro erwirtschaftete. Er ist Lehrbeauftragter der Technischen Universität München für Baubetriebswirtschaftslehre, seit 1998 als Honorarprofessor. Bauer ist Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande und erhielt unter anderem die Staatsmedaille für besondere Verdienste um die bayerische Wirtschaft. Seit 2003 ist er Landesschatzmeister der CSU. 2020 wurde er zum Präsidenten der European Construction Industry Federation FIEC gewählt.
Talbrücke Lindenau
Foto: STRABAG AG
StraßeDie Mobilitätsoffensive
Für 77 Prozent der Deutschen ist das Auto das wichtigste Verkehrsmittel. Doch jahrzehntelanges Missmanagement hat zu vollen Autobahnen, bröckelnden Brücken und einer überlasteten Infrastruktur geführt. Eine Tour durch Nordrhein-Westfalen.
Zur Koelnmesse, auf die A3 und nach Leverkusen. Von dort auf die A1 bis Remscheid. Weiter über die B229 nach Lüdenscheid, auf die A45 und nach Hagen. Danach bis Witten und auf die A44, zwischen Bochum und Wattenscheid rüber auf die A40, durch Essen, Mülheim an der Ruhr nach Duisburg und auf der A3 wieder zurück nach Köln. 430 Kilometer kreuz und quer durch Nordrhein-Westfalen. Baustellen inspizieren und über Straßenbau plaudern. Das ist der Plan.
Neun Uhr morgens, Treffpunkt am Haupteingang STRABAG AG in Köln-Deutz. Sven Hoffmann wartet in einem blauen VW Passat mit Hamburger Kennzeichen. Hoffmann, technischer Gruppenleiter Großprojekte, ein höflicher junger Mann, groß, schlank, Brille, rekapituliert noch einmal die Route, schätzt die Dauer der Aufenthalte an den Baustellen, und meint: »Gegen 16 Uhr sind wir zurück.« Bis zum ersten Stopp an der Autobahnraststätte Sauerland-Ost sind es etwa 80 Kilometer. Genug Zeit, um zu erzählen, wie er in der Baubranche gelandet ist.
Hoffmann ist in Olpe aufgewachsen. Großvater Maschinenbauer, Vater Maschinenbauingenieur. Er wird Straßenbauer. Der Job ist okay, aber Hoffmann will mehr. Was folgt, ist ein Studium des Bauingenieurwesens. 2019 kommt er zur STRABAG, wo er regelmäßig zwei bis drei Projekte parallel betreut, häufig von der Ausschreibung bis zur Übergabe an den Bauherrn. Hoffmann sagt: »Man lädt sich das ganze Paket der Ausschreibung vom Internet herunter, dann wird auf der Basis eines Einheitspreisverfahrens ein Angebot formuliert.« Ein Kilometer Autobahnsanierung liegt bei drei bis fünf Millionen Euro, eine Raststätte etwa bei zehn Millionen, eine Brücke kann schon mal 50, 100, auch 500 Millionen und mehr kosten. Fast immer gilt: »Der Billigste gewinnt.«
Schnell ist klar: Dieser Mann mag seinen Job. An der Raststätte Sauerland-Ost referiert er ausdauernd über den Ausbau von Park- und Lkw-Stellplätzen. Besonders angetan hat es ihm eine Stützwand, die einen Hang absichert: acht Meter hoch, fünf Grad Neigung, die Verkleidung besteht aus Betonplatten, versetzt mit Steinen und Kunstharz. Hoffmann sagt: »Man schaut in so einem Fall natürlich, wo gibt es eine Technologie, mit der man das Projekt kostengünstiger machen kann? Kann ich zum Beispiel eine Maschine aus dem Betonbau im Erdbau einsetzen? Welche Werkstoffe sind am besten geeignet?« Der Markt sei umkämpft, so Hoffmann: »Umso größer mein Know-how, das Wissen der Firma ist, umso mehr Möglichkeiten habe ich, mein Angebot günstig zu gestalten und eine Ausschreibung zu gewinnen.«
Zurück zum Wagen und auf die A45 Richtung Hagen. Nach einigen Kilometern eine Spurverengung. Tempolimit 60. Eine Baustelle. Hoffmann bremst ab, schaut nach links, schaut nach rechts, studiert die Firmenschilder, den Maschinenpark der Konkurrenz, wie viele Leute an welcher Stelle im Einsatz sind. »Man schaut schon, ob die etwas anders machen als wir, das will man natürlich gerne wissen.« Seine Frau, so Hoffmann, necke ihn gerne mit der Feststellung: »Du bist der einzige Mensch, der sich über einen Stau auf der Autobahn freut, weil du dann wieder Gucken kannst.« Was soll er machen? »Straßenbau ist mein Leben.«
Deutschland hat 230.000 Kilometer Straßen. 41.000 Kilometer davon sind Bundesstraßen, 13.000 Kilometer Autobahnen; über beide läuft die Hälfte des Auto-, Lkw- und Busverkehrs. Tendenz steigend. Denn Deutschland ist nicht nur ein Land der Autobauer. 77 Prozent bezeichnen das Auto weiter als wichtigstes Verkehrsmittel. Weshalb die Initiative Pro Mobilität festgestellt hat: »Das Fundament der Mobilität der Zukunft ist eine gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur.« Dabei durfte der Hinweis nicht fehlen, dass auf Bundesstraßen und Autobahnen 70 Prozent der Güter transportiert werden – auf der Schiene sind es 18 Prozent. Pro Mobilität bezweifelt daher, dass die für die nächsten Jahre geplanten Investitionen von acht bis neun Milliarden Euro jährlich ausreichen.
Zuständig für die Bundesfernstraßen waren bislang die Bundesländer; die meisten von ihnen hatten sich dafür der Projektmanagementgesellschaft Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) angeschlossen. Da die Finanz- und Personalsituationen der Länder jedoch unterschiedlich sind, konnten häufig Gelder, die der Bund bereitstellte, nicht abfließen. Projekte stockten, mussten vertagt oder storniert werden. Die vom Bund gegründete Autobahn GmbH soll dies ändern. Seit 1. Januar 2021 ist sie zuständig für den Bau, Betrieb und Erhalt sowie die Finanzierung und vermögensmäßige Verwaltung der deutschen Autobahnen und einiger Bundesstraßen. Gunther Adler, Geschäftsführer Personal der Autobahn GmbH, versichert: »Mit der Bündelung der Aufgaben in einer Hand stärkt die Autobahn GmbH Qualitätsstandards im Autobahnnetz hinsichtlich Verkehrsfluss, Sicherheit und Serviceorientierung.«
Auf der A45. Sven Hoffmann nimmt die Abfahrt Hagen-Süd. Am ersten Kreisverkehr rechts in die Kattenohler Straße, die schmal und kurvenreich durch Wald und Wiesen führt. Wieder rechts, diesmal auf einen ausgebauten Feldweg. Eine Schranke. Hoffmann steigt aus, sperrt auf, wenig später parkt der Passat unter der Talbrücke Brunsbecke, 540 Meter lang, 76 Meter sind es vom Boden bis zur höchsten Stelle. Hoffmann zeigt auf das Stahlgerüst, das die Fahrbahn trägt und über die der Verkehr rattert. Die Betonstützen darunter bröseln vor sich hin. Spannungsrisse im Beton, an etlichen Stellen ist bereits die Bewehrung zu sehen. Rings um die Füße der Stützen liegen Betonbrocken.
Die A45, auch Sauerlandlinie genannt, soll in den kommenden Jahrzehnten sechsspurig ausgebaut werden. Im Bundesverkehrswegeplan 2030 wurde dem Projekt vorrangige Bedeutung eingeräumt. Dazu gehört auch ein Neubau der Talbrücke Brunsbecke, der ein kompliziertes Verfahren nötig macht. Die bestehende Brücke wurde in monolithischer Bauweise errichtet, das heißt, beide Fahrbahnen führen über ein Tragwerk. Die neue Brücke wird über getrennte Tragwerke, die zunächst auf provisorische Stützen gestellt werden, führen. Über diese wird der Verkehr während des Rückbaus der alten Konstruktion fließen. Danach werden die neuen Brückenpfeiler errichtet, auf die die neuen Fahrbahnen im Querverschubverfahren geschoben werden. Nicht machbar ohne exzessive Planung. »So eine Brücke«, so Hoffmann, »hat gut und gerne 10.000 Einzelpläne, jede Schraube, die besondere Anforderungen erfüllt, ist dokumentiert.«
Aus verkehrstechnischen Gründen kann die Talbrücke Brunsbecke nur gleichzeitig mit der etwa einen Kilometer entfernten Talbrücke Kattenohl, 199,5 Meter lang, 30 Meter hoch, gebaut werden. Die vorbereitenden Erdbauarbeiten für beide Brücken hat die STRABAG längst erledigt. Bäume wurden gerodet, Zufahrtswege angelegt, Arbeitsbereiche vorbereitet. Unter anderem wurde eine Hangsicherung mit einem innovativen Geogitter2 aus Textilien und verzinktem Stahl installiert.
Gebaut wird trotzdem nicht. Bei der Talbrücke Brunsbecke wurden von den planenden Ingenieuren offenbar sensible Daten nicht berücksichtigt, der ursprüngliche Konstruktionsentwurf war nicht umsetzbar. Alles noch mal von vorn. Bei der Talbrücke Kattenohl gibt es, so die zuständige Behörde Straßen.NRW, Probleme mit dem Baugrund. Auch hier muss neu berechnet werden. Wenigstens kommt sechs Kilometer weiter Richtung Dortmund der Neubau der Lennetalbrücke, 989 Meter Länge, endlich voran. Voraussichtliche Fertigstellung Mitte 2021, nach fast acht Jahren Bauzeit.
Deutschland liegt beim Zustand seiner Straßen im internationalen Vergleich inzwischen nur noch auf Rang 19, zusammen mit Namibia und Malaysia, knapp vor Aserbeidschan. Rund 10.000 Kilometer Autobahn sind in schlechtem bis sehr schlechtem Zustand. Jede dritte der 39.500 Brücken an Bundesfernstraßen muss zeitnah renoviert werden, bei elf Prozent herrscht dringender Baubedarf. Die meisten stammen aus den Sechziger- und Siebzigerjahren, sind marode und hoffnungslos überlastet.
Viel Arbeit für die Autobahn GmbH, die gewissermaßen ein Provisorium übernommen hat. Der ADAC zählte im Juni 2019 allein auf deutschen Autobahnen mehr als 560 Baustellen. Jede vierte davon befindet sich in Nordrhein-Westfalen, das über das dichteste Autobahnnetz des Landes verfügt. Nach dem Einsturz der Morandi-Brücke in Genua im August 2018 recherchierte Bild, ob ein ähnliches Unglück auch hierzulande möglich sei. Unter dem Titel »So bröseln Deutschlands Brücken« wurden die zehn prominentesten Problemfälle gelistet. Fünf davon befinden sich in Nordrhein-Westfalen.
Interessant ist, dass die Leverkusener Rheinbrücke keine Erwähnung fand, obwohl sie seit Jahren Schlagzeilen produziert. Über sie führt seit 1965 der nördliche Kölner Autobahnring über den Rhein. Geplant für 40.000 Kraftfahrzeuge täglich, muss die 1.061 Meter lange Schrägseilbrücke mittlerweile mit dem dreifachen Verkehrsaufkommen zurechtkommen, darunter 14.000 Lkws. Die Folgen sind Risse im Tragwerk, aufgeplatzte Schweißnähte, Einsturzgefahr. Michael Groschek, damals Verkehrsminister in Düsseldorf, sprach 2016 von einem »Mahnmal für den katastrophalen Zustand der deutschen Infrastruktur«. Inzwischen beträgt das Tempolimit auf der Brücke 60 km/h, für Lastwagen über 3,5 Tonnen ist sie gesperrt.
Der Neubau ist seit Jahren beschlossen und bereits im Gange. Die Spundwände für die Baugrube stehen, die Bohrarbeiten für die Gründung sind ausgeführt, einige Pfeiler bereits betoniert. Doch auch hier gibt es Verzögerungen. Im April 2020 wurde der Vertrag mit dem österreichischen Bauunternehmen Porr gekündigt. Beanstandet wurde der in China angeschaffte Stahl für die neue Brücke. Beulen, fehlerhafte Schweißnähte, massive Qualitätsmängel beim Korrosionsschutz. Die anschließende Vergabe des Auftrags an Hochtief war aus vergabetechnischen Gründen umstritten. Anfang 2021 konnte jedenfalls niemand sagen, wann und mit welchem Unternehmen es weitergeht. Geplante Fertigstellung war Ende 2020.
Für einen Ortstermin hat Sven Hoffmann nicht die Leverkusener, sondern die Duisburger Rheinbrücke ausgewählt. Auch sie eine Schrägseilbrücke, eröffnet 1970, vergleichbares Format, ähnliche Probleme wie in Leverkusen. Die Brücke ist Teil der A40, verbindet die Stadtteile Neuenkamp und Homberg und ist umgeben von klassischer Revierromantik. Der Binnenhafen Ruhrort ganz in der Nähe. Fabriken mit hohen Schloten zwischen Backsteinhäusern, mittendrin ein Denkmal, errichtet 1887. Auf dem Sockel eine Viktoria. Die Inschrift: »Ein deutsches Schwert beschützt den deutschen Rhein.« Während auf der Uferpromenade ein Rentner mit seinem Hund spaziert und der Ausflugsdampfer »Stadt Duisburg« vorübergleitet, spricht Hoffmann von Schwefel- und Salzsäure, von Schwermetallen im Boden. »Im Ruhrgebiet gibt es keinen Quadratmeter ohne Schadstoffe.«
Hoffmann war bei der Duisburger Rheinbrücke zuständig für den Bau einer Kläranlage und Zufahrten für Baustellenfahrzeuge. Er deutet auf die Rollwägen, die langsam an beiden Seiten des Tragwerks entlanggleiten. Täglich müssen Schäden im Stahlkörper der altersschwachen Konstruktion geschweißt werden. Das Metall ist übersät mit weißen Markierungen, die Details der Arbeiten festhalten. Auch die Duisburger Rheinbrücke wird durch einen Neubau ersetzt werden. Zum ersten Spatenstich im Dezember 2019 kam sogar Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Er versprach »ein neues Wahrzeichen für Duisburg«, das sich der Bund 366 Millionen Euro kosten ließe. Die Summe relativiert sich, wenn man weiß, dass eine Sperrung der Brücke pro Tag einen wirtschaftlichen Schaden von 1,2 Millionen Euro verursacht. Hoffmann glaubt: »Die Politik hat inzwischen verstanden, wie wichtig der Straßenbau für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist.«
Die STRABAG AG ist eines der größten Bauunternehmen Deutschlands. Sie gehört zum Konzernverbund der börsennotierten österreichischen STRABAG SE und macht hierzulande allein im Verkehrswegebau mit 12.000 Mitarbeitern etwa drei Milliarden Euro Umsatz. Auf ihrer Webseite garantiert sie »bestmögliche Qualität, effiziente Strukturen und moderate Kosten«. Und: »Gutes immer besser machen: Das ist unser Antrieb.« Wie bei der Erneuerung eines 3,7 Kilometer langen Teilstücks der A2, die in 88 Stunden abgeschlossen werden konnte; wie bei der Sanierung zweier Schnellrollbahnen auf dem Frankfurter Flughafen, die in 140 Nachtschichten absolviert wurde. Dabei kam auch der vom Unternehmen mit entwickelte Clean Air Asphalt zum Einsatz. Er besteht aus ultrahochfestem Beton und Abstreumaterial aus Titandioxid; unter Einwirkung von UV-Strahlung verwandelt er schädliche Stickoxide in unschädliche Nitrate.
Einer der demnächst anstehenden Großaufträge unter Beteiligung der STRABAG ist der Bau eines 31 Kilometer langen Teilstücks der A49 zwischen Schwalmstadt und dem Ohmtal-Dreieck in Nord- und Mittelhessen. Das Projekt wird in Öffentlich-Privater Partnerschaft (ÖPP) ausgeführt und beinhaltet auch die Planung und anteilige Finanzierung sowie den Erhalt und Betrieb der Autobahn auf einer Strecke von knapp 62 Kilometern. Das geplante Bauauftragsvolumen liegt bei über 700 Millionen Euro.
»Lassen Sie sich nicht von den großen Zahlen irritieren«, sagt Peter Hübner, »Aufträge in diesen Dimensionen sind auch bei uns eher die Ausnahme.« Hübner ist Mitglied des STRABAG-Vorstands. Hermann Kirchner, Hübners Großvater, gründete 1926 in Bad Hersfeld ein Bauunternehmen. Die mittelständische Kirchner Holding GmbH wurde 2008 von der STRABAG übernommen. Hübner sagt, im täglichen Geschäft seien die Unterschiede zwischen dem Familienunternehmen und einem Baukonzern eher marginal. »Wir bauen nicht nur Autobahnen, Brücken, Gleisanlagen oder Raststätten, wir machen auch Hofeinfahrten, Feldwege, Bewässerungssysteme oder Sportstätten. Wir operieren wie ein Mittelständler mit gut vernetzten Niederlassungen. Bauen ist und bleibt ein regionales Geschäft.« Die durchschnittliche Auftragssumme der STRABAG im Verkehrswegebau: 500.000 Euro.