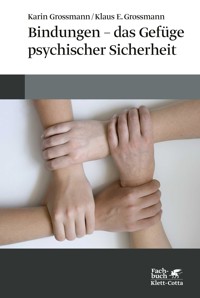
74,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Das Standardwerk zur Bindungsforschung aus der Feder der führenden deutschsprachigen Experten liegt seit 2012 in überarbeiteter und völlig aktualisierter Form vor: mit den neuesten Erkenntnissen aus den Neurowissenschaften und der Psychophysiologie sowie den jüngsten Befunden der Langzeitstudien. Seit über 30 Jahren betreiben Karin und Klaus Grossmann ihre weltweit beachteten Langzeituntersuchungen über menschliche Bindungen. Mit diesem Buch legten Deutschlands bekannteste Bindungsforscher ihr Lebenswerk vor. Fast 100 Kinder konnte das Ehepaar Grossmann über mehr als 30 Jahre, von der Geburt an bis heute, wissenschaftlich begleiten und beobachten. Schon als Säugling binden wir uns an die Eltern, die uns versorgen und schützen. Ob es aber gelingt, eine sichere Bindung zu entwickeln, hängt von der Qualität der Erfahrungen mit Mutter und Vater ab. Und davon hängen wiederum unsere Erwartungen über die Reaktionen anderer Menschen ab, wenn wir deren Unterstützung brauchen. Wie die Forschungsergebnisse zeigen, führen positive Erfahrungen mit beiden Eltern zur Bereitschaft, verläßliche, vertrauensvolle Beziehungen einzugehen, die auf Gegenseitigkeit beruhen. Bereits in den ersten Lebensjahren wird das Fundament für Freundschaften, Partnerschaften und den rücksichtsvollen sozialen Umgang mit anderen gelegt. Der Bindungsprozeß und die Entstehung psychischer Sicherheit wird von seinen frühen Anfängen ebenso dargestellt wie der Einfluß von Bindungen bei Erwachsenen und im hohen Lebensalter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1167
Ähnliche
Karin Grossmann Klaus E Grossmann
Bindungen
Das Gefüge psychischer Sicherheit
IMPRESSUM
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Besuchen Sie uns im Internet: www.klett-cotta.de
Klett-Cotta
© 2004/2012 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH,
gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Klett-Cotta Design
Unter Verwendung eines Fotos von fotolia © Alexander Raths
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Dieses E-Book entspricht der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Printausgabe: ISBN 978-3-608-98737-9
E-Book: ISBN 978-3-608-10278-9
PDF-E-Book: ISBN 978-3-608-20152-9
EINLEITUNG
Das vorliegende Buch ist eine Lebensarbeit. Es ist das Ergebnis unserer dreißigjährigen Bindungsforschung, die wir in Zusammenarbeit mit vielen anderen durchgeführt haben. Bindungen gehören zu den Ursprüngen der Menschwerdung mit der verlängerten Kindheit des Menschen im Vergleich zu anderen Primaten. Erforderlich ist die individuelle Zuneigung besonderer Erwachsener, die das Kind beschützen, versorgen und in die Kultur einführen. Bindungen gehören zur Natur des Menschen.
Das Gefüge psychischer Sicherheit entsteht aus menschlicher Zuneigung. Psychische Sicherheit bereichert das Leben, während psychische Unsicherheit es einschränkt. Wir wünschen uns, dass dieses Buch dazu beiträgt, den Wert von Bindungen für Menschen aller Altersgruppen zu erkennen. Wir möchten dazu beitragen, dass besser verstanden wird, warum unsere Bindungen uns so sehr in unserem Fühlen, Denken, Planen und Tun beeinflussen. Das Buch beschreibt, was zu psychischer Sicherheit führt. Es ist damit auch ein Plädoyer gegen Nachlässigkeit im sozialen Miteinander und es wirbt für mehr Rücksicht und Behutsamkeit gegenüber anderen, besonders gegenüber Kindern.
Unser Engagement für Bindung begann in den 1960er Jahren. Wir waren nach vier Jahren in den USA, in denen Klaus seinen Dr. phil. (Ph.D.) in experimenteller und vergleichender Psychologie erwarb, Karin Mathematik und Englisch bis zum Bachelor-Abschluss studierte und unser erstes Kind Carol May geboren wurde, nach Deutschland zurückgekehrt. Weil es in der damaligen akademischen Psychologie zwar viele unverbundene theoretische Ansätze gab, aber kein übergreifendes Konzept existierte, das im Einklang mit der Stammesgeschichte des Menschen, seinen psychologischen Besonderheiten und seiner individuellen Entwicklung stand, suchte Klaus einen Wirkungsort, an dem er sein Interesse an solchen Fragen weiterverfolgen konnte. Durch die Berücksichtigung von Kultur (Cole, 1996), Anthropologie und sozialer Entwicklung (Hrdy, 2000) gewann die Psychologie für Klaus wieder an Lebensnähe.
Eine Ausnahme und ein Lichtblick in den USA bereits in den 1950er Jahren war das langzeitliche Forschungsprogramm des vergleichenden Psychologen Harry Harlow und seiner Mitarbeiter, darunter seine Frau Margaret K. Harlow. Sie hielten die Beobachtungen von René A. Spitz über die pathologischen Folgen der Mutterentbehrung bei Säuglingen für wichtig genug, um sie experimentell und modellhaft an Rhesusaffen zu untersuchen – mit allen Problemen, die solche Tier-Mensch-Vergleiche mit sich bringen (Harlow & Harlow, 1971; Blum, 2010).
Auf der Suche nach einer Möglichkeit, in Deutschland eine umfassendere Psychologie wissenschaftlich zu verfolgen, bekamen wir Hilfe von dem damaligen Wissenschaftsredakteur der Wochenzeitung Die Zeit, Thomas von Randow. Er war Mitglied der Fulbright-Kommission gewesen, der wir unser Studium in den USA verdankten. Er hatte gemeinsam mit dem Literaturredakteur Dieter E. Zimmer einen Hochschulführer verfasst und machte uns auf den Zoologen und Verhaltensbiologen Bernhard Hassenstein in Freiburg aufmerksam. Hassenstein war als ausgezeichneter Ethologe und Kybernetiker ein wahrhaft interdisziplinär orientierter Wissenschaftler und darüber hinaus sehr an der Entwicklung von Kindern interessiert. Er ermöglichte dem Nicht-Zoologen Klaus eine Assistenzstelle am Zoologischen Institut der Universität Freiburg und warb für Karin Forschungsmittel für eine umfangreiche Literaturrecherche ein. In dieser Zeit wurde unser zweites Kind Gerald Bert geboren. Klaus erforschte zunächst experimentell den Farbensinn und das individuelle Lernvermögen von Honigbienen und konnte sich damit in Verhaltensbiologie und Psychologie gemeinsam bei Bernhard Hassenstein und Robert Heiss habilitieren. Karin exzerpierte Literatur zur Sozialisation von Tier und Mensch für Hassensteins erfolgreiche „Verhaltensbiologie des Kindes“ (1973), die 2006 in der 6., überarbeiteten Auflage erschien. Er überzeugte uns von der Stärke offener Neugier als Grundlage für wissenschaftliches Forschen.
Die Arbeit in Freiburg war die Basis für unsere Bindungsforschung. Wir setzten uns mit den theoretischen Vorstellungen von Konrad Lorenz auseinander, gingen mit ihm Graugänse beobachten und machten uns in der Ethologie kundig (Grossmann, K. E., 1968; Grossmann, K. & Grossmann, K. E., 1969). B. Hassenstein bestärkte uns im offenen Explorieren, das er mit Forschen gleichsetzte, wie es auch Konrad Lorenz tat (Lorenz, 1967). Wir lasen die ersten Schriften von John Bowlby, der sich als Psychiater, Psychoanalytiker und unabhängiger Geist weder der herrschenden verengten akademischen Psychologie noch der Doktrin der Psychoanalyse verpflichtet fühlte – wohl aber ihren Fragen – und der das Wissen der damaligen Ethologie und der Systemforschung in seine Theorie einbezog.
Wir waren fasziniert von der Möglichkeit, Beobachtungen auf der Basis der Verhaltensforschung an Kindern und ihren Eltern sowie anderen vertrauten Personen durchzuführen und sie mit der traditionellen Entwicklungspsychologie zu verbinden. Für uns war die verhaltensbiologisch orientierte Bindungstheorie deswegen so anziehend, weil sie gesunde, gelingende, aufeinander abgestimmte Interaktionen innerhalb einer Familie als „normal“ ansah. Im Gefüge psychischer Sicherheit spielen Freude, Zärtlichkeit, behutsamer, entgegenkommender und rücksichtsvoller Umgang miteinander – kurz Liebe – eine zentrale Rolle. Wir wollten die Bedingungen in Familien erforschen, die eine seelisch gesunde, psychisch sichere Entwicklung ermöglichen. Sie lassen sich mit Störungen und Mängeln vergleichen, die zu abweichenden oder gar pathologischen Entwicklungen führen können (Bowlby, 1979 d/2001).
Die in den USA forschende Psychologin Mary Ainsworth mit ihrer äußerst detaillierten, sorgfältig beobachtenden Forschung war unser leitendes Vor- und Leitbild. Aufgrund der dort gesammelten Erkenntnisse darüber, wie unterschiedliche mütterliche Stile im Umgang mit Säuglingen deren Bindungsentwicklung beeinflussten, wurden ihre Untersuchungen in Uganda und Baltimore zu einer der einflussreichsten systematischen Forschungen der modernen Entwicklungspsychologie. Es lag nahe, zunächst genauso zu beginnen. Dabei halfen uns auch ihre Schülerinnen Mary Main und Inge Bretherton, denen wir ebenso wie Mary Ainsworth selbst großen Dank schulden für ihre beständige, wohlwollende, tatkräftige, hilfreiche und ermutigende Unterstützung. Wir haben die grundlegenden Untersuchungen von Mary Ainsworth in einem Sammelband auf Deutsch herausgegeben (Grossmann, K. E. & Grossmann, K., 2003).
Zunächst waren wir skeptisch, ob stundenlange Beobachtungen von Müttern mit ihren Säuglingen auch in durchschnittlichen deutschen Familien möglich wären, da die meisten Familien das Baby in den sehr privaten Räumen Schlafzimmer, Bad und Küche versorgten. So begann Karin eine Voruntersuchung mit sechs Müttern und ihren Säuglingen. Diese Familien waren so offen, zugänglich und freundlich, dass uns die Erfahrungen mit ihnen Mut zu weiterer Forschung dieser Art machten. Die Voruntersuchung öffnete uns aber auch die Augen für die Lebendigkeit und damit Unvorhersagbarkeit einer Erforschung des Erlebens von Säuglingen in ihren Familien, auf das wir uns einzulassen im Begriff waren. Wir danken diesen Familien herzlich.
Zwischen 1970 und 1980 war es auf den Entbindungsstationen üblich, die Neugeborenen von den Müttern zu trennen und in getrennten Säuglingszimmern unterzubringen. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse favorisierten, dass sie zusammenblieben, um „bonding“ zu ermöglichen (Klaus & Kennell, 1976). Das wollten wir überprüfen.
Dazu war es notwendig, die damalige Routine einer Wochenstation entsprechend einem wissenschaftlichen Forschungsplan ändern zu dürfen. Was das an Vorarbeit und Engagement bedeutete, hatten wir uns nicht vorstellen können. Ohne das Engagement des damaligen Chefarztes des St.-Franziskus-Krankenhauses in Bielefeld, Dr. Philipp Lachenicht, wäre das undenkbar gewesen. Seine beständige Unterstützung, die er uns bei jeder Begegnung auf den Fluren des Krankenhauses entgegenbrachte und die sich allmählich auf die meisten Schwestern übertrug, bleibt uns in dankbarer Erinnerung. Die Hebammen waren uns eine besondere Hilfe dabei, die Eltern der zunächst 51 Kinder unserer Bielefelder Untersuchung zur Mitarbeit zu gewinnen. Viele Eltern willigten ein, noch ehe das Kind geboren war. Ihnen gebührt unser uneingeschränkter und bewundernder Dank dafür, dass sie sich so lange von unserem Forschungsteam befragen und beobachten ließen. Das gilt ebenso für die 51 Regensburger Eltern, die wir um ihre Teilnahme baten, als die Kinder knapp ein Jahr alt waren.
Wir konnten damals noch nicht abschätzen, ob wir eine bindungspsychologische Langzeituntersuchung durchführen konnten und ob wir die dafür erforderlichen Forschungsgelder bekommen würden. Dies war anfangs besser gelungen als im weiteren Verlauf, als wir unsere anonymen Gutachter nicht immer von unseren ethologischen und diskursiven Forschungsmethoden überzeugen konnten. Zu Beginn war es die Stiftung Volkswagen, die unser Projekt 5 Jahre lang finanzierte. Zahlreiche Forschungsanträge an die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Weiterführung der Untersuchungen in Bielefeld und zur Durchführung der zweiten und mehrerer kleinerer Untersuchungen in Regensburg sowie kultur-vergleichender Forschungen in Japan und auf den Trobriand-Inseln, Papua-Neuguinea, wurden ebenfalls bewilligt. Schwierig wurde es immer dann, wenn wir neues Terrain betraten: das erste Mal, als wir Forschungsgelder für lebensnahe „unkontrollierbare“ Beobachtungen von Mutter-Kind-Interaktionen zu Hause beantragten, statt uns auf kontrollierbare Tests und Fragebögen zu beschränken; das zweite Mal, als wir „als Laien“ auch nicht-intrusive physiologische Untersuchungen durchführen wollten (Veränderungen der Herzschlagfrequenz und den Kortisolanstieg). Wir sollten, um methodischen Ansprüchen zu genügen, einjährige Kinder allen Ernstes festschnallen („arretieren, um motorische Artefakte auszuschließen“), obwohl wir sie rechnerisch kontrollieren konnten (Spangler & Grossmann, K. E. 1993). Beim dritten Mal – als wir innere Modelle über Bindung („Bindungsrepräsentationen“) und Partnerschaft („Partnerschaftsrepräsentationen“) erfassen wollten – blieb eine Bewilligung aus, weil wir uns nicht an gängige Sprachanalysen hielten. Die späteren Untersuchungen wären deshalb ohne die großzügige Unterstützung der Köhler-Stiftung von Dr. Lotte Köhler, München, unvollendet geblieben. Erst durch die Fortführung ins junge Erwachsenenalter, oft mit neuen, zwar bindungstheoretisch fundierten, aber damals noch empirisch ungeprüften Methoden, konnte das Bild entstehen, das wir in diesem Buch darstellen. Das suchende Forschen hat Lotte Köhler uns ermöglicht, wofür wir ihr sehr dankbar sind.
Beim Schreiben des Buches haben wir uns als Leser all jene vorgestellt, die mit Kindern und Beziehungen zwischen einander vertrauten Menschen sowie mit ihren Problemen zu tun haben, in Beratungsstellen, Institutionen, in der Forschung oder als wissensdurstige Eltern. Wir hoffen natürlich, auch diejenigen Psychologen zu erreichen, die nur in der Enge des experimentellen Paradigmas gefangen sind, um ihnen zu zeigen, wie lebensnah psychologische Forschung sein kann.
Die Ergebnisse haben wir in anschaulichen Beschreibungen, aber auch in technischer Sprache, in Tabellen und Graphiken über die Zusammenhänge und mit vielen Literaturhinweisen dargestellt, um keine „Schwarz-Weiß-Malerei“ zu betreiben und uns an wissenschaftliche Standards zu halten. Trotzdem hoffen wir, dass im Kopf des Lesers ein klares Bild entsteht. Jeder gefundene Zusammenhang muss im Ganzen und als Wahrscheinlichkeit gesehen werden, der nicht immer für jeden einzelnen Fall zutreffen muss.
Unser Dank gilt – neben den beteiligten Familien – unseren Lehrern, finanziellen Unterstützern und Helfern, besonders auch unseren vielen Studenten, Diplomanden und Doktoranden. Sie haben viele Daten gesammelt, umfangreiche Auswertungen von videografierten Beobachtungen und schriftlich festgehaltenen Gesprächen durchgeführt und all das analysiert. Im Rahmen unserer Langzeit- und kürzeren Untersuchungen sind in 30 Jahren über 200 Diplomarbeiten und 25 Dissertationen am Lehrstuhl für Entwicklungspsychologie der Universität Regensburg entstanden. Unser besonderer Dank gebührt auch denjenigen unserer Doktoranden, die unter finanziell eingeschränkten Bedingungen weite Fahrten unternommen haben, um möglichst viele Jugendliche und junge Erwachsene in ganz Deutschland wiederzufinden. Trotz großer Anstrengung, oft langer Geduldsproben und mancher Irrwege herrschten überwiegend Zuversicht und eine gute Atmosphäre unter allen Beteiligten. Etliches ist gescheitert, aber vieles auch gelungen. Das Gelungene ist im vorliegenden Buch dargestellt. Die erfolglosen Versuche haben jedoch oft erst den Erfolg ermöglicht, weil man vorher meist nicht genau wissen kann, worauf es bei der Analyse von Zusammenhängen ankommt!
Ein besonderer Glücksfall für das vorliegende Buch war die Mitarbeit von Sue Kellinghaus, die ihr Zeichentalent im Dienst unserer Bindungsforschung weiterentwickelt und alle Bilder dieses Buches gezeichnet hat. Sie machen vieles anschaulich. Eine solche Zusammenarbeit mit jungen, klugen und engagierten Studierenden und werdenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist eine besondere Gnade, die selbst das eigene Altern erfreulich macht.
Die Zentrale nahezu allen Geschehens war Margit Frimberger, unsere Sekretärin am damaligen Lehrstuhl. Ohne ihren Überblick über die vielen Forschungsanträge, ihre kundige Verwaltung der Konten, die umfangreiche Korrespondenz mit Forschungskollegen und den zahlreichen Interessenten an unserer Forschung und besonders ohne ihre Niederschrift zahlreicher Versionen des Buchmanuskripts und die Verwaltung der umfangreichen Literatur des vorliegenden Buches hätten wir unser Ziel kaum erreicht. Es war eine Freude, mit ihr zu arbeiten, und eine Quelle der Sicherheit, sich immer auf sie verlassen zu können.
Wir danken auch – und nicht zuletzt – unseren eigenen Kindern, die während ihrer Kindheit Eltern ausgehalten haben, die auch noch Arbeitskollegen waren. Das brachte die Notwendigkeit langfristiger Planungen, oft Verspätungen, häufiges geistiges „Abwandern“ – auch am Familientisch – in fachliche Gespräche, „heimliches“ Verschwinden an die Uni, auch an manchen Samstag, und viel berufsbedingte Abwesenheit mit sich. Sie haben es meist wohlwollend oder, nachträglich, mit Humor hingenommen.
Der Aufbau des Buches in seinen Teilen folgt dem Alter der untersuchten Kinder, wobei in Teil I die theoretischen Grundlagen gelegt werden und Teil X eine Art bewertende Rückschau darstellt. Innerhalb jedes Teils werden zunächst ausgewählte Entwicklungsschritte und -aufgaben in dem jeweiligen Altersabschnitt beschrieben, um an die allgemeine Entwicklungspsychologie anzuknüpfen. In jedem Alter sind Bindungsgefühle und Bindungsverhalten eng mit der gesamten Entwicklung verbunden, mit der Entwicklung von Denken, Planen, Wollen, der Entwicklung der Selbständigkeit, der Selbstkontrolle und der sozialen Fähigkeiten. Das Forschen im Rahmen der Bindungstheorie hat uns viel Freude bereitet.
ZU DIESER AUFLAGE
Die Bindungstheorie hat sich etabliert. Sie zeigt, was Eltern ihren Kindern geben können und was Kinder brauchen, um psychische Sicherheit in ihrem Leben zu erlangen und aufrechtzuerhalten – einem Leben, das voller komplexer Anforderungen und in dem manches unvereinbar sein wird. John Bowlby hatte die Bindungstheorie für seine klinisch-therapeutischen Kollegen als theoretisches Gerüst entworfen. Sie wurde jedoch zuerst von Entwicklungspsychologen als eine Theorie der seelischen Entwicklung angenommen, die mit ihren Forschungsmitteln überprüfbar war. Auf den entwicklungspsychologischen Forschungsergebnissen basierend hat sie Eingang in die klinische Psychologie und in schulenunabhängige Therapien gefunden. Sie dient dort als immer besser etablierte Grundlage für nachhaltige Interventionen. Sie hat in der Entwicklungs-, der klinischen Psychologie und in der Psychobiologie zu einer außerordentlichen Forschungsaktivität geführt, entsprechend Bowlbys Wunsch nach wissenschaftlicher Überprüfung und Fundierung alter Fragen über die Bedingungen für eine seelisch gesunde menschliche Entwicklung. Ebenso kann sie Fragen beantworten, welche Bedingungen eine gesunde Entwicklung beeinträchtigen.
Den enormen internationalen Zuwachs an neuen empirischen Forschungsergebnissen belegt die 2. Auflage des Handbook of Attachment: Theory, Research and Clinical Applications (Cassidy & Shaver, 2008). In Deutschland zeigen die von Karl Heinz Brisch und Theodor Hellbrügge (seit 2011 nur noch von Brisch) beim Verlag Klett-Cotta herausgegebenen Bände zu den Münchner Bindungskonferenzen und z.B. auch der Sammelband von Bernhard Strauß (2008) die große Bedeutung bindungspsychologischer Erkenntnisse für die klinische Praxis. Langzeituntersuchungen wurden weitergeführt und neue, auch im Erwachsenenalter, wurden begonnen. Verfeinerte Methoden der Erfassung von Bindungsqualitäten und neue Methoden in der Datenanalyse haben Forschungsprojekte auch in angewandten Bereichen ermöglicht: bezüglich Tagesbetreuung, Adoption und Langzeitpflege, zu den Folgen einer Scheidung der Eltern und hinsichtlich einer Kindeswohlgefährdung. Die Anwendungsbereiche erstrecken sich inzwischen „von der Wiege“, der Neonatologie (Brisch & Hellbrügge, 2007), „bis zur Bahre“, der Palliativmedizin (Petersen & Köhler, 2005, 2006), wie John Bowlby es sich vorstellte (Bowlby, 1979 a/2001, S. 160).
In der vorliegenden Neuauflage wurden viele Quellen, die in der 2004 erschienenen Erstauflage angegeben waren, durch neue Veröffentlichungen ersetzt. Es hat uns erstaunt, wie gut die neuen Forschungsergebnisse in das Grundkonzept der Bindungstheorie passten. Besonderes Gewicht haben die Bedingungen und Folgen desorganisierter Bindungsunsicherheit erhalten. Der Zuwachs ist beeindruckend, den es im genaueren und differenzierteren Wissen für die klinische Praxis (Strauß, 2008; Steele & Steele, 2008 a), für die erzieherische Arbeit in der Frühpädagogik (Ahnert, 2010; Becker-Stoll & Textor, 2007; Suess & Burat-Hiemer, 2009), für die Erziehungsberatung (Sunderland, 2007) und in der Bindungspsychologie Erwachsener (z.B. Mikulincer & Shaver, 2007; Rholes & Simpson, 2004) gegeben hat. Neurophysiologische Untersuchungen haben unser Wissen über genetische Einflüsse revolutioniert. Man erkannte über Artengrenzen hinweg, dass die epigenetische Genexpression (die von der Umwelt beeinflusste ausgeführte oder behinderte Aktivität der Gene) entscheidend von der Qualität der Fürsorge abhängt. Eine angemessene bemutternde Fürsorge kann eine Disposition zu Überreaktionen auf Stress verhindern, aber ebenso kann mangelnde Fürsorge eine Disposition zu ausgeglichenen Reaktionen auf Stress in Überreaktionen verwandeln (Spangler, 2011; Suomi, 2003).
Wir haben uns weiterhin auf die Entwicklung und Erscheinungsformen psychischer Sicherheit konzentriert. Was sind Kennzeichen – in Interaktionen und in Dialogen – für gegenseitige Wertschätzung, für liebevolle Fürsorge, für eine Unterstützung des Schwächeren oder weniger Kundigen und für die Hilfsbereitschaft bei Überforderung? Wir haben dies für jede Altersgruppe beschrieben, für das Säuglings- und Kleinkindalter, das Schul- und Jugendalter, das Erwachsenenalter bis zum höheren Alter. Psychische Unsicherheiten waren in den von uns untersuchten Nicht-Risiko-Gruppen durch Einschränkungen und Störungen möglicher Entfaltung, Einschränkungen in der seelischen Gesundheit und durch Verzerrungen in den Interaktionen in engen sozialen Beziehungen gekennzeichnet. Für bindungsunsichere Entwicklungswege beschrieb John Bowlby die Folgen so: „Wenn die Sehnsucht nach Liebe und Zuneigung verschlossen ist, bleibt sie unzugänglich. Dann richtet sich Ärger auf die falschen Ziele, Angst tritt in unangemessenen Situationen auf, und Feindseligkeit wird von falscher Seite erwartet.“ (Bowlby, 1988d/2008, im Orig. S. 117). Das können wir auch auf der Basis unserer Ergebnisse in der Grundlagenforschung bestätigen.
Die Kenntnis einer unbeeinträchtigten Bindungsentwicklung kann Fachleuten in den helfenden Berufen als Bezugsrahmen dienen, um Einschränkungen in der psychischen Sicherheit in ihren vielen Erscheinungsformen zu erkennen. Mit dem Blick auf eine normale Entwicklung, die angemessenen sozialen Bedingungen und gesunde Bewältigungsmethoden wird eher deutlich, was in der Entwicklung zu psychischer Unsicherheit gefehlt hat. Mit Hilfe des Bezugsrahmens „psychische Sicherheit“ können nicht nur genauer die Mängel und nachteiligen Einflüsse im Leben der belasteten Person erkannt werden, sondern auch, was im Verhalten und in der Vorstellung zu verändern ist, um den Einklang mit sich und den seinen zu verbessern. Diese Perspektive ist der „Gewinn“ der Bindungstheorie für die klinische Arbeit.
Wie bereits bei der ersten Auflage gebührt vielen Helfern und Unterstützern unser Dank. Besonders intensiv und wiederum erfreulich und förderlich war, wie bereits bei der ersten Auflage, die Hilfe beim Schreiben und bei der Literatur von Margit Frimberger und stilistisch von Thomas Reichert.
Regensburg, im Juli 2011
Dr. Karin Grossmann, Prof. Dr. Klaus E. Grossmann
TEIL I Historische, biologische und bindungspsychologische Grundlagen
Die Fähigkeit des Menschen, Sprache und andere Symbole zu gebrauchen, sein Vermögen, Pläne und Modelle zu entwickeln, eine lang andauernde Zusammenarbeit und endlose Konflikte mit anderen einzugehen, dies macht den Menschen zu dem, was er ist. All diese Prozesse haben ihren Ursprung in den ersten drei Lebensjahren, und alle sind zudem von den ersten Lebenstagen an Teil der Organisation des Bindungsverhaltens (Bowlby, 1969/2006, S. 358 im Orig.).
KAPITEL I.1 Historische und evolutionsbiologische Wurzeln der Bindungsforschung
I.1.1 Bindung und Bindungstheorie
Bindung (attachment) ist die besondere Beziehung eines Kindes zu seinen Eltern oder Personen, die es beständig betreuen. Sie ist in den Emotionen verankert und verbindet das Individuum mit anderen, besonderen Personen über Raum und Zeit hinweg (Ainsworth, 1973). Die Bindungstheorie wurde von John Bowlby, einem englischen Psychoanalytiker, formuliert. Sie ist im ethologischen Denken der 1960er Jahre entstanden und verbindet klinisch-psychoanalytisches Wissen mit evolutionsbiologischem Denken. In der Bindungstheorie werden vier Betrachtungsebenen miteinander verbunden: eine phylogenetisch-ethologische, eine psychologische, eine ontogenetische und eine klinische. In jüngster Zeit sind durch die Neurowissenschaften und die Psychologie auch die Physiologie und die Epigenetik, d.h. die Beeinflussung der Gen-Expressionen durch Umweltereignisse, hinzugekommen (Spangler, Johann, Ronai & Zimmermann, 2009; Coan, 2008).
Evolutionsbiologisch besteht eine angeborene Bereitschaft des Menschen und damit die Notwendigkeit zur Bindung auf der Grundlage stammesgeschichtlicher Selektionsbedingungen. Ohne Schutz und Fürsorge kann bei sozial lebenden Säugetieren kein Junges überleben. Psychologisch, in der wirklichen Erfahrung jedes einzelnen Menschen, können die individuellen Qualitäten von Bindung des Kindes an seine Eltern im ersten Lebensjahr bereits sehr verschieden sein. Diese Unterschiede haben Folgen für das Individuum während des Lebenslaufs (Ontogenese). Die Bindungsforschung untersucht die Art individueller Verinnerlichung unterschiedlicher Bindungserfahrungen und ihre Auswirkungen auf die Organisation der Gefühle, des Verhaltens und der Ziele einer Person. Die Verinnerlichung dessen, wie man sich als handelndes Individuum erlebt, entsteht primär aus dem Zusammensein mit den Bindungspersonen: den Eltern, Adoptiv- oder Pflegeeltern und anderen Personen, die dem Kind nahestehen.
Die evolutionsbiologisch andere Seite des Bedürfnisses eines Kindes nach Schutz und Fürsorge ist die meist unbewusste Kalkulation der Eltern, ob und wie viel sie in dieses Kind investieren wollen. Während ein junges Kind unmittelbare Reaktionen seiner Bindungsperson einfordert, sind die elterlichen Perspektiven eher langfristig auf ihre eigene reproduktive Fitness ausgerichtet, und sie müssen vielfältige Aufgaben in ihrem Leben und ihrer Familie berücksichtigen. Die Vernachlässigung eines „unpassenden“ Kindes könnte dem Wohlergehen eines oder mehrerer anderer Kinder dienen. Mit dieser Kalkulation könnten sie die Anzahl ihrer Nachkommen in der übernächsten Generation erhöhen (George & Solomon, 2008; Simpson & Belsky, 2008; Trivers, 1974).
Historisch und allgemein ist von bindungstheoretischem Interesse, wie in verschiedenen Epochen, Kulturen und Gemeinschaften mit dem angeborenen Bindungsbedürfnis des Menschen umgegangen wird (Grossmann, K. E., 1995). Im Detail wissen wir darüber leider noch wenig, aber Schutz und Fürsorge wird Kindern in allen Kulturen gegeben, und kleine Kinder aller Kulturen flüchten bei Angst zu ihrer Bindungsperson (Grossmann, K. E. & Grossmann, K., 2005).
Die Bindungstheorie befasst sich also mit der emotionalen Entwicklung des Menschen, mit seinen lebensnotwendigen soziokulturellen Erfahrungen und vor allem mit den emotionalen Folgen, die sich aus unangemessenen Bindungserfahrungen ergeben können. Sie war von Bowlby primär als klinische Theorie geschaffen worden, um „die vielen Formen von emotionalen und Persönlichkeitsstörungen, einschließlich Angst, Wut, Depression und emotionale Entfremdung, die durch ungewollte Trennung und Verlust ausgelöst werden, zu erklären“ (Bowlby, 1969/2006; 1973/2006, S. 57). Mittlerweile sind einige der Bedingungen erforscht worden, die zu Unterschieden in der Organisation der Gefühle und des Verhaltens führen, und man hat herausgefunden, welche Auswirkungen sie im Lebenslauf haben (Grossmann, Grossmann & Waters, 2005). Dies geschah zunächst, vorbereitet durch psychoanalytische Überzeugungen, im Rahmen einer verhaltensbiologischen Konzeption aus der Zeit der klassischen Ethologie (Bowlby, 1969/2006; Grossmann, Grossmann et al., 2003).
Die empirische Bindungsforschung überprüft Annahmen und Vorhersagen der Bindungstheorie über Unterschiede im sozial-emotionalen Verhalten zwischen Menschen über alle Altersstufen hinweg. Sie begann in den 1950er und 1960er Jahren mit grundlegenden Beobachtungen im Säuglings- und Kleinkindalter. Sie befasste sich zunächst mit der allgemeinen Bindungsentwicklung, mit unterschiedlichen Bindungsqualitäten, dem Einfluss der mütterlichen Feinfühligkeit, mit unterschiedlichen Bindungsqualitäten zu Mutter, Vater und anderen Bindungspersonen, mit Unterschieden bei Trennungs- und Wiedervereinigungsreaktionen von Säuglingen und mit Veränderungen in ihrem kommunikativen Ausdrucksverhalten. Darauf aufbauend und unter Berücksichtigung von Bowlbys Bindungstheorie als altersübergreifendem Paradigma wurden in den nachfolgenden Jahren zahlreiche Kinder und ihre Familien von verschiedenen Forschern längsschnittlich, von Geburt an bis zum 22. Lebensjahr, untersucht. Ergebnisse für spätere Altersstufen liegen inzwischen vor. Eltern, Geschwister und sogar Großeltern wurden wiederholt einbezogen. Darüber wird in den folgenden Kapiteln berichtet.
Bindungstheoretische Überlegungen im weitesten Sinne motivierten bereits Karl Philipp Moritz zum ersten psychologischen Roman der Weltgeschichte, der vor über 200 Jahren geschrieben wurde. Im autobiographischen Roman Anton Reiser, der von 1785 bis 1790 in vier Bänden veröffentlicht wurde, versucht Moritz zu erkunden, warum sein Leben so jammervoll verlief. Er suchte nach Erklärungen z.B. für die panische Angst, die ihn überkam, als ein früherer Logiskollege eines Tages verhaftet wurde. Er sah seine Angst als „eine natürliche Folge seines von Kindheit an unterdrückten Selbstgefühls …“ (Moritz, 1987, S. 185).
Eine wissenschaftlich-empirische Methode zur Überprüfung der anekdotischen individuellen Rückblicke als Grundlage für die Analyse tatsächlicher Zusammenhänge war aber damals nicht verfügbar, und wohl auch zur Hoch-Zeit der Psychoanalyse, über 150 Jahre später, noch nicht (Grossmann, K. E., 1995). Es wurden keine Prüfmethoden entwickelt und keine systematischen Untersuchungen durchgeführt.
I.1.2 Die kritische Rolle individueller Entwicklung in der Psychologie
Im Wien der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, in dem die Ideen Freuds bereits 20 Jahre lang diskutiert worden waren, arbeitete das Ehepaar Karl und Charlotte Bühler am Psychologischen Institut der Universität. Karl Bühler sah in der leider forschungsfeindlichen Doktrin der äußerst einflussreichen Psychoanalyse eine „Krise der Psychologie“ (Bühler, 1927). Andererseits hatte nach Ansicht von Charlotte Bühler und Hildegard Hetzer (1929) Wilhelm Wundt den naturwissenschaftlichen Geist, von dem er dachte, er müsse sich an dem Weltbild der Physik orientieren, endgültig für die Psychologie erobert. Karl Bühler hatte ein Dilemma erkannt: Die Psychologie habe noch keinen eigenen Weg zwischen einem am Weltbild der Physik des 19. Jahrhunderts orientierten experimentellen Ansatz auf der Ebene von Variablen und einer „Psychologie des Verstehens“ (Dilthey, 1957; Orig. 1894) gefunden. Auch heute noch plagt sie sich damit.
Charlotte Bühler und Hildegard Hetzer (1929) wiesen bereits damals auf eine Schwäche der Gesamtpsychologie hin – die auch heute noch besteht –, dass nämlich „… Leistung als Lebensbewältigung und somit das eigentliche Problem der menschlichen Handlung außerhalb ihres [der Psychologie] Rahmens fiel“. Karl Bühlers theoretische Wendung weg von der Physik, aber auch weg von der wissenschaftsfeindlichen Psychoanalyse hin zur Biologie als „Mutterwissenschaft“ bahnte sich damals an. Er hätte vielleicht also schon 1927 den Weg für eine Art Bindungstheorie ebnen können.
I.1.3 Die Bindungstheorie zwischen Psychoanalyse und Entwicklungspsychologie
Die Bindungstheorie entstand in den 40er und 50er Jahren des letzten Jahrhunderts in der Auseinandersetzung des englischen Psychiaters und Psychoanalytikers John Bowlby mit der Theorie der Psychoanalyse. Er arbeitete und forschte an der Tavistock-Klinik in London. Er integrierte die damals neue Beobachtungssystematik der Ethologie, die Erkenntnisse der Kontrolltheorie und der kognitiven Psychologie (Bowlby, 1991/2003). John Bowlby, der die Bindungstheorie und ihre wissenschaftlichen Grundlagen zunächst in öffentlichen Vorträgen bekanntmachte, wurde wegen seines empirischen Ansatzes von psychoanalytischen Kollegen angegriffen (Holmes, 2002). Sein Denken und seine Vorgehensweise zeigten sich erstmals in einer Untersuchung an 44 jugendlichen Dieben.
John Bowlby erkannte die unbedingte Notwendigkeit von empirischer Forschung. Die Bindungstheorie begann folglich als ein Versuch, die Ursprünge des Selbstwertgefühls in frühen und andauernden Bindungsbeziehungen von Personen zu sehen und dies so objektiv wie möglich zu untersuchen (Bowlby, 1988 e/2008). Die Bindungsforschung konnte sich so entwicklungspsychologisch und klinisch etablieren.
Eine empirische Umsetzung der Bindungstheorie im Kleinkindalter gelang in den 1950er Jahren Mary Ainsworth in einer Felduntersuchung in Uganda (Ainsworth, 1967). Sie führte die besondere, individuelle Qualität der Bindung zwischen Mutter und Kind auf bestimmte qualitative Verhaltensreaktionen der Mütter auf kindliches Ausdrucksverhalten („Signale“) zurück. Ihre Beobachtungskategorien legten die Grundlagen zu entsprechenden Beobachtungen in der häuslichen, „natürlichen“ Umwelt von Säuglingen in Baltimore, USA (s. die übersetzten Beiträge von Mary D. Ainsworth in Grossmann, K. E. & Grossmann, K., 2003). Validiert wurden die Hausbeobachtungen durch eine standardisierte Beobachtungssituation, „Fremde Situation“ genannt. Diese Laborsituation erfasste prospektiv am Ende des ersten Lebensjahres die gelernten Erwartungen des Krabbelkindes bezüglich der Zugänglichkeit der Mutter bei Leid, das durch Trennung herbeigeführt wurde. Die so beobachteten Verhaltensmuster wurden von Mary Ainsworth „Bindungsqualitäten“ genannt und sehr detailliert beschrieben. Die Frage, ob die im Alter von einem Jahr beobachteten Bindungsqualitäten auch spätere Bindungsentwicklungen anbahnen oder gar vorhersagbar werden lassen konnten, blieb nachfolgenden Langzeituntersuchungen überlassen, über die wir in diesem Band berichten.
Die im Rahmen der Bindungstheorie behandelten Themen, vor allem die Frage, ob Kindheitserfahrungen mit den Bindungspersonen einen langfristigen Einfluss auf die Persönlichkeit eines Menschen haben, haben eine lange Tradition. Ihre feste Verankerung in der schöngeistigen, fachlichen und wissenschaftlichen Literatur zeigt ihre zentrale Bedeutung für Laien wie auch besonders für die Psychotherapie. Neue Antworten kommen auch von den Neurowissenschaften, wie z.B. von J. Bauer anschaulich dargestellt wurde (Bauer, 2002).
I.1.4 Bowlbys Lösung durch Ethologie und Kontrollsystemtheorie
Bowlby, ein profunder Kenner des Kinderelends im und nach dem Zweiten Weltkrieg (Bowlby, 1951/2010), der selbst als junger Schüler unter englischen Boarding Schools gelitten hatte (Holmes, 1993), wandte sich nach seiner psychoanalytischen Ausbildung der empirischen Wissenschaft zu: Freischwebende Nomenklatur und retrospektive Äußerungen von erwachsenen Patienten seien radikal durch prospektive Untersuchungen, also durch entwicklungspsychologisch orientierte Längsschnittforschung, abzulösen, um Erkenntnis von (Aber-) Glauben und Vorurteilen unterscheiden zu können. Die Methode der Wahl waren zunächst systematische Beobachtungen. René Spitz, Harry Harlow und andere hatten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Terrain vorbereitet (Grossmann, K. E., 1987; Blum, 2010). Die damals noch junge Verhaltensforschung, untrennbar mit den Namen Konrad Lorenz, Niko Tinbergen und Robert Hinde verbunden, bot schließlich den nötigen verhaltensbiologisch-ethologischen Bezugsrahmen (Bowlby, 1991a/2003).
Bowlby verband seine klinische Erfahrung mit Vorstellungen über eine Psychodynamik individueller Anpassung im Rahmen sogenannter Internaler Arbeitsmodelle. Positive, flexible und adaptive Internale Arbeitsmodelle zeichnen sich durch ein hohes Maß an Integrität zwischen inneren und äußeren Erfahrungen aus. Die Integration vor allem negativer Gefühle in eine zielkorrigierte, die Motive anderer berücksichtigende Orientierung ist durch Main, Kaplan und Cassidy (1985) zu einem Leitbild theoretischer Orientierung geworden (Sroufe, Egeland, Carlson & Collins, 2005 a). Die Entwicklung einer sicheren Organisation von Emotionen und Verhalten des Säuglings in Übereinstimmung mit seinen „wirklichen“ Bindungserfahrungen wird durch dasjenige mütterliche Verhalten unterstützt, das Ainsworth als die mütterliche Feinfühligkeit gegenüber den Signalen des Säuglings konzipiert hat. Dies ist der Beginn der Entwicklung des Selbst und des Selbstvertrauens (Bowlby, 1979 c/2001). Der Psychoanalytiker Erik Erikson hatte auch gemäß neuesten Erkenntnissen ganz richtig postuliert, es könne dann kein Urvertrauen entstehen, wenn sich nicht zumindest eine Person zuverlässig und liebevoll um den Säugling kümmere (Erikson, 1957). Die Versagung der frühkindlichen Grundbedürfnisse nach Liebe, Schutz und Fürsorge bewirkt auch psychobiologisch eine Spannungszunahme, Unlust, Unsicherheit und physiologische Dysregulation (Bühler, 1959; Spangler et al., 2002).
Während die Psychoanalyse also zentrale Fragen bereitstellte, lieferte die Ethologie oder Verhaltensbiologie die Grundlagen zu ihrer Erforschung. Daraus ergaben sich Konsequenzen für die Methodologie, für die Erklärungsansätze der beteiligten Prozesse und Folgen, die die Bindungsforschung in mancherlei Hinsicht auch von traditionellen Forschungsansätzen der Psychologie unterscheidet. Zu nennen sind hier vor allem die Beobachtung des Ausdrucks von Gefühlen und des Verhaltens mit seinen Signalwirkungen, die prospektive entwicklungsorientierte Untersuchungsplanung und der systemische Ansatz. Durch Beobachtung ergibt sich die Möglichkeit zur objektiven Erfassung von Parametern individuellen Verhaltens bzw. von emotionalen Bewertungen in kommunikativen Prozessen. Vor allem in der frühen Kindheit kann man von einer weitgehenden Parallelität zwischen den inneren Vorgängen und dem Verhalten ausgehen, so dass sich die Analyse von Verhaltensweisen als ein Zugang zu den sich gleichzeitig vollziehenden geistigen Prozessen erweist. Durch Verhaltensbeobachtung können frühe Phasen in der Entwicklung objektiv beschrieben und die Bedingungen und Konsequenzen einer spezifischen Persönlichkeitsentwicklung in konkreten Situationen untersucht werden. Dabei wird das Kind nicht als Einzelwesen beobachtet, sondern im Zusammenspiel mit seiner Bindungsperson als natürliche Einheit.
An die Stelle von psychoanalytischen Begriffen über psychische Energie in Form von „Trieben“ und ihrer Entladung tritt bei Bowlby das Konzept der Verhaltenssysteme und ihrer Steuerung oder Regulierung. Verhaltenssysteme werden durch spezifische Informationen gesteuert, die sowohl aus der Umwelt als auch aus dem Organismus selbst kommen können (vgl. auch Bischof, 1975). Dadurch ist die Grundlage für „zielkorrigiertes“ Verhalten im Rahmen eines hierarchisch organisierten Regelsystems gegeben: Durch den Vergleich der Bedürfnislage des Organismus mit der gegebenen Situation (Sollwert/Istwert) erhält der Organismus Informationen über die Wirksamkeit seiner Aktionen auf die Umwelt und über den Einfluss der Umwelt auf den Organismus. Daraus folgen entsprechende „Anleitungen“ zur weiteren Steuerung des Verhaltens (Bowlby, 1969/2006, Kap. 13), die zu Internalen Arbeitsmodellen bzw. zu Regelsystemen werden (Bretherton & Munholland, 2008). Es geht also in der Bindungstheorie nicht um mentale Zustände und um die Bewertung von Gefühlen allein („emotional appraisal“), sondern immer, quasi dialektisch, um ihr Zusammenspiel mit der Wirklichkeit („situational appraisal“) (Bowlby, 1982). Innere Regeln zeigen sich dann am deutlichsten, wenn vom Individuum eine Anpassung an reale Gegebenheiten, die belastend sind, gefordert ist. In Bindungsbeziehungen ist das immer mit Gefühlen verbunden, weil die Emotionen im phylogenetischen Programm eines jeden Individuums verankert sind (Cosmides & Tooby, 2000; Buss, 2008). Ein Säugling muss sich zunächst an die individuellen Besonderheiten seiner Bindungspersonen anpassen. Er kann sich seine Bindungspersonen nicht auswählen. Seiner Natur nach wird er mit der Erwartung geboren, dass mindestens ein starker und kluger Erwachsener sich schützend, liebevoll, fürsorglich und kulturvermittelnd um ihn kümmert. Sind die Eltern jedoch nur eingeschränkt bereit, sich um diesen Säugling zu kümmern, hat das Neugeborene keine Wahl und muss sich dennoch an diese Eltern binden. Dieser Entwicklungsprozess führt dazu, dass der Säugling über die besondere Art und Weise des Verhaltens der Bindungspersonen besonders im Umgang mit ihnen allmählich Erwartungen ausbildet.
I.1.5 Die Bedeutung von Verhaltenssystemen
Verhaltenssysteme haben ihren Ursprung in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit, in deren Verlauf sie einen bestimmten Überlebenswert gewonnen haben („evolutionary adaptedness“). Die Funktion des Bindungsverhaltens, welches die Nähe zur Mutter herstellt bzw. aufrechterhält, sieht Bowlby erstens in der Gewährleistung des Schutzes des Kindes vor Gefahren, die das Kind noch nicht kennt (s.a. Goldberg et al., 1999), und in der der Angst des Kindes vor Fremden und daher meist nicht verwandten Mitmenschen, die kein Interesse an einer Fürsorge für „fremde Gene“ haben. Dies mag in der menschlichen Entwicklungsgeschichte jahrmillionenlang einen entscheidenden Überlebenswert gehabt haben. Die Anthropologin Sarah Blaffer Hrdy hält die Annahme, das kindliche Bindungsbedürfnis sorge für einen Überlebensvorteil, aufgrund ihrer vielen Untersuchungen an Primaten für zutreffend. Sie schreibt: „Die Aufrechterhaltung mütterlicher Zuwendung war einst für das Überleben eines Säuglings genauso wichtig wie die Luft zum Atmen, und daran hat sich bis heute wenig geändert“ (Hrdy, 2000, S. 436). Zweitens hat das Kind darüber hinaus in der Gesellschaft seiner Familie die Möglichkeit, Tätigkeiten und Dinge zu erfahren, die es auf sein Überleben und seine Rolle in der Gemeinschaft vorbereiten. Vererbt sind hierbei nicht die Emotions- und Verhaltenssysteme selbst, sondern das Potential, bestimmte Verhaltenssysteme zu entwickeln, deren Wesen und Ausprägung sich ontogenetisch qualitativ unterschiedlich ausbilden können und erst so für bestimmte Realitäten adaptiv werden (Simpson & Belsky, 2008). Das genetische Programm muss also die Möglichkeit enthalten, für die Ausbildung eines Phänotyps, eines Individuums, verschiedene Wege gehen zu können. Das Individuum reagiert dann auf die besondere Qualität der Regulation von außen durch die Bindungsperson, die auf den Ausdruck seiner Emotionen reagiert.
Bindung beruht auf evolutionär gewordenen Vorgaben. Die umfassendste Vorgabe ist die Selektion der genetisch verankerten Strategien darüber, wie viele Nachkommen gezeugt werden und wie viel „Investitionen“ sie nachgeburtlich seitens der Eltern („parental investment“; Trivers, 1972) und auch anderer Verwandter (inklusive „fitness“; Hamilton, 1964) erhalten. Die evolvierten Gegensätze sind die R-Strategie und die K-Strategie. Bei der R-Strategie wird die Anzahl der Nachkommen maximiert und die elterliche Investition minimiert. Dies hat eine äußerst geringe Überlebenschance eines einzelnen Nachkommen zur Folge, aber es überleben genug Individuen, um die Art zu erhalten. Säugetiere entwickelten eine K-Strategie der Fortpflanzung, bei der die Anzahl der Geburten begrenzt und die elterliche Investition maximiert wird. Bei der K-Strategie hat jeder der wenigen Nachkommen wegen des genetischen Programms elterlicher Investition bessere Überlebenschancen. Bei Primaten einschließlich des Menschen entwickelt sich durch eine liebevolle, individuelle Bindung mit jedem einzelnen Kind und mit nur wenigen Kindern während der gesamten Jahre der physiologischen Unreife, also bis ins frühe Erwachsenenalter hinein, die Fähigkeit, adaptiv mit den Anforderungen ihrer Gruppe bzw. ihrer Mitmenschen und ihrer Kultur umzugehen. Dieses ist sicher das komplexeste aller offenen genetischen Programme, das in seinen Ausgestaltungen vollkommen auf Bindungen angewiesen ist (Polan & Hofer, 2008).
In der Entwicklungsgeschichte des Menschen, unter den Bedingungen des evolutionären Angepasstseins, brachte eine Frau im Durchschnitt etwa alle drei bis vier Jahre ein Kind zur Welt. Rein rechnerisch bekam sie also höchstens vier bis fünf Kinder, wenn sie mit 20 Jahren geschlechtsreif und mit 40 Jahren unfruchtbar wurde. Die besonderen Umstände während der Zeit des enormen Bevölkerungswachstums in Europa, als Kinder manchmal im Jahresabstand geboren wurden, gehören zu kulturell neuen Lebensbedingungen bei großem Nahrungsangebot, die sich von den evolutionären Lebensbedingungen weit entfernt haben. Es ist unmittelbar einsichtig, dass unter solchen, von der Anpassung an die ursprüngliche evolutionäre Umwelt abweichenden Lebensbedingungen (Bowlby, 1969/2006) die Qualität elterlicher Investition gelegentlich nachlässt und die Kinder dann darunter leiden müssen (Ariès, 1975; Badinter, 1984; DeMause, 1974; Grossmann, K. E., 1987, 1995). Wenn einer Mutter jedoch „Helfer am Nest“ (Hrdy, 2000) zur Verfügung stehen, kann ein Mangel elterlicher direkter Fürsorge ausgeglichen werden (Ahnert, 2010; Hrdy & Schmidt, 2010).
Das phylogenetische Erbe stattet den Säugling von Anfang an mit grundlegenden Bedürfnissen und mit kommunikativen Fähigkeiten wie Signalverhalten, Orientierungsfähigkeit und Erkenntnishunger aus (Gropnik, Kuhl & Meltzhoff, 2001). Diese und das mütterliche Fürsorgeverhaltenssystem sind „präadaptiv“ aneinander angepasst und bilden die Grundlage zur Ausbildung einer sozio-emotionalen Beziehung („affectionate systems“; Harlow & Harlow, 1971). Einige Erkenntnisse aus psychobiologischer Sicht werden im folgenden Kapitel dargestellt.
KAPITEL I.2 Psychobiologie der Bindung und Trennung: Erkenntnisse aus der Erforschung sozial lebender Tiere
I.2.1 Physiologische Grundlagen
Für Freud als Arzt war seinerzeit klar: All unsere provisorischen Vorstellungen in der Psychologie werden aller Voraussicht nach eines Tages auf eine organische Grundlage gestellt werden. Damit ist bereits vor längerem begonnen worden. Die psychologische Grundannahme der Bindungstheorie lautet (s.a. Kap. I.5): Das menschliche Streben nach Nähe zu vertrauten anderen bei Angst und Trauer, um bei ihnen Schutz und Beistand zu finden, beruht auf einer lebensnotwendigen Verhaltensdisposition besonders während der Zeit der Unreife (Bowlby, 1991b/2003). Zusammen mit anderen, die stärker und klüger sind, kann ein Mensch Schwierigkeiten besser meistern. Die Ansicht, dass ein Streben nach Nähe und Schutz in belastenden Situationen ein Anzeichen von Schwäche sei, kann im Hinblick auf die vergleichende Verhaltensforschung nicht aufrechterhalten werden. Statt Unabhängigkeit fordert das Menschenbild der Bindungstheorie Autonomie in Verbundenheit (Becker-Stoll & Grossmann, 2002; Bowlby, 1991b/2003; Ryan, Deci & Grolnick, 1995).
Vor allem in der Zeit der Unreife kann der Mensch nicht allein überleben. Er ist von Natur aus ein soziales Wesen. Wie bei allen gemeinschaftlich lebenden Säugetieren sind soziale Bindungen die Grundlage seiner Sozialstrukturen (s.a. Carter, Lederhendler & Kirkpatrick, 1997; Carter, Ahnert, Grossmann, Hrdy et al., 2005). Bei vielen Tierarten erhöhen der Gruppenzusammenhalt und besonders das Fürsorgeverhalten von Elterntieren die Überlebenschancen eines jeden Individuums und damit der ganzen Art. Auch die meisten menschlichen Aktivitäten, vor allem elterliche Fürsorge und Paarbildung, finden innerhalb sozialer Gruppen statt. Die Gruppe ermöglicht gegenseitigen Schutz während der elterlichen Fürsorge für die Jungen und sorgt damit gleichzeitig für ihren Erhalt. Damit dieses Ziel nicht gefährdet wird, haben sich zahlreiche, fast automatische organische Mechanismen im Verhalten und in den physiologischen Systemen von sozial lebenden Tieren einschließlich des Menschen entwickelt, die seit etlichen Jahren zum Gegenstand eigenständiger Forschungsgebiete geworden sind (siehe die Sektion „Biological Perspectives“ in Cassidy & Shaver, 2008; Carter et al., 2005).
Nach Panksepp (1998) ist das Gehirn des Menschen als Steuerungsinstanz ein Organ, das auch die stammesgeschichtlich alten Strukturen der Säugetiere widerspiegelt, die in unseren Genen enkodiert sind (s.a. MacLean, 1990). Mit der Kenntnis dieser grundlegenden Strukturen kann man menschliches Verhalten besser verstehen als ohne sie. Hirnphysiologische Veränderungen sind gelegentlich überzeugendere, greifbarere Indikatoren und haben „Substanz“ im Vergleich zu den komplexen Zusammenhängen im Verhalten, die die Sozialforschung entdeckt. Trotzdem sind Hirnstrukturen während der Entwicklung des Gehirns hauptsächlich die Folge und weniger die Ursache sozialer Erfahrungen (Coan, 2008).
I.2.2 Prägung
Die Stammesgeschichte des Sozialverhaltens von Tierarten belegt eine zunehmend wichtigere Rolle individueller Beziehungen und Bindungen (Fleming, 2005). Unter den Vogelarten und Säugetierarten haben sich unterschiedliche Formen elterlicher und kindlicher Verhaltensstrategien entwickelt, die alle garantieren sollen, dass das Jungtier überlebt. Bei nesthockenden Vögeln und Säugetieren kennt das Muttertier das Nest und kehrt mit Nahrung oder zum Säugen dorthin zurück. Die Jungen müssen nur den Schnabel aufsperren bzw. die Zitze finden, um Nahrung zu erhalten. Außerhalb des Nestes haben sie kein Verhaltensmuster, um das Nest oder das Muttertier wiederzufinden, sondern sind darauf angewiesen, von der Mutter zurückgeholt zu werden, wobei – wie etwa bei jungen Katzen und Hunden – vom Jungtier eine Tragehaltung eingenommen wird.
Bei Schafen und anderen Huftieren, deren Junge bald nach der Geburt allein laufen können, kann man eine Prägung des Muttertieres beobachten (in der USamerikanischen Literatur „bonding“ genannt, im Unterschied zu „attachment“, dem Bindungsprozess des Kindes, s.a. Carter et al., 2005). Es erkennt seine Jungen am Geruch und verjagt jedes anders riechende Jungtier. Diese Mutterprägung scheint aber mit dem Ende der Nahrungsabhängigkeit des Jungtieres vom Muttertier zu erlöschen. Bei Schafen wird die Mutterbindung stark durch die große Anhänglichkeit des Lammes unterstützt. Lämmer zeigen extremen Trennungsprotest (Cairns, 1966). Bei Gänse- und Entenvögeln bewirkt das biologische Programm, dass sich die Küken sehr schnell nach dem Schlüpfen auf das individuelle Aussehen ihres Muttertieres prägen und ihm überallhin folgen. Konrad Lorenz und viele andere Verhaltensforscher konnten das Prägungsprogramm sogar täuschen und boten sich selbst den frisch geschlüpften Küken als Muttertier zur Nachfolge-Prägung an. So lief hinter Lorenz eine Gänseschar her, die ihm als ihrer Prägungsfigur folgte. Wird das Küken älter, verliert es seine Prägung auf das Muttertier, aber es bleibt die Prägung auf seine eigene Art, soziale Prägung genannt, deren Ausbildung wesentlich länger dauert als die Nachfolge-Prägung. Sie garantiert u.a., dass sich das Tier mit einem Artgenossen paaren wird (Lorenz, 1978, S. 222 f.).
Aber selbst das relativ festgeschriebene biologische Programm der Jungtierprägungen kann durch besondere Einflüsse variiert werden. Die Nachfolge-Prägung von Gänseküken konnte noch intensiviert werden, wenn sich das Küken beim Nachfolgen besonders anstrengen musste, weil man z.B. Hürden in seinen Weg zur Mutter eingebaut hatte. Wenn man andererseits dem Gänseküken zwei Menschen als Mutterersatz anbot, prägte es sich auf denjenigen, der seine Ruflaute beantwortete. Die andere Person, die zwar ebenso viele Laute von sich gab, deren Lautäußerungen aber keine unmittelbaren (kontingenten) Antworten auf die Kükenrufe waren, wurde vom Küken nicht als Prägungsfigur gewählt. Selbst das Prägungsprogramm braucht also bestimmte interaktive Erfahrungen, um angeregt zu werden und zu funktionieren.
Primaten (alle Affenarten und der Mensch) haben jedoch kein solches, gleich nach der Geburt voll funktionierendes und schnell ablaufendes Prägungsprogramm. Primaten entwickeln auf der Grundlage sofortiger enger Nähe lebenslange Bindungen (attachments), die erst allmählich im Laufe der Säuglingszeit entstehen und viele Erfahrungen mit der Bindungsfigur erfordern. Beide Bindungspartner müssen einander zunächst individuell kennenlernen und sich aufeinander einstimmen. Sie sind dann ohne emotionale Stressreaktionen nicht mehr beliebig austauschbar, weil die Erfahrungen miteinander fester Bestandteil ihrer Bindungsgefühle und ihrer körperlichen Prozesse sind (Polan & Hofer, 2008, Neumann, 2009).
I.2.3 Schutz durch Nähe
Durch die individuelle Fürsorge der Bindungsfigur wird diese zum Ort der Entspannung und Sicherheit. Wenn ein explorierendes Affenkind Angst bekommt, läuft es auch über Hürden hinweg zur Mutter und klammert sich an sie (Harlow & Harlow). Falls das Junge bedroht oder angegriffen wird, bedroht das Muttertier den Angreifer („protective threat“, schützende Drohung) und schützt so das verletzliche Junge mit ihrem Körper (Harlow, Harlow & Hansen, 1964). In manchen Situationen beseitigt sie auch den ängstigenden Gegenstand. Dies wird vom Äffchen aus seiner sicheren Position am schützenden Körper der Mutter beobachtet, und so lernt es die Gefahren, aber auch die Herausforderungen seiner Umwelt kennen.
Bei einigen Affenarten schützen auch die Männchen die Jungen. Berberaffenmännchen tragen z. T. das Jungtier auf dem Rücken oder setzen sich wie ein Schutzschild hinter das Jungtier und bewachen es (Todt et al., 1992). Das Junge kann sich aus dieser sicheren Position heraus zunächst Unbekanntes anschauen. Mit einem verteidigungsbereiten, wehrhaften Männchen im Rücken traut sich ein Affenkind viel mehr als ohne diesen Schutz zu, z. T. andere, ranghöhere oder stärkere Affenjugendliche anzugreifen oder ihnen zu drohen („protected threat“, beschützte Drohung; Kummer, 1979).
Die positiven Gefühle bei Interaktionen und die Erfahrung, dass nämlich durch Nähe physiologischer Stress abgebaut wird, sowie die negativen Gefühle bei drohender und tatsächlicher Trennung sind Grundlagen oder „Motoren“ (emotionalen Beweggründe) des Verhaltens bei Tier und Mensch. Freude am gemeinsamen Spiel weckt Spiellust, Schutz und Unterstützung machen Mut zur Exploration, Bedrohungen ängstigen und führen zu Flucht, Verteidigung oder Angriff, und Trennungen machen unruhig und führen zur intensiven Suche nach dem Bindungspartner. Trennungen bedingen eine Reihe von Verhaltensmustern beim Jungen wie beim Muttertier, die eine Wiedervereinigung zum Ziel haben, etwa intensives Suchen und Rufen, Distress-Laute und „Weinen des Verlassenseins“, eine aggressive Bereitschaft, gegen Angreifer und Entführer zu kämpfen und Hindernisse aus dem Weg zu räumen, und auch ärgerliches Strafen des Jungen, wenn es sich in Gefahr begibt. Der intensive Wunsch, den anderen wiederzufinden, kann das Verhalten so sehr dominieren, dass Nahrungsaufnahme, Schlaf, Spiel und Sexualität in den Hintergrund treten. Andere Gruppenmitglieder ersetzen nicht das besondere Individuum, an den es gebunden ist.
Die von den Gefühlen angetriebenen Verhaltensweisen finden Entsprechungen oder Resonanzen in körperlichen Reaktionen. Die enge Verkoppelung von Verhalten und Körperfunktionen bei Ratten und einigen Affenarten wurde detailliert erforscht, um Rückschlüsse auf die Psychobiologie von Bindung und Trennung auch beim Menschen ziehen zu können. Jonathan Polan und Myron Hofer (2008) sprechen von verborgenen externen Regulatoren des Körpers junger Ratten und zeigen, dass das Muttertier durch Nähren, Wärme, Berührung, ihren Geruch und vieles mehr eine externe körperliche Regulationsfunktion für das Jungtier hat. Ohne diese externe Regulation können selbst die meisten Körperfunktionen des Jungtieres nicht funktionsgerecht ablaufen. Das Zusammensein mit dem Muttertier ist also für das Jungtier überlebenswichtig. Es ist als genetisch „offenes“ Programm zu verstehen, weil es notwendig gelernte Regulationsprozesse einbezieht.
Polan und Hofer (1999) beschreiben an Beispielen auch die Vernetzung einzelner Systeme beim Menschen wie etwa beim Stillen. Wenn, wie an der Brust, ein neuer Geruch zusammen mit Streicheln präsentiert wurde, lernten Säuglinge diesen Geruch schneller, als wenn der Geruch ohne Hautkontakt gegeben wurde. Zusätzlich wirkte die warme Milch im Magen als wirkungsvolle Belohnung für das Lernen. Warme Muttermilch ist auch nicht nur ein Nahrungsmittel, sondern ihre Wärme, ihr Zuckergehalt, ihr Geruch, das begleitende Saugen und der Hautkontakt beruhigen den Säugling nachhaltig. Auf diese Weise wirkt das An-der-Brust-Trinken auch als Regulator der Herzschlagrate, der Atmung, der Körpertemperatur und, wenn von Rhesusaffen-Jungtieren auf den menschlichen Organismus geschlossen wird, auch auf die Ausschüttung des Wachstumshormons Somatotropin und die Verminderung des Stresshormons Kortisol. Normale Bemutterung reguliert also den gesamten Säugling von seinem Verhalten bis zu seinem Herzschlag. Polan und Hofer (1999) fassen ihre vergleichenden Untersuchungen folgendermaßen zusammen: Das Bestreben eines Jungen, nahe bei seiner Mutter zu sein, wurde ebenso wie seine negativen Reaktionen auf eine Trennung von ihr während der Stammesgeschichte fest im Verhaltensprogramm der Säugetiere verankert.
Die beruhigende Wirkung von Körperkontakt ist nach den Untersuchungen von Panksepp primär in hormonellen Mechanismen im Gehirn des Kindes und der Mutter angelegt (Panksepp, 1998). Körperkontakt stimuliert im Gehirn die Ausschüttung des körpereigenen Opiats Endorphin, das sowohl die Mutter als auch das Jungtier entspannt. Werden beide getrennt, bleibt die Entspannung aus. Der Verlust von hirneigenen Endorphinen durch Trennung kann zwar bis zu einem gewissen Grad durch externe Opiate ausgeglichen werden, aber externe Opiate bewirken z.B. nicht, wie bereits die Forschung von Saul Shanberg (1994) an Ratten zeigte, dass parallel dazu auch das Wachstumshormon Somatotropin oder die zur Proteinsynthese notwendigen Enzyme ausgeschüttet werden. Externe Opiate können die zahlreichen anderen Funktionen des körpereigenen Endorphins nicht in Gang setzen.
In einer Untersuchung mit Hühnerküken konnte dieser Prozess demonstriert werden: Küken, die von ihrer Hennen getrennt werden, piepen normalerweise, laufen suchend umher und sind sehr unruhig. Wenn man ihnen während der Trennung ein Opiat gibt, zeigen sie diese Verhaltensweisen nicht mehr, sondern bleiben passiv. Sie suchen die Henne nicht und bekommen so keinen Körperkontakt, der die anderen physiologischen Prozesse anregt. Im Gegenversuch beließ man Küken bei der Henne, gab ihnen jedoch einen Opiatblocker, um die Wirkung der ausgeschütteten körpereigenen Endorphine zu unterbinden. Die Küken piepten dann unruhig und liefen immer wieder von der Henne weg. Sie verhielten sich, als ob sie getrennt wären. Eigene Hirnopiate (Endorphine) festigen den Bindungsprozess physiologisch, während Fremdopiate diesen Prozess stören (Panksepp, 1998). Neueste neurowissenschaftliche und zellbiologische Forschungen an Ratten, Mäusen und Affen bestätigen die Notwendigkeit und die lang anhaltenden positiven Folgen früher intensiver Fürsorge für die Jungen. Entsprechendes gilt dann für die negativen Folgen von Vernachlässigung. Neumann fasst ihre und die entsprechenden Forschungsergebnisse ihrer Kollegen wie folgt zusammen: „Die Entwicklung des sozialen Gehirns wurde vorangetrieben auf der Basis a) der Aktivierung der Belohnungszentren durch soziale Stimuli, b) der positiven Folgen von engen sozialen Interaktionen auf die Emotionalität (die in sich schon belohnend ist) und c) der negativen Folgen für die Gesundheit, wenn enge soziale Interaktionen fehlen oder plötzlich unterbrochen werden. Z.B. haben soziale Interaktionen wie die zwischen Mutter und Kind oder zwischen Geschlechtspartnern förderliche Wirkungen besonders auf die adaptiven Prozesse, die sich auf die emotionale und physiologische Stressverarbeitung beziehen“ (Neumann, 2009 [Übersetzung K. Grossmann]; s.a. Polan & Hofer, 2008).
In ihren frühen theoriebildenden Schriften hatten Bowlby (1969/2006) und Ainsworth (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978) betont, empfundene Bedrohung und Gefahr sowie das Vertrauen in den Schutz der fürsorgenden Person seien Schlüsselelemente für Bindung. Goldberg et al. (1999) machten damals, im Vorgriff auf neurowissenschaftliche Ergebnisse, den Vorschlag, den ursprünglichen Fokus der Bindungstheorie Vertrauen in den Schutz wieder in den Mittelpunkt der Diskussion um die Funktion von Bindung zu stellen. Auch in der neurowissenschaftlichen Forschung gilt Vertrauen in den Schutz einer Bindungsperson bei Belastung und Angst als stressreduzierend.
James Coan formuliert folgende These: Wenn ein vertrauter anderer (Starker und Weiser) zuverlässig die Überwachung der Umgebung übernimmt, die Ressourcen erkennt und bereitstellen kann, darauf achtgibt, ob irgendwo Gefahr droht, und für Sicherheit sorgt, dann kann die geistige/physische Energie (der Metabolismus des Gehirns), die sonst dafür nötig wäre, „gespart“ werden. Sie kann dann für so nützliche Aktivitäten wie Lernen oder Kommunikation in der aktuellen Situation verwendet werden (Coan, 2008, S. 256).
I.2.4 Trennung und Isolation
Die physiologischen Begleiterscheinungen von Trennung im Körper von Säugetierjungen wurden besonders bei Ratten und Rhesusaffen untersucht. Trennte man Rattenjunge von ihrem säugenden Muttertier, wurden dem Jungtier nicht nur die beruhigenden Effekte von Milch im Magen, sondern auch die positiven Wirkungen vieler Prozesse, die auf die externe Regulation durch das Muttertier angewiesen sind, entzogen. Dies waren die Kontrolle von Schlaf-Wachzuständen, Aktivitätsniveau, Saugmuster, Vokalisation und Regulation des Blutdrucks (Polan & Hofer, 1999). Die Trennungsreaktionen von Rhesus-Äffchen waren: Sie wurden unruhig, sehr aktiv, und sie suchten und riefen intensiv nach ihrer Mutter. Bei anhaltender Trennung zeigte sich folgende Entwicklung: Nach dem zweiten Trennungstag ließ die Aktivität merklich nach, und am dritten Tag hörten sie auf, zu rufen und zu suchen, und wurden passiv, so als ob sie aufgegeben hätten. Sobald sie aber aufhörten, zu rufen und zu suchen, stieg ihr Kortisolspiegel dramatisch an. Außerdem wurde das Wachstumshormon Somatotropin während der Trennungszeit nur in geringen Mengen ausgeschüttet.
Der Organismus reagiert mit der physiologischen Notfallfunktion, wenn er nichts mehr tun kann, um zum Muttertier zu gelangen. Reite und Field (1985) sprechen von einer Art „Sparschaltung“ des Körpers, um länger auf die Rückkehr „warten“ zu können. Nach ihrer Ansicht stellt sich der kindliche Körper bei Trennung vom extern regulierenden Muttertier auf einen verminderten Energieverbrauch ein, vermutlich, um so bis zu seiner Rückkehr überleben zu können. Diese Reaktion geht allerdings „auf Kosten“ einer ebenfalls reduzierten Immunaktivität durch den erhöhten Ausstoß des „Stresshormons“ Kortisol. Dies macht den Organismus anfälliger für Infekte. Vor allem aber verhindert erfolgloses Verhalten weitere Anstrengungen, den „Soll-Zustand“ (das „set-goal“, wie Bowlby, 1969/2006, sagt), nämlich die Herstellung von Nähe zum Muttertier, zu erreichen.
Weitere physiologische Begleiterscheinungen einer Trennung vom Muttertier waren Herzrhythmusstörungen, Störungen des Wach-/Schlafrhythmus – z.B. längerer Schlaf, aber verkürzte Phasen des erholsamen Schlafes (REM-Phasen) –, veränderte Gehirnstrommuster (EEG) und eine vorübergehende Steigerung der Körpertemperatur (Fieber) mit anschließender Hemmung des Wärme-Metabolismus (Untertemperatur) (Laudenslager & Reite, 1984).
In den Primaten-Forschungslabors der Universität von Wisconsin, USA, begann Harry F. Harlow Mitte des letzten Jahrhunderts seine weitreichenden Untersuchungen an mutterlos aufgezogenen Rhesusaffen. Die Affen wurden bis in ihr Erwachsenenalter und dann über weitere Generationen hin fortlaufend untersucht, um die basalen Prozesse der Bindung und der nachteiligen Folgen von Trennung für die soziale, emotionale und physiologische Organisation der Affenjungen zu erforschen (Harlow, 1958; Harlow & Harlow, 1966; s.a. Suomi, 1999, 2008). An diesen „Modellen“ wurden auch Hypothesen für die Entstehungsmechanismen von affektiven Störungen beim Menschen – etwa der Depression – entwickelt (McKinney, 1977).
Das erste, überraschende Forschungsergebnis zeigte: Rhesusaffen-Babys, die nur mit Hilfe von Stoffattrappen aufgezogen wurden, entwickelten eine Bindung zu dieser Attrappe. Sie suchten Sicherheit bei ihr, obwohl die Attrappe nicht auf sie reagierte und auch nicht die Nahrungsquelle des Äffchens war. Nahm man den Äffchen die Stoffattrappe weg, konnten sie nicht spielen, waren nicht neugierig auf neue Sachen, hatten deutliche Angst, umklammerten und verletzten sich selbst und entwickelten Bewegungsstereotypien. Die Motivation der Rhesusäffchen, bei ihrer „Mutter“ Schutz zu suchen, erwies sich als so stark, dass sie, statt zu fliehen, Hindernisse und angsteinflößende Gegenstände übersprangen, um zu ihr als Sicherheitsbasis zu gelangen. Hatten sie ihre „Mutter“ erreicht, umklammerten sie sie fest, wodurch ihre Erregung abnahm. In weniger erregtem Zustand konnten sie sich dann umschauen und begannen zu erforschen, was ihnen Angst gemacht hatte. Von der sicheren Basis aus konnten sie sich Neues, sogar Ängstigendes in allmählich längeren und weiteren Erkundungsschüben vertraut machen (Harlow, 1958). Die Attrappen konnten ihnen kein Sozialverhalten vermitteln. Sie waren aggressiv (Kraemer & Clark, 1996), und es mangelte ihnen an angemessenen „taktvollen“ Verhaltensweisen in der sozialen Gruppe. Deborah Blum (2010) hat ein hervorragendes Buch über Harry Harlow, seine Affenversuche und die Entdeckung der Mutterliebe geschrieben.
Im Anschluss an Harlows Untersuchungen an Rhesusaffen entstanden viele Primaten-Forschungslabors, die Bedingungen für eine angemessene soziale Entwicklung untersuchten. Bowlby berichtet in Kapitel 4 seines Buches Trennung ausführlich über die frühen Studien zu den Auswirkungen von Trennungen vom Muttertier auf das Jungtier (Bowlby, 1973/2006; s.a. Dornes, 2000). Bowlby betonte einerseits, dass es auch unter den jungen untersuchten Affen große individuelle Unterschiede in ihren Reaktionsmustern gab. Jedoch waren viele Reaktionsweisen des Jungen auf das mütterliche Verhalten sowohl vor als auch nach der Trennung zurückzuführen. Die häufigsten Distress-Reaktionen zeigten die Äffchen, deren Mütter ihr Annäherungsverhalten schon vor der Trennung und auch nach dem Ende der Trennungszeit chronisch zurückwiesen (Hinde & Spencer-Booth, 1971). Auch bei kleinen Kindern weiß man um die nachteiligen Auswirkungen einer schlechten Eltern-Kind-Beziehung auf ihre Verarbeitung von Trennungen wie Krankenhausaufenthalten (Grossmann, K., 1988; Prugh, 1983; Prugh & Eckhardt, 1980).
Spätere Fortschritte in der Hirnforschung machten es einem jungen Mitarbeiter von Harlow möglich, die besondere Passung und die systemische Vernetzung der neuronalen Strukturen im Gehirn zusammen mit den physiologischen Reaktionen zu untersuchen (Kraemer, 1992; Kraemer & Clark, 1996). Nach ihren Forschungsergebnissen und in Übereinstimmung mit den Befunden von D. Siegel (1999, s.a. Kap. I.3) hängt ein adäquates Funktionieren des Gehirns, d.h. ein kohärentes Zusammenspiel von neuronalen Aktivitäten, das zu zielgerichteter Aktivität führt, von einer sozialen Bindung ab. Ohne sie mangelt es an den notwendigen neuronalen Verbindungen (Braun, Helmeke & Bock, 2009).
Äffchen, die ohne Mutter aufgezogen worden waren, reagierten z.B. entweder mit zu viel oder zu wenig Stresshormonen bei Belastung. Die Steuerung ihrer Feinmotorik und des Lernens ist im Normalfall von einer angemessenen Dosierung des Noradrenalins abhängig. Die Aufregung, etwas Neues zu erleben, und die damit oft verbundene konfliktreiche Spannung (Berlyne, 1960) konnten sie nicht wirksam genug steuern. Es gelang ihnen nicht, ihre Neugier durch anhaltende Konzentration aufrechtzuerhalten. Ihre „Aufregung“ führte schließlich zu völliger Desorganisation und Orientierungslosigkeit.
Auch die Enzyme, etwa die von Insulin, waren mangelhaft aufeinander abgestimmt. So wurden zu wenig wichtige Enzyme ausgestoßen, so dass einige innere Organe Funktionsstörungen entwickelten. Das Hormon Noradrenalin wurde bei mutterloser Aufzucht in weit geringerem Maße ausgeschüttet, was weitreichende negative Konsequenzen hatte, da es zur Regulation der Feinabstimmung innerhalb der Verhaltenssysteme notwendig ist. Durch die soziale Isolation wurde z.B. sogar das Ess- und Trinkverhalten der Äffchen so gestört, dass sie häufig zu viel oder zu wenig aßen und tranken.
Mutterlos aufgewachsene Äffchen konnten auch die sozialen Verhaltensregeln ihrer Gruppe nicht lernen. Diese Jungtiere zeigten z.B. keine Impulskontrolle, wenn sie aggressiv wurden. Ihr aggressives Verhalten war unangemessen, und zwar sowohl in der Art, bemessen am Auslöser, als auch in seinen Zielen. Sie konnten nicht mehr aufhören zu kämpfen, es sei denn, sie wurden handlungsunfähig gemacht. Außerdem verhielten sie sich aggressiv auch in für sie sozial attraktiven Situationen. Sie zeigten auch später vielfach kein angemessenes Sexualverhalten und versagten häufiger bei der Fürsorge für ihre Jungen, ein Ergebnis, das mit den Forschungsergebnissen aus der Forschungsstation von Harry Harlow übereinstimmte (Harlow, Harlow & Hansen, 1964; McKinney, 1977; Suomi, S. J., 1999). Darüber hinaus lernten sie schlechter bei Lernaufgaben in Experimenten (Kraemer, 1992; Kraemer & Clark, 1996).
In weiteren Untersuchungen über die Auswirkungen eines Entbehrens der Mutter vermied man die Effekte, die auf soziale Isolation zurückzuführen waren, indem man die Äffchen gleich oder später in Gruppen mit anderen ebenfalls von ihren Müttern getrennten Jungen aufzog. Viele der sozialen Verhaltensstörungen wurden gemildert, so dass die Tiere teilweise „normal“ wirkten (Kraemer, 1992; Novack & Harlow, 1975). Unter Stress konnten die mutterlos aufgezogenen Jungen jedoch ihre Verhaltensorganisation nicht aufrechterhalten (Suomi, 1999).
Die Auswirkungen auf die Hormonausschüttung im Vergleich zu Jungen, die von der Mutter aufgezogen wurden, blieben zeitlebens nachweisbar. Etliche der hormonellen Prozesse bei Jungtieren waren zwar noch umkehrbar, wenn man sie wieder erfolgreich mit ihren Müttern zusammenführen konnte, aber die sozialen Regeln des Miteinanders wurden später nur unvollkommen nachgelernt. Durch ihre unkoordinierten und „regellosen“ Aktionen und Reaktionen waren sie für die Gruppenmitglieder in ihrem Verhalten schwer vorhersagbar und wurden von ihnen gemieden, so dass ein „Teufelskreis“ begann: Sie bekamen durch ihr Verhalten und die resultierende Ablehnung der Gruppe noch seltener Gelegenheit, Gruppenverhalten zu lernen und sich in die Gruppe zu integrieren. Nach Aufzucht in Isolation blieb die Resozialisation von Rhesusaffen in mancherlei Hinsicht defizitär (Kraemer, 1992). In Teil IV dieses Buchs, in dem das Sozialverhalten von Vorschulkindern beschrieben wird, werden wir wieder einem solchen „Teufelskreis“ aus sozialer Inkompetenz und sozialer Zurückweisung begegnen.
Andere Ergebnisse zeigten Versuche, in denen die Jungtiere, z.B. Totenkopfäffchen, nur für kürzere Zeiten von ihren Muttertieren getrennt wurden. Sie hatten bei erneuter Trennung zwei und drei Jahre später ein geringeres Cortisolniveau als die nie getrennten Jungtiere (Levine & Mody, 2001). Die Mütter jedoch pflegten ihre Jungen nach den frühen Trennungen intensiv, und die Jungen verbrachten mehr Zeit am Körper der Mutter. Die Forscher interpretieren ihre Befunde als Hinweis darauf, dass begrenzte Stresserfahrungen mit anschließender nachhaltiger Beruhigung zu einer höheren Stresstoleranz im Erwachsenenalter führen können.
Zellbiologische Untersuchungen im Labor von M. Meaney an Ratten können einige Hinweise darüber geben, wie es physiologisch möglich ist, dass frühe Beziehungen lang anhaltende Wirkungen auf den Organismus haben (s. Polan & Hofer, 2008, S. 165 ff.). Frühe Fürsorgequalität beeinflusst die Zellmembran-Rezeptoren im Hippocampus, die die Menge des Kortisols erkennen und – in der Wirkungsweise einem Thermostat vergleichbar – verhindern, dass zu viel Kortisol nach einem Stressor ausgeschüttet wird. Weiterhin konnten beobachtbare Unterschiede in der frühen Fürsorgequalität nach täglichen Trennungen mit Molekularprozessen in Verbindung gebracht werden, die die Genexpression (das „Anschalten“ und „Stummschalten“ einzelner Gengruppen) regeln. Mütterliche intensivierte Fürsorge nach zuvor täglichen Trennungen vom Rattenjungen waren zunächst an nur kleinen Veränderungen innerhalb des Gehirnbereichs zu erkennen, der für die Integration von adrenokortikalen und Verhaltensreaktionen auf Stress verantwortlich ist. Aber nach 23 oder gar nach 45 Tagen sah man eine beständige Reduktion der Genaktivität in der Region des Gehirns, die die Kortisolproduktion regelt (Fenoglio et al., 2006). Die gesamte Bandbreite der Stressreaktionen von Rattenjungen wurde durch die intensivere mütterliche Fürsorge nach begrenzten Stresserfahrungen durch Trennungen verbessert. Geringe mütterliche Fürsorge zeigte sich bei den adulten Tieren in größerer Ängstlichkeit, intensiveren Schreckreaktionen und in verstärkten adrenokortikalen Reaktionen auf Stress. Zusätzlich zur „Vererbung“ der wenig ausgeprägten Mütterlichkeit waren die weiblichen Nachkommen früher sexuell reif, aktiv und häufiger trächtig.
Das Muttertier übt also bei allen sozial lebenden Säugetieren eine starke, organisierende Wirkung auf das Verhalten und das körperliche Funktionieren des Jungtieres aus. Ein anhaltendes Entbehren der Mutter verändert nicht nur das soziale Verhalten und die Lernfähigkeit der jungen Säugetiere oft bis ins reife Alter hinein, sondern auch innerlich die Entwicklung der üblichen zentralnervösen Bahnen und Aktivitäten zwischen den verschiedenen neuronalen, neurochemischen und neurohormonellen Systemen (Keverne, 2005; Sachser, 2005). Die stammesgeschichtliche Entwicklung des Menschen als sozial lebendem Primaten enthält ebenfalls das komplexe Gefüge aus seiner biologischen Vergangenheit.
KAPITEL I.3 Psychische Sicherheit als Integration von Emotionen, motivierten Intentionen und sprachlichen Interpretationen
Der Mensch ist von Natur aus ein Kulturwesen (Lorenz, 1967; Barkow, Cosmides & Tooby, 1992; Bischof, N. 1985, 1996). Biologisch gehört er zu den Primaten. Als Kulturwesen hat er eine Sonderstellung. Er schafft sich eine Umwelt, die von kultureller Bedeutung gekennzeichnet ist, aus biologischer Notwendigkeit. Sie wird im Wesentlichen durch sprachliche, aber auch durch bildliche Symbole repräsentiert, die durch wichtige reife und erfahrene Mitmenschen vermittelt werden. Im Verlaufe seiner individuellen Entwicklung erwirbt jedes Kind lebensnotwendige Bedeutungen. Im Rahmen enger, von Gefühlen bestimmter Bindungsbeziehungen wird der Säugling allmählich zu einem Individuum, das, aufbauend auf vorsprachlicher Kommunikation, innerhalb dieser engen zwischenmenschlichen Erfahrungen die Muttersprache erlernt. Dieser Prozess ist zwar genetisch vorprogrammiert, bedarf aber besonderer Qualitäten des Miteinanders auf dem langen Weg zur Ausgestaltung und Verwirklichung. In Bowlbys Worten ist die Notwendigkeit von Bindung umweltstabil, d.h. genetisch gegeben, die Entwicklung besonderer Bindungsqualitäten aber umweltlabil, d.h. erfahrungsabhängig.
Die Qualität von Bindungen ist das zentrale Thema des vorliegenden Buches. Bindung ist die wichtigste Grundlage für eine Entwicklung, in der verschiedene Ebenen des menschlichen Gehirns mit den Komplexitäten der zwischenmenschlichen Beziehungen, des Verhaltens und der Physiologie eines Menschen in Einklang gebracht werden müssen. Erst dadurch wird das Kind zu einer Person, die wichtige Aspekte ihrer Kultur aktiv beherrscht und mit anderen Individuen zeitlebens kommuniziert, weil das kulturelle Wissen auf viele Individuen unterschiedlich verteilt ist (Hutchins, 1991). Die Kulturfähigkeit des Menschen beruht also wie die Bindung auf biologischen Anlagen, die von Genen vorprogrammiert sind und die während der Evolution ausgelesen wurden.





























