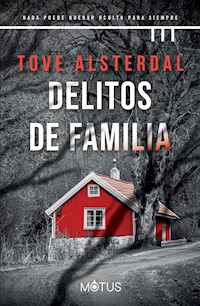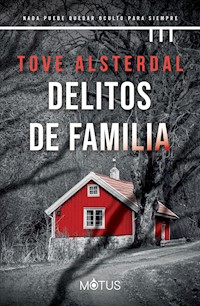Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Schwedens Spannungsstar Tove Alsterdal lässt ein dunkles Kapitel der Vergangenheit lebendig werden: das Schicksal der Sudetendeutschen. Bewegend, intelligent, herausragend erzählt. Um ihre Ehe zu retten, wagen Sonja und Daniel einen Neuanfang: Das schwedische Paar kauft ein Weingut in Böhmen und wandert dorthin aus. Allerdings ist das Anwesen stark heruntergekommen, und in den Kellergewölben entdecken sie eine mumifizierte Leiche. Offenbar war der Tote Sudetendeutscher, die Polizei scheint jedoch kein Interesse zu haben, den Fall weiter zu verfolgen. Mithilfe der Anwältin Anna erfährt Sonja mehr über die bewegte Geschichte des Dorfes, die Annexion der Gebiete durch Hitler und das Leid der Bevölkerung, vor allem das der Kinder. Doch dann wird Anna ermordet und Daniel als Verdächtiger verhaftet. Sonja begreift, dass der Schlüssel in der Vergangenheit liegen muss. Und dass manche Dinge für immer verborgen bleiben sollen. «Auf dem hohen Niveau von Henning Mankell.» Expressen
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:9 Std. 29 min
Sprecher:Sandra Voss
Ähnliche
Tove Alsterdal
Blinde Tunnel
Kriminalroman
Über dieses Buch
Die Ehe von Sonja und Daniel kriselt, daher wagt das schwedische Paar einen radikalen Neuanfang: Sie kaufen ein Weingut in Böhmen. Allerdings ist das Anwesen ziemlich heruntergekommen. Und in den Kellergewölben entdecken sie eine mumifizierte Kinderleiche. Offenbar war der tote Junge Sudetendeutscher, und die Polizei scheint kein Interesse zu haben, den Fall weiterzuverfolgen. Mit Hilfe der Anwältin Anna erfährt Sonja mehr über die bewegte Geschichte des Dorfes, die Annexion der Gebiete durch Hitler und das Leid der Bevölkerung auf allen Seiten. Doch dann wird Anna ermordet und Sonjas Mann als Verdächtiger verhaftet. Sonja begreift, dass der Schlüssel in der Vergangenheit liegen muss. Und dass manche Dinge für immer verborgen bleiben sollen.
Vita
Tove Alsterdal, 1960 in Malmö geboren, zählt zu den renommiertesten schwedischen Spannungsautor:innen, ihre Romane erscheinen in 25 Ländern und wurden vielfach ausgezeichnet. Mit der Trilogie um Ermittlerin Eira Sjödin gelang ihr in Schweden ein Sensationserfolg, für «Sturmrot» erhielt sie den Schwedischen Krimipreis 2020 und den Skandinavischen Krimipreis 2021, ebenso wie «Erdschwarz» stand der Roman wochenlang auf Platz 1 der schwedischen Bestsellerliste. Auch in Deutschland stiegen die Romane sofort in die Top 10 der Spiegel-Bestsellerliste ein. Die Filmrechte sicherte sich eine Hollywood-Produktionsfirma.
Hanna Granz, geboren 1977, hat in Bonn Skandinavistik und Literaturwissenschaften studiert. Seit 2012 arbeitet sie als freie Übersetzerin und hat u.a. Romane von Sofie Sarenbrant, Patrik Svensson und Alex Schulman ins Deutsche übertragen.
Impressum
Die schwedische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel «Blindtunnel» im Verlag Lind & Co, Stockholm.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Blindtunnel» Copyright © 2019 by Tove Alsterdal
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Covergestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-644-01763-4
www.rowohlt.de
Betten zeichnen sich in der Dunkelheit ab. Dann Körper, wie Hügel und Täler einer Landschaft. Ein Gesicht leuchtet auf, als der Lichtstrahl durchs Zimmer flackert.
Drei Betten an jeder Wand, sechs Körper. Jemand muss das hier kontrollieren. Das Gesicht einer alten Frau, eingesunken und starr. Er möchte die dünne Haut berühren, aber er kann nicht. Geschlossene Augen, verdorrte Gesichter. Ein klaffender Mund, über das Kissen gebreitetes Haar, ein Fuß mit gekrümmten Zehen genau da, wo er am Bettpfosten Halt sucht.
Das Herz klopft ihm bis zum Hals, als müsste es zerspringen. Jetzt begreift er die Stille, die Dunkelheit.
Tot, sie sind alle tot.
Die Augen der letzten Frau sind offen, wässrig stieren sie ins Nichts, aber wo sind die Männer, wo sind die jungen Leute?
Die Kinder – haben sie die schon geholt?
Hätte ich in diesen ersten Tagen morgens nicht allein am Tisch gesessen, hätte ich die Frau ganz hinten in der Ecke des Wirtshauses gar nicht bemerkt. Im Nachhinein verfälscht man die Eindrücke ja gern, sagt Dinge wie «man sah ihr an, dass sie hier fremd war» oder «sie schien ein Geheimnis mit sich herumzutragen», obwohl man zu dem Zeitpunkt viel zu sehr mit dem Menschen beschäftigt war, der einem beim Frühstück gegenübersaß, um die Einsamen zu bemerken.
Die Pension befand sich in einem Haus, dessen Putz längst bröckelte. Früher hatte «Gasthaus» an der Fassade gestanden, inzwischen waren die Buchstaben nur noch zu erahnen. Ein Geruch nach kaltem Rauch hing in den Gardinen und den abgewetzten Polstern. Die anderen Gäste waren vor allem einheimische Männer in verwaschener Kleidung, die hier morgens ihren Kaffee tranken und sich alle zu kennen schienen.
Die Frau in der Ecke passte einfach nicht hierher. Ihre Kostümjacke wirkte viel zu teuer an so einem Ort, und ihre blankgeputzten Schuhe gehörten eher in eine Bankfiliale als in diese kleine Stadt, deren einzige Touristenattraktion die Wanderwege in der Umgebung waren. An der Wand hinter ihr hing der Kopf eines toten Rehbocks.
Immobilien, dachte ich. Bestimmt war sie unterwegs, um ein paar der baufälligen Häuser aufzukaufen, die es hier im Ort überall gab, verlassen, mit zerbrochenen Fensterscheiben, Bäumen, die durch die Balkone wuchsen und sich in die einstmals so schönen Salons drängten.
Am dritten Tag begegneten wir uns an der Tür, und ich grüßte sie auf Englisch. Nahm einen britischen Akzent wahr, als sie mir antwortete, und fragte, ob sie in dem Wirtshaus wohne. Anschließend herrschte Schweigen, sodass ich viel zu viel redete, als wären die Pausen nur dazu da, um von mir gefüllt zu werden.
Dass ich ein Haus gekauft hätte oder eher gesagt ein Weingut, dass wir aber gerade erst eingezogen seien und noch kein Internet hätten. Und dass am Stadtrand, auf der anderen Seite des Flusses und im Schatten der Berge, der Empfang nicht so gut sei.
Deshalb würde ich jeden Morgen in die Stadt kommen, um zu frühstücken und bei der Gelegenheit Kontakt zur Umwelt aufzunehmen.
Sie hörte zu, ohne mich direkt anzusehen. Ich ergänzte, dass ich auch immer noch an der Bäckerei vorbeigehen und frisch gebackenes Brot kaufen würde, um es meinem Mann mitzubringen, damit sie nicht dachte, ich wäre einsam und verzweifelt auf der Suche nach jemandem, mit dem ich reden könnte.
«Er ist sehr beschäftigt mit den Renovierungsarbeiten, es ist viel zu tun, ja, Sie haben bestimmt gesehen, wie die Häuser hier in der Stadt teilweise aussehen …»
Die Frau schaute auf die Straße mit ihren heruntergekommenen Fassaden und Ziegeldächern hinaus, auf die kleine Kirche, die eingeklemmt hinter einem Kuhstall stand.
«Stadt?», sagte sie. «Würden Sie das wirklich als Stadt bezeichnen?»
Das anhaltende Unbehagen darüber, zu viel geredet zu haben, und der verachtungsvolle Ton in ihrer Stimme verflogen erst, als ich am bröckelnden Straßenrand entlang zurückging.
Selbst wenn ich bis an mein Lebensende hierbliebe, würde mir dieser Weg, der kurz vorm Fluss in die Landstraße überging, niemals langweilig werden. Er führte an einem schlossähnlichen Haus mit rissigen Säulen vorbei, das bis zum Dach von wildem Wein bewachsen war und auf dessen Mauer ein paar streunende Katzen lungerten. An der Brücke über den stetig dahinströmenden Fluss stand eine ehemalige Brauerei mit kaputten Fenstern, aus der es nach wie vor nach Hopfen und Malz roch, und dann die Klatschmohnfelder. In wallendem Rot breiteten sie sich am Ufer entlang bis zu den Bergen aus, hemmungslos, sinnlich, das sind die Worte, die mir dabei einfallen. Ich hatte solche Klatschmohnfelder seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen, als wir ein paar Sommer in einem Häuschen in Österlen verbrachten. Als ich später im Erwachsenenalter dorthin zurückkehrte, waren sie verschwunden. Jemand meinte, sie würden inzwischen als Unkraut betrachtet.
Daniel war wach, als ich zurückkam, ich roch den Duft frisch gebrühten Kaffees. Dann hatte er also zumindest den Herd in Gang bekommen oder den Wasserkocher, irgendetwas in dem Chaos aus alten Stromleitungen musste funktioniert haben. Ich hörte Lärmen und Hämmern aus dem Keller, packte die Einkäufe aus, rief, dass es frisches Brot gebe. Ließ Wasser für noch mehr Kaffee einlaufen, das inzwischen nicht mehr ganz so verfärbt vom Rost in den Leitungen war, und stellte die Mohnblumen, die ich gepflückt hatte, zu den Butterblumen und dem Wald-Storchschnabel in die Vase. Es kam mir seltsam vor, dass hier die gleichen Wiesenblumen standen wie zu Hause.
«Mann, ist das heiß hier oben», sagte Daniel, als er mit nacktem Oberkörper und einer feinen grauen Staubschicht im Haar und auf den Armen aus dem Keller kam.
Er stellte etwas ab, das wie ein Vorschlaghammer aussah, schwer und überdimensioniert. Solche Dinge lagen hier überall auf dem Hof verstreut, uraltes Werkzeug, von dem sich kaum noch sagen ließ, wozu es einmal gedient hatte. In einer Abstellkammer hatten wir die verschiedensten Mistgabeln und Hacken gefunden, wie wir sie noch nie zuvor gesehen hatten.
Daniel füllte sich ein Glas Wasser aus dem Hahn und trank es samt Rost, wischte sich mit einem der neuen Küchenhandtücher den Schweiß aus dem Nacken. Die Luft war heiß und stand still, schon im Mai waren es beinahe dreißig Grad. Eine Klimaanlage stand ganz oben auf unserer Liste.
«Bald bin ich durch», sagte er und ließ sich am gedeckten Tisch nieder. Drei Küchenstühle hatten wir gefunden, die einigermaßen stabil waren, keiner glich dem anderen. Ich konnte mich nicht entsinnen, dass irgendetwas im Keller absolute Priorität gehabt hätte, um das Haus bewohnbar zu machen. Vorsichtig strich ich ein wenig Staub aus seinem Haar.
«Was machst du eigentlich da unten? Willst du das Haus abreißen?»
Daniel lachte.
«So in der Art. Guck mal, hier.» Er streckte die Hand nach seinem Handy aus. Ich spürte den warmen Dampf, der von seiner Haut aufstieg, als ich mich neben ihn setzte, den schweren Geruch nach Schweiß, der seltsam fremd an dem Mann war, mit dem ich seit über zwanzig Jahren zusammenwohnte. In dem Leben, das wir bisher gemeinsam geführt hatten, schwitzte er im Grunde nur nach dem Laufen, und dann ging er direkt duschen. Oder manchmal wenn wir Liebe machten. Das hier jedoch war ein anderer Geruch, er trug die Feuchtigkeit des noch nicht eingerichteten Kellers in sich, Staub und Ungewaschenheit, Schweiß von gestern, darüber hinaus aber noch etwas anderes, das ich zuvor nicht an ihm gekannt hatte, eine Besessenheit, die ihm nicht erlaubte auszuruhen, bis er spätnachts ins Bett fiel. Morgens, wenn ich meinen Spaziergang zum Wirtshaus unternahm, schlief er noch wie ein Stein. Ich wusste nicht, ob er immer noch Schlaftabletten nahm, obwohl er gesagt hatte, er hätte damit aufgehört. Vermutlich war er direkt runtergegangen, nachdem ich mich auf den Weg gemacht hatte, um im Stehen eine Tasse Kaffee zu trinken und dann gleich nach dem Vorschlaghammer zu greifen. Der Appetit, mit dem er seine Brote verschlang, legte das jedenfalls nahe.
«Ich musste gestern vor dem Einschlafen darüber nachdenken», sagte er zwischen zwei Bissen. «Irgendetwas stimmt mit den Zeichnungen nicht.»
Er suchte ein Foto heraus, den Grundriss, den uns die Stadtverwaltung, bei der wir die Dokumente unterschrieben hatten, digital zugeschickt hatte. Es gab anscheinend keine Kopien, nur die Originale in einem großen, sperrigen Ordner.
«Wenn das hier ein Weingut war», sagte Daniel, «und es einen Keller gibt – warum gibt es dann keinen Weinkeller?»
Er vergrößerte das Foto. Ich kniff die Augen zusammen, um die verschwommenen Linien besser erkennen zu können, die Zeichnung schien vom Anfang des 19. Jahrhunderts zu sein, als das Haus vermutlich gebaut worden war. Er glaube, dass es eine Öffnung gebe, meinte Daniel, eine Tür weiter links, von der Treppe aus gesehen.
«Du weißt schon, wo der alte Schrank stand, wo das Mauerwerk freilag …» Daniel war ganz außer Atem vor Aufregung, oder war es die Hitze in der stickigen Küche? «Nirgendwo sonst im Keller gibt es solche einfachen Ziegelwände und im ganzen Haus gibt es kein sichtbares Mauerwerk.»
«Wäre toll, wenn es einen Weinkeller gibt.» Ich räumte das Frühstück ab oder eher das Mittagessen, Butter und Käse, bevor sie schmolzen. «Das wird schön, wenn wir erst mal so weit sind.»
«Anschließend kümmere ich mich sofort um die Klimaanlage, versprochen. Und um den Strom.»
«Alles gut.» Ich nahm meine Handtasche, um nach einem Zettel zu suchen, den ich tags zuvor im Eisenwarenladen bekommen hatte. Der alte Händler konnte weder Englisch noch Deutsch, aber mit Hilfe einer Übersetzungs-App und ein bisschen Zeichensprache hatte ich mich mit ihm verständigen können. «Es gibt anscheinend einen Elektriker in der Stadt, ich habe seine Nummer …»
«Das machen wir lieber selbst.» Daniel stand auf und griff wieder nach seinem Hammer. «Dann weiß ich wenigstens, was los ist, wenn etwas kaputtgeht.»
Ich nahm mir das Zimmer im Obergeschoss vor, das unser Schlafzimmer werden sollte, schrubbte das Fenster mit der Aussicht frei. Auch das stand nicht ganz oben auf unserer Liste, aber die schmalen Betten, die wir in der Kammer neben der Küche zusammengeschoben hatten, machten niemanden glücklich. Sobald ein paar Zimmer bewohnbar waren, wollten wir nach Prag fahren, neue Betten und andere Dinge kaufen. Es war, als passten unsere alten Möbel aus dem Reihenhaus in Älvsjö nicht hierher. Was wir geerbt hatten oder wovon wir uns nicht trennen konnten, hatten wir eingelagert und den Rest über Kleinanzeigen verkauft. Es hatte sich angefühlt, als würden wir noch einmal bei null anfangen.
Ein weißes Blatt, eine neue Seite, eine Leere, die mich euphorisch stimmte.
Der Schmutz lief die Scheiben hinunter, und tote Fliegen fielen zuhauf auf den Boden, aber nach drei Wasserwechseln hatte ich die Aussicht freigelegt. Die Wiese, die sich bis zu den Wäldern erstreckte, und die Berge, die sich dahinter erhoben, zur anderen Seite ein struppiges Gehölz, wo unser Grundstück zum Fluss hin im Schatten einer gewaltigen Linde abfiel. Der schmale Nebenfluss verschwand in einer Biegung Richtung Stadt, dort, wo in ein paar Kilometern Entfernung die Hausdächer und die beiden Kirchtürme sichtbar wurden.
Wie soll ich es erklären?
Diesen Moment, in dem etwas beginnt.
Es waren nicht die Bilder, die uns überzeugten, die Fotos, die so schlecht waren, dass man nicht erkennen konnte, wie die Zimmer angeordnet waren.
Es lag an sieben Buchstaben. Einem einzigen Wort.
Weingut.
Ich war an dem Abend viel zu spät nach Hause gekommen, vielleicht nahm ich mir deshalb die Zeit, wirklich hinzuschauen, als Daniel mich vom Arbeitszimmer aus rief. Es war nicht die erste Annonce, die er mir zeigte. Den ganzen Winter hatte er dagesessen und nach Wochenendhäusern auf dem Land geschaut. Er war zu der Überzeugung gelangt, dass ihm die Natur guttun, dass es ihm dort besser gehen würde. Erst war es Norrland, um seiner alten Heimat wieder näherzukommen, dann Spanien, um den dunklen Wintern zu entfliehen, es war, als zöge es ihn magnetisch immer weiter fort. Und schließlich fand er dieses Weingut in Böhmen.
Daniel vergrößerte die Bilder.
Böhmen?
Ich begriff nicht, wovon er redete, es war völlig absurd. Sowohl von Gutshöfen als auch von Weinen hatten wir geträumt, von Reisen, wie man sie unternimmt, wenn die Kinder aus dem Haus sind, in die Toskana oder in die Provence, aber Böhmen? Daniel hatte es gegoogelt, es lag nur eine gute Stunde mit dem Auto von Prag entfernt und weniger als zwei Stunden von Berlin, in den Bergen an der Grenze zwischen Deutschland und Tschechien.
«Die ehemaligen Oststaaten?» Ich fühlte mich müde, der Wein, den ich getrunken hatte, schmerzte hinter meinen Augen. «Ich dachte, du träumst von einer Pension in der Toskana oder einem Haus in der Provence.»
«Zentraleuropa», sagte er. «Prag liegt übrigens weiter im Westen als Stockholm. Und weißt du, was ein Weingut in der Provence kostet?»
«Ist da nicht alles voller ehemaliger Kohleindustrie?»
Daniel klickte ein paar Bilder mit Felsformationen, wogenden Tälern und blauenden Bergen an, die Böhmische Schweiz.
Das Gebiet, zu dem diese Gegend gehörte, war auch unter einem anderen Namen bekannt.
Sudetenland.
Ich zog mir den Sessel heran und setzte mich neben ihn, sah den Kaufpreis in tschechischen Kronen. Wenn Daniel richtig gerechnet hatte, war es weniger, als unsere Nachbarn, die sich gerade getrennt hatten, für ihr Reihenhaus aus den achtziger Jahren bekommen hatten, das baugleich mit unserem war.
«Aber wir kennen uns doch mit Wein gar nicht aus», sagte ich.
«Das könnten wir lernen. Die Ernte verkaufen und Flaschen mit eigenen Etiketten zurückbekommen … Ein paar Zimmer herrichten und vermieten.»
«Die Leute würden vielleicht sogar dafür bezahlen, die Trauben stampfen zu dürfen …» Ich wollte so gern, dass der Glanz in seiner Stimme noch ein bisschen blieb.
«Und dann müssen sie wiederkommen, um ihren eigenhändig gestampften Wein zu probieren, wie er reifer wird, Jahr für Jahr.»
«Eigenfüßig wohl eher …»
«Stampft man Weintrauben eigentlich immer noch? Ernsthaft?»
Unser Lachen an diesem Abend stieg auf und schwebte leicht und verrückt zwischen uns, glitt ineinander und löste sich wieder, es war lange her, dass ich uns so lachen gehört hatte.
Die Leute sagen, man müsse im Jetzt leben, aber das ist unmöglich. Das Jetzt gibt es nicht. Es verschwindet in jeder Sekunde. Immer wenn ich versucht habe, im Jetzt zu sein, hat mich die Vergangenheit eingeholt. Vielleicht liegt es am Alter. Der Geruch von Teer und das Wellengeplätscher von Fischerbooten zum Beispiel führen mich zurück in meine Kindheit, als meine Eltern ein Ferienhäuschen in Österlen mieteten, und im nächsten Augenblick möchte ich weinen, weil es vorbei ist und ich allein zurückgeblieben bin.
Das Klatschmohnfeld löste dasselbe in mir aus, verwandelte sich in Wehmut. Das Reihenhaus, in dem wir über fünfzehn Jahre gewohnt hatten, war voll von der Leere, die die Kinder zurückgelassen hatten, die jetzt in Seattle und Umeå waren, um ihr eigenes Leben zu beginnen. Und mein Mann … Ja, mein Mann googelte Höfe und Ferienhäuser und ging immer seltener aus. Wenn ich ein Essen mit Freunden vorschlug oder einen Kinobesuch oder was auch immer, sagte er jedes Mal, ihm sei gerade nicht danach.
Aber geh du nur.
Ich glaube, es ist nicht das Jetzt, was wir wollen, es ist die Zukunft. Wenn wir die aus dem Blick verlieren, stirbt etwas. Das Jetzt ist allenfalls der Moment, in dem die Zukunft beginnt. Etwas Reines. Die Aussicht auf der anderen Seite der Scheibe, der Horizont, von dem man nicht wusste, dass es ihn gibt. Zu wissen, dass alles Mögliche passieren kann und nichts bleibt, wie es war.
Der Laut einer Katze im Garten.
Sie war gelb und blickte zu mir hinauf, ich hatte mehrere von ihnen umherstreunen sehen. Jetzt maunzte sie, als würde sie wissen, dass bessere Zeiten winkten, Leute auf dem Hof und Futter in der Schüssel, wenn es gut lief. Es fühlte sich an, als würde sie uns willkommen heißen. Jemand hatte uns gesehen und freute sich, dass wir da waren.
Ich ließ das Fenster weit offen, um, so gut wie es bei der Hitze möglich war, zu lüften. Dann ging ich hinunter, um im Kühlschrank nach etwas zu suchen, das ich der Katze geben konnte. Aus dem Keller war wieder das beharrliche, rhythmische Hämmern zu hören. Vielleicht brauchte er das. Etwas kaputtschlagen, etwas einreißen, sich abreagieren und befreien.
NOTIZEN, BEOBACHTUNG
in der Nacht zu Mittwoch, 06:20 Uhr
Rastlosigkeit.
Er ist wach.
Schaut aus dem Fenster, kurz vor der Morgendämmerung.
Nackt.
Wo sind wir?
Ich sehe das Tor, aber ich sehe den Fluss nicht.
Meinen Sie den See? Der ist dahinten, hinter den Bäumen, wenn der Nebel sich lichtet, müssten Sie ihn sehen können.
Nein, den Fluss, habe ich gesagt.
Er floss dort hinten, genau da.
Wer sind Sie?
Warum sehe ich den Fluss nicht mehr?
Gab es einen Fluss dort, wo Sie früher gewohnt haben?
Die Toten tragen die Lebenden.
Entschuldigung, was haben Sie gesagt?
Die Lebenden tragen die Toten.
Aber sehen Sie das denn nicht?
Wer sind Sie überhaupt?
Gehen Sie weg.
Eine Berührung an meiner Wange, ein Flüstern. Warum flüsterte er? Ich öffnete die Augen, konnte meinen Mann in der Dunkelheit jedoch nicht erkennen, es war, als befände ich mich noch immer in einem Traum.
«Komm, wach auf, das musst du dir angucken.»
«Was?»
Im Traum hatte ich einen anderen berührt, die Hitze war noch da. Daniel stand über mein Bett gebeugt und suchte unter der Decke nach meiner Hand.
«Ist was passiert? Wie viel Uhr ist es?»
«Zwei, vielleicht auch schon drei …» Er sagte es, als wäre Zeit ein unwichtiges Detail. «Zieh dir was an, es ist kälter da unten.»
«Im Keller?»
Er blendete mich mit der Taschenlampe, einer starken, wie man sie auf Baustellen benutzt, leuchtete den Stuhl an, auf dem meine Kleider lagen. Ich gab den Wunsch, mich zusammenzurollen, auf, zog mein Kleid an und fand auch die Pantoffeln. Daniel legte mir eine Decke um die Schultern. Führte mich in die Küche, ohne ein weiteres Wort, dann die schmale Treppe hinunter. Die Haut seiner Hand fühlte sich härter an als noch vor ein paar Wochen.
Ich war bisher nur ein paarmal im Keller gewesen. Ein kurzer Gang mit niedriger Decke, ein Heizungsraum und ein paar Verschläge, die mit diversem Krempel vollgestopft waren, bestimmt war hier seit Jahrzehnten nicht aufgeräumt worden. Jetzt war es noch dreckiger als zuvor, Reste von Mörtel und Schotter knirschten unter meinen Sohlen. Am Ende des Ganges hielt der Lichtkegel inne. Haufen von Ziegelsteinen lagen dort. Und die Reste der Mauer waren zu sehen, ein Loch direkt in die Finsternis.
«Es ging viel leichter, als ich gedacht hatte, sie war ziemlich schlampig gemauert.» Daniel reichte mir die Taschenlampe. «Geh du vor.»
Die Öffnung war ungleichmäßig und nicht besonders groß, ich duckte mich und kletterte hindurch, schürfte mir die Beine an den Ziegelsteinen auf. Die Wolldecke ließ ich fallen, die tiefe Kühle auf der anderen Seite war angenehm. Ich ließ den Lichtstrahl über den Boden wandern, bevor ich meine Füße aufsetzte. Dachte kurz an Ratten und Ungeziefer.
«Pass mit der Treppe auf», sagte Daniel leise an meinem Ohr. Ich spürte die Wärme seines Atems und griff wieder nach seiner Hand. Ein paar Meter hinter der Backsteinmauer führte eine weitere, schmalere Treppe hinunter, sie war sehr steil. Die steinernen Stufen waren ausgetreten und an den Kanten mit Holzleisten versehen. Sie mussten vor Jahrhunderten in den Stein gehauen worden sein, die Vertiefungen stammten von den Menschen, die hier rauf- und runtergegangen waren. Wie viele Jahre es wohl dauerte, bis solche Spuren entstanden?
Am Fuß der Treppe drehte ich mich um, Daniels Gesicht wie ein weißer Schatten. Er nickte mir zu, geh ruhig weiter. Die Dunkelheit kam mir entgegen, schluckte das Licht nach nur wenigen Metern. Harte Wände, nackter Fels. Und kein Fußboden, nur gestampfte Erde. Ich sah, dass die Decke von dicken Balken gestützt wurde. Dann fiel das Licht auf ein paar Holztonnen. Fässer, dachte ich und spürte, wie mein Herz schneller schlug, keine Tonnen, es heißt Weinfässer. Ein paar leere Flaschen lagen ebenfalls herum sowie eine uralte Schubkarre, ganz rau vom Rost und mit riesigen Rädern. Daniel führte meine Hand und richtete den Lichtstrahl noch weiter ins Innere. Wir hielten beide den Atem an.
Wo die Felskammer endete, waren Weinregale angebracht worden, in denen noch Flaschen lagen, sorgfältig einsortiert vom Boden bis zur Decke.
Die Stille wuchs und umschloss uns wie in einer Kirche, mir wurde ganz feierlich zumute.
«Wow», flüsterte ich. «Was glaubst du, wie alt die sind?»
«Alt.»
Wir traten näher, und Daniel nahm mir die Taschenlampe ab, beleuchtete die Flaschen. Dunkelgrün schienen sie zu sein, vielleicht auch braun, in dem künstlichen Licht war die Farbe schwer zu bestimmen. Von einer dünnen Staubschicht bedeckt, absolute Stille.
Das Licht fiel auf ein Etikett, ich beugte mich vor. Strich den Staub beiseite, bis die Beschriftung sichtbar wurde.
1937.
Ich sah Daniel an. Wir waren wie von Schwindel ergriffen.
«Was glaubst du, was die wert sind?»
«Keine Ahnung.»
Ich drehte die Flasche vorsichtig, um das Etikett entziffern zu können. Ein Bild, eine Art Logo. Die Zeichnung eines Baums, eine Bergsilhouette. Elegant geschwungene Buchstaben. «Müller-Thurgau», las ich. Das sagte mir nichts, außer, dass es mir deutsch vorkam.
«Was meinst du, wollen wir …?»
Wir sahen uns an und mussten beide lachen. Die Anspannung ließ nach, das Heilige wich ein wenig. Daniel zog eine weitere Flasche heraus, derselbe Jahrgang.
«Ja, warum nicht? Das ist bestimmt im Kaufpreis inbegriffen.»
Wir nahmen jeder eine Flasche, gingen kichernd die Treppe hinauf, und als Daniel mein Kleid losmachte, das sich an den unregelmäßigen Steinen in der Öffnung verfangen hatte, streichelte er mich zwischen den Beinen, ich hielt seine Hand kurz fest, und wir redeten wild durcheinander, wie wir den Keller mit alten Weinfässern einrichten könnten, um hier unten teure Verkostungen zu veranstalten, und Daniel erinnerte sich, dass auf einem gesunkenen Schiff eine Ladung hundertjähriger Champagner gefunden worden war, wie viel waren die Flaschen eigentlich wert gewesen? Und die Etiketten, wir könnten dieselbe Zeichnung von Baum und Bergen benutzen, die Tradition fortsetzen, das Alte zu neuem Leben erwecken.
Es dauerte eine Weile, bis Daniel den Korken der ersten Flasche herausbekam. Ich zündete Kerzen an und stellte Weingläser auf den Tisch. Es war ein symbolischer Akt, eine Art Einweihung. Bisher hatten wir nicht gefeiert. Die Weingläser waren aus echtem böhmischem Kristall, ich hatte sie in einem Gebrauchtwarenladen hinter dem Markt gefunden.
Das Geräusch, als der Korken nachgab, das Geräusch des Weins beim Einschenken. Auch in mir gluckste es, und ich glaube, in Daniel ebenfalls.
Es war Weißwein. Oder besser gesagt, er war dunkelgelb, beinahe bernsteinfarben, wir ließen ihn in unseren Gläsern über den Kerzen kreisen und taten, als wären wir Weinkenner, die geschliffenen Kelche funkelten in den Flammen, und wir sogen den Duft ein und überlegten, ob die Farbe ursprünglich oder durch die lange Lagerung entstanden war.
Achtzig Jahre alter Wein.
Wir stießen an, auf uns, darauf, dass von jetzt an alles gut werden würde.
«Bah», machte Daniel und spuckte den Wein ins Glas zurück.
Ein saurer Geschmack breitete sich in meinem Mund aus. Es schmeckte überhaupt nicht nach Wein. Sondern nach irgendetwas anderem. Wässrig. Schließlich schluckte ich ihn dennoch hinunter.
«Ist da überhaupt Alkohol drin?»
Daniel schnupperte erneut.
«Vielleicht ist der nach achtzig Jahren verdunstet.» Er goss den Rest des Weins ins Waschbecken und stellte das Glas viel zu hart ab. «Völlig wertlos, das Zeug.»
«Aber es gibt doch solchen und solchen Wein», sagte ich, «wir wissen es doch noch gar nicht, vielleicht lagert da unten noch anderer, der …» Ich wollte die Stimmung festhalten, das Gefühl des Rauschs. Die Art und Weise, wie er mich berührt hatte, als ich vor ihm durch das Loch gekrochen war. Ich war nackt unter dem Kleid, und es hatte mich erregt, wie es zwischen uns jetzt nur noch selten vorkam, zumindest im letzten Jahr.
Daniel zerrte den Korken aus der anderen Flasche, roch daran und zog eine Grimasse.
«Vielleicht hat er auch von vornherein so eklig geschmeckt», sagte er, «vielleicht haben sie ihn deshalb eingemauert, um das Zeug nicht trinken zu müssen.»
«Es spielt keine Rolle», sagte ich, «es ist nicht wichtig.»
«Und dafür habe ich dich mitten in der Nacht geweckt …»
«Es war trotzdem lustig. Das Wichtigste ist doch, dass du den Weinkeller gefunden hast, die Flaschen können einfach liegen bleiben, als Deko …»
Er holte sich ein Bier aus der Speisekammer und ließ sich schwer auf einen Stuhl sinken.
«Und ich dachte, ich hätte einen echten Schatz entdeckt», sagte er, «ein Vermögen. Wie bescheuert von mir.»
Ich streichelte ihm das Haar, küsste ihn auf die Stirn, ließ meine Hand in seinen Nacken gleiten, ertrug nicht, dass er sich so hängenließ. Erst jetzt merkte ich, wie schmutzig er war, der Schweiß hatte den Staub des alten Mörtels auf seiner Haut zu einer dicken Schicht verklebt. Er öffnete die Flasche an der Tischkante. Der Küchentisch war ohnehin zerkratzt und rissig, es machte nichts aus.
«Wie konnte ich dich da nur reinziehen.»
Daniel drehte das Bier in seiner Hand, lehnte sich zurück, der Stuhl knarrte beängstigend.
«Ich bin froh, dass du mich geweckt hast», sagte ich.
«Ich meine das alles hier», sagte er und breitete die Arme aus, über die Küche, die ich gerade lieben lernte, auch wenn die Arbeitsflächen abgenutzt waren und ein paar Schranktüren schief hingen, aber mit dem riesigen Holzofen würde es richtig gemütlich werden, wenn erst der Schornsteinfeger hier gewesen war und wir uns trauten, Feuer zu machen. Im Moment war es dafür sowieso zu heiß.
«In diesem Haus gibt es nichts, was ganz ist, wir kennen uns mit Wein nicht aus, ich verstehe nicht mal, was auf diesen verdammten Etiketten steht. Müller-Thurgau, Erzge… Verdammt, was heißt das?»
Er stieß die Weinflasche an, die am nächsten stand, sodass sie beinahe umfiel, ein paar Tropfen des sauren Inhalts schwappten über, bevor ich sie auffangen konnte.
«Und dann habe ich mich endlos mit dieser scheiß Ziegelmauer beschäftigt, statt mich um die Stromversorgung zu kümmern oder das Dach zu reparieren, dieses verdammte Ding wird uns noch über dem Kopf zusammenbrechen. Und dafür hast du alles zurückgelassen, das Haus, deine Arbeit, alles, nur weil ich …»
Ich hatte ungefähr das Gleiche gedacht, dass es vielleicht nicht funktionieren würde. Wir waren beide durch das Haus gegangen und hatten gesehen, wie schön es werden könnte, nicht wie es tatsächlich aussah.
«Ich bin froh, dass du die Idee hattest, hierherzukommen», sagte ich, «es wird großartig werden.»
Daniel starrte zur Decke, die leider auch keinen erfreulichen Anblick bot, seine Augen blieben an einem großen Fleck hängen, wo die Farbe abgeblättert war.
«Julia», las ich auf der Weinflasche, die ich noch immer in der Hand hielt, ich wusste inzwischen, dass es am besten war, über etwas anderes zu sprechen, wenn Daniel in dieser Stimmung war, wenn alles verkehrt zu laufen schien und er sich für einen Totalversager hielt.
«Ob das der Name des Weins ist?», sagte ich und drehte das Etikett ins Kerzenlicht. «Dann wäre Müller-Thurgau der Nachname, vielleicht ein Familienname, wenn es nicht eine Rebsorte ist.» Die Kerzen waren ein ganzes Stück heruntergebrannt, das Wachs tropfte. Ich konnte ziemlich gut Deutsch, hatte sowohl in der Grundschule als auch auf dem Gymnasium Unterricht gehabt und war ein paar Jahre mit einem Typen aus München zusammen gewesen, aber der Text auf dem Etikett ließ sich nicht so leicht deuten, eine zierliche und eigentlich sehr schöne Schrift. «Erzgebirge sagt mir jedenfalls etwas, das ist der deutsche Name der Bergkette hier, Malmbergen auf Schwedisch. Glaubst du, das Gut hieß so, oder ist das eine Markenbezeichnung? ‹Weingut Erzgebirge› klingt vielleicht nicht so gut, aber wie wäre es mit Ore Mountain Vineyard, oder Bohemian Winery …?»
Daniel gähnte.
«Das klingt gut, entschuldige, ich bin ein bisschen müde.» Er gab mir einen flüchtigen Kuss, bevor er aufstand. Ich spürte ihn kaum. «Können wir morgen darüber sprechen?»
Die Katze wartete hinter einem Rosenstrauch neben der Tür. Zog sich zurück, als ich herauskam, und fauchte. An einer Hinterpfote hatte sie eine kahle Stelle. Sie ließ mich nicht an sich heran. Ich überlegte immer noch, wie sie heißen sollte. Madame Bovary oder Anna Karenina oder Sessan, so wie meine erste Katze. Schwere Wolken zogen von Norden über die Berge heran.
Ich musste noch einmal ins Haus und den Futternapf mit Essensresten vom Vortag füllen, einen Regenschirm nahm ich gleich mit.
Die Farbe des Flusses veränderte sich mit der des Himmels. Aschgrau strömte er mir entgegen und verdunkelte sich zu fließendem Blei, Wasserwirbel tanzten und spritzten um die Steine unmittelbar vor den Brückenpfeilern. Ich sah alles so deutlich, jedes Detail war neu. Allein der Duft des Grases, wie er sich mit dem näher kommenden Regen veränderte, stärker wurde. Der Regen wird guttun, dachte ich, vor allem der Natur. Anschließend würde die Luft frischer sein und es atmete sich wieder leichter. Alles war gut. Glück konnte so still und einfach sein. Ein Frühsommerregen, ein Spaziergang.
Ich fuhr nie mit dem Auto in die Stadt, selbst wenn ich viel zu transportieren hatte, lieber ging ich mehrmals, so wie jetzt, nachdem ich die erste Schicht Weiß im Schlafzimmer aufgetragen hatte und die Farbe vor dem zweiten Durchgang ohnehin erst trocknen musste.
Ich überlegte, ob wir Fahrräder kaufen sollten. Mit Korb und Gepäckträger. Dann rissen die Wolken auf und der Regen war über mir, es goss in Strömen. Mein Regenschirm bog sich im Wind. Ich rannte das letzte Stück zum Wirtshaus. Der Mann an der Bar, der, soweit ich wusste, zugleich auch der Eigentümer war, sagte etwas und reichte mir ein Küchenhandtuch. Ich lachte und trocknete mir das Gesicht und die Haare ab, beim Rest war nicht viel zu machen. Er fragte, ob ich Kaffee wolle, und erinnerte sich, dass ich ihn schwarz trank.
Der Regen klatschte gegen die Scheiben. Ich konnte ebenso gut ein Glas Wein dazubestellen.
«Rot oder weiß?» Der Wirt legte einen Bierdeckel mit dem Logo einer bekannten Brauerei vor mich hin, drehte das Glas zwischen den Fingern. Ich glaube, er hieß Libor. Zumindest riefen das die Männer, die im Schankraum saßen und Karten spielten, wenn sie noch ein Bier wollten.
«Haben Sie welchen von hier», fragte ich. «Bohemian wine? Ich würde gerne mal einen lokalen probieren, weiß, wenn es geht.»
Der Mann war an die zwei Meter groß und musste sich unter den Gläsern bücken, die über der Theke hingen. Er nahm ein paar geöffnete Flaschen heraus.
«Ich habe französischen Weißwein», sagte er, «und italienischen.»
«Warum keinen einheimischen?»
«Danach fragt keiner. Er hat nicht den Ruf, besonders gut zu sein.»
Sein Englisch war schlecht, manchmal schob er ein paar Brocken Deutsch ein. Vielleicht wollte er nur sagen, dass es hier keinen guten Wein gab, in diesem Tal. Die Stadt lag verkehrstechnisch ungünstig, es fuhren nur wenige Züge, und eine Autobahnanbindung gab es nicht. Wir hatten ziemlich viel gegoogelt und Bilder von Weingütern gefunden, die nach dem Fall des Kommunismus wieder in Betrieb genommen worden waren, in einem Schloss in Mělník außerhalb von Prag sowie in neugebauten Scheunen auf einem Feld vor Litoměřice, der nächsten größeren Stadt, wo ein Kohlemilliardär die tausendjährige Tradition der Weinproduktion wiederaufgenommen hatte. Wir hatten beim Surfen schicke Web-Seiten mit Flaschen im Gegenlicht und wogendem Grün gesehen und gedacht, das wäre genau das Richtige, auch wenn die Weinstöcke auf unserem eigenen Gut bisher noch einen eher kläglichen Anblick boten.
«Communist wine», sagte Libor mit einer Grimasse und wusch sich die Hände im Spülbecken.
«Dann würde ich gern den französischen probieren.»
Er lächelte und öffnete eine Flasche Bordeaux.
«In Mähren, ja, da machen sie guten Wein, das sind Bauern», sagte er versöhnlich und füllte mein Glas. Aber aus diesem Teil des Landes habe er auch nichts auf Lager.
Er ließ Bier in ein Seidel laufen, wartete kurz, bis der Schaum sich gesetzt hatte, bevor er mit dem nächsten weitermachte, stellte die Gläser auf ein Tablett und trug sie hinaus.
Ich loggte mich im Internet ein, tauchte ab in die Nachrichten von Freunden über das Leben zu Hause. In Luleå hatte es geschneit, in Stockholm fingen die Kirschen an zu blühen. Ich hatte bereits Fotos vom Gut und von der Stadt gepostet. Hatte vor mir gesehen, wie wir an warmen Abenden hierherschlendern, im Biergarten ein Glas Wein trinken und die Leute mit Namen kennenlernen würden. Doch noch war es nicht so weit. Die Männer in der Kneipe wischten sich den Bierschaum vom Mund. Der Regen lief immer noch an den Fensterscheiben herab. Die Scheinwerfer vereinzelter Autos blitzten durch das Wasser und verschwanden wieder. Es wäre netter gewesen, die einheimischen Weine probieren zu können, ihre unterschiedliche Qualität zu diskutieren. Dann wäre es eher ein Auftrag gewesen.
Ich bestellte mir noch ein zweites Glas von dem Französischen.
Als Libor von seiner Runde nach draußen an die Rezeption zurückkehrte, erzählte ich ihm von dem Weinkeller, den wir auf dem Gut gefunden hatten.
«Der könnte sehr alt sein», sagte er und betrachtete das Foto, das ich ihm zeigte. «Wenn er zu den Tunneln gehört, ist er viele hundert Jahre älter als das Haus selbst.»
«Was für Tunnel?»
«Die es hier unter der Stadt gab.» Libor sah sich die anderen Fotos an und hielt bei einem inne, auf dem die Weinflaschen zu sehen waren.
Es habe ein verschlungenes System von Gängen gegeben, teilweise bis zu drei Stockwerke unter der Erde. Sie seien im Mittelalter angelegt worden, um in Kriegszeiten Essen transportieren zu können. Zur Zeit der alten Könige hätten sie als Munitionslager gedient sowie als Fluchtwege und Schutzräume. Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts seien sie wieder zugemauert worden, als alles ans Licht strebte, nach oben und in die Moderne.
Er vergrößerte das Foto einer Weinflasche, Jahrgang 1937.
«Lag der da unten? Nicht schlecht, möchte mal wissen, wie der schmeckt.»
«Grässlich.»
Er lachte laut.
«Verkaufen Sie ihn an deutsche Touristen. 1937! Da lässt sich vielleicht sogar böhmischer Wein verkaufen, sie zahlen wer weiß was für antike Sachen.»
Ich fragte ihn nach dem Text auf dem Etikett und erfuhr, dass Müller-Thurgau der Name einer Rebsorte sei oder besser gesagt einer Kreuzung mehrerer Rebsorten, ursprünglich vor allem in Deutschland angebaut, sie erinnere an Riesling.
«Eine der beiden Rebsorten, die im Kommunismus erlaubt waren, deshalb hat er keinen besonders guten Ruf. Im Kohleabbau waren sie deutlich besser, wenn man das so sagen darf.»
«Wie hieß die andere?»
«Ja, wie hieß die … Muscat?»
Zu dem, was sonst noch auf dem Etikett stand, konnte er nichts sagen, weder zum Namen des Weinguts noch des Weins, er konnte sich überhaupt nicht erinnern, dass in dieser Stadt je Wein produziert worden wäre oder dass überhaupt jemand auf dem Gut gewohnt hätte. Als Kind sei er herumgestromert und habe auf den verlassenen Höfen Abwehrstellungen gebaut, das täten wohl alle Jungs, die zu spät geboren worden seien, um Partisanen zu werden. Sie folgten den Spuren der Werwölfe und malten sich aus, die Deutschen würden sich noch irgendwo verstecken.
«Weißt du noch?», rief er zum Tisch hinüber und wiederholte etwas auf Tschechisch, einer der Männer schüttelte die Faust in der Luft, bumm bumm, lautes Lachen erfüllte das Lokal.
«Mein Großvater kam in den vierziger Jahren hierher und übernahm den Laden», sagte Libor, «aber er hatte es wohl nicht so mit dem Wein.»
Ich hatte mich von den Stimmen einhüllen lassen und gar nicht bemerkt, dass sie aufgetaucht war, die Engländerin. Wusste nicht, wie lange sie schon hinter mir gestanden hatte, ein paar Meter entfernt, als ich mich der Höflichkeit halber umdrehte und in das Lachen der Männer einstimmte.
Ihr Regenschirm war anscheinend von besserer Qualität als meiner, das Wasser lief daran herab, als sie ihn zusammenklappte, und bildete eine kleine Pfütze, die von den dunklen, beinahe schwarzen Dielen aufgesogen wurde. Sie selbst war vollkommen trocken.
«Ich muss mich entschuldigen, ich war neulich nicht besonders freundlich», sagte sie.
«Kein Problem», sagte ich, «ich habe gar nicht darüber nachgedacht.»
«Vielleicht lag es an der Hitze, die vertrage ich nicht so gut. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich mich zu Ihnen setze?» Sie schaute sich diskret um. «Sieht aus, als wären wir hier die einzigen Damen.»
«Nein, ja, klar», sagte ich und zog einen Barhocker heraus. «Ich wollte nur den Regen abwarten, aber der scheint ja gar nicht mehr aufhören zu wollen.»
Diskret. Ihre Bewegungen, ihre ganze Erscheinung fanden in diesem Wort Platz. Wie sie lautlos den Barhocker zu sich heranzog und eine schwarze Ledertasche auf dem Boden abstellte, sich mit einer kaum merklichen Geste ein Glas Wein derselben Sorte wie meines bestellte.
Ihr Lächeln, als sie am Wein nippte.
«Hm, nicht besonders, oder?»
Plötzlich war da ein kleines Einvernehmen. Ich ließ mir mein Glas nachfüllen.
Sie hieß Anna Jones.
«Sonja», wiederholte sie, nachdem ich mich vorgestellt hatte, «und wie spricht man Ihren Nachnamen aus, diese Kringel und Punkte, Aastrom?»
«Åström, das ist sehr schwedisch, nicht zu gebrauchen im Rest der Welt.»
Sie wiederholte es dreimal und bekam es korrekt hin. Es gefiel mir, dass ihr das wichtig war. Wir wechselten ein paar Worte über den Regen, die Hitze, und sie meinte, dass das Gästezimmer im Wirtshaus besser sei, als sie erwartet habe. Eigentlich habe sie ein Zimmer im Grandhotel am Markt gebucht. Ihr sei nicht klar gewesen, dass dort gerade renoviert wurde. «Ich hatte nicht den Eindruck, dass da irgendetwas passiert.» Ihr Akzent erinnerte mich an Downton Abbey, britische Schlösser und Herrensitze.
«Und was machen Sie hier?», fragte ich. «Geschäfte?»
Jetzt, wo sie so nah war, konnte ich graue Strähnen in ihrem Haar erkennen, kleine Fältchen rund um die Augen, sie war ein paar Jahre älter als ich.
«Ich reise und schaue mich um», sagte sie, «zu Orten, an denen ich noch nie war, jetzt, da ich unerwartet Zeit dafür habe.»
Anna Jones fingerte an ihrem Glas herum, trank ein bisschen vom Wein. Es kam mir aufdringlich vor, weiterzufragen.
«Mein Mann», sagte sie schließlich, «entschuldigen Sie, mein Exmann, läuft mit künstlerischen Ambitionen durch die Gegend und glaubt, er würde mal ein großer Fotograf werden, mit den richtigen Kameras, er liebt große Objektive.» Sie zeigte mit einer Geste, wie groß, und wir lachten. «Er arbeitet in der Personalabteilung einer der größeren Londoner Banken, es wäre daher ein ziemlicher Schritt, aber wie auch immer, nach einer Menge Wein kam er auf die Idee, ein Buch zu machen, zusammen mit einem Freund, der in ähnlicher Weise davon träumt, Autor zu werden und den ganzen Zirkus in der Stadt einfach hinter sich zu lassen. Am Arsch Europas sollte es heißen.»
Ich lachte ein bisschen zu laut, allmählich fühlte ich mich ziemlich beschwipst. Anna Jones hatte noch nicht einmal ihr erstes Glas ausgetrunken.
«Sie wollten die deprimierendsten Orte Europas aufsuchen», fuhr sie fort, «die allerlangweiligsten Städte, die hässlichsten und nichtssagendsten Gegenden, es sollte ein Reiseführer werden, wie es ihn bisher noch nie gegeben hat, ein Bestseller, weil die Leute großartige Bauwerke und hinreißende Landschaften angeblich so leid sind. Das alles sei doch längst bis zum Erbrechen abfotografiert worden, niemand wolle mehr die Brücken von Venedig sehen oder die Sagrada Família.»
Sie schwieg und schaute aus dem Fenster, der Regen hatte etwas nachgelassen, man konnte jetzt die Häuser auf der anderen Straßenseite sehen. Die Männer hatten ihr Kartenspiel beendet, leere Seidel auf dem Tisch, nur einer saß noch da, über eine Zeitung gebeugt.
«Was meinen Sie, wäre dieser Ort hier dafür geeignet?»
«Nein», sagte ich.
Als sie lächelte, hoben ihre Mundwinkel sich kaum merklich, aber es war ein Lächeln.
«Ich finde es schön hier», sagte ich und suchte nach Worten für das, was ich empfand. Es ging nicht nur um die blühenden Felder und die Berge und den Fluss, auch die verlassenen Häuser hatten etwas, die Schönheit des Verfalls. Es regte die Phantasie an. Vielleicht hatte es etwas damit zu tun, wo ich aufgewachsen war. Ich hätte ihrem Exmann eine Menge über die schwedische Abreißhysterie in den sechziger Jahren erzählen können, von viereckigen Marktplätzen und ebensolchen Domus-Kaufhäusern.
Anna Jones lachte leise.
«Es wird nicht schlimmer gewesen sein als dort, wo ich herkomme», sagte sie.
Wie sich herausstellte, kam sie gar nicht aus England, sondern aus Deutschland, war im Osten aufgewachsen, nicht weit von der polnischen Grenze. Im Braunkohlegebiet, sagte sie. Tal der Ahnungslosen habe man damals die Gegenden genannt, die so weit im Osten lagen, dass man dort kein Westfernsehen empfangen konnte. Dort wohnten die, die von nichts eine Ahnung hatten. Doch das habe sie als Kind nicht gewusst und deshalb gar nicht begriffen, wie ahnungslos sie war, bis sie nach Berlin gezogen sei. Am Abend, als die Mauer fiel, habe sie in ihrem Studentenzimmer gesessen und Jura gebüffelt, sei später aber rausgegangen, um sich etwas zu essen zu kaufen. Der einsame Barmann habe gefragt, was sie dort noch zu suchen hätte. «Alle anderen sind in den Westen abgehauen.»
«Man hört Ihnen gar nicht an, dass Sie Deutsche sind», sagte ich. «Ich dachte, Sie kämen aus England.»
«Ich habe selbst beinahe angefangen, das zu glauben.»
Ich spürte eine Art Verbundenheit. Wir hatten beide etwas hinter uns gelassen, befanden uns beide an einer Weggabelung. Plötzlich drehte sich alles.
«Ich glaube, ich muss was essen», sagte ich.
«Entschuldigung, ich will Sie nicht aufhalten.»
«Nein, nein, es ist sehr nett mit Ihnen.»
Ich schickte Daniel eine Nachricht, dass ich später kommen würde, schob es auf den Regen und bestellte einen Römersalat. Anna Jones nahm eine Tasse Tee, «ich bin sehr britisch geworden, wie Sie sehen».
«Das mit dem Weingut klingt interessant», sagte sie dann, «ja, Entschuldigung, ich habe Sie über Rebsorten reden hören, als ich reinkam … Warum ausgerechnet hier?»
Ich erzählte von der Anzeige, dass wir einfach Lust gehabt hatten, mit dem Rest unseres Lebens noch etwas Neues anzufangen, wegzugehen und gleichzeitig innezuhalten. Von der Sehnsucht nach Ganzheitlichkeit und Bodenständigkeit, die wohl auch ein bisschen damit zusammenhing, wie erschreckend und unbegreiflich die Welt sich entwickelte. Sie hörte aufmerksam zu, stellte aber keine weiteren Fragen. Ich erzählte wohl auch ein bisschen mehr über meinen Mann. Dass er das bräuchte, eine Veränderung, etwas zum Anpacken.
«Und Sie, brauchen Sie das auch?»
Brauchte ich es?
«Es ist, als befänden wir uns am Beginn eines Traums», sagte ich, «es fühlt sich irgendwie unwirklich an.»
Als ich weitere Fragen zu ihrer Herkunft stellte, antwortete Anna Jones höflich, aber ziemlich distanziert, als gehe es um jemand anderen. Sie hatte in Berlin einen Engländer kennengelernt, als die Mauer gefallen und Deutschland wiedervereint war, sie bekamen zwei Kinder. Ein Haus in Nordlondon, eine Anstellung bei einer Firma, die sich auf europäisches Wirtschaftsrecht spezialisiert hatte.
«Was bin ich also, Deutsche, Engländerin, Europäerin? Das Land, in dem ich aufgewachsen bin, ist verschwunden. Es sollte keine Grenzen mehr geben. Jetzt soll der Hauptsitz unserer Firma von London nach Frankfurt verlegt werden, meine Söhne sind erwachsen. Als wir uns kurz vor der Abstimmung über den Brexit beim Schuhmacher trafen, sagte eine Nachbarin zu mir, dass es ganz bestimmt nicht solche wie ich wären, die sie loswerden wollten, my dear Mrs. Jones, solche, die arbeiteten und sich integriert hätten und die sie gut kennen würden. Aber wenn ich nicht mehr Mrs. Jones bin, wenn ich meinen Job verliere und in ein Viertel ziehe, wo mich niemand kennt, was bin ich dann?»
Anna Jones wiederholte leise, nur für sich und auf Deutsch: Was bin ich? Es war das Einzige, was ich sie auf Deutsch sagen hörte.
«Und was hast du dann gesagt?»
«Wozu?»
Daniel trug Sportklamotten, als ich kurz vor der Dämmerung nach Hause kam. Wir trafen uns im Flur vor der Küche. Ich hatte ihm von meiner Begegnung im Wirtshaus erzählt und warum ich so lange dortgeblieben war, dass der Supermarkt schon geschlossen hatte.
«Willst du jetzt wirklich rausgehen?», fragte ich. «Im Wald muss es pitschnass sein.»
«Das meiste saugt der Boden auf.»
«Ich habe nur erzählt, dass wir einen Neuanfang machen wollten, dass wir das Gefühl hatten, es wäre an der Zeit dafür.»
«Okay.» Er bückte sich und schnürte seine Laufschuhe. «Ich habe übrigens den Boden im Salon abgeschliffen.»
«Komplett?»
«Ja.»
Ich ahnte einen Vorwurf, er hatte in Staub und Sägemehl gekniet, während ich Wein geschlürft hatte. Ich strich ihm über den Arm.
«Ich habe nichts über dich erzählt.»
«Schon okay.» Er schnallte die Stirnlampe fest, auf den Waldwegen würde es bald dunkel werden. Bis zur nächsten Straßenlaterne war es weit, einen halben Kilometer, wo der Kiesweg an der Brücke in die Landstraße überging. «Ich möchte nur gerne wissen, was die Leute von mir denken, wenn du jetzt mit Freundinnen in der Stadt rumhängst.»
«Es war keine Freundin. Nur jemand auf der Durchreise, mit der ich in der Bar gesessen habe, weil es draußen regnete.»
Für den Regen konnte ich nichts.
«Ist doch nett, wenn du Leute kennenlernst.» Daniel befestigte die Hülle mit dem Handy an seinem Arm. Die Stirnlampe leuchtete grellweiß, wie ein drittes Auge auf seiner Stirn. «Es ist mir nur wichtig, selbst Einfluss auf den ersten Eindruck zu haben, den die Leute von mir bekommen.»
«Du brauchst dir keine Sorgen zu machen.»
Nach dem Regen waren die Gerüche draußen stärker geworden, die Rosen drängten sich förmlich in den Vordergrund. Ich meinte, Thymian zu riechen. Auf dem Weg, den Daniel getrampelt hatte, erhöhte er das Tempo, joggte durch das wildwachsende Gras und verschwand nach oben, Richtung Wald.