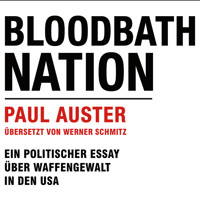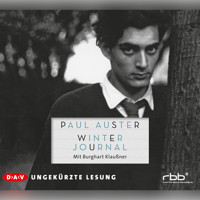22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Dies ist Paul Austers sehr persönliche Abrechnung mit der Vergottung des Waffentragens in der amerikanischen Kultur und Gesellschaft. Er erzählt davon zunächst in biografischen Vignetten, beginnend bei den Spielzeugcolts der Kindheit und den Western im Fernsehen. Es folgen die ersten Einschläge im näheren Umfeld, der von der Großmutter erschossene Großvater – lange Zeit ein Familiengeheimnis, von dem Auster nur durch Zufall erfuhr. Von da aus geht er zurück in die amerikanische Geschichte und erklärt, warum die Waffe in der Hand des freien Bürgers in direkter Linie aus der Gewalt der Sklavenhaltergesellschaft hervorgegangen ist. Der Streit ums Waffentragen führt ins Zentrum der aktuellen Auseinandersetzungen um die Gestaltung des amerikanischen Gesellschaftssystems. Auster zeigt sich hier als ebenso polemischer wie klarsichtiger politischer Beobachter und Kommentator. Der Text wird begleitet von Fotos des US-Fotografen Spencer Ostrander – in ihrer Stille gespenstisch eindrückliche Schwarz-Weiß-Aufnahmen der Schauplätze bekannter Massaker.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 114
Ähnliche
Paul Auster • Spencer Ostrander
Bloodbath Nation
Mit Fotos von Spencer Ostrander
Über dieses Buch
Dies ist Paul Austers sehr persönliche Abrechnung mit der Vergottung des Waffentragens in der amerikanischen Kultur und Gesellschaft. Er erzählt davon zunächst in biografischen Vignetten, beginnend bei den Spielzeugcolts der Kindheit und den Western im Fernsehen. Es folgen die ersten Einschläge im näheren Umfeld, der von der Großmutter erschossene Großvater - lange Zeit ein Familiengeheimnis, von dem Auster nur durch Zufall erfuhr.
Von da aus geht er zurück in die amerikanische Geschichte und erklärt, warum die Waffe in der Hand des freien Bürgers in direkter Linie aus der Gewalt der Sklavenhaltergesellschaft hervorgegangen ist. Der Streit ums Waffentragen führt ins Zentrum der aktuellen Auseinandersetzungen um die Gestaltung des amerikanischen Gesellschaftssystems. Auster zeigt sich hier als ebenso polemischer wie klarsichtiger politischer Beobachter und Kommentator.
Der Text wird begleitet von Fotos des US-Fotografen Spencer Ostrander - in ihrer Stille gespenstisch eindrückliche Schwarz-Weiß-Aufnahmen der Schauplätze bekannter Massaker.
Vita
Paul Auster wurde 1947 in Newark, New Jersey, geboren. Er studierte Anglistik und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Columbia University und lebte danach einige Jahre in Frankreich. International bekannt wurde er mit seinen Romanen «Im Land der letzten Dinge» und der New-York-Trilogie. Sein umfangreiches, vielfach preisgekröntes Werk umfasst neben zahlreichen Romanen auch Essays und Gedichte sowie Übersetzungen zeitgenössischer Lyrik.
Spencer Ostranderwurde 1984 in Seattle geboren und lebt seit den Nullerjahren in New York. Er hat auf allen Gebieten der Fotografie gearbeitet und zwei weitere Bücher publiziert: «Long Live King Kobe» mit Text von Paul Auster und «Times Square in the Rain».
Werner Schmitz ist seit 1981 als Übersetzer tätig, u. a. von Malcolm Lowry, John le Carré, Ernest Hemingway, Philip Roth und Paul Auster. 2011 erhielt er den Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Preis. Er lebt in der Lüneburger Heide.
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel «Bloddbath Nation» bei Grove Press, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2024
Copyright der deutschen Erstausgabe © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Text © 2021 by Paul Auster
Photographs © 2021 by Spencer Ostrander Inc.
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München, nach dem Original von Grove Press
ISBN 978-3-644-01492-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Bloodbath Nation
Vorbemerkung
Die Bilder, die den Text dieses Buchs begleiten, sind Fotos der Stille. Über zwei Jahre hinweg hat Spencer Ostrander auf Reisen durchs ganze Land die Schauplätze von mehr als dreißig Amokläufen der letzten Jahre fotografiert. Bemerkenswert an diesen Bildern ist die völlige Abwesenheit von Menschen, und auch von Waffen findet sich keine Spur, nicht der kleinste Hinweis darauf, dass es dort irgendwo welche geben könnte. Es sind Porträts von Gebäuden, oft trostlosen, hässlichen Bauten in öden, nichtssagenden amerikanischen Landschaften, vergessenen Schauplätzen entsetzlicher Massaker, verübt von Männern mit Gewehren und Pistolen, für kurze Zeit ins öffentliche Bewusstsein gedrungen und bald wieder in Vergessenheit geraten, bis dann Ostrander mit seiner Kamera auftauchte und sie zu Grabsteinen unserer kollektiven Trauer machte.
1
Ich habe nie eine Schusswaffe besessen. Jedenfalls keine richtige, doch bin ich, kaum den Windeln entwachsen, zwei oder drei Jahre lang mit einem Revolver an der Hüfte herumstolziert. Ich war Texaner, auch wenn ich in den Vorstädten von Newark, New Jersey, lebte, denn Anfang der Fünfziger war der Wilde Westen überall, und Legionen kleiner amerikanischer Jungen waren stolze Besitzer eines Cowboyhuts und einer billigen Spielzeugwaffe samt zugehörigem Kunstlederholster. Gelegentlich wurde eine Rolle Zündblättchen vor den Hahn des Revolvers gespannt, Ersatz für das Geräusch echter Kugeln, wenn wir zielten und feuerten und wieder einmal einen Schurken aus der Welt beförderten. Meistens jedoch drückten wir einfach ab und schrien: Peng, peng, du bist tot!
Ursprung dieser Fantasien war das Fernsehen, eine Neuheit, die sich exakt zur Zeit meiner Geburt (1947) zu verbreiten begann, und da das Haushaltsgerätegeschäft meines Vaters auch diverse Fernsehmodelle führte, darf ich mich rühmen, weltweit einer der Ersten zu sein, die seit dem Tag ihrer Geburt mit einem Fernseher im Haus gelebt haben. Hopalong Cassidy und The Lone Ranger sind mir am besten in Erinnerung geblieben, doch im Nachmittagsprogramm meiner Vorschuljahre gab es eine wahre Flut von billigen Western aus den Dreißigern und frühen Vierzigern, oft mit dem gut aussehenden, athletischen Buster Crabbe und seinem kauzigen Kumpan Al St. John in den Hauptrollen. Alle diese Filme waren der reine Schund, aber das konnte ich mit drei, vier, fünf Jahren nicht erkennen, und eine Welt, sauber aufgeteilt in Männer mit weißen Hüten und Männer mit schwarzen Hüten, war genau das Richtige für die beschränkten Fähigkeiten meines jungen, einfältigen Verstands. Meine Helden waren gutmütige Trottel, dickfellig, wortkarg, mutlos in Gegenwart von Frauen, konnten aber Recht von Unrecht unterscheiden und schlugen oder schossen sämtliche Bösewichte nieder, wann immer eine Ranch oder eine Viehherde oder die Sicherheit der Stadt in Gefahr war.
Jeder in diesen Filmen trug eine Waffe, Helden und Schurken gleichermaßen, doch nur die Waffe des Helden war ein Werkzeug der Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit, und da ich mich nicht als Schurken, sondern als Helden sah, war der Spielzeugrevolver an meiner Hüfte ein Zeichen meiner eigenen Güte und Tugend, handfester Beweis meiner idealistischen Pseudomännlichkeit. Ohne ihn wäre ich kein Held gewesen, nur ein Niemand, nur ein Kind.
Damals war mein größter Wunsch ein Pferd, aber nicht ein einziges Mal kam mir in den Sinn, eine echte Waffe besitzen oder auch nur abfeuern zu wollen. Als sich mir schließlich die Chance dazu bot, war ich neun oder zehn und hatte meine infantile Traumwelt der Fernsehcowboys längst hinter mir gelassen. Jetzt war ich Sportler mit besonderer Leidenschaft für Baseball, aber auch Leser von Büchern und hin und wieder Verfasser furchtbar schlechter Gedichte, ein kleiner Junge auf dem verschlungenen Weg, ein größerer Junge zu werden. In jenem Sommer schickten meine Eltern mich in ein Ferienlager in New Hampshire, wo es neben Baseball auch Schwimmen, Kanufahren, Tennis, Bogenschießen und Reiten gab und zweimal wöchentlich am Schießstand geübt wurde, wo ich zum ersten Mal erlebte, wie viel Spaß es macht, den Umgang mit einem Kleinkalibergewehr zu lernen und Kugeln in eine fünfundzwanzig oder fünfzig Meter entfernte Zielscheibe zu jagen (die genaue Distanz habe ich vergessen, aber damals kam sie mir gerade richtig vor – weder zu nah noch zu weit). Unser Betreuer kannte sich bestens mit der Materie aus, und ich erinnere mich lebhaft daran, wie er mir beibrachte, das Gewehr richtig zu halten, wie man das Ziel über den Lauf hinweg anvisiert, wie man vor dem Schuss zu atmen hat und dass man, um die Kugel aus dem Lauf zu befördern, den Abzug mit einer langsamen, gleichmäßigen Bewegung zurückziehen sollte. Damals hatte ich gute Augen und machte rasch Fortschritte, erst in Bauchlage, wo ich einmal mit fünf Schüssen siebenundvierzig von fünfzig Punkten holte, dann im Sitzen, was ein ganzes Arsenal neuer Techniken erforderte, doch gerade als ich zum Knien übergehen sollte, war der Sommer zu Ende und mit ihm meine Karriere als Schütze. Meine Eltern fanden, das Ferienlager sei zu weit weg, und schickten mich im nächsten Sommer in ein anderes, nur halb so weit entferntes, und dort stand Schießen nicht auf dem Programm. Eine kleine Enttäuschung, mag sein, in jeder anderen Hinsicht aber war das zweite Lager besser als das erste, und so dachte ich nicht weiter darüber nach. Und doch, mehr als sechzig Jahre später ist mir immer noch deutlich im Gedächtnis, wie gut es sich anfühlte, einen Schuss mitten ins Schwarze zu setzen – diese Zufriedenheit, ähnlich der, die mich jedes Mal erfüllte, wenn ich als Shortstop einen vom Leftfielder geworfenen Ball erwischt und mit einer schnellen Drehung dem Catcher zugeworfen hatte, während ein Runner schon um die dritte Base gekurvt und auf dem Weg zur Homeplate war. Dieses Gefühl, mit etwas oder jemand weit Entferntem verbunden zu sein; einen Ball werfen oder eine Kugel abfeuern und ins Schwarze treffen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen – einen Run des Gegners abzufangen, am Schießstand eine hohe Punktzahl zu erzielen –, so ein Erfolgserlebnis machte mich geradezu euphorisch. Entscheidend war das Gefühl der Verbundenheit, und ob es dazu eines Balls oder einer Gewehrkugel bedurfte, spielte keine Rolle.
Die nächste Chance zur Benutzung eines Gewehrs bekam ich mit vierzehn oder fünfzehn. Unterdessen ging meine Sportbegeisterung über Baseball hinaus und umfasste auch Football und Basketball, und gleichgültig, ob ich Tackle oder Touch spielte, auf großem oder kleinem Feld, die Verbundenheit mit etwas oder jemand weit Entferntem war noch immer das Berauschendste an der Sache – einen Sprungwurf aus fünf oder sieben Metern zu versenken oder in meiner Rolle als Quarterback einen 40-Meter-Pass genau über die Reihen der gegnerischen Verteidigung hinweg in die Arme meines nach vorn stürmenden Receivers zu werfen, sodass ihm ein Touchdown gelang. Einer meiner engsten Freunde jener Zeit kam aus einer wohlhabenden Familie, und nicht lange nachdem sein Vater eine Hobbyfarm im Sussex County erworben hatte, wurde ich für einen Samstag oder Sonntag Mitte November dorthin eingeladen. An das meiste kann ich mich nicht erinnern, unvergesslich allerdings sind die ein oder zwei Stunden, die wir in dieser frostigen ländlichen Umgebung unter kahlen Ästen und lärmend herumflatternden Krähen mit Tontaubenschießen verbrachten. Diesmal war es kein Kleinkalibergewehr, sondern eine doppelläufige Schrotflinte mit kräftigem Rückstoß, ein Schießprügel, der schon mehr hermachte, und ich schoss nicht mehr auf eine Pappscheibe, die an einer Mauer befestigt war, sondern auf ein Ding, das sich frei durch die Luft bewegte – eine runde schwarze Scheibe, Tontaube genannt, die von einer Vorrichtung am Boden schräg nach oben geschleudert wurde, und beim Zielen auf dieses über den grauweißen Himmel sausende schwarze Ding war mir sofort klar, ich musste schnell handeln, sonst schlug es am Boden auf, bevor ich abgedrückt hatte. Seltsamerweise kam mir das nicht schwierig vor, und schon beim ersten Versuch gelang es mir, Geschwindigkeit und Flugbahn der Scheibe zu berechnen und richtig einzuschätzen, wie weit vor die Scheibe ich zu zielen hatte, damit das Projektil auf seinem Weg durch die Luft am Ende mit dem auf es zufliegenden Ding kollidierte. Mein erster Schuss war ein Volltreffer. Die Tontaube zersprang mitten im Flug und ging in winzigen Splittern zu Boden, und als Sekunden später die zweite hochgeschleudert wurde, traf ich auch sie. Anfängerglück, mag sein, doch ich fühlte mich eigenartig souverän; dann kamen mein Freund und sein Vater an die Reihe, und während ich wartete, sagte ich mir, es müsse irgendwie mit all den Bällen zu tun haben, die ich in den letzten zwei oder drei Jahren geworfen hatte. Und sosehr mir das Schießen auf Zielscheiben in New Hampshire gefallen hatte, spürte ich sofort, dass diese Art zu schießen wesentlich mehr Befriedigung verschaffte. Vor allem, weil es schwieriger war, aber auch, weil es mehr Spaß machte, eine Tontaube zu zertrümmern, als in ein Stück Pappe ein Loch zu stanzen. Den ganzen Nachmittag habe ich kein einziges Mal danebengeschossen.
Wenn ich bedenke, wie viel Gefallen ich an diesem neuen Sport gefunden habe, ist mir rätselhaft, warum ich damit nicht weitergemacht habe. In New Jersey hätte ich bestimmt einen Schützenverein finden und ein- oder zweimal die Woche nach Herzenslust schießen können, aber sosehr ich diesen Tag auf der Farm genossen hatte, ließ ich die Sache dann einfach fallen. Noch rätselhafter, in all den Jahren seither habe ich niemals mehr eine Schusswaffe in der Hand gehabt.
Mangels anderer Erklärungen vermute ich, mein Desinteresse an Schusswaffen rührt daher, dass nichts in meiner damaligen Umgebung mich an sie herangeführt hat. Weder mein Vater noch meine Mutter oder sonst jemand im weiteren Familienkreis besaß eine Schusswaffe, keiner von ihnen betätigte sich als Jäger, war im Schützenverein oder sprach jemals davon, sich eine Kurzwaffe oder ein Gewehr anschaffen zu wollen, um seine Familie vor Einbrechern zu schützen. Dasselbe galt für alle meine Freunde und deren Familien, und obwohl die Zeitungen in den 1950ern voll waren von Berichten über Morde in der Unterwelt, kann ich mich nicht erinnern, dass Waffen in meiner Heimatstadt jemals Gesprächsstoff waren. Auf dem Land nahmen Väter schon ihre kleinen Söhne mit auf die Jagd, und in den Großstädten befehdeten sich Halbwüchsige in den Armenvierteln mit selbst gebastelten Pistolen und wurden als «jugendliche Straftäter» abgestempelt, doch in meiner weitgehend friedlichen, aber auch nicht von Verbrechen verschonten Vorstadtwelt waren Schusswaffen kein Thema, nicht einmal in den Jahren, als wöchentlich zwanzig oder dreißig Western im Fernsehen liefen und Hollywood am Fließband Wildwestfilme produzierte. Nimmt man die Flut von Gangsterfilmen und -TV