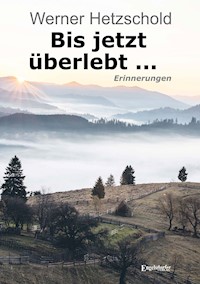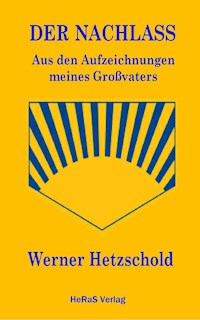Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Andreas Bleibtreu studiert Anglistik und Germanistik. Lehrer soll er werden, wie alle seiner Sippe. Sein Geldproblem ist chronisch. Als ihn sein Kommilitone Jan fragt, ob er nicht Lust hätte, Nachhilfeunterricht zu erteilen, sagt er ohne Bedenken zu. So gerät er in die gutbetuchte Familie Birnbaum, Geschäftsleute, zurückgezogen in einer pompösen Villa in Bad Homburg lebend. Ihren Sohn Daniel soll er in Deutsch und Englisch fördern. Gemeinsam mit Daniel, Andreas und seiner Partnerin unternimmt er im Auftrage des Herrn Birnbaum eine vierwöchige Bildungsreise nach Großbritannien. Während einer Tanzveranstaltung, fragt Andreas Jan nach den Gründen, weshalb er die äußerst lukrative Lehrtätigkeit bei den Birnbaums ausgeschlagen hat. Jan erzählt, dass sein Vater viele Jahre für die Birnbaums gearbeitet hat und jetzt von ihnen gefeuert worden sei. Andreas kann sich nicht vorstellen, dass der feinsinnige Herr Birnbaum Jans Vater vor die Tür setzt, wenn nicht zwingende Gründe vorliegen. Plötzlich sind Jan und der junge Birnbaum spurlos verschwunden. Herr Birnbaum weiß Bescheid, informiert Andreas, dass eine junge Frau ihn habe wissen lassen, wenn er wünsche, dass seinem Sohn nichts passiert, so soll er eine gewisse Summe zahlen. Er werde den geforderten Geldbetrag der Anruferin zukommen lassen, sagt Herr Birnbaum. Die Polizei will er auf keinen Fall einschalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 156
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Werner Hetzschold
BLOß NICHT HERVORSTECHEN
Engelsdorfer VerlagLeipzig2022
Werner Hetzschold,
geboren 1944, erlernte nach dem Abitur
den Beruf des Schriftsetzers (Handsatz /
Maschinensatz), arbeitete als Korrektor,
studierte Anglistik und Germanistik,
beendete erfolgreich sein Studium als Diplom-
Fachlehrer für Englisch und Deutsch,
erwarb die Lehrbefähigungen für Stenografie,
Maschinenschreiben, Textverarbeitung, für das Fach ProfilPASS,
absolvierte erfolgreich ein Studium als Sozialtherapeut,
am Literaturinstitut „Johannes R. Becher“,
war fünf Jahrzehnte als Lehrer in der Berufsausbildung,
der Erwachsenenqualifizierung in vielen Fächern,
als Sprachlehrer für Deutsch als Fremdsprache,
als Übersetzer und Dolmetscher für Englisch,
als Programmredakteur tätig.
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Copyright (2022) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Titelbild © zenobillis [Adobe Stock]
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Bloß nicht hervorstechen
Ich heiße Andreas Bleibtreu, studiere Anglistik und Germanistik, bin im sechsten Semester, bin 25 Jahre alt und habe eine Freundin. Lehrer soll ich werden wie alle vor mir in meiner Sippe. Wir sind ein Lehrerclan. In unserer Familie gibt es nur Studierte, aber keine wirklich klugen Leute. Bis jetzt hat es noch keiner zu Reichtum gebracht. Alle hatten ihr bescheidenes Auskommen. Meine verwandtschaftlichen Zeitgenossen – soweit verheiratet – haben alle ihr eigenes Haus und einen zweiten Wagen, damit die Ehefrau auch flexibel und mobil ist, sich als Individuum realisieren kann. So konservativ und traditionell verhaftet es in unserer Familie zugeht, so anpassungsfähig sind wir auch. Das sichert das Überleben. Zumindest sind wir davon überzeugt. Das liegt bei uns im Blut. Ich bin überzeugt, was von einer Generation auf die nächste kontinuierlich übertragen wird, verfestigt sich bestimmt irgendwann einmal, wird zum genetischen Erbgut.
Eigentlich will ich gar nicht Lehrer werden, aber alle haben mir zugeredet, den Weg des Pädagogen zu gehen. Zum Mediziner oder Rechtsanwalt reicht es nicht, hat der Vater gesagt. Und der Beruf des Pädagogen hat den Vorteil, hat er gesagt, dass auch du irgendwann einmal verbeamtet wirst. Mein Sohn, es ist ein Beruf auf Lebenszeit. Lebenslang bist du abgesichert, überlebst in der Regel alle Krisen mehr oder weniger unbeschadet. Ein gutes Beispiel ist deine eigene Familie. Bis jetzt haben wir überlebt, wenn auch nicht immer unbeschadet. Nur Opfer muss jeder bringen. Wir selbstverständlich auch. Nur haben wir überlebt, immer und zu allen Zeiten, ganz gleich, wohin das Schicksal uns auch trieb. Wir passten uns an, fassten Fuß, fanden eine neue Heimat, wurden sesshaft, manchmal sogar beinahe bodenständig.
Mein Vater überzeugte mich. Ich erkannte selbst, dass ich nicht das Zeug hatte, um Arzt oder Rechtsanwalt zu werden. Manche aus unserer Sippe hatten diesen Weg gewählt und waren sehr erfolgreich. Sie wurden zum leuchtenden Vorbild für die anderen. Ich hatte den Eindruck, dass aus mir nie ein Vorbild werden würde. Ich gehörte zu denen, von denen die Späteren sagen, er hat sich redlich ernährt, war fleißig und gewissenhaft, hat es sogar zum Studiendirektor gebracht, aber der Biss, der richtige Biss, der fehlte ihm eben.
Meine Eltern unterstützen mich. Meine Mutter mehr als mein Vater. Frauen haben eben doch ein weicheres Herz, zumindest ihren Söhnen gegenüber. Sie wünschen sich, dass der Sohn nicht nur erfolgreich, sondern auch glücklich ist. Und meine Mutter will einen glücklichen Sohn. Trotzdem besitze ich nie Geld. Das Geldproblem ist schon chronisch. Ich muss mir immer etwas einfallen lassen, um diese persönlichen Missstände zu beheben. Deshalb arbeite ich oft am Wochenende, aber manchmal auch an den Abenden innerhalb der Woche als Kellner. Frankfurt bietet da viele Möglichkeiten.
Ich weiß nicht mehr, wann es genau war, als mich mein Kommilitone Jan ansprach und mich fragte, ob ich nicht Lust hätte, Nachhilfe-Unterricht zu erteilen. Der Job würde sehr gut bezahlt werden. Die Leute wären nicht nur sehr gut betucht und hoch angesehen innerhalb der Frankfurter Bürgerschaft, sondern auch sehr freundlich und unkompliziert im Umgang mit ihren Mitmenschen. Es sind Geschäftsleute, würden aber persönlich – vielleicht aus Bescheidenheit – kaum öffentlich in Erscheinung treten. Und diese offensichtlich reichen Leute hätten einen Nachzügler, einen Sohn, den sie gern in Deutsch und Englisch gefördert sehen möchten.
„Und das sind deine Disziplinen“, sagte Jan. „In diesen Fächern wirst du dich doch auskennen.“ Er fügte hinzu, er könnte diesen Job momentan nicht übernehmen, da er noch einige Prüfungen nachzuholen hätte. Ich sagte zu. Er gab mir eine Telefon-Nummer. Ich sollte mich auf ihn berufen.
„Vielleicht bin ich eine sehr gute Referenz für dich“, sagte er lächelnd, bevor wir uns trennten.
Ich brauchte dringend Geld. Im Antiquariat hatte ich preisgünstig Bücher erwerben können, die ich schon lange in meinen Besitz bringen wollte. Unverzüglich rief ich an. Ein Termin wurde vereinbart.
Jetzt werde ich in Bad Homburg erwartet.
Mich empfängt ein kleiner Mann, sein Alter etwa zwischen Fünfzig und Sechzig, mit einem schmalen, fein geschnittenen Gesicht, aus dem mich prüfend zwei große, dunkelbraune Augen unter schwarzen Augenbrauen mustern, in einem großen Raum, der nur spärlich erleuchtet ist. Trotzdem bemerke ich sofort die vielen Bücherregale an den Wänden. Sie erregen meine Neugier. Ich erkenne Bücher, die ich gern besitzen würde.
„Nehmen Sie bitte Platz“, sagt sanft eine sonore Stimme.
Uns trennt ein gewaltiger Schreibtisch, der sicher viele Generationen überlebt hat und noch immer als Zierde des Geistes nicht nur seine Aufgabe erfüllt, sondern ein echtes ästhetisches Highlight ist. Gern besäße ich diesen Schreibtisch. Stehe ich doch nicht nur auf alte Bücher, sondern auch auf alte Möbel, eigentlich auf alles, was alt, schön, gediegen, aber gleichzeitig prächtig ist, und die Phantasie anregt.
Wie sich mein Gegenüber von mir gewiss ein Bild macht, so mache ich mir eins von ihm. Ich finde diesen Mann interessant: seine ausdrucksstarken, lebhaft dreinblickenden, dunkelbraunen Augen, seine bereits ergrauten Locken, die ihn älter erscheinen lassen, als er in Wirklichkeit zu sein scheint. Ich beneide ihn um diesen vollen Haarschopf, habe ich doch ernstlich schon gegen meine Haarprobleme anzukämpfen, verfüge über eine Tonsur, wie sie früher die Mönche getragen haben.
„Sie studieren also Anglistik und Germanistik. Wollen später einmal Lehrer werden.“ Prüfend ruht sein Blick auf mir. Ich fühle, wie mich seine Augen abtasten. Ich spüre so etwas. Er schaut durch mich hindurch. Zumindest habe ich diese Vermutung.
„Gefällt Ihnen Ihr Studium?“ Ohne eine Antwort abzuwarten, fährt er fort: “Ich stelle mir vor, zum Pädagogen muss der Mensch geboren sein. Der Mensch muss sich zu diesem Beruf berufen fühlen wie der Arzt…“ Wieder macht er eine Pause. „Im sechsten Semester sind Sie?“
„Im sechsten!“ Ich bilde mir ein, meine Stimme klingt belegt, anders als sonst. Das macht die Aufregung, denke ich, denn ich fühle mich ziemlich nervös, unruhig, aber nicht ausgeliefert. Dieser Mann strahlt eine große Ruhe aus, eine große Sympathie geht von ihm aus, die sich auf seine Umgebung überträgt.
„Nun gut“, sagt er unvermittelt, „ich bin der Ansicht, wir sollten es versuchen. Über die Höhe des Honorars sind wir uns einig. Er reicht mir ein kleines weißes Blatt Papier herüber. Irgendwelche Einwände?“
Abwehrend schüttle ich mit dem Kopf, deute an, wie sehr zufrieden ich mit dieser Gage bin.
Ich habe schon für die Hälfte dieses Betrages gearbeitet. Und schwer. An Bildungseinrichtungen der Erwachsenenqualifizierung. Das alles sage ich ihm aber nicht.
„Sie haben sicher nichts dagegen, wenn ich die ersten Stunden mit im Raum anwesend bin. Ich möchte sehen, wie sich mein Sohn Daniel so anstellt. Und wie Sie sich profilieren. Das möchte ich auch gern erleben. Ich möchte Sie einfach als Lehrer und als Menschen kennen lernen. Bitte folgen Sie mir. Daniel erwartet uns sicher mit Ungeduld.“
Wir verlassen diesen großen Raum mit den vielen Büchern, steigen Stufen hinauf, betreten einen kleineren Raum, in dem ein blonder Junge mit großen, sehnsüchtig blickenden, blauen Augen sitzt, uns fragend anschaut.
„Mein Sohn Daniel, Ihr Schüler“, scherzt der Vater, „und nun sind Sie an der Reihe, junger Mann. Beweisen Sie, dass Sie ein guter Pädagoge sind.“ Mit diesen Worten setzt er sich auf einen Stuhl abseits in unmittelbarer Nähe des Fensters, das in ein helles, freundliches Licht getaucht wird von der noch immer kräftigen Sommersonne.
Ich nehme gegenüber dem jungen Mann Platz. 13, 14 Jahre ist er vielleicht, besucht die siebente Klasse eines Gymnasiums. Möglichst unauffällig betrachte ich sein Gesicht, bevor ich mit meinen Ausführungen beginne. Verträumt blicken seine großen, blauen, schwermütigen Augen in diese Welt, die keine Träumer duldet, nur Realisten.
„Beginnen wir mit Englisch“, sage ich, „wenn es recht ist.“
Er nickt mir ermunternd zu.
Wir unterhalten uns über Dinge des Alltags. Während wir reden, vergesse ich die Nähe seines alten Herrn. Daniel spricht ein sehr gepflegtes Englisch. Ich beneide ihn um seine fundierten Kenntnisse, über die er bereits in so jungen Jahren verfügt. Wir sprechen und sprechen…
„Das reicht für heute“, sagt der Vater. „Ihre Methode, Ihr Umgang mit dem Jungen, Ihre ganze Art gefällt mir. Auf Deutsch kann er heute verzichten. Sie sind engagiert.“
Er bittet mich noch einmal in seine Bibliothek. Er nähert sich seinem Schreibtisch, entnimmt ihm einen Briefumschlag.
„Das ist für Sie!“ Zum Abschied reicht er mir die Hand.
Zur vereinbarten Zeit stehe ich vor dem schlichten Tor, entdecke überall Sicherheitsvorrichtungen, die die Bewohner der Villa vor den Leuten auf der Straße schützen, das Verhalten der da draußen überwachen. Ich drücke auf den Knopf. Ein Summen ertönt. Langsam öffnet sich das Tor. Ich trete ein, folge dem breiten Fahrweg, der geradlinig zur Villa führt, die von großen, schattigen Bäumen verdeckt wird. Am Eingang empfängt mich eine junge Frau, geleitet mich wortlos in das Zimmer des Hausherrn.
Sobald ich den Raum betreten habe, erhebt er sich hinter seinem Schreibtisch, geht mir entgegen, reicht mir die Hand, begrüßt mich wie einen alten, vertraut und lieb gewordenen Bekannten.
„Nehmen Sie bitte Platz“, sagt er mit seiner sanften, so angenehm klingenden Stimme. „Bereits beim letzten Mal hatte ich Ihnen gesagt, dass mir Ihre Unterrichtsmethodik ausnehmend gut gefällt. An diesem Urteil hat sich auch nichts geändert. Mir gefällt Ihre zwanglose, offene, unkomplizierte Form. Sie bringen Ihr Wissen Daniel spielerisch bei. Das imponiert mir. Und Sie sind fest entschlossen, Lehrer zu werden?“
„Ja! Ich werde Lehrer, wie die vor mir, wie mein Vater, wie mein Großvater. Alle waren Lehrer, zumindest fast alle. Manche wurden auch Ärzte oder Rechtsanwälte. Die meisten aber Lehrer.“
„Sie studieren in Frankfurt?“
„Ja! An der Uni!“
„Sie wohnen in Frankfurt?“
„Ja!“
„Und Ihre Familie?“
„Sie – meine Eltern – leben in Aschaffenburg, vorher waren wir in Schweinfurt für ein paar Jahre zu Hause. Jetzt sind wir nach Aschaffenburg gezogen. Mein Vater erhielt dort eine feste Anstellung …“
„Wie das?“, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche. Staunend sind die Augen des Mannes auf mich gerichtet. „Ist Ihr Herr Vater kein Beamter? Ich frage das deshalb, weil er erst jetzt eine feste Anstellung gefunden hat.“
„So ist es! Sie müssen wissen, wir kommen aus dem Land der aufgehenden Sonne. Das liegt zwar schon eine Ewigkeit zurück, dass wir hier her kamen, aber trotzdem sind wir Fremde geblieben für die, die sich einbilden, schon immer hier gelebt zu haben. Dabei kommen viele von denen von dort her, wo meine Vorväter einst gelebt haben – aus dem Osten. Nur waren sie schneller als wir. Manche sind gleich nach dem Krieg westwärts gezogen, andere sind erst einmal dort geblieben, wohin sie das Schicksal gerade verschlagen hatte. Und später konnten sie nicht weiter wandern. Ein Zaun aus Stacheldraht und Minen hätte sie empfangen, offensichtlich ein beliebtes Mittel, um die Menschen wirkungsvoll daran zu hindern, dass sie das Paradies verlassen.“
„Woher kommen Ihre Eltern? Woher kommen Sie, junger Mann?“ Zugleich interessiert und teilnahmsvoll sind seine Augen auf mich gerichtet.
„Meine Eltern lebten zuletzt in Cottbus, vorher hielten sie sich lange in Leipzig auf.“
„Cottbus kenne ich nicht, dafür aber Leipzig. Es muss einmal eine sehr schöne Stadt gewesen sein, dieses Leipzig. Ich bin überzeugt, diese Messe-Metropole wird auch wieder einmal eine prächtige Stadt werden. Vielleicht werden wir es noch erleben, zumindest Sie, junger Mann.“
„Wir fahren dort nicht mehr hin“, sage ich. „Ich habe weder Sehnsucht nach Leipzig noch nach Cottbus. Ich habe keine Sehnsucht nach der alten Heimat, wie so viele sagen, meinen, fühlen, wenn sie von ihrem Geburtsort oder der Gegend sprechen, in der sie aufgewachsen sind. Für mich ist das nur Gerede und Schnee von Gestern. Ich lebe im Hier und Jetzt und nicht in der Vergangenheit. Mein Vater sagt auch immer: Schau niemals zurück. Es bringt nichts. Was vergangen ist, ist unwiderruflich vergangen, kann nicht rückgängig gemacht werden. Orientiere dich an der Gegenwart und versuche das Beste für dich auch für die Zukunft herauszuholen, ohne anderen Menschen Schaden zuzufügen. Tue nie jemandem etwas an, von dem du möchtest, dass es auch dir nicht angetan wird.“
„Ein kluger Mann, Ihr Herr Vater.“
„Wenn er klug wäre, hätte er es weiterbringen müssen. Er verkauft sich unter seinem Wert. Das ist meine persönliche Ansicht.“
„Vielleicht hat er keine andere Wahl. Nicht jedem ist es gegeben, sich als Geschäftsmann zu realisieren.“ Er macht eine Pause, dann fragt er unvermittelt: „Und Ihre Eltern, Ihre Großeltern, wo sind sie zu Hause gewesen?“
„Ich kann mich erinnern“, beginne ich zögernd, „dass meine Mutter mir einmal, als ich noch Kind war, Geschichten von ihrer Mutter und deren Vorfahren erzählte. Die Vorfahren meiner Mutter lebten damals in Posen, das ist heute Polen. Ich bin schon einmal in dieser Stadt gewesen. Ich war beeindruckt von der Größe und Schönheit dieser Stadt. Und in Krakau war ich auch. Ich war von den Buchhandlungen fasziniert. Dort gab es Literatur, die sonst in keiner anderen Volksdemokratie zu haben war. Ja, in Posen haben die Vorfahren meiner Mutter gelebt. Das war noch vor dem Krieg. Und der Krieg liegt ja nun fast schon wieder 60 Jahre zurück. Meine Mutter erzählte mir von den Menschen dieser Stadt. Sie sagte: Meine Großmutter war damals als junge Frau als Anwaltsgehilfin bei einem jüdischen Rechtsanwalt beschäftigt, dessen Klientel nicht nur Deutsche, Juden, Polen, sondern auch Russen, Ukrainer, Balten waren. Deshalb soll meine Großmutter nicht nur fließend Deutsch gesprochen haben, sondern auch Polnisch und Russisch und sogar etwas Englisch und Französisch.
Polnisch und Russisch hatte sie auf der Straße gelernt, wenn sie als kleines Mädchen mit den Kindern der Nachbarschaft spielte. Und ihre Eltern, also meine Urgroßeltern, sollen auch diese Sprachen gesprochen haben. Ihr Vater war ja Lehrer. Englisch und Französisch war ihr auf der Handelsschule beigebracht worden … “
„Und was hat Ihre Frau Mutter über die Juden gesagt?“, unterbricht er mich.
„Sie hat gesagt, dass ihre Mutter und Großmutter gesagt hätten… “ Ich halte inne, zögere, überlege.
„Nur Mut, junger Mann, sagen Sie das, was Ihnen Ihre Frau Mutter gesagt hat.“
„Die Juden sind in ihren Geschichten nicht besonders gut weggekommen. Meine Mutter erzählte mir, dass es in Posen viele Juden gegeben habe. Sie wohnten in Posen oder in der näheren Umgebung der Stadt, nur ganz wenige auf dem Lande. Viele kamen auch von Krakau, Warschau, Lemberg, Lodz und von vielen anderen Städten. Die reichen Geschäftsleute, die reichen Händler sollen sehr gut ausgesehen haben mit ihren dunklen, melancholischen oder mit ihren vor Witz sprühenden und blitzenden Augen, ihren gepflegten, langen Bärten und in ihren malerischen Trachten. Sie sollen wie die Apostel ausgesehen haben. Und reden sollen sie gekonnt haben wie die Propheten. Und ihre Frauen sollen erst märchenhaft schön ausgesehen haben, sehr geschmackvoll und bunt gekleidet waren sie. Sie glichen Paradiesvögeln aus Tausend und eine Nacht. Aber dann soll es auch viele Juden gegeben haben, die nicht reich waren, die ärmer waren als die ärmsten Deutschen oder Polen. Schmutzige, ungewaschene Gestalten mit langen, verdreckten Haaren und langen, verfilzten Bärten sollen es gewesen sein, die selbst mit dem Müll Schacher getrieben haben sollen. Sie sollen eine Sprache gesprochen haben, die kein vernünftiger Mensch verstand, weil es eigentlich gar keine richtige Sprache war, sondern eher ein Mischmasch von Sprachen. Diese Sprache soll sich angehört haben wie das Gegacker von Hühnern. Wenn diese Juden von einer Straßenecke vertrieben worden waren, sollen sie sich an der nächsten Ecke gleich wieder niedergelassen haben, um ihren Plunder zu verhökern. Selbst größte Erniedrigungen waren nicht imstande sie zu vertreiben. Sie gehörten zum Straßenbild wie heute die Bettler, die Süchtigen in Frankfurt … “
„Das ist das Bild, das ihre Mutter, Großmutter, Urgroßmutter von den Juden gezeichnet hat. Finden Sie es nicht etwas einseitig, junger Mann?“
„Ich kann das nicht beurteilen, bin nicht dabei gewesen, habe nur wiedergegeben, was mir meine Mutter erzählt hat, und sie, meine Mutter, hat das nacherzählt, was sie von ihrer Mutter, ihrer Großmutter gehört hat.“
„Ihre Familie“, habe ich den Eindruck, “wechselte mit jeder Generation die Gegend, gab die alte Heimat auf, um irgendwo eine neue zu suchen, vielleicht auch zu finden, bis die nächste Generation die Erfahrung machte, dass es doch nicht die richtige Heimat war und weiter zog … “
„Wenn ich Sie unterbrechen darf, Herr Birnbaum, so lag das gewöhnlich an den Umständen. Meine Eltern zum Beispiel haben nicht freiwillig die Gegend verlassen. Erst wollten sie nicht in diese Gegend, sie mussten aber, weil es ihr Beruf so mit sich brachte, das dort hingegangen wurde, wo der Staat das lehrende Individuum benötigte, wenn ich es einmal so ausdrücken darf.“
„Konnten Ihre Eltern darauf keinen Einfluss nehmen? Entsprechend meiner Auffassung kann ich als denkendes Individuum auf alles in irgendeiner Form Einfluss nehmen.“
„Sie hatten keine Alternative. Sie hatten als Lehrende ohne jegliche Beziehungen zu einflussreichen Funktionären dorthin zu gehen, wo der Staat sie als Lehrende dringend benötigte. Und da hatten sie noch Glück, dass sie nicht in eine Gegend versetzt worden sind, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen.“
„Sie konnten also ihren künftigen Aufenthaltsort doch in gewisser Weise bestimmen, wenn ich Sie richtig verstehe. Ihnen wurden, wie ich anhand Ihrer Worte schlussfolgere, einige Angebote unterbreitet.“
„Ja, da haben Sie Recht. Sie hätten nach Mecklenburg ziehen können, in die Uckermark… So entschlossen Sie sich für die Niederlausitz. Sie handelten die Stadt Cottbus aus mit dem Vertreter der Volksbildung des Bezirkes, als die große Verteilung der Absolventen vorgenommen wurde. Später wollte dieser Funktionär nichts mehr von seiner Zusage wissen. Er wollte meine Eltern in Spreewald-Gemeinden schicken… Aber das ist eine lange Geschichte.“
„Vielleicht sprechen wir ein anderes Mal darüber“ Ein nachdenkliches Lächelt gleitet über das schmale Gesicht. Herr Birnbaum erhebt sich und begleitet mich in das Zimmer seines Sohnes, das er gleich darauf wieder verlässt.
Der junge Mann erwartet mich. Er sitzt auf seinem gewohnten Platz, vor ihm liegen ausgebreitet die Bücher. Ich gewinne den Eindruck, er hat sich ausgiebig auf den Unterricht vorbereitet.
„Daniel“, sage ich, „du musst meine Verspätung entschuldigen … “
„Ich weiß Bescheid“, sagt er. „Mein Vater schätzt Sie sehr. Er unterhält sich gern mit Ihnen. Ich habe Verständnis dafür und warte, bis Sie Zeit für mich haben.“
Ich bin in der Mensa, schaue mich nach einem Platz um. Eine mir vertraute Stimme höre ich, drehe mich um. In der Fensterecke sitzt mein Kommilitone Jan und winkt mich zu sich heran, fordert mich zum Sitzen auf.