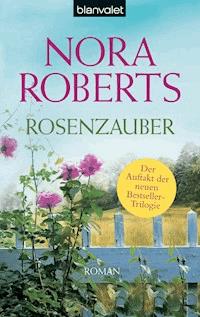9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Garten-Eden-Trilogie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes findet die junge Stella Rothchild für sich und ihre zwei kleinen Söhne bei Roz Harper ein neues Zuhause. Stella geht ganz in ihrer Aufgabe als Managerin der Gärtnerei auf und auch mit Roz verbindet sie bald eine enge Freundschaft. Das Glück scheint perfekt, als Stella Logan begegnet. Bis zu dem Tag, an dem der Schatten einer unbekannten Frau die junge Liebe von Stella und Logan zu zerstören droht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 575
Sammlungen
Ähnliche
Zum Buch
Seit Jahrhunderten ist es ein wunderschönes herrschaftliches Anwesen außerhalb von Memphis Sitz der Familie Harper. Und solange die Erinnerung zurückreicht, ist Harper House ein verwunschener Ort gewesen.
Um den Schatten der Vergangenheit zu entkommen, kehrt die junge Witwe Stella Rothchild mit ihren zwei Söhnen in ihre Heimat Tennesse zurück. Mutig beginnt die talentierte Gartenarchitektin, sich ein neues Leben aufzubauen. Ihre Arbeit in der Gärtnerei der Familie Harper erfüllt Stella schon bald mit großer Zufriedenheit, und Gavin und Luke fühlen sich in Harper House, wo sie jetzt wohnen, sehr wohl. In der als anspruchsvoll und schwierig geltenden Hausherrin Rosalind Harper findet Stella eine gute Freundin. Die größte Überraschung aber ist Logan Kitridge. Der gut aussehende Landschaftsgärtner weckt Gefühle in Stella, die sie verloren glaubte. Doch jemand will diese Verbindung um jeden Preis verhindern.
Die neue Trilogie von Bestsellerautorin Nora Roberts erzählt die Geschichte dreier Frauen aus drei verschiedenen Generationen, deren Leben eng miteinander verbunden sind, die füreinander da sind und die sich die Kraft schenken, ihr Herz für die Liebe zu öffnen.
Zum Autor
Die amerikanische Bestsellerautorin Nora Roberts, geboren in Silver Spring, Maryland, erhielt für ihre Romane internationale Auszeichnungen, und sie war eine der ersten, die in die »Romance Writer’s Hall of Fame« aufgenommen wurde. Inzwischen hat sie mehr als 100 Romane verfasst, die in über 30 Sprachen übersetzt wurden. Mit ihren Liebes- und Gesellschaftsromanen avancierte sie zu einer der meistverkauften Autorinnen weltweit.
»Erinnerung des Herzens« »Hafen der Träume« »Gezeiten der Liebe« »Insel der Sehnsucht« »Tief im Herzen« »Verborgene Gefühle« »Nächtliches Schweigen« »Sehnsucht der Unschuldigen«
Inhaltsverzeichnis
Ist der Wurzelballen sehr dicht und kompakt, sollte man ihn beim Umtopfen vorsichtig lockern. So können sich die Wurzeln an ihrem neuen Platz besser ausbreiten und mehr Standfestigkeit gewinnen.
Aus: »Treasury of Gardening« – Umtopfen von Zimmerpflanzen –
Und daran glaube ich, dass jede Blume die Atemluft genießt, die sie empfängt.
William Wordsworth
Für Dan und Jason
Ihr mögt zwar Männer sein, aber ihr werdet immer meine Jungen bleiben.
PROLOG
Memphis, Tennessee, August 1892
Ein Bastard war in ihren Plänen nicht vorgesehen. Als sie erfuhr, dass sie das Kind ihres Liebhabers in sich trug, verwandelten sich der Schock und die Panik rasch in blanke Wut.
Es gab natürlich Mittel und Wege, das Problem zu lösen. Eine Frau in ihrer Position verfügte über Kontakte, Möglichkeiten. Doch sie schreckte davor zurück, fürchtete die Engelmacher fast genauso wie dieses wachsende, unerwünschte Etwas in ihr.
Die Geliebte eines Mannes wie Reginald Harper konnte sich eine Schwangerschaft nicht leisten.
Er hielt sie nun seit nahezu zwei Jahren aus und zeigte sich dabei sehr großzügig. Oh, sie wusste, dass es auch noch andere Frauen gab – einschließlich seiner Gattin –, doch das kümmerte sie nicht.
Sie war noch jung. Und sie war schön. Jugend und Schönheit ließen sich gut verkaufen. Sie hatte das beinahe zehn Jahre lang getan, mit klarem Verstand und stählernem Herzen. Sie hatte sich Anmut und Charme angeeignet, indem sie jahrelang die feinen Damen beobachtet und nachgeahmt hatte, die in dem Herrenhaus am Fluss, wo ihre Mutter arbeitete, ein- und ausgegangen waren.
Sie hatte auch etwas Bildung genossen. Gleichwohl wusste sie weniger über die schönen Künste als über die Kunst der Verführung.
Zum ersten Mal hatte sie sich im Alter von fünfzehn Jahren verkauft und sich mit dem Geld auch Erfahrung erworben. Doch Prostitution war nicht ihr Ziel, genauso wenig wie ein eintöniges Leben als Hausfrau oder Fabrikarbeiterin. Sie kannte den Unterschied zwischen einer Hure und einer Geliebten. Eine Hure tauschte schnellen, kalten Sex gegen eine Hand voll Münzen ein und war aus dem Gedächtnis des Mannes bereits gelöscht, noch ehe er seinen Hosenlatz wieder zugeknöpft hatte.
Eine Geliebte hingegen – zumindest eine kluge und erfolgreiche – bot auch Romantik, Bildung, Gespräche und Vergnügen. Sie war eine Gefährtin, eine Klagemauer, eine sexuelle Fantasie. Eine talentierte Geliebte verstand es, nichts zu fordern und sehr viel zu erhalten.
Amelia Ellen Conner hatte Talent – und ehrgeizige Ziele. Die meisten hatte sie auch erreicht.
Sie hatte sich Reginald sorgfältig ausgesucht. Er war weder attraktiv noch geistreich. Dafür war er, wie ihre Nachforschungen bestätigt hatten, sehr reich und seiner dünnen, ehrbaren Gattin, die über das Harper-Anwesen herrschte, sehr untreu.
Eine seiner Geliebten lebte in Natchez und angeblich eine weitere in New Orleans. Da er sich mühelos noch eine Geliebte leisten konnte, hatte Amelia die Netze nach ihm ausgeworfen – ihn gelockt und erobert.
Mit vierundzwanzig Jahren lebte sie in einem hübschen Haus in der South Main und verfügte über drei Dienstboten. Ihr Schrank war mit schönen Kleidern gefüllt und ihr Schmuckkästchen mit glitzerndem Geschmeide.
Gut, sie wurde von den feinen Damen, die sie einst so beneidet hatte, nicht empfangen, dafür gab es eine mondäne Halbwelt, wo eine Frau ihrer Stellung willkommen war. Und wo man sie beneidete.
Sie veranstaltete rauschende Partys. Sie reiste. Sie lebte.
Doch ein Jahr, nachdem Reginald sie in diesem hübschen Haus untergebracht hatte, stürzte ihre klug und geschickt aufgebaute Welt plötzlich ein.
Sie wollte es vor ihm verbergen, bis sie den Mut gefunden hätte, in den Rotlichtbezirk zu gehen und der Sache ein Ende zu setzen. Doch dann ertappte er sie dabei, wie sie sich erbrach, und musterte mit diesen dunklen, scharf blickenden Augen prüfend ihr Gesicht.
Und wusste Bescheid.
Er war nicht nur erfreut, sondern verbot ihr sogar, die Schwangerschaft abzubrechen. Und zur Feier des Ereignisses kaufte er ihr eine Saphirkette.
Sie hatte das Kind nicht gewollt, aber er wollte es.
Also begann sie zu überlegen, wie sie das Kind zu ihrem Vorteil einsetzen könnte. Als die Mutter von Reginald Harpers Kind – ob Bastard oder nicht – würde sie bis an ihr Lebensende versorgt sein. Wenn ihre Jugend verwelken und die Schönheit schwinden würde, würde er vielleicht das Interesse an ihr verlieren, das Kind und sie aber dennoch weiterhin unterstützen.
Seine Gattin hatte ihm keinen Sohn geschenkt. Doch vielleicht würde sie ihm einen Sohn gebären.
Und so plante sie ihre Zukunft, während der Winter verging und der Frühling ins Land zog.
Dann geschah etwas Seltsames. Das Kind begann sich zu bewegen. Streckte sich, boxte, trat verspielt gegen ihren Bauch. Das Kind, das sie nicht gewollt hatte, wurde plötzlich ihr Kind.
Es wuchs in ihr wie eine Blume, die nur sie allein sehen und fühlen konnte. Die nur sie allein kannte. Und je größer es wurde, desto größer und heftiger wurde ihre Liebe.
In der schwülen stickigen Sommerhitze blühte sie auf, und zum ersten Mal in ihrem Leben erfuhr sie eine leidenschaftliche, glühende Liebe für ein anderes Wesen.
Das Kind, ihr Sohn, brauchte sie. Sie würde ihn mit all ihrer Kraft beschützen.
Die Hände fürsorglich über ihren runden Bauch gelegt, überwachte sie die Einrichtung des Kinderzimmers. Hellgrüne Wände und weiße Spitzengardinen; ein aus Paris importiertes Schaukelpferd, eine kunstvoll geschnitzte Wiege aus Italien.
Sie ordnete die winzigen Hemdchen und Höschen in den kleinen Kleiderschrank ein. Irische und bretonische Spitze, französische Seide. Alles mit Monogrammen bestickt, den drei Anfangsbuchstaben des Babys, das James Reginald Conner heißen sollte.
Sie würde einen Sohn haben. Ein Kind, das ein Teil von ihr war. Endlich jemand, den sie lieben konnte. Sie würden zusammen reisen, sie und ihr schöner Sohn. Sie würde ihm die Welt zeigen. Er würde die besten Schulen besuchen. Er würde ihr Stolz sein, ihre Freude. Was kümmerte es sie da, dass Reginald im Verlauf dieses schwülen Sommers immer seltener kam.
Er war nur ein Mann. Der Mensch, der in ihr wuchs, war ein Sohn.
Sie würde nie wieder allein sein.
Als die ersten Wehen kamen, spürte sie keine Angst. Während dieser qualvollen Stunden hatte sie nur einen Gedanken: ihr Kind. Ihr James. Ihr Sohn.
Ihre Augen brannten vor Erschöpfung, und die Hitze, ein lebendiges atmendes Ungeheuer, war beinahe schlimmer als der Schmerz.
Sie bemerkte, wie der Arzt und die Hebamme Blicke austauschten. Finstere, ernste Blicke. Doch sie war jung, sie war gesund. Sie würde diese Prüfung bestehen.
Es gab keine Zeit mehr; die Stunden verschmolzen ineinander im Schein der Gaslampe, die flackernde Schatten an die Wände warf. Durch ihre Erschöpfung hindurch vernahm sie einen dünnen Schrei.
»Mein Sohn.« Tränen rannen über ihre Wangen. »Mein Sohn.«
Die Hebamme strich ihr über das Haar und murmelte: »Bleiben Sie still liegen. Trinken Sie etwas. Ruhen Sie sich aus.«
Sie nippte an einem Glas, um das Brennen in ihrer Kehle zu lindern, und schmeckte Laudanum. Ehe sie protestieren konnte, trieben ihre Gedanken ab. Weit weg.
Als sie erwachte, war es düster im Raum; die Vorhänge waren zugezogen. Sofort stand der Arzt aus seinem Sessel auf, hob ihre Hand und prüfte den Puls.
»Mein Sohn. Mein Baby. Ich möchte mein Baby sehen.«
»Ich werde Ihnen einen Teller Brühe bringen lassen. Sie haben sehr lange geschlafen.«
»Mein Sohn. Er muss hungrig sein. Bringen Sie ihn mir.«
»Madam.« Der Arzt setzte sich auf die Bettkante. Er wirkte sehr bleich, sehr besorgt. »Es tut mir Leid. Das Kind war eine Totgeburt.«
Etwas Monströses, Grausames umklammerte ihr Herz, durchbohrte es mit Krallen aus Schmerz und Angst. »Das ist eine Lüge! Ich habe ihn schreien hören. Warum quälen Sie mich so?«
»Es hat nie geschrien.« Behutsam ergriff er ihre Hände. »Die Geburt war lang und schwer. Gegen Ende befanden Sie sich im Delirium. Es tut mir aufrichtig Leid, Madam. Sie haben ein totes Kind zur Welt gebracht. Es war ein Mädchen.«
Sie wollte es nicht glauben. Sie schrie, tobte, weinte, wurde mit Laudanum ruhig gestellt, nur um beim Erwachen erneut zu schreien, zu toben und zu weinen.
Erst hatte sie das Kind nicht gewollt. Und dann war es der Mittelpunkt ihres Lebens geworden.
Ihr Kummer war namenlos und unermesslich.
Er trieb sie in den Wahnsinn.
ERSTES KAPITEL
Southfield, Michigan, September 2001
Sie hatte die Sahnesoße anbrennen lassen. Stella würde sich immer an dieses kleine, ärgerliche Detail erinnern, wie sie sich auch an das Donnergrollen des nahenden Gewitters und an das Gezanke ihrer Kinder, das aus dem Wohnzimmer zu ihr drang, erinnern würde.
Ebenso an den beißenden Geruch, an das jähe Schrillen des Rauchmelders und an ihre mechanischen Handbewegungen, mit denen sie die Pfanne vom Herd genommen und ins Waschbecken gestellt hatte.
Sie war keine begnadete, aber dennoch gute Köchin. Für dieses Willkommensmenü hatte sie »Huhn Alfredo« geplant, eines von Kevins Lieblingsgerichten. Dazu gab es Feldsalat, selbst gemachtes Pesto und frisches, knuspriges Weißbrot.
In der ordentlichen Küche ihres hübschen Vorstadthauses hatte sie all ihre Zutaten bereitgestellt und das Kochbuch mit dem Plastikeinband auf einen Ständer gelegt.
Über der frisch gewaschenen Hose und dem T-Shirt trug sie eine marineblaue Schürze, und die wilden roten Locken waren zu einem Pferdeschwanz gebunden, um sie aus dem Gesicht zu haben.
Eigentlich hatte sie schon eher mit dem Kochen beginnen wollen, doch im Gartencenter, wo sie arbeitete, war die Hölle los gewesen. Sämtliche Herbstblumen waren reduziert worden, und bei dem warmen Wetter waren die Kunden in Scharen herbeigeströmt.
Normalerweise machte ihr das nichts aus. Sie liebte ihre Arbeit als Geschäftsführerin der Gärtnerei. Es tat ihr gut, wieder berufstätig zu sein, inzwischen Vollzeit, da Gavin zur Schule ging und Luke alt genug für eine Spielgruppe war. Kaum zu glauben, dass Gavin bereits ein Schulkind war.
Kevin und sie sollten sich etwas aktiver um ein drittes Kind bemühen. Vielleicht heute Abend, dachte sie lächelnd. Wenn die Willkommensfeier in die letzte und sehr private Phase eintreten würde.
Als sie die Zutaten abwog, hörte sie nebenan ein Krachen und gleich darauf lautes Geheul. Ich muss masochistisch veranlagt sein, dachte sie, während sie alles stehen und liegen ließ und hinausstürmte. Wie kann ich an ein weiteres Baby denken, wenn mich meine zwei Söhne schon fast um den Verstand bringen?
Sie betrat das Wohnzimmer, und da waren sie. Ihre kleinen Engel. Der blonde Gavin saß mit Unschuldsmiene, aber mutwillig funkelnden Augen da und ließ zwei Matchboxautos zusammenstoßen, während Luke, der von ihr den roten Lockenschopf geerbt hatte, brüllend vor seinen verstreut herumliegenden Holzklötzchen stand.
Auch ohne nachzufragen, wusste sie sofort, was geschehen war. Luke hatte gebaut; Gavin hatte zerstört.
Das war in diesem Haus eine Art Gesetzmäßigkeit.
»Gavin. Warum?« Sie hob Luke hoch und klopfte ihm beruhigend auf den Rücken. »Ist gut, Schatz. Du kannst etwas Neues bauen.«
»Will mein Haus! Mein Haus!«
»Es war ein Unfall«, behauptete Gavin, doch das verräterische Funkeln blieb in seinen Augen und hätte Stella fast ein Lachen entlockt. »Das Auto hat es umgefahren.«
»Das glaube ich dir gern – nachdem du mit dem Auto auf das Haus gezielt hast. Warum kannst du nicht brav spielen? Er hat dich doch nicht gestört.«
»Ich habe gespielt. Er ist nur ein Baby.«
»Das ist richtig.« Unter ihrem eindringlichen Blick schlug Gavin die Augen nieder. »Und wenn du dich ebenfalls wie ein Baby benehmen willst, so kannst du das in deinem Zimmer tun. Allein.«
»Es war ein dummes Haus.«
»Nei-hein! Mom.« Luke legte die kleinen Hände um ihr Gesicht und sah sie mit riesigen, von Tränen überfließenden Augen an. »Es war schön.«
»Ich bin mir sicher, du kannst sogar ein noch schöneres bauen. Gut? Gavin, lass ihn in Ruhe. Ich meine es ernst. Ich bin in der Küche beschäftigt, und Daddy kommt bald nach Hause. Oder willst du gleich an Daddys erstem Tag bestraft werden?«
»Nein. Aber ich weiß nicht, was ich spielen soll.«
»Du Armer. Wirklich ein Jammer, dass du keine Spielsachen hast.« Sie setzte Luke ab. »Bau dir ein neues Haus, Luke. Und du ärgerst ihn nicht, Gavin. Wenn ich noch einmal hereinkommen muss, werde ich nicht so freundlich sein.«
»Ich möchte rausgehen!«, maulte Gavin.
»Bei dem Regen geht das nicht. Wir müssen alle drinnen bleiben, also benimm dich.«
Gereizt kehrte sie zu ihrem Kochbuch zurück und versuchte, wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Automatisch schaltete sie den Küchenfernseher an. Gott, sie vermisste Kevin. Die Jungen waren den ganzen Nachmittag über quengelig gewesen, und sie fühlte sich erschöpft und ausgelaugt. In den vier Tagen ohne Kevin hatte sie sich wie eine Irre abgestrampelt und sich um das Haus, die Jungen und ihren Job gekümmert.
Wenn Kevin zu Hause war, half er im Haushalt mit, beteiligte sich an der Erziehung ihrer Söhne und spielte mit ihnen. Wäre er jetzt hier, könnte er mit den Jungen spielen – und ihre Streitigkeiten schlichten –, während sie kochte.
Oder besser noch, er würde kochen und sie mit den Jungen spielen.
Sie vermisste seinen Geruch, wenn er hinter sie trat, sich zu ihr hinunterbeugte und seine Wange an ihrer Wange rieb. Sie vermisste es, sich nachts im Bett an ihn zu schmiegen und im Dunkeln über Zukunftspläne zu reden oder über irgendeinen Streich oder eine neue Wortschöpfung der Jungen zu lachen.
Herrgott, mahnte sie sich. Man könnte meinen, er sei vier Jahre und nicht nur vier Tage fort gewesen.
Während sie die Sahnesoße umrührte und aus dem Fenster in das stürmische Treiben hinausblickte, hörte sie mit halbem Ohr zu, wie Gavin seinen Bruder zu überreden versuchte, einen Wolkenkratzer zu bauen, den sie dann beide umwerfen könnten.
Nach seiner Beförderung würde Kevin nicht mehr so häufig unterwegs sein, überlegte sie. Bald, sehr bald. Er hatte hart gearbeitet und stand nun kurz davor. Das zusätzliche Geld könnten sie gut brauchen, vor allem, wenn sie noch ein Kind bekämen – diesmal vielleicht ein Mädchen.
Dank der bevorstehenden Beförderung und ihrem Wiedereinstieg ins Berufsleben könnten sie nächsten Sommer mit den Jungen irgendwohin fahren. Vielleicht nach Disney World. Oh, das würde ihnen gefallen. Selbst wenn sie schwanger wäre, könnten sie das bewerkstelligen. Sie hatte im Lauf der Zeit etwas Geld für die Urlaubskasse gehortet – und auch für die Autokasse, um irgendwann einen neuen Wagen zu kaufen.
Als sie die Jungen nebenan lachen hörte, entspannte sie sich wieder. In Wahrheit hatte sie keinen Grund zur Klage. Ihr Leben war vollkommen, genauso, wie sie es sich immer erträumt hatte. Sie war mit einem wunderbaren Mann verheiratet, in den sie sich gleich bei der ersten Begegnung Hals über Kopf verliebt hatte. Kevin Rothchild mit seinem zögernden, süßen Lächeln.
Sie hatten zwei hübsche Söhne, ein schönes Haus in einer guten Gegend, erfüllende Berufe, gemeinsame Zukunftspläne. Und wenn sie sich liebten, herrschte immer noch dieselbe Leidenschaft wie am Anfang ihrer Beziehung.
Lächelnd malte sie sich seine Reaktion aus, wenn sie heute Abend, sobald die Kinder im Bett wären, in die neue sexy Reizwäsche schlüpfen würde, die sie während seiner Abwesenheit erstanden hatte.
Ein wenig Wein, Kerzenlicht und dann ...
Als nebenan ein neuerliches Krachen ertönte, verdrehte sie die Augen. Diesmal folgte darauf jedoch kein Geheul, sondern begeisterter Jubel.
»Mom! Mom!« Freudestrahlend kam Luke in die Küche gerannt. »Wir haben das ganze Hochhaus umgeschmissen. Kriegen wir Kekse?«
»Nein, nicht so kurz vor dem Abendessen.«
»Bitte, bitte, bitte, bitte!«
Er zerrte an ihrer Hose, versuchte, an ihrem Bein hochzuklettern. Stella legte den Kochlöffel aus der Hand und schob Luke vom Herd weg. »Keine Kekse vor dem Abendessen, Luke.«
»Wir verhungern!« Gavin stürmte herein, in jeder Hand ein Matchboxauto. »Wieso können wir nicht essen, wenn wir Hunger haben? Warum müssen wir überhaupt das doofe Hühnchen essen?«
»Darum.« Als Kind hatte sie diese Antwort immer gehasst, doch inzwischen hatte sie deren praktischen Nutzen erkannt.
»Wenn dein Vater nach Hause kommt, werden wir alle zusammen essen.« Sie hoffte nur, seine Maschine würde keine Verspätung haben. »Ihr könnt euch einen Apfel teilen.«
Sie holte aus der Obstschüssel auf der Theke einen Apfel heraus und schnappte sich ein Messer.
»Ich mag meinen Apfel geschält«, verlangte Gavin.
»Dazu habe ich jetzt keine Zeit.« Mit energischen Bewegungen rührte sie die Soße um. »Außerdem ist die Schale gesund.«
»Krieg ich was zu trinken?« Luke zerrte erneut an ihrer Hose. »Ich hab Durst.«
»O Gott. Gebt mir fünf Minuten, gut? Fünf Minuten. Geht rüber und baut irgendetwas. Danach könnt ihr geschälte Apfelschnitze und Saft haben.«
Ein tiefes Donnergrollen ertönte, was Gavin zum Anlass nahm, wie wild herumzuhüpfen und zu kreischen: »Erdbeben! Erdbeben!«
»Das ist kein Erdbeben.«
Mit ausgestreckten Armen lief er einmal im Kreis herum und rannte dann unter weiteren »Erdbeben!«-Rufen hinaus.
Luke stürmte ihm nach und schrie gleichfalls: »Erdbeben! Erdbeben!«
Stella presste die Hand an die Schläfen. Der Lärm war kaum auszuhalten, aber zumindest waren die beiden nun beschäftigt, und sie konnte sich wieder um das Essen kümmern.
Sie ging an den Herd zurück und lauschte ohne großes Interesse den Kurznachrichten im Fernsehen.
Die Meldung sickerte durch ihre Kopfschmerzen hindurch. Langsam drehte sie sich zu dem Fernsehgerät um.
»Flugzeugabsturz auf dem Inlandflug von Lansing nach Detroit, Michigan. An Bord waren zehn Passagiere ...«
Der Rührlöffel fiel ihr aus der Hand. Ihr Herz klopfte zum Zerspringen.
Kevin. Kevin.
Die Kinder kreischten vor Schreck, als ein lauter Donnerschlag die Luft erzittern ließ. Stellas Welt zerfiel in Scherben, und sie sank ohnmächtig auf den Küchenboden.
Sie kamen, um ihr mitzuteilen, dass Kevin tot sei. Fremde Menschen mit ernsten Mienen. Sie konnte es nicht verstehen, konnte es nicht glauben. Obwohl sie es in dem Moment gewusst hatte, als aus dem kleinen Küchenfernsehgerät die Stimme des Reporters an ihr Ohr gedrungen war.
Kevin konnte nicht tot sein. Er war jung und gesund. Gleich würde er nach Hause kommen, und sie würden zusammen »Huhn Alfredo« essen.
Die Soße hatte sie anbrennen lassen. Der Rauch hatte das Schrillen des Rauchmelders ausgelöst, und in dem hübschen Haus hatte nur noch Chaos geherrscht.
Die fremden Männer rieten ihr, die Kinder zur Nachbarin zu schicken, damit sie Stella alles in Ruhe erklären könnten.
Aber wie sollte das Unmögliche, das Undenkbare erklärbar sein?
Ein Fehler. Das Gewitter, ein Blitz, und alles hatte sich für immer verändert. Nur ein Augenblick, und der Mann, den sie liebte, der Vater ihrer Kinder, lebte nicht mehr.
Gibt es jemanden, den Sie anrufen möchten?
Wen außer Kevin sollte sie anrufen? Er war ihre Familie, ihr Freund, ihr Leben.
Sie redeten über Details, die kaum zu ihr hindurchdrangen, über Ansprüche, Rechtsberatung. Sie sprachen Stella ihr Beileid aus.
Dann gingen sie, und sie blieb allein in dem Haus zurück, das Kevin und sie gekauft hatten, als sie mit Luke schwanger gewesen war. Das Haus, das sie sich gemeinsam erspart und gestrichen und eingerichtet hatten. Das Haus mit dem Garten, den sie selbst gestaltet hatte.
Das Gewitter war vorbei, es herrschte wieder Stille. War es jemals so still gewesen? Sie konnte ihren eigenen Herzschlag hören, das Summen der sich einschaltenden Heizung, das Tröpfeln des Regens aus der Dachrinne.
Und dann nahm sie ihr eigenes Wehklagen wahr, als sie in der Diele vor der Haustür zusammenbrach. Seitlich zusammengerollt, die angezogenen Knie an die Brust gedrückt, lag sie da. Sie weinte nicht, noch nicht. Ihre Tränen waren in ihrem Inneren zu einem harten, heißen Knoten verdichtet. Der Schmerz war zu groß, um weinen zu können. Sie konnte nur daliegen und diese hohen klagenden Laute ausstoßen.
Es war dunkel, als sie sich schwankend und zitternd auf die Beine kämpfte. Kevin. Kevin. Ihr Innerstes schrie seinen Namen wieder und wieder.
Sie musste ihre Kinder abholen. Sie musste ihnen erzählen, was geschehen war.
O Gott! O Gott, wie sollte sie ihnen das beibringen?
Sie öffnete die Haustür und trat in die kalte Dunkelheit hinaus. Achtlos ließ sie die Tür hinter sich offen, ging zwischen den Chrysanthemen und Astern hindurch, vorbei an den glänzend grünen Blättern der Azaleen, die Kevin und sie an einem schönen Frühlingstag eingepflanzt hatten.
Wie eine Blinde überquerte sie die Straße, ging durch Pfützen hindurch und weiter über nasses Gras auf die Verandalaterne ihrer Nachbarin zu.
Wie hieß ihre Nachbarin überhaupt? Komisch, sie kannte sie schon seit vier Jahren. Sie hatten sich zu einer Fahrgemeinschaft zusammengeschlossen, und manchmal gingen sie zusammen einkaufen. Aber sie konnte sich nicht erinnern ...
Ah, natürlich. Diane. Diane und Adam Perkins mit ihren Kindern Jessie und Wyatt. Nette Familie, dachte sie gleichgültig. Eine nette, normale Familie. Erst vor wenigen Wochen hatten sie zusammen gegrillt. Kevin hatte Hühnchen besorgt. Er grillte für sein Leben gern. Sie hatten einen guten Wein getrunken, Spaß gehabt und die Kinder hatten gespielt. Wyatt war hingefallen und hatte sich das Knie aufgeschrammt.
Natürlich erinnerte sie sich.
Dennoch stand sie nun vor der Haustür und wusste nicht recht, weshalb sie hier war.
Ihre Kinder. Natürlich, sie war wegen ihrer Kinder gekommen. Sie musste ihnen sagen ...
Nicht daran denken. Sie schlang die Arme um sich und wiegte sich hin und her. Denk jetzt nicht daran. Wenn du daran denkst, wirst du zerbrechen. In eine Million Teile zersplittern, die man nie wieder zusammenfügen kann.
Ihre Kinder brauchten sie. Brauchten sie jetzt. Hatten nur noch sie.
Sie kämpfte den heißen, harten Knoten zurück und klingelte.
Sie nahm Diane wie durch einen Schleier wahr. Verwackelt, mit unscharfen Konturen. Hörte ihre Stimme wie aus weiter Ferne. Fühlte ihre Arme, die sich stützend und mitfühlend um sie legten.
Aber dein Mann ist nicht tot, dachte Stella. Dein Leben ist nicht vorbei. Deine Welt ist noch dieselbe wie gestern. Du hast keine Ahnung. Keine Ahnung.
Als sie merkte, wie sie zu zittern begann, wich sie zurück. »Nicht jetzt, bitte. Ich kann nicht. Ich muss die Jungen abholen.«
»Ich kann mit dir kommen.« Unter Tränen streckte Diane die Hand aus und strich ihr über das Haar. »Soll ich mit dir kommen? Bei dir bleiben?«
»Nein. Nicht jetzt. Ich muss ... die Jungen.«
»Ich werde sie holen. Komm doch rein, Stella.«
Sie schüttelte nur den Kopf.
»Nun gut. Die Kinder sind im Spielzimmer. Ich werde sie dir bringen. Stella, wenn ich irgendetwas für dich tun kann – du brauchst nur anzurufen. Es tut mir Leid. Es tut mir so Leid.«
Reglos stand sie in der Dunkelheit, starrte blicklos in die erleuchtete Diele und wartete.
Sie vernahm die Protestschreie, die Beschwerden, danach das Getrappel von Schritten. Und dann standen ihre Jungen vor ihr – Gavin mit dem blonden Haar seines Vaters, Luke mit dem Mund seines Vaters.
»Wir wollen noch nicht gehen«, teilte Gavin ihr mit. »Wir machen gerade ein Spiel. Dürfen wir das zu Ende spielen?«
»Nein. Wir müssen nach Hause.«
»Aber ich gewinne. Das ist nicht fair und –«
»Gavin. Wir müssen gehen.«
»Ist Daddy gekommen?«
Sie blickte zu Luke hinunter, in sein glückliches, unschuldiges Gesicht, und brach fast zusammen. »Nein.« Rasch hob sie ihn hoch und küsste ihn zart auf den Mund, der so sehr Kevins Mund glich. »Gehen wir.«
Mit Luke auf dem Arm und Gavin an der Hand machte sie sich auf den Rückweg zu ihrem leeren Haus.
»Daddy würde mich fertig spielen lassen«, jammerte Gavin, den Tränen nahe. »Ich will zu Daddy.«
»Ich weiß. Ich auch.«
»Kriegen wir einen Hund?«, wollte Luke wissen und drehte mit den Händen ihr Gesicht zu sich herum. »Können wir Daddy fragen? Kriegen wir einen Hund wie Jessie und Wyatt?«
»Lass uns ein andermal darüber reden.«
»Ich will zu Daddy«, wiederholte Gavin nun etwas schriller.
Er weiß Bescheid, dachte Stella. Er spürt, dass etwas nicht stimmt. Dass etwas Schlimmes passiert ist. Ich muss es den Kindern sagen. Jetzt.
»Setzen wir uns ins Wohnzimmer.« Behutsam, ganz behutsam schloss sie die Tür hinter sich und trug Luke zum Sofa. Sie nahm ihn auf den Schoß und legte Gavin den Arm um die Schulter.
»Ein Hund wäre so schön«, plapperte Luke weiter. »Ich will mich auch immer um ihn kümmern. Wann kommt Daddy?«
»Er kann nicht kommen.«
»Muss er noch in der anderen Stadt bleiben?«
»Er ...« Gott, hilf mir. Steh mir bei. »Es gab einen Unfall. Daddy hatte einen Unfall.«
»So was wie ein Autounfall?«, fragte Luke. Doch Gavin sagte nichts, sah sie nur unentwegt an.
»Es war ein sehr schlimmer Unfall. Daddy ist jetzt im Himmel.«
»Aber danach muss er wiederkommen.«
»Das kann er nicht. Er kann nicht mehr nach Hause kommen. Er muss jetzt im Himmel bleiben.«
»Er muss aber zurückkommen!« Gavin wollte weglaufen, doch sie hielt ihn fest. »Ich will, dass er jetzt zurückkommt.«
»Das würde ich mir auch wünschen, mein Liebling. Aber er kann nicht mehr kommen, sosehr wir das auch wollen.«
Lukes Lippen zitterten. »Ist er böse auf uns?«
»Nein. Nein, nein, nein, mein Schatz. Nein.« Sie presste das Gesicht an sein Haar. Ihr Magen krampfte sich zusammen und ihr Herz pochte wie eine schmerzende Wunde. »Er ist nicht böse auf uns. Er liebt uns. Er wird uns immer lieben.«
»Er ist tot«, stieß Gavin wütend hervor. Doch gleich darauf verzog er das Gesicht, und er war nur noch ein kleiner Junge, der in den Armen seiner Mutter weinte.
Sie hielt beide Kinder an sich gedrückt, bis sie eingeschlafen waren, und trug sie dann in ihr Ehebett, damit keiner von ihnen dreien allein aufwachte. Vorsichtig zog sie ihnen die Schuhe aus und deckte sie zu.
Als sie wie eine Schlafwandlerin durch das Haus wanderte, Türen absperrte und Fenster schloss, ließ sie das Licht brennen. Nachdem sie sich vergewissert hatte, dass alles sicher war, schloss sie sich im Badezimmer ein. Sie ließ sich ein heißes Bad einlaufen, das den ganzen Raum mit feuchten Dampfschwaden erfüllte.
Erst als sie in die Wanne stieg und in das heiße Wasser eintauchte, ließ sie es zu, dass der Knoten sich löste. Am ganzen Leib zitternd, saß sie in dem heißen Wasser und weinte. Weinte und weinte.
Sie überlebte es. Man riet ihr zu Beruhigungsmitteln, doch sie wollte ihre Gefühle nicht unterdrücken. Außerdem brauchte sie allein schon wegen der Kinder einen klaren Kopf.
Die Bestattung verlief in einem schlichten Rahmen. Kevin hätte es so gewollt. Stella kümmerte sich um jede Einzelheit für seinen Gedenkgottesdienst – die Musik, die Blumen, die Fotos. Für seine Asche, die sie über dem See verstreuen wollte, wählte sie eine silberne Urne. An diesem See hatte er an einem Sommernachmittag in einem gemieteten Ruderboot um ihre Hand angehalten.
Bei der Trauerfeier trug sie schwarz – eine Witwe von einunddreißig Jahren, mit zwei kleinen Jungen, einer Hypothek und einem Herzen, das in tausend Stücke zersprungenen war, sodass sie sich fragte, ob sie für den Rest ihres Lebens die Splitter in ihrer Seele fühlen würde.
Sie umhegte ihre Kinder und machte für sie alle Termine bei einem auf Trauerarbeit spezialisierten Therapeuten.
Aufgaben. Mit Aufgaben konnte sie umgehen. Solange es etwas Konkretes zu tun gab, hielt sie durch. War stark.
Freunde kamen, zeigten ihr Mitgefühl, trockneten Geschirr und Tränen. Sie war ihnen eher dankbar für die Ablenkung als für die Anteilnahme. Für sie gab es keinen Trost.
Ihr Vater und seine Frau, die aus Memphis anreisten, waren ihr jedoch eine Stütze. Jolene, die Frau ihres Vaters, umsorgte und bemutterte sie, wohingegen ihre eigene Mutter sich darüber beschwerte, dass sie sich mit dieser Person im selben Zimmer aufhalten musste.
Nach der Trauerfeier, als die Freunde gegangen waren und ihr Vater und Jolene nach einem innigen und tränenreichen Abschied den Heimflug angetreten hatten, zog sie das schwarze Kleid aus.
Sie stopfte es in einen Beutel für die Altkleidersammlung. Sie wollte es nie wieder sehen.
Ihre Mutter blieb. Stella hatte sie darum gebeten. Unter solch tragischen Umständen hatte sie ein Anrecht auf ihre Mutter. Welche Reibereien es auch immer zwischen ihnen gegeben hatte und nach wie vor gab, angesichts des Todes waren sie unbedeutend.
Als sie in die Küche kam, kochte ihre Mutter gerade Kaffee. Stella war dankbar, dass ihr jemand diese kleinen Aufgaben abnahm. Spontan ging Sie zu Carla hinüber und küsste sie auf die Wange.
»Danke. Ich kann keinen Tee mehr sehen.«
»Kein Wunder. Jedes Mal, wenn ich dieser Person den Rücken kehrte, hat sie ihren verdammten Tee gekocht.«
»Jolene wollte nur behilflich sein, und wahrscheinlich hätte ich vorher gar keinen Kaffee vertragen.«
Carla drehte sich zu ihr um. Sie war eine schlanke Frau mit kurzem blondem Haar. Seit Jahren bekämpfte sie die Spuren der Zeit mit regelmäßigen Besuchen bei einem Chirurgen. Skalpell und Injektionen hatten zwar einige Jahre weggewischt, ließen sie jedoch, wie Stella fand, unnatürlich und hart aussehen.
»Immer ergreifst du für sie Partei.«
»Das stimmt nicht, Mom.« Müde setzte sich Stella an den Küchentisch. Jetzt gab es keine Ablenkungen mehr, wurde ihr bewusst. Keine Aufgaben, in die sie sich flüchten könnte.
Wie sollte sie die Nacht nur überstehen?
»Ich sehe nicht ein, weshalb ich sie tolerieren soll.«
»Es tut mir Leid, wenn du dich unwohl gefühlt hast.
Aber ich fand Jolene sehr lieb. Dad und sie sind seit, ach, seit fünfundzwanzig Jahren oder so verheiratet. Allmählich solltest du dich daran gewöhnt haben.«
»Ich kann ihr komisches Gesicht und diese näselnde Stimme einfach nicht ertragen. Na ja, Wohnwagenpöbel eben.«
Stella öffnete den Mund, schloss ihn wieder. Jolene kam weder aus einer Wohnwagensiedlung, noch war sie Pöbel. Aber was nutzte es, wenn sie das klarstellte? Oder ihre Mutter daran erinnerte, dass sie es war, die die Scheidung gewollt und danach noch zweimal geheiratet hatte?
»Nun, jetzt ist sie ja weg«, lenkte Stella ein.
»Stimmt, die sind wir Gott sei Dank los.«
Stella holte tief Luft. Kein Streit, mahnte sie sich. Ich habe keine Kraft zum Streiten.
»Die Kinder schlafen. Sie waren völlig erschöpft. Morgen... Nun ja, morgen sehen wir weiter. Wahrscheinlich wird mein Leben auf diese Art weitergehen. Von einem Tag auf den anderen.« Sie senkte den Kopf, schloss die Augen. »Ich denke noch immer, dass alles nur ein böser Traum ist und ich jeden Moment aufwachen werde. Und dann wird Kevin da sein. Ich ... ich kann mir ein Leben ohne ihn nicht vorstellen. Ich ertrage nicht einmal den Gedanken daran.«
Tränen stiegen ihr in die Augen. »Mom, ich weiß einfach nicht, wie es weitergehen soll.«
»Er hatte doch eine Versicherung, nicht wahr?«, fragte Carla, während sie ihr eine Tasse Kaffee hinstellte.
Entgeistert starrte Stella ihre Mutter an. »Wie bitte?«
»Eine Lebensversicherung. Er hat doch sicher vorgesorgt.«
»Ja, aber –«
»Du solltest einen Anwalt wegen einer Klage gegen die Fluggesellschaft zurate ziehen. Dich mit den praktischen Dingen befassen.« Sie setzte sich mit einer Tasse Kaffee zu Stella an den Tisch. »Das kannst du sowieso am besten.«
»Mom.« Sie redete so langsam, als würde sie aus einer fremden Sprache übersetzen. »Kevin ist tot.«
»Das weiß ich, Stella, und es tut mir Leid.« Flüchtig tätschelte sie Stellas Hand. »Ich habe ja auch alles stehen und liegen lassen, um dir beizustehen, nicht wahr?«
»Ja.« Sie musste sich das vergegenwärtigen. Es anerkennen.
»Was ist das nur für eine verfluchte Welt, in der ein Mann seines Alters einfach so stirbt? Sinnlose Verschwendung. Ich werde das nie begreifen.«
Stella zog ein Taschentuch heraus und wischte sich die Tränen ab. »Ich auch nicht.«
»Ich mochte ihn. Tatsache ist aber, dass du jetzt in einer schwierigen Lage bist. Eine Witwe mit zwei kleinen Söhnen. Auf so etwas wird sich kaum ein Mann einlassen, das kannst du mir glauben.«
»Herrgott, Mom! Ich will keinen anderen Mann!«
»Warte es ab«, erwiderte Carla ungerührt. »Aber sieh zu, dass der Nächste Geld hat. Mach nicht dieselben Fehler wie ich. Du hast deinen Gatten verloren, und das ist hart. Verdammt hart. Aber Frauen verlieren jeden Tag ihre Ehemänner. Besser, ihn so wie du zu verlieren, als durch Scheidung.«
Der Schmerz in Stellas Innerem war zu scharf, um Trauer auszudrücken, zu kalt, um Zorn zu empfinden. »Mom, heute war Kevins Trauerfeier. Seine Asche befindet sich in einer gottverdammten Urne in meinem Schlafzimmer.«
»Du wolltest meine Hilfe.« Sie deutete mit dem Kaffeelöffel auf Stella. »Und ich versuche, dir diese Hilfe zu geben. Du wirst die Fluggesellschaft verklagen, dich um ein solides finanzielles Polster bemühen. Und um Himmels willen keinen Versager heiraten, so wie mir das immer passiert. Du kannst dir nicht vorstellen, dass eine Scheidung ein schwerer Schlag ist, was? Tja, schließlich hast du das noch nie durchgemacht. Ich schon. Zweimal. Du weißt es noch nicht, aber jetzt steht mir das dritte Mal bevor. Ich bin mit diesem Idioten fertig. Du hast keine Ahnung, was ich mit ihm durchgemacht habe. Er ist nicht nur ein rücksichtsloses, großmäuliges Arschloch, sondern er betrügt mich auch.«
Seufzend stand sie auf, schnitt sich ein Stück Kuchen ab und nahm wieder Platz. »Wenn er meint, dass ich das dulde, hat er sich gründlich getäuscht. Ha, ich würde zu gern sein dummes Gesicht sehen, wenn er die Scheidungspapiere erhält. Heute.«
»Tut mir Leid, dass deine dritte Ehe nicht funktioniert hat«, sagte Stella steif. »Aber es fällt mir schwer, Mitleid zu empfinden, da sowohl deine Ehen als auch deine Scheidungen deine eigenen Entscheidungen waren. Mein Mann ist tot. Und das war ganz bestimmt nicht meine Entscheidung.«
»Denkst du, ich will das alles noch einmal durchmachen? Denkst du etwa, es macht mir nichts aus, wenn ich zu dir komme, um dir beizustehen, und dann dieses Flittchen deines Vaters vorgesetzt kriege?«
»Sie ist seine Ehefrau, die sich dir gegenüber immer korrekt verhalten hat.«
»Nach außen hin.« Carla schob sich einen Bissen Kuchen in den Mund. »Glaubst du, du bist die Einzige, die Probleme hat? Und Kummer? Man schüttelt das nicht mehr so einfach ab, wenn man auf die fünfzig zugeht und plötzlich allein leben muss.«
»Die fünfzig hast du ja bereits überstanden, Mom, und die Scheidung war, wie gesagt, dein eigener Wunsch.«
Wütend kniff Carla die Augen zusammen. »Dein Ton gefällt mir nicht, Stella. Das muss ich mir nicht bieten lassen.«
»Nein, das musst du nicht. In der Tat wäre es vermutlich für uns beide das Beste, wenn du abreist. Sofort. Es war eine schlechte Idee, dich zum Bleiben aufzufordern. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe.«
»Wenn du willst, dass ich gehe, bitte sehr!« Carla stand auf. »Dann werde ich eben wieder nach Hause fahren. Du warst schon immer ein undankbares Geschöpf, das mir nichts als Ärger bereitet hat. Falls du mal wieder eine Schulter zum Ausheulen brauchst, dann wende dich an deine provinzielle Stiefmutter.«
»Das werde ich tun«, murmelte Stella, während Carla aus der Küche rauschte. »Sehr gern sogar.«
Sie stand auf, um ihre Tasse zum Spülbecken zu bringen. Statt die Tasse ins Becken zu stellen, ließ sie sie, einem inneren Drang folgend, einfach hineinfallen. Am liebsten hätte sie alles um sich herum kaputtgeschlagen, wie das Schicksal auch sie zerstört und gebrochen hatte.
Den Rand des Spülbeckens umklammernd, betete sie, dass ihre Mutter so schnell wie möglich packen und abreisen würde. Sie wollte sie nicht mehr hier haben. Wie war sie nur auf die Idee gekommen, ihre Mutter könnte ihr Trost bieten? Ihr Verhältnis hatte sich nicht verändert, war so kalt wie eh und je. Es gab keine Verbindung, keine Gemeinsamkeit.
Und sie hätte, weiß Gott, des Trostes bedurft. Vor allem für diese eine Nacht. Morgen war ein neuer Tag, den sie irgendwie überstehen würde. Aber heute Nacht wäre sie gern im Arm gehalten und getröstet worden.
Mit zitternden Fingern sammelte sie die Scherben aus dem Spülbecken und warf sie weinend in den Mülleimer. Dann ging sie zum Telefon und bestellte für ihre Mutter ein Taxi.
Sie wechselten kein Wort mehr miteinander. Stella fand, so sei es am besten. Nachdem sie hinter ihrer Mutter die Tür geschlossen hatte, lehnte sie sich dagegen und lauschte dem abfahrenden Taxi.
Danach sah sie nach ihren Söhnen, zog die Bettdecken zurecht und küsste jeden sanft auf die Stirn.
Ihre Söhne waren nun alles, was sie hatte. Und sie war alles, was ihre Söhne hatten.
Sie würde eine bessere Mutter werden, schwor sie sich. Geduldiger. Nie, nie würde sie ihre Söhne im Stich lassen. Nie weggehen, wenn ihre Söhne sie brauchten.
Und, bei Gott, wann immer sie des Trostes bedurften, würde sie da sein. Egal, warum. Egal, wann.
»Ihr steht für mich an erster Stelle«, flüsterte sie. »Ihr werdet immer an erster Stelle stehen.«
Im Schlafzimmer zog sie sich aus und nahm Kevins alten Flanellmorgenmantel aus dem Schrank. Sie zog ihn über, hüllte sich in diesen vertrauten, herzzerbrechenden Duft.
Eng zusammengerollt lag sie auf dem Bett, schloss die Augen und betete, dass diese Nacht vorüberginge.
ZWEITES KAPITEL
Harper-Haus, Januar 2004
Sie durfte sich weder von dem Haus noch von dessen Hausherrin einschüchtern lassen. Trotz des Rufes, den beide hatten.
Über das Haus sagte man, es sei alt und vornehm mit einem wunderschön angelegten Garten, der es mit dem Garten Eden aufnehmen könne. Davon hatte sie sich soeben selbst überzeugen können.
Über die Frau hieß es, sie sei interessant, eine Einzelgängerin und etwas »kompliziert«. Ein Wort, das, wie Stella wusste, alles bedeuten konnte, von eigenwillig bis hin zur eingebildeten Zicke.
Welche Eigenarten die Frau auch immer haben mochte, sie würde damit zurechtkommen, sagte sich Stella und kämpfte den Impuls nieder, aufzustehen und das Weite zu suchen. Sie hatte schon ganz andere Dinge geschafft.
Sie wollte diesen Job unbedingt. Nicht nur wegen der Bezahlung – die sehr großzügig war –, sondern vor allem deshalb, weil es sie nach einer Herausforderung dürstete. Einer Aufgabe, die sie aus dem Trott herausreißen würde, in den sie zu Hause gefallen war.
Sie sehnte sich nach einem Berufsleben, das mehr beinhaltete als eine Stechuhr und einen Gehaltsscheck, der sofort von den anfallenden Rechnungen verschlungen wurde. Es hörte sich vielleicht banal an, aber sie brauchte eine Aufgabe, die sie erfüllte.
Rosalind Harper führte ein erfülltes Leben, dessen war sich Stella sicher. Ein herrlicher Stammsitz, ein blühendes Unternehmen. Wie mochte es wohl sein, wenn man jeden Morgen beim Aufwachen genau wusste, wohin man gehörte und was man wollte?
Wenn sie eines für sich erreichen und an ihre Kinder weitergeben wollte, so war es dieses Wissen um den eigenen Platz in der Welt. Seit Kevins Tod hatte sie dafür jedes Gefühl verloren. An Tatkraft mangelte es ihr nicht. Stellte man sie vor eine Aufgabe oder ein Problem, so tat sie ihr Bestes, die Aufgabe zu erfüllen und das Problem zu lösen.
Doch das tief verwurzelte Vertrauen in sich und in die Welt war an jenem Tag im September zweitausendeins schwer angeschlagen worden und würde nie mehr ganz wiederhergestellt werden können.
Der Umzug zurück nach Tennessee war ein Neuanfang. Genauso wie dieses entscheidende Bewerbungsgespräch mit Rosalind Harper. Falls sie den Job nicht bekommen sollte – auch gut, dann würde sie eben einen anderen kriegen. Man mochte alles Mögliche über sie sagen, aber sie scheute die Arbeit nicht und war sehr wohl imstande, den Lebensunterhalt für sich und die Kinder zu verdienen.
Aber, Herrgott, sie wollte nun mal diesen Job.
Sie straffte die Schultern und versuchte, die zweifelnden Stimmen in ihrem Kopf zu ignorieren. Sie wollte diesen Job und sie würde ihn, verdammt noch mal, auch kriegen!
Sie hatte ihre Garderobe sorgfältig ausgewählt. Marineblaues Kostüm mit einer gestärkten weißen Bluse, gute Schuhe, gute Handtasche, schlichter Schmuck. Dezentes Make-up, das ihre blauen Augen betonte. Das widerspenstige, lockige Haar straff zurückgenommen und im Nacken zu einem Knoten gesteckt. Wenn sie Glück hatte, würden die Locken bis zum Ende des Gesprächs nicht herausspringen.
Rosalind Harper ließ sie warten. Vermutlich war das Taktik, überlegte Stella, während sie mechanisch an ihrem Uhrenarmband zupfte. Man ließ sie absichtlich in diesem beeindruckenden Salon mit den exquisiten Antiquitäten und Gemälden und dem herrlichen Blick aus den Fenstern schmoren.
In diesem eleganten Südstaaten-Ambiente, in dem sie sich als Yankee wie ein Fisch auf dem Trockenen fühlte.
Hier im Süden liefen die Uhren langsamer, erinnerte sie sich. Sie musste sich wieder bewusst machen, dass hier eine andere Kultur herrschte.
Der Kamin war vermutlich ein Adams, überlegte sie. Die Lampe ganz eindeutig eine originale Tiffany. Nannte man hier im Süden die Vorhänge Portiere oder war das zu sehr Scarlett O’Hara? Und waren die Spitzengardinen unter den Vorhängen Erbstücke?
Gott, sie fühlte sich absolut fehl am Platz. Was hatte eine aus der Mittelschicht stammende Witwe aus Michigan in dieser luxuriösen Südstaatenumgebung verloren?
Als sich aus der Eingangshalle Schritte näherten, atmete sie tief durch und setzte eine neutrale Miene auf.
»Ich bringe Kaffee.« Es war nicht Rosalind, sondern der freundliche Hausangestellte, der Stella die Tür geöffnet und sie in den Salon geleitet hatte.
Er war etwa dreißig Jahre alt, mittelgroß und sehr schlank, mit glänzendem braunen Haar, das sich um sein gut geformtes Gesicht wellte. Obwohl er schwarz trug, wirkte er nicht wie ein Butler oder Diener. Dazu war er zu schick, zu bohemienhaft. Er hatte sich mit David vorgestellt.
Gekonnt setzte er das Tablett mit der Porzellankanne, den Tassen, den Leinenservietten, der Zuckerdose, dem Milchkännchen und der kleinen Vase mit einem Veilchenstrauß auf dem Tisch ab.
»Roz wurde aufgehalten, aber sie wird gleich kommen. Trinken Sie schon einmal ein Tässchen Kaffee. Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit?«
»Ja, sehr.«
»Kann ich noch irgendetwas für Sie tun?«
»Nein, danke.«
»Entspannen Sie sich einfach«, ordnete er an, während er ihr den Kaffee einschenkte. »Nichts geht über ein Kaminfeuer im Januar, finden Sie nicht auch? Es lässt einen vergessen, dass es noch vor wenigen Monaten heiß genug war, um einem die Haut von den Knochen zu schmelzen. Wie trinken Sie Ihren Kaffee, Schätzchen?«
Stella war es nicht gewöhnt, von fremden Männern, die ihr in vornehmen Salons Kaffee servierten, »Schätzchen« genannt zu werden. Vor allem, wenn die Männer ein paar Jahre jünger waren als sie.
»Nur etwas Sahne.« Sie musste sich zwingen, ihn nicht anzustarren. Mit den sinnlichen Lippen, den saphirblauen Augen, den kräftigen Wangenknochen und dem sexy Grübchen im Kinn sah er einfach umwerfend aus. »Arbeiten Sie schon lange für Mrs. Harper?«
»Seit Ewigkeiten.« Mit charmantem Lächeln reichte er ihr den Kaffee. »Wenigstens kommt es mir so vor, was ich als Kompliment meine. Ein kleiner Rat an Sie: Geben Sie klare Antworten auf klare Fragen und lassen Sie sich nicht einschüchtern.« Sein Lächeln wurde breiter. »Sie hasst es, wenn Leute vor ihr kuschen. Sie haben übrigens ganz wunderbares Haar, Schätzchen.«
»Oh.« Unwillkürlich hob sie die Hand an ihr Haar. »Danke.«
»Tizian wäre von Ihnen begeistert gewesen. Viel Glück mit Roz«, sagte er im Hinausgehen. »Klasse Schuhe übrigens.«
Sie seufzte innerlich. Er hatte ihr Haar und ihre Schuhe bemerkt und ihr für beides Komplimente gemacht. Eindeutig schwul. Welch Verlust für die Weiblichkeit!
Der Kaffee war gut, und David hatte Recht. Ein Kaminfeuer im Januar war in der Tat sehr behaglich. Draußen war es feucht und trübe. O ja, man könnte sich durchaus daran gewöhnen, an Wintertagen vor dem Kamin zu sitzen und einen guten Kaffee aus – welches Porzellan war es? Meissner? Wedgwood? – zu trinken. Neugierig hob sie die Tasse, um den Herstellerstempel zu überprüfen.
»Es ist Staffordshire, Mitte des neunzehnten Jahrhunderts von einer der Harper-Bräute aus England hierher gebracht.«
Es hatte keinen Sinn, sich zu verwünschen. Keinen Sinn, sich zusammenzukrümmen, weil ihre für Rothaarige typische helle Haut vor Verlegenheit knallrot anlief. Also senkte sie die Tasse und sah Rosalind Harper unerschrocken in die Augen.
»Das Service ist wunderschön.«
»Finde ich auch.« Zwanglos ließ sich Mrs. Harper auf den Stuhl neben Stella nieder und schenkte sich eine Tasse Kaffee ein.
In Bezug auf die Kleiderordnung für das Bewerbungsgespräch schienen sie eine sehr unterschiedliche Auffassung zu haben, wurde Stella bewusst.
Rosalind trug einen weiten olivfarbenen Pullover und eine unförmige schlammfarbene, ausgefranste Arbeitshose. Statt Schuhen hatte sie dicke braune Wollsocken an den Füßen. Was wohl der Grund war, dachte Stella, dass sie ihr Nahen nicht gehört hatte.
Sie war groß und schlank und hatte kurzes schwarzes Haar.
Als Vorbereitung auf dieses Gespräch hatte Stella etwas Recherche im Internet betrieben, um sich ein Bild von ihrer potenziellen Arbeitgeberin zu machen – nicht nur in Bezug auf deren Lebenslauf, sondern auch auf deren Aussehen.
In den Archiven von Zeitungen und Zeitschriften waren Unmengen von Artikeln gewesen. Stella hatte über Rosalinds Kindheit und Jugend gelesen. Sie hatte die Fotos der achtzehnjährigen atemberaubend schönen Braut bewundert und bei den Bildern der bleichen, tapfer dreinblickenden Witwe tiefes Mitgefühl empfunden.
Daneben gab es noch jede Menge anderer Artikel und Fotos. Berichte in den Klatschblättern, die sich vor allem mit der Frage befassten, wann und ob die Witwe wieder heiraten würde. Meldungen über den Aufbau der Gärtnerei, über den Park, ihr Liebesleben; über ihre zweite Ehe und die bald darauf folgende Scheidung.
Stella hatte das Bild einer willensstarken, klugen Frau vor Augen gehabt. Ihr blendendes Aussehen sah sie als das Ergebnis von Fotokunst, Beleuchtung und Make-up an.
Sie hatte sich geirrt.
Mit ihren sechsundvierzig Jahren war Rosalind Harper eine voll erblühte Rose. Nicht die Treibhaussorte, dachte Stella, sondern eine jener Wildrosen, die Wind und Wetter ausgesetzt waren und jedes Jahr kräftiger und schöner blühten.
Rosalind hatte ein schmales, markantes Gesicht und tief liegende längliche Augen in der Farbe von edlem Kognak. Ihr Mund mit den vollen, scharf gemeißelten Lippen war ungeschminkt, wie auch ihr Gesicht ohne jedes Make-up war.
Um die dunklen Augen lagen einige feine Falten, die das Leben als Tribut eingefordert hatte, doch sie taten der Schönheit keinen Abbruch.
So würde ich später auch gern aussehen, dachte Stella. Nur etwas besser gekleidet.
»Ich habe Sie warten lassen, nicht wahr?«
Klare Fragen, klare Antworten, erinnerte sich Stella. »Ein wenig. Aber es gibt Schlimmeres, als in diesem Zimmer zu sitzen und aus Staffordshire-Porzellan Kaffee zu trinken.«
»David liebt es, andere zu bemuttern. Ich war so in die Arbeit im Gewächshaus vertieft, dass ich die Zeit vergessen habe.«
Ihre Stimme klang lebhaft. Nicht abgehackt – man kann die Südstaatenvokale nicht abgehackt sprechen –, sondern klar und voller Energie. »Sie sehen jünger aus, als ich erwartet habe. Sie sind, wie war das noch mal, dreiunddreißig?«
»Ja.«
»Und Ihre Söhne sind ... sechs und acht?«
»Ja, das ist richtig.«
Titel der Originalausgabe BLUE DAHLIA – IN THE GARDEN
Redaktion: Birgit Groll
Deutsche Erstausgabe 03/2005
Copyright © 2004 by Nora Roberts Copyright © dieser deutschsprachigen Ausgabe 2005 by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlagillustration: Thomas Lemmler, Hamburg Umschlaggestaltung: Eisele Grafik-Design, München Satz: hanseatenSatz-bremen, Bremen
eISBN 978-3-641-09189-7
http://www.heyne.de
www.randomhouse.de
Leseprobe