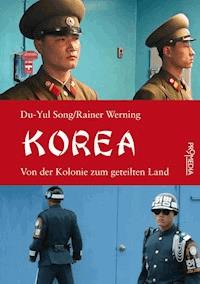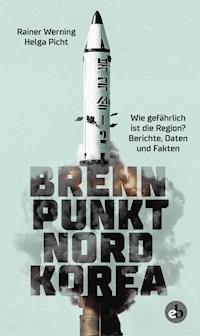
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition berolina
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Der seit Jahrzehnten schwelende Konflikt um die Koreanische Halbinsel heizt sich seit Monaten zu einer den Weltfrieden bedrohenden Auseinandersetzung auf. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un testet Atomwaffen und Raketen, und US-Präsident Donald Trump droht dafür mit der totalen Vernichtung dieses Landes. Erschrocken mahnen Politiker aus aller Welt, vom deutschen Außenminister über den UNO-Generalsekretär bis zum russischen Präsidenten, eine friedliche Lösung des Konflikts an, denn ein atomarer Weltbrand droht! Doch was wissen wir eigentlich über den Konflikt, seine Vorgeschichte, seine aktuelle Brisanz und die handelnden Akteure? Die drei im vorliegenden Band versammelten Experten, die Koreanistikprofessorin Helga Picht, der Asienkenner Rainer Werning und der politische Publizist und Philosoph Arnold Schölzel, bringen Klarheit in die Problematik. Gegen die einseitigen Berichte in den westlichen Medien setzen sie eine umfassende Betrachtung aller Aspekte. Denn: Nur wer die Hintergründe versteht, kann sich selbst ein reales Bild machen. Ein kluges Buch genau zur rechten Zeit und eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich Aufklärung statt Propaganda wünschen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rainer Werning
Helga Picht
Brennpunkt Nordkorea
Wie gefährlich ist die Region?
Berichte, Daten und Fakten
edition berolina
Das vorliegende Buch wurde in Zusammenarbeit mit dem Korea Verband e. V. herausgegeben:
www.koreaverband.de
Rainer Werning, Jahrgang 1949, Dr. rer. pol., studierte an der Universität Osnabrück, University of Hull, Sophia University (Tokyo), der University of the Philippines sowie der Columbia-University in the City of New York Sozial- und Politikwissenschaften sowie Literatur und Philosophie. Er verbrachte viele Jahre in Asien, u. a. in Nord- und Südkorea. Werning begründete 1986 das Korea Forum und war von 2003 bis 2007 Vorstandsvorsitzender des Korea Verband e. V. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist er als Dozent an der Akademie für Internationale Zusammenarbeit (AIZ) tätig. Er ist Verfasser zahlreicher Publikationen. Zuletzt erschien von ihm der gemeinsam mit Song Du-yul verfasste Band: Korea. Von der Kolonie zum geteilten Land (Promedia Verlag, 2012).
Helga Picht, Jahrgang 1934, Prof. Dr., studierte Sinologie, Japanologie und Koreanistik in Berlin und Pjöngjang. Sie war von 1968 bis 1970 als Wissenschafts- und Kulturattaché an der Botschaft der DDR in Pjöngjang tätig und viele Jahre aufgrund ihrer exzellenten Sprachkenntnisse als Dolmetscherin für hochrangige DDR-Delegationen. Von 1980 bis 1992 leitete sie das Institut für Koreanistik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie war die erste Lehrstuhlinhaberin für Koreanistik in Deutschland und die einflussreichste Koreanistin der DDR. Von 1990 bis 2000 war Picht stellvertretende Vorsitzende der International Society for Korean Studies mit Sitz in Osaka. Sie veröffentlichte zahlreiche Beiträge zur Sprache, Kultur, Geschichte und Gegenwart Koreas.
eISBN 978-3-95841-555-3
1. Auflage
© 2018 by BEBUG mbH / edition berolina, Berlin
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Umschlagabbildung: picture alliance / AP Photo
edition berolina
Alexanderstraße 1
10178 Berlin
Tel. 01805/30 99 99
FAX 01805/35 35 42
(0,14 €/Min., Mobil max. 0,42 €/Min.)
www.buchredaktion.de
Kriegsherd oder Fake News – was wissen wir über Korea?
»Raketentest in Nordkorea. Kim schoss fast ein Passagierflugzeug ab«, titelte die Bild am 3. August 2017. Weiter hieß es, dass der Verrückte aus Pjöngjang mit seinen Atomraketen nun jeden Punkt der Welt treffen könne. Mit seinen Raketentests halte der Diktator Kim Jong-un die Welt in Atem.
Diese ungeheuerlichen Provokationen verlangen natürlich sofort eine angemessene Reaktion der »freien Welt« beziehungsweise dessen oberster Instanz, der USA. Also wurden Flugzeugträger und US-Bomber in Marsch gesetzt. Das deutsche Leitbildverbreitungsorgan Bild am 30. Juli 2017 unter dem Titel »US-Bomber fliegen über Korea«: »›Nordkorea bleibt die größte Bedrohung für die regionale Stabilität‹, sagte General Terrence J. O’Shaughnessy, der den Einsatz leitete.«
Dann der vorläufige Höhepunkt am 19. September 2017: US-Präsident Donald Trump spricht vor der UNO und Bild berichtet unter der Überschrift »Knallhart-Rede gegen Kim vor der UNO. Trump droht mit Zerstörung Nordkoreas«: »Schon nach wenigen einleitenden Worten wandte er sich mit einer Knallhart-Drohung an das Regime in Nordkorea. Das Land ›lässt die eigene Bevölkerung verhungern‹ und ›bedroht die Welt mit Atomwaffen‹. Trump stellte klar: ›Wir wollen keinen Krieg, aber wenn wir unser Land verteidigen müssen, dann werden wir es tun.‹ Trumps Ansage: ›Dann haben wir keine andere Wahl als die totale Zerstörung Nordkoreas.‹« Und es passiert etwas, was US-Präsidenten bei Reden vor der UNO seit dreißig Jahren nicht mehr passiert ist – es gibt Applaus.
Ja, ist denn die Welt völlig aus den Fugen geraten? Bedroht wirklich ein völlig außer Kontrolle geratener Diktator die Welt mit Atomraketen, und darf man vor der UNO die völlige Vernichtung eines souveränen Staates ankündigen und dafür Beifall bekommen? Wie groß ist die Bedrohung wirklich? Wer bedroht hier wen und warum? Und befähigen uns die Meldungen der meinungsbildenden Medien heute tatsächlich dazu, uns eine eigene Meinung zu bilden? (Immerhin ein Slogan des bereits oben erwähnten Leitbildverbreitungsorgans: »Bild Dir Deine Meinung!«)
Was tun »wir« (also die westliche Wertegemeinschaft, was immer das auch sein mag) gegen die Bedrohungen unterschiedlichster Art, die uns seit 2001 medial in immer düsteren Farben geschildert werden? Üblicherweise ziehen die USA – mal mit mehr, mal mit weniger Verbündeten im Schlepptau, mal mit, mal ohne UN- oder NATO-Mandat – mit Feuer und Schwert gegen diese Bedrohungen zu Felde. Immer im Namen der gequälten, unterdrückten und ihrer Freiheitsrechte beraubten Menschen der jeweiligen Region. Begonnen wird meist mit dem Verhängen von Sanktionen. Diese Schraube wird dann immer stärker angezogen, und dabei werden Verbündete eingesammelt. Und wenn man der Meinung ist, der jeweilige »Schurkenstaat« ist nun geschwächt genug, dann kommt das Militär zum Einsatz. Irgendwie erinnert das fatal an die mittelalterliche Belagerungstechnik, mit der feindliche Bastionen wochen- und monatelang von allem Lebensnotwendigem abgeschnitten worden sind, bis sie sturmreif waren. Aber die Leidtragenden waren nicht die Herrscher, deren Vorräte meist reichten, sondern die armen Leute und Verteidiger der Burgen.
Sanktionen kennen wir ja aus dem Kalten Krieg. Wenn man Länder vom notwendigen Austausch ausschließt, bremst man zwangsläufig ihre Entwicklung, denn kaum ein Land ist in der Lage, sich autonom mit allem zu versorgen (verstärkt wird das Ganze oft von Herrschern, die diese Abschottung auch von innen vornehmen). Aber ein Land von wichtigen Ressourcen abzuschneiden, dann seine Rückständigkeit in der Entwicklung zu beklagen, sich zu wundern, dass die betroffene Bevölkerung die Sanktionierer nicht liebt, und sie dann anschließend, im militärischen Versuch, ihr die »Freiheit« wiederzugeben, noch um ein paar Tausende zu dezimieren – das hat in den letzten dreißig Jahren nie zu wirklich positiven Ergebnissen bei den betroffenen Menschen geführt, sondern eher Elend und Not verstärkt und seltsame Gebilde hervorgebracht, die heute als Terrororganisationen gefürchtet werden, wie Al Qaida oder IS.
Sollen diese Eskalationsstufen zur Verteidigung der »freien Welt« nun auch auf Nordkorea Anwendung finden? Und wie werden sich Nord-, aber auch Südkorea dazu verhalten? Warum sind die Südkoreaner bisher so gelassen? Müssen wir unsere, die westliche, Sicht der Heilsbringerei nicht auf den Prüfstand stellen, und wissen wir eigentlich genug, um tatsächlich profund beurteilen zu können, ob das, was da geschieht, auch in unserem Interesse erfolgt?
Auf all diese Fragen versuchen die Herausgeber und Autoren dieses Buches, die Koreanistik-Professorin Helga Picht sowie der Asienexperte und Politikwissenschaftler Dr. Rainer Werning, Antworten zu geben. Unterstützung erhalten sie dabei von weiteren Autoren, unter anderem von dem Philosophen und linken Publizisten Dr. Arnold Schölzel. Nicht alle Beiträge sind brandneu – das eine oder andere ist schon im Internet veröffentlicht oder anderswo zu finden. Zusammen ergibt dieses Mosaik jedoch ein vielfältiges, spannendes und umfassendes Bild zur Lage um die Koreanische Halbinsel. Denn: Nur wer die ganze Geschichte um diesen Konflikt kennt, wer um die vielen Facetten der Verflechtung internationaler Interessen weiß und darüber hinaus die Spezifik Koreas in Betracht zieht, kann sich eine Meinung bilden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre!
Uli Jeschke
edition berolina
Rainer Werning und Helga Picht
Einleitendes
Vermissen Sie den Kalten Krieg, vermintes Gelände, gar undurchdringliche Stacheldrahtverhaue? Oder sperriges Mauerwerk, das Besuchern nach über einem Vierteljahrhundert seit dem Fall der Berliner Mauer noch Schauder erbitterter West-Ost-Blockkonfrontation über den Rücken jagt?
Dann reisen Sie nach Korea – vorzugsweise an den 38. Breitengrad. Dieser teilt die Halbinsel unschön in zwei Hälften, diesseits eine kapitalistische, jenseits eine sich sozialistisch verstehende, beide in solidem Zustand. Es ist dies das weltweit höchstmilitarisierte Terrain, das in circa vier Kilometern Breite und 240 Kilometern Länge den Norden, die Demokratische Volksrepublik Korea, und Süden des Landes, die Republik Korea, seit den Staatsgründungen beider Länder vor genau siebzig Jahren voneinander abschottet. Es war und ist dies nach dem ersten »heißen« Konflikt im Kalten Krieg, dem Koreakrieg (1950–1953), auch und gerade ein Hort aufgeheizter gegenseitiger Anfeindungen und ein Nährboden für immer wieder aufflackernde Konflikte mit internationalem Zündstoff. Bis heute. Einer der Gründe für diese prekäre Sicherheitslage auf der Halbinsel sowie in der Region Nordostasien ist die Tatsache, dass seit Ende dieses Krieges lediglich ein Waffenstillstandsabkommen existiert, das noch immer nicht in einen dauerhaft gültigen Friedensvertrag überführt werden konnte.
Südkorea wurde bereits 1996 nach Japan als zweites asiatisches Land in den erlauchten Club der in Paris ansässigen Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) aufgenommen. Seine Metropole Seoul präsentiert sich mit ihren glitzernden Glas- und Betonfassaden als kosmopolitischer Outpost von Globalisierung. In scharfem Kontrast zu der nördlichen, mit Monumentalbauten gesäumten Hauptstadt Pjöngjang, wo noch einiges an die Hochphase der Großen Proletarischen Kulturrevolution in der Volksrepublik China Ende der 1960er Jahre erinnert – inklusive häufiger Massenauftritte und mit Marschmusik untermalter Arbeitseinsätze von Soldaten und Zivilisten. Für westliche Besucher haftet den Alltagsrealitäten dort Museales an, wobei die zahlreichen Museen in Nordkoreas Metropole »aufgeräumte« Realitäten spiegeln. Eine Irritation, die dazu beiträgt, dass das Land aus westlicher Perspektive bleibt, was es seit seiner Gründung am 9. September 1948 war: bestenfalls eine Terra incognita, meist jedoch ein »Archipel Gulag im Fernen Osten«.
»Anschuldigungen gegen und Vorurteile über Nordkorea sind uns sattsam bekannt«, sagte einst Südkoreas bedeutendster zeitgenössischer Schriftsteller, Hwang Sok-yong, im Gespräch mit dem Autor dieser Zeilen. Und er fuhr fort: »Das erinnert an herumtollende Kinder, die auf Spielplätzen gern vor aufgestellten großen Spiegeln posieren und Mätzchen machen. Wenn sie dann in die Spiegel schauen, stellen sie verdutzt fest, dass ihre Körper mal aufgebläht und riesig sind oder sie auf einmal wie Winzlinge, Zwerge erscheinen. Über Nordkorea zirkulieren Verzerrungen, ja, Zerrbilder der gröbsten Art. Offenbar ist da auch eine Abwehrhaltung im Spiel. Denn das Land fühlt sich permanent bedroht, und sein Bild im Ausland, selbst in Kinofilmen, ist in den schwärzesten Farben gemalt. Allen anderen Ländern wird zugestanden, zumindest zwei Gesichter zu haben.«
Hwang, von dem auch Romane und Erzählungen in deutscher Übersetzung vorliegen, befasst sich in seinem Werk mit der Kolonialgeschichte, Teilung, Entfremdung und mit dem Krieg in seinem Land, dessen Herrscher ihn wegen »unerlaubten« Aufenthalts in Nordkorea zeitweilig hinter Gitter gesperrt hatten. »Wir Koreaner hatten das Pech«, so des Autors Resümee ob all dieser Erfahrungen, »zu lange auf rauchenden Kanonenrohren unseren Reis kochen zu müssen.«
Den ersten großen Roman über den Koreakrieg veröffentlichte Südkoreas bedeutendste Schriftstellerin Pak Kyongni (1926–2008) im Jahr 1964. Darin umging sie eine direkte Schuldzuweisung, beschrieb jedoch die Leiden der Bevölkerung mit dem beeindruckenden Bild, wie eine junge Witwe »unter von oben als riesige Pferdehufe drohenden Bombenflugzeugen« in einer weiten Ebene mit ihren zwei kleinen Kindern zu entkommen versucht. Später verdichtete Pak diese Szene in ihren Gesprächen und Memoiren (1993) und schlussfolgerte: »Zweifellos ist Krieg das größte Verbrechen, das die Menschheit als Ganzes gegen sich selbst begeht.«
Bei zahlreichen Besuchen und Gesprächen zwischen 1955 und 2009 in Nord- wie Südkorea konnte die Autorin dieser Zeilen immer wieder feststellen, dass die einfachen Menschen Paks Grundüberzeugung vollauf teilen, daraus ihre Sehnsucht nach friedlicher Wiedervereinigung ableiten und jedwede Einmischung ausländischer Mächte ablehnen. In diesem Sinne bleibt zu hoffen, dass der im Vorfeld der Olympischen Winterspiele 2018 im südkoreanischen Pyeongchang wiederbelebte innerkoreanische Dialog nördlich wie südlich des 38. Breitengrads Früchte trägt.
Übrigens entsandte Nordkoreas Machthaber seine Schwester Kim Yo-jong mit einer Regierungsdelegation im Februar 2018 zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele nach Südkorea, um mit der Regierung in Seoul erneut Direktgespräche zu führen und Präsident Moon Jae-in nach den Spielen in die Demokratische Volksrepublik Korea einzuladen. Eine solche Offerte hat es seit dem Koreakrieg nicht gegeben, was unter anderem IOC-Chef Thomas Bach sowie chinesische und russische Offizielle als äußerst ermutigend werteten. Nur der ebenfalls zur Eröffnung der Winterspiele in Pyeongchang angereiste US-Vizepräsident Mike Pence und Japans Ministerpräsident Shinzō Abe waren »not amused«.
Arnold Schölzel
Vorkrieg
Die Gefahr eines militärischen Konflikts in Korea ist ein Resultat der Politik des Westens im vergangenen Vierteljahrhundert.
Wenige Tage vor seiner Amtseinführung als US-Präsident verwendete Donald Trump im Interview mit Bild und Londoner Times Mitte Januar 2017 markige Worte, um die außenpolitische Hinterlassenschaft seiner Vorgänger zu charakterisieren. So erklärte er zum Irak-Krieg von 2003 und seine Folgen: »Schauen Sie, diese ganze Geschichte hätte nie passieren dürfen. Der Irak hätte gar nicht erst angegriffen werden dürfen, stimmt’s? Das war eine der schlechtesten Entscheidungen, möglicherweise die schlechteste Entscheidung, die in der Geschichte unseres Landes je getroffen wurde. Wir haben da etwas entfesselt – das war, wie Steine in ein Bienennest zu schmeißen. Und nun ist es einer der größten Schlamassel aller Zeiten.«
Sein erstes Amtsjahr nutzte Trump dazu, nicht nur Steine in ein Bienennest zu werfen, um sein Bild zu verwenden, sondern mit ständig größeren Brandfackeln eine Horde von Flugsauriern zu reizen. Im Klartext: den US-Kurs auf Krieg und Weltkrieg beschleunigt fortzusetzen. Eine Woche nach Amtsantritt beginnend, verschärfte er mit Militärschlägen in Jemen und im April in Syrien internationale Spannungen, stopfte systematisch weiter das Pulverfass im Mittleren Osten und zündete mit der von ihm auf den Weg gebrachten Kündigung des Iran-Abkommens in der Region die Kriegslunte. Er weitete den Afghanistan-Krieg aus, drohte ziemlich vielen Staaten zwischen Südostasien und Venezuela mit militärischen Interventionen und ließ den US-Rüstungsetat nicht, wie angekündigt, um zehn Prozent aufstocken, sondern um etwa das Doppelte: Das US-Repräsentantenhaus verabschiedete am 15. November einen Gesetzentwurf, der Militärausgaben in Höhe von rund 692 Milliarden US-Dollar (586,5 Milliarden Euro) erlauben würde. Die Zustimmung des Senats galt als wahrscheinlich.
Korea-Krise
Das alles ist nahtlose Fortsetzung der US-Außenpolitik seit dem Ende der Sowjetunion 1991. Die permanente Führung neokolonialer Kriege ist im vergangenen Vierteljahrhundert zur Existenzweise der USA und ihrer Verbündeten geworden. Diese Feldzüge, die zumeist ohne Legitimation durch den UN-Sicherheitsrat geführt werden oder ohne die Einschränkungen von dessen Mandat zu respektieren, bargen und bergen stets die Gefahr eines größeren Krieges in sich, zumal nicht wenige gegen Russland und China gerichtet sind. Am Ende des Jahres 2017 ist allerdings eine neue Situation eingetreten: Mit der von Trump systematisch angeheizten Krise in Korea findet sich die Welt akut in einem Vorkriegszustand, es droht ein Weltkrieg. Die Hauptverantwortung dafür liegt in Washington, das seit dem Beginn des Korea-Krieges vor fast siebzig Jahren auf der ostasiatischen Halbinsel eine unheilvolle Rolle spielt. Was damals durch China und die Sowjetunion verhindert wurde – die Wiederherstellung des kolonialen oder halbkolonialen Status ganz Koreas –, sollte nach 1991 im Zeichen des Triumphs im Kalten Krieg durch »Regime Change« nachgeholt werden. Was in Jugoslawien, in Afghanistan, dem Irak und Libyen gelang, scheiterte aber bislang in Syrien, dem Iran und in der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK). In Syrien gelang es dem Westen und seinen Verbündeten, in den Golfdiktaturen einen verheerenden »Bürgerkrieg« zu beginnen und anzuheizen, bis die russischen Streitkräfte am 30. September 2015 eingriffen und maßgeblich die Dschihadisten zurückdrängten. Das Abkommen über das iranische Atomprogramm, das im selben Jahr vereinbart wurde und dem Land etwas Luft verschaffte, will Trump torpedieren. Im Fall der DVRK scheint er aufs Ganze zu gehen.
Wer daher nur die Atombomben- und Raketentests der DVRK anführt, ignoriert die treibende Kraft dieses Konflikts. Die USA trainieren in jährlichen Militärmanövern in Südkorea die Invasion des Nordens einschließlich eines Atomwaffenangriffs. 2016 bot die DVRK Friedensverhandlungen an, und China schlug im März 2017 vor, dass die USA auf diese Übungen verzichten, im Gegenzug würde Nordkorea seine Atomwaffentests einstellen. Das blieb unbeantwortet, wie alle vom Norden seit 1953 gemachten Vorschläge. Stattdessen trieb die Trump-Administration die von US-Präsident Barack Obama initiierte Stationierung des THAAD-Raketenabwehrsystems (Terminal High Altitude Area Defense) voran, das China als Angriff auf seine nationalen Interessen bezeichnet. Im März ließ Trump Außenminister Rex Tillerson verkünden, die »Zeit der strategischen Geduld« sei beendet. Zu diesem Zeitpunkt waren die Vorbereitungen für die Raketenabwehr bereits im vollen Gang. So fand der Test von vier Raketen in der DVRK am 6. März statt, am gleichen Tag lieferten die USA Südkorea zwei THAAD-Raketenwerfer. Anfang Mai meldeten die Südkoreanischen Streitkräfte die eingeschränkte Einsatzbereitschaft des Waffensystems, bis Ende 2017 solle es voll einsatzfähig sein. Im Oktober berichtete das US-Außenministerium im Übrigen, die USA hätten sich mit Saudi-Arabien auf die Lieferung des THAAD-Systems im Wert von 15 Milliarden US-Dollar geeinigt. Frieden schaffen mit stets mehr Waffen und zum Nutzen der Rüstungsindustrie.
Militärische Eskalation
Im Herbst 2017 steigerte Washington erneut die rhetorische und militärische Eskalation. Trump erklärte im Oktober, sein Außenminister Rex Tillerson »verschwendet seine Zeit« mit dem Versuch, bei DVRK-Staatschef Kim Jong-un etwas zu erreichen.
Dem folgte ein US-Militärmanöver nach dem anderen vor und über der Koreanischen Halbinsel:
• Einen Tag vor der Abreise Trumps zu einer zwölftägigen Asien-Reise, die ihn zunächst nach Japan, Südkorea und China führte, hielten die USA mit Südkorea und Japan am 2. November eine gemeinsame Luftwaffenübung ab. Dabei überflogen US-Kriegsflugzeuge vom Typ B-1B Südkorea. Das Training sei Teil einer Mission »ständiger Bomberpräsenz« im Pazifik und keine Reaktion auf ein aktuelles Ereignis gewesen, teilte die U.S. Air Force offiziell mit.• Am 11. November begann östlich der Koreanischen Halbinsel ein gemeinsames Seemanöver der USA und Südkoreas, an dem auch drei amerikanische Flugzeugträger beteiligt waren. Nach Angaben Seouls sollte die viertägige Übung die »erweiterte Abschreckung« gegen die DVRK stärken. Die Verbände der Flugzeugträger »USS Ronald Reagan«, der »USS Nimitz« sowie der »USS Theodore Roosevelt« fuhren am 12. November in Formation in das sogenannte militärische Einsatzgebiet Südkoreas im Japanischen Meer. Washington hatte zuvor angekündigt, dass die Flugzeugträger vom 11. bis zum 14. November in »internationalen Gewässern« des westlichen Pazifiks ein Manöver durchführen würden. Nach Angaben aus Seoul nahmen sieben südkoreanische Marineschiffe, einschließlich Zerstörern und Begleitschiffen, daran teil.• Die Streitkräfte der USA und Südkoreas starteten am 4. Dezember ihr bis dahin größtes gemeinsames Luftwaffenmanöver. An der fünftägigen Übung »Vigilant Ace« (»Wachsames Ass«) vom 4. bis zum 8. Dezember 2017 in der Pazifikregion waren mehrere Zehntausend Soldaten sowie mehr als 230 Militärflugzeuge beteiligt. Auch US-Tarnkappenbomber vom Typ F-22 Raptor kamen zum Einsatz. Trainiert wurden unter anderem Präzisionsangriffe auf nordkoreanische Nuklearanlagen. Die DVRK erklärte am 3. Dezember, das Manöver sei eine »offene und umfassende Provokation«, die jederzeit zu einem Atomkrieg führen könne.Wenige Tage vor Beginn der Übung, am 28. November 2017, hatte Pjöngjang den 19. Raketentest des Jahres durchgeführt und gab an, nun in der Lage zu sein, das gesamte Festland der USA mit Atomsprengköpfen anzugreifen.
Trump reagierte darauf für seine Verhältnisse relativ gelassen mit der Bemerkung: »Wir werden uns darum kümmern.« Allerdings hatte er in einer Rede unmittelbar zuvor Kim Jong-un als »kranken jungen Hund« (»sick puppy«) bezeichnet. Von den Verbündeten der USA ließ er den Rückzug ihrer Botschafter aus Pjöngjang fordern, was vor allem die Bundesrepublik betraf. Sie hat als eines von wenigen westlichen Ländern in der DVRK eine Vertretung. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel erklärte am 30. November nach einem Gespräch mit Tillerson, Berlin werde in Pjöngjang einen Diplomaten, aber nicht den Missionschef abziehen. Eine Schließung der deutschen Botschaft in der DVRK-Hauptstadt habe Tillerson nicht verlangt. Die Bundesregierung hatte bereits seit dem Sommer signalisiert, dass sie vermitteln wolle. Im September schlug Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Beispiel vor, dass die Sechs-Mächte-Gespräche, die zu einem Abkommen mit dem Iran führten, um seine Nuklearaktivitäten zu begrenzen, ein Modell für den Umgang mit dem koreanischen Konflikt sein könnten. »Europa, und insbesondere Deutschland, sollten bereit sein, eine sehr aktive Rolle zu spielen«, sagte Merkel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Deutsche Diplomaten ließen sich wiederholt mit der Auffassung zitieren, Deutschland könne gemeinsam mit Russland und China auf eine diplomatische Lösung hinarbeiten.
In Washington warf nach dem nordkoreanischen Raketentest am 28. November die zweite Reihe des Establishments die mediale Hysteriemaschine an. Der republikanische Hardliner, Senator Lindsey Graham, beeilte sich, über CNN und CBS anzukündigen, beim nächsten Atomtest der DVRK werde es einen »präemptiven« Krieg geben. Er empfahl per TV den in Südkorea stationierten 28.500 US-Soldaten, sie sollten ihre Familien nach Hause schicken. Der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Herbert R. McMaster, behauptete am 2. Dezember, die Wahrscheinlichkeit eines Krieges mit Nordkorea steige »mit jedem Tag«. DVRK-Staatschef Kim Jong-un komme »näher und näher« an Atomwaffen heran: »Es bleibt nicht viel Zeit.«
Beijing reagierte auf all das mit gewohnter Gelassenheit und rief alle Seiten zur Mäßigung auf. Dagegen antwortete Moskau mit ungewöhnlich klaren Worten. Chinas Staatschef Xi Jinping kommentierte die Andeutungen der US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, China könne bezüglich der Blockade Nordkoreas »mehr unternehmen«, die Volksrepublik sei bereit, mit den USA bei der Regulierung des nordkoreanischen Problems zusammenzuarbeiten. Dabei betonte er, dass »die Denuklearisierung der gesamten Koreanischen Halbinsel« zu den »unerschütterlichen Zielen Chinas« gehöre.
Am 30. November erklärte der russische Außenminister Sergej Lawrow bei einem Aufenthalt in der Hauptstadt von Belarus, Minsk, kühl und in undiplomatisch klarer Sprache, wenn die USA einen Vorwand für die Vernichtung Nordkoreas suchten, müssten sie das klar sagen. Moskau werde seine Entscheidung daran messen, was die USA wirklich wollten: »Sie sollten uns erklären, worin ihre künftigen Handlungen bestehen werden.« Das Vorgehen der USA sei geeignet, Nordkorea zu extremen Schritten zu provozieren, fügte er hinzu.
Am 2. Dezember strahlte der belarussische Fernsehsender STV ein Interview mit Lawrow aus, in dem er noch einmal unterstrich, Ansprüche der DVRK auf Atomwaffen würden von Russland und seinen Verbündeten nicht geduldet. Er wies darauf hin, dass es aber bis zum 28. November zwei Monate lang keine nordkoreanischen Raketentests gegeben habe, und fuhr fort: »Parallel dazu gaben uns im September unsere amerikanischen Kollegen zu verstehen, dass die nächsten großangelegten Militärübungen um die Koreanische Halbinsel erst für das Frühjahr des nächsten Jahres geplant sind. Es wurde angedeutet, dass – wenn die Pause, die auf eine natürliche Weise während der amerikanisch-südkoreanischen Übungen entsteht, auch von Pjöngjang zur Aufrechterhaltung des Friedens verwendet werden würde – man Bedingungen für einen Dialogstart entwickeln könnte. Wir sagten, dass wir diesen Zugang schätzen. Wir arbeiteten mit Pjöngjang zusammen. Plötzlich, zwei Wochen nachdem uns die Amerikaner ein Signal gaben, gaben sie ihre außerordentlichen Übungen bekannt – also nicht im Frühjahr, sondern im Oktober und dann im November. Jetzt gaben sie bereits weitere Übungen für Dezember bekannt. Es scheint, als hätten sie absichtlich Kim Jong-un provoziert, damit er keine Pause einhält, sondern ausflippt. Wir verurteilen seine Spielchen mit Atomwaffen, und genauso verurteilen wir das Verhalten unserer US-Kollegen. Leider versuchen sie, die Japaner und die Südkoreaner in dieselbe Richtung zu ziehen, die, wie Sie richtig sagten, die ersten Opfer im Falle einer Kriegsauslösung auf der Koreanischen Halbinsel sein werden.«
Neue Epoche, neue Kriege
Die heutige Situation ist das folgerichtige Resultat der seit 1991 von den USA und ihren Verbündeten verfolgten Politik.
Nach dem Ende der Sowjetunion und der sozialistischen Länder Europas hatten Ideologen der sogenannten Globalisierung und die Politiker der führenden westlichen Nationen angekündigt, ein Kapitalismus mit sozialem Antlitz werde sich weltweit ausbreiten wie auch die parlamentarische Demokratie. Die Rede war von einer »Friedensdividende«. Der US-Politikwissenschaftler Francis Fukuyama fand dafür die Formel vom »Ende der Geschichte«. Tatsächlich – dieses Fazit lässt sich nach gut einem Vierteljahrhundert ziehen – enthielt diese Botschaft ein Programm des Staatsterrorismus gegen kolonial befreite, aber auf ihrer Souveränität beharrenden Länder sowie extreme ökonomische und politische Diktate der stärksten kapitalistischen Länder gegenüber schwächeren. Der italienische Philosoph und Historiker Domenico Losurdo bezeichnet diese vergangenen gut 25 Jahre in seinem Buch Wenn die Linke fehlt … Gesellschaft des Spektakels, Krise, Krieg (Köln 2017) als dritte Etappe eines globalen Kampfes zwischen Kolonialismus und Antikolonialismus, der vor hundert Jahren begonnen habe: »Die erste Etappe reicht von der Oktoberrevolution (und dem von Lenin an die Sklaven der Kolonien gerichteten Appell zur Rebellion) bis Stalingrad und bis zur in Europa und Asien dem (vom ›Dritten Reich‹, vom Reich der aufgehenden Sonne und Mussolini-Italien vorangetriebenen) Projekt zugefügten Niederlage, dem Projekt nämlich, die koloniale Tradition wiederzubeleben und zu radikalisieren, indem sie auch in Ländern mit gefestigter, alter oder sehr alter Zivilisation wie Polen, Russland, China oder den Balkanländern durchgesetzt werden sollte. Die zweite Etappe geht von Stalingrad bis zum Sieg der USA und des Westens im Kalten Krieg und zeitigt einerseits den Zusammenbruch des klassischen Kolonialismus und andererseits den tückischen Beginn des Neokolonialismus.«
Die dritte Etappe ist aus dieser Perspektive noch im Gang. Allerdings unter anderen Bedingungen als denen, mit denen sie um 1990 herum einsetzte. Es war nicht nur symbolisch, dass an ihrem Anfang der Caracazo vom Februar 1989 in Caracas stand, ein Volksaufstand, dessen Niederschlagung etwa 3.000 Tote kostete. Während sich die westlichen Medien jedes Jahr neu Anfang Juni mit großem moralischen Aufwand an den Ereignissen in Beijing im selben Jahr abarbeiten, erwähnen sie die in Venezuela nie. Das Gleiche gilt für den Krieg der USA gegen Panama vom 20. Dezember 1989 bis 3. Januar 1990, immerhin die bis dahin größte Luftlandeoperation seit dem Zweiten Weltkrieg. Sie forderte nach US-Angaben 250 Tote unter der Zivilbevölkerung, die Vereinten Nationen schätzen mindestens 2.500 Tote. Jedes Jahr erneut wird in den Medien der westlichen Welt dieses Kriegsverbrechen, das unmittelbar nach Öffnung der Berliner Mauer am 9. November 1989 stattfand, zu Unrecht als Symbol für den Beginn der neuen Epoche und der sogenannten neuen Kriege missachtet. 1989 scheint nur in Berlin und der DDR etwas geschehen zu sein.
Tatsächlich steht die sogenannte deutsche Einheit auf ihre Weise als Symbol für die von Losurdo bezeichnete dritte Etappe: Krieg im Stil der Kanonenbootpolitik der klassischen imperialistischen Länder zu Beginn des 20. Jahrhunderts war wieder führbar geworden – nur etwa einen Monat nach dem 9. November 1989 musste Panama das hinnehmen.
Dem Panama-Krieg im Stil eines Überfalls bei absoluter Überlegenheit des Angreifers folgte der schon mit mehr Sorgfalt vorbereitete Krieg gegen den Irak Anfang 1991, den der Dichter Volker Braun für die Ostdeutschen zum »Begrüßungskrieg« erklärte. Die Operation Desert Storm genannte Invasion, von der Bundesregierung mit einem Betrag von etwa 18 Milliarden DM mitfinanziert, war der erste mediengerecht inszenierte High-Tech-Krieg. Dem interessierten Publikum wurden allabendlich »chirurgische Schläge« gegen irakische Städte und Dörfer in den Fernsehnachrichten serviert. Der Krieg hatte seinen »Höhepunkt« im sogenannten Truthahnschießen auf der Autobahn zwischen Kuwait und Bagdad – auch dies ein Symbol für den Charakter der neuen Kriege: Wehrlose Gegner werden systematisch massakriert, der Tod von Zivilisten wird entgegen jedem Völkerrecht systematisch herbeigeführt. Der Irak-Krieg kostete 150.000 Menschenleben, darunter 76 US-Soldaten. Er wurde unter dem Deckmantel von US-Sanktionen länger als ein Jahrzehnt weitergeführt, am Ende waren mehr als eine Million Iraker tot. In der westlichen Welt wurde das kaum noch zur Kenntnis genommen.