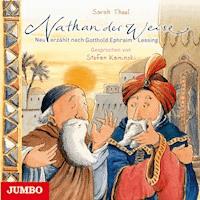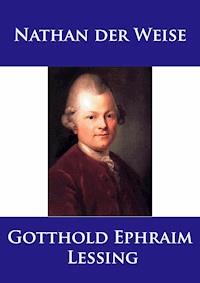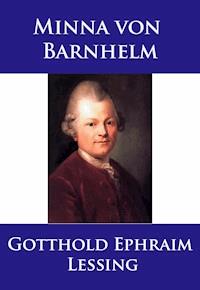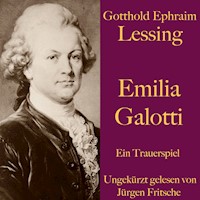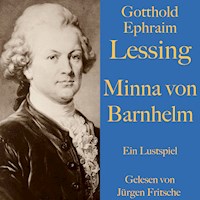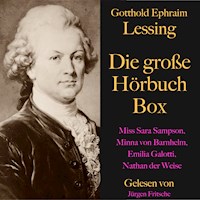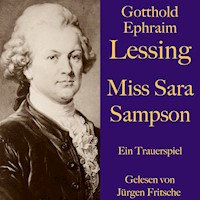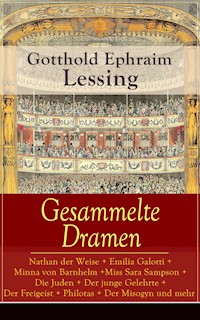Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Lessings über 300 Briefe gehören zu den ersten Werken der Kritik schöner Literatur. An eine fiktive Person gebunden entwickelt sich schnell ein Klassiker der deutschen Buchgeschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 492
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Briefe, die neueste Literatur betreffend
Gotthold Ephraim Lessing
Inhalt:
Gotthold Ephraim Lessing – Biografie und Bibliografie
Briefe, die neueste Literatur betreffend
Erster Teil
Einleitung
Erster Brief
Zweiter Brief
Dritter Brief
Vierter Brief
Fünfter Brief
Siebender Brief
Achter Brief
Neunter Brief
Zehnter Brief
Eilfter Brief
Zwölfter Brief
Dreizehnter Brief
Vierzehnter Brief
Funfzehnter Brief
Sechzehnter Brief
Siebzehnter Brief
Achtzehnter Brief
Beschluß des achtzehnten Briefes
Neunzehnter Brief
Dreißigster Brief
Beschluß des dreißigsten Briefes
Nachricht
Zweiter Teil
Vorbericht
Ein und dreißigster Brief
Beschluß des ein und dreißigsten Briefes
Zwei und dreißigster Brief
Drei und dreißigster Brief
Sechs und dreißigster Brief
Neun und dreißigster Brief
Vierzigster Brief
Ein und vierzigster Brief
Fortsetzung des ein und vierzigsten Briefes
Beschluß des 41sten Briefes
Drei und vierzigster Brief
Vier und vierzigster Brief
Dritter Teil
Acht und vierzigster Brief
Neun und vierzigster Brief
Funfzigster Brief
Ein und funfzigster Brief
Zwei und funfzigster Brief
Beschluß des 52sten Briefes
Drei und funfzigster Brief
Vierter Teil
Drei und sechzigster Brief
Beschluß des drei und sechzigsten Briefes
Vier und sechzigster Brief
Fünf und sechzigster Brief
Siebenzigster Brief
Beschluß des siebenzigsten Briefes
Ein und siebenzigster Brief
Fünfter Teil
Sieben und siebenzigster Brief
Beschluß des sieben und siebenzigsten
Briefes
Ein und achtzigster Brief
Ein und neunzigster Brief
Sechster Teil
Hundert und zweiter Brief
Hundert und dritter Brief
Hundert und vierter Brief
Hundert und fünfter Brief
Hundert und sechster Brief
Der Beschluß künftig
Beschluß des 106ten Briefes
Hundert und siebender Brief
Hundert und achter Brief
Hundert und neunter Brief
Hundert und zehnter Brief
Hundert und elfter Brief
Hundert und zwölfter Brief
Siebenter Teil
Hundert und sieben und zwanzigster
Brief
Beschluß des hundert und sieben und zwanzigsten Briefs
Vierzehnter Teil
Zweihundert und drei und dreißigster Brief
Drei und zwanzigster Teil
Drei hundert und zwei und dreißigster Brief
Beschluß des dreihundert und zwei und dreißigsten Briefes
Briefe, G. E. Lessing
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849625597
www.jazzybee-verlag.de
Gotthold EphraimLessing – Biografie und Bibliografie
Namhafter deutscher Dichter und unübertroffener Kritiker, geb. 22. Jan. 1729 zu Kamenz in der sächsischen Oberlausitz, wo sein Vater Prediger und später Hauptpastor war, gest. 15. Febr. 1781 in Braunschweig, bezog 21. Juni 1741 die Fürstenschule St. Afra in Meißen, auf der er eine gründliche Ausbildung in den alten Sprachen erwarb und bei dem Selbststudium, das nach dem gesunden Prinzip der Fürstenschulen verstattet war, sich mit Vorliebe zu den Charakterdarstellern und Dramatikern Theophrast, Plautus und Terenz wandte. Von poetischen Plänen und Entwürfen gehörte der Meißener Schülerzeit bereits eine erste Bearbeitung des später in Leipzig abgeschlossenen Lustspiels »Der junge Gelehrte« an. Auf der Universität Leipzig, die L. im Herbst 1746 bezog, fühlte er sich von den mittelmäßigen theologischen Vorlesungen keineswegs angezogen, weit mehr jedoch von den philologischen, besonders denjenigen Christs (s. Christ 1), sowie ferner von denen des Mathematikers und Naturforschers A. G. Kästner (s. d.). Von Beziehungen zu Gottsched, der in Leipzig Professor war, hören wir nichts. L. setzte es gelegentlich einer Reise in die Heimat (Anfang 1748) bei seinen Eltern durch, das theologische Studium aufgeben zu dürfen, um sich der Medizin zu widmen und sich »nebenbei auf Schulsachen zu legen«. Doch auch in der Folge betrieb L. seine Studien nur unregelmäßig. Erfüllt von dem Wunsche, das Leben kennen zu lernen und sich von einseitiger Buchgelehrsamkeit frei zu halten, gab er sich den Freuden der Geselligkeit hin, pflegte nahe Beziehungen zum Theater und vervollkommte sich in weltläufigem Benehmen; auch kräftigte er seine Gesundheit durch fleißig betriebene körperliche Übungen. Doch des Jünglings bescheidene Mittel zerrannen schnell bei solcher Lebensführung, und er geriet in allerlei Fährlichkeit und in Schulden. Die Neigung, die er für das Drama schon aus Meißen mitgebracht hatte, wurde in Leipzig, wo Friederike Neuber und ihre Gesellschaft noch spielten, durch die Anschauung einer lebendigen Bühne derart gesteigert, daß die erste literarische Tätigkeit des jungen L., neben anakreontischen Versuchen und kleinen Sinngedichten, sich durchaus auf dramatische Arbeiten und Entwürfe richtete. Das neubearbeitete Lustspiel »Der junge Gelehrte« wurde von der Neuberschen Truppe ausgeführt. Von Lessings sonstigen dramatischen Jugendversuchen aus der Zeit bis 1750 sei noch erwähnt das ausgelassene Possenspiel: »Die alte Jungfer«, das er selber nicht der Aufnahme in seine Schriften würdigte, das Situationslustspiel »Der Misogyn«, ferner »Der Freigeist«, dessen Titelheld von einem ernsten und würdigen Geistlichen beschämt wird, und »Die Juden«, in denen L. sich gegen das herrschende religiöse und soziale Vorurteil erklärt. Anlehnungen an die ältere, speziell sächsische Lustspieldichtung lassen sich in all diesen noch jugendlich unbedeutenden Stücken bemerken; ihr Hauptverdienst besteht in dem flotten, pointierten Dialog. Nachdem im Frühjahr 1748 die Katastrophe der Neuberschen Schauspielergesellschaft eingetreten war, wurde dem jungen Autor und Studenten, der sich für einzelne Mitglieder der Truppe verbürgt hatte, der Boden in Leipzig zu heiß unter den Füßen. Er entwich vor seinen Gläubigern nach Wittenberg, wo er krank ankam. Kaum daß er die Erlaubnis seiner Eltern erhalten, auf dieser zweiten sächsischen Universität seine Studien fortzusetzen, so bedrängten ihn auch hier seine Gläubiger derart, daß er den Entschluß faßte, vorderhand seine Universitätsstudien abzubrechen, vom Ertrag seiner Stipendien seinen Gläubigern gerecht zu werden, für sich selbst aber in Berlin eine literarische Existenz zu suchen.
Im November 1748 kam L. in dürftigem Auszug und völlig mittellos in Berlin an; das Nötigste erwarb er zunächst durch Ordnung der Rüdigerschen Bibliothek, durch Übersetzungen für Buchhändler und auch für Voltaire, dessen Prozeßschriften im Streithandel mit dem Juden Hirsch L. in deutscher Sprache redigierte, ferner durch literarische Besprechungen für die »Vossische Zeitung«, für die er vom April 1751 an ein Bei blatt: »Das Neueste aus dem Reiche des Witzes«, herausgab (genaues Verzeichnis darüber von Muncker in Houbens »Bibliographischen Repertorium«, Bd. 2, Berl. 1905). Hier beginnt sich bereits sein klarer, scharfer, durch Gleichnisse und überraschende Wendungen belebter Prosastil zu entwickeln; die Selbständigkeit seines Urteils zeigt sich besonders gegenüber neu auftauchenden Größen der Literatur, wie Rousseau, Diderot und Klopstock. In Gemeinschaft mit seinem Freunde Christlob Mylius begann er die kurzlebige Zeitschrift »Beiträge zur Historie und Aufnahme des Theaters« (Stuttg. 1750), die namentlich durch einen Aufsatz über Plautus bemerkenswert ist, dessen »Trinummus« L. damals u. d. T.: »Der Schatz« bearbeitete. Seine lyrischen Versuche sammelte er als »Kleinigkeiten« (Stuttg. 1751). Im Dezember 1751 entschloß er sich, Berlin zu verlassen, die Universität Wittenberg abermals zu beziehen, um den Magistergrad zu erwerben. In jugendlicher Neugier und Unbedachtsamkeit ließ er sich die Indiskretion zu schulden kommen, ein Manuskript Voltaires gegen dessen Wissen und Willen auf die Reise mitzunehmen, infolge wovon ein Zerwürfnis zwischen ihm und Voltaire eintrat. In Wittenberg, am Stammsitz des Luthertums, beschäftigte er sich, durch die reichhaltige Bibliothek unterstützt, mit Reformationsgeschichte sowie mit Gelehrtengeschichte und Bibliographie im allgemeinen. Er vollendete damals eine Reihe von Aufsätzen, die er »Rettungen« überschrieb, und in denen sich eine charakteristische Richtung seines Geistes frühzeitig offenbart; L. verteidigt eine Reihe von Männern, hauptsächlich aus dem Reformationszeitalter, gelehrt und scharfsinnig gegen Vorwürfe, die herkömmlich gegen sie erhoben wurden, darunter auch Gegner Luthers, wie Cochläus und Lemnius, ferner Horaz, bei dessen Verteidigung er darlegt, man dürfe nicht alles ernsthaft nehmen, was ein lyrischer Dichter von sich selber berichtet. Auch hat er sich in Wittenberg, durch das Studium Martials angeregt, mit Vorliebe der Epigrammendichtung gewidmet. Noch vor Ablauf des Jahres 1752 kehrte L., nachdem er zum Magister promoviert worden, nach Berlin zurück, schrieb hier wiederum Kritiken für die »Vossische Zeitung« und begründete eine neue »Theatralische Bibliothek« (Berl. 1754–58), die uns noch deutlicher als seine frühere dramaturgische Zeitschrift erkennen läßt, wie er sich durch selbständiges Nachdenken und ausgebreitete Lektüre von dem herkömmlichen französischen Klassizismus allmählich befreite. Nach Mylius' (s. d.) frühem Tode (1754) befreundete er sich immer enger mit Nicolai und Mendelssohn, später auch mit Ramler. Als die Berliner Akademie die Preisaufgabe stellte, das philosophische System des Dichters Pope zu untersuchen, verfaßte er mit Mendelssohn die Schrift »Pope ein Metaphysiker!« (Danzig 1755), in der er dartat, daß der Vortrag eines konsequenten philosophischen Systems dem Wesen der Dichtkunst widerspreche. Sein ausgebreitetes Wissen, sein genialer Einblick in den Kern aller poetischen und literarischen Aufgaben und sein unerschrockener Freimut begannen gefürchtet zu werden, seitdem er, frech herausgefordert, mit seinem überaus scharfen »Vademecum für Herrn Samuel Gotthold Lange, Pastor in Laublingen« (Berl. 1754) an dem seichten und flüchtigen Horaz-Übersetzer und in ihm an der ganzen behaglichen und platten Mittelmäßigkeit in der damaligen schönen Literatur ein Exempel statuiert hatte. Damals faßte er auch seine bisherige Wirksamkeit in der ersten Sammlung seiner »Schriften« (Berl. 1753–1755) zusammen. Band 1 enthält »Lieder und Epigramme«, Band 2 »Kritische Briefe«, größtenteils durch Umarbeitung der Aufsätze im »Neuesten aus dem Reiche des Witzes« entstanden, jedoch mit Hinzufügung einiges Neuen, z. B. des merkwürdigen Tragödienfragments »Samuel Henzi«, in dem L. einen Stoff aus der jüngsten Vergangenheit behandelt, Band 3 »Rettungen«, Band 1–6 »Dramen«, darunter »Miß Sara Sampson« (1755), mit der er im Anschluß an den englischen Familienroman und Lillos »Kaufmann von London« das bürgerliche Trauerspiel in Deutschland begründete. War auch die Führung der Handlung in diesem Drama noch sehr anfechtbar, der Dialog oft breit und rührselig, die Charakteristik der Hauptperson frischen Lebens bar, so zeugten doch einzelne Szenen und namentlich das Charakterbild der Lady Marwood von einer Kraft und Eigenart, die alle Zeitgenossen übertraf.
L. vertauschte im Oktober 1755 Berlin wieder mit Leipzig und konnte bald darauf seinen Berliner Freunden von einer Aussicht melden, über die er große Genugtuung empfand: er sollte als Reisebegleiter eines jungen Leipziger Patriziers, Winkler, Ostern 1756 eine auf drei Jahre berechnete Bildungsreise nach den Niederlanden, England, Frankreich, Italien antreten. Er bereitete sich ernsthaft auf die Reise vor, die in der Tat 10. Mai angetreten wurde und L. durch das nördliche Deutschland nach den Niederlanden führte, wo von Amsterdam aus die vorzüglichsten Städte besucht wurden. Der Ausbruch des Siebenjährigen Krieges aber und die Besetzung Leipzigs durch preußische Truppen trieben Winkler nach Leipzig zurück, wohin ihm L. notgedrungen folgen mußte. Da es hier rasch zu einem Zerwürfnis zwischen L. und seinem seitherigen Genossen kam, das in einen erst nach Jahren (1764) zu Lessings gunsten erledigten Prozeß auslief, so sah sich der Schriftsteller, der auf drei Jahre der Sammlung und Muße gehofft hatte, wieder auf seine Feder angewiesen und mußte mehr als je zuvor zu Übersetzungen, Korrekturen und andern Notbehelfen greifen. Zunächst hielt ihn der Verkehr mit dem preußischen Major Ew. v. Kleist (dem Dichter) in Leipzig zurück; als aber dieser im Mai 1758 zur preußischen Feldarmee ging, zog es auch L. wieder nach Berlin. Hier lebte er von 1758–60 unter den Eindrücken der Taten und Wechselfälle des Siebenjährigen Krieges. Mit seinen Freunden vereinigte er sich zur Herausgabe eines neuen kritischen Organs für Besprechung der neuern deutschen schönwissenschaftlichen Literatur: der »Briefe die neueste Literatur betreffend« (Berl. 1759–65, 24 Bde.), für die er besonders 1759 tätig war; hervorzuheben sind die Briefe, in denen er Wieland und Klopstock bespricht, die Gottschedsche Richtung in der dramatischen Literatur bekämpft, Shakespeare als den größten dramatischen Dichter feiert und eine Szene aus seinem unvollendeten Faustdrama mitteilt (Brief 17). Er veröffentlichte nebenbei drei Bücher seiner »Fabeln« in Prosa nebst Abhandlungen, in denen er zum erstenmal nicht nur als Kritiker, sondern auch als Theoretiker auftrat (Berl. 1759), und das kleine, in einer knappen, scharfen Prosa abgefaßte Trauerspiel »Philotas« (das. 1759), in dem sich trotz dem antiken Schauplatz der Handlung doch die patriotische Erregung der Zeit widerspiegelt. Auch schrieb er damals sein erst später aus Lessings Nachlaß von Eschenburg (1790) veröffentlichtes »Leben des Sophokles«, gab »Logaus Sinngedichte« (Leipz. 1759) heraus und übertrug »Das Theater des Herrn Diderot« (Berl. 1760, 2 Bde.), die verwandten Bestrebungen des französischen Kritikers und Dichters teils richtig würdigend, teils überschätzend. Die Unsicherheit seiner Lage, der erneut wiederkehrende Wunsch, sich größern Arbeiten in aller Muße und ohne Rücksicht auf ihre frühere oder spätere Vollendung widmen zu können, veranlaßten L., eine Stellung als Sekretär des Generals Tauenzien, des Gouverneurs von Schlesien, anzunehmen und im Herbst 1760 nach Breslau zu gehen. Wenn auch die Freunde darüber den Kopf schüttelten, daß sich L. in eine Flut von ganz unliterarischen, militärischen und bürgerlichen Geschäften hineingestürzt habe und er selbst in einigen Briefen über die Last ermüdender, unbedeutender Beschäftigungen, erlogener Vergnügen und Zerstreuungen klagte, so ward ihm doch der mehrjährige Aufenthalt in Breslau fruchtreich: während die Freunde, zumal nach dem Heldentode des von L. tief betrauerten Kleist (1759), dem rastlos vorwärts strebenden nicht mehr viel zu bieten vermochten, konnte er hier »in sich selbst Wurzel fassen«, sich in ernste Studien, z. B. des Spinoza und der Kirchenväter, versenken, lebendiger Wirklichkeit, die ihn umgab, die poetische Seite abgewinnen und fand Gelegenheit, nicht nur seine Familie reichlich zu unterstützen (was er übrigens auch in seinen dürftigsten Lagen über seine Kräfte hinaus getan), sondern auch eine beträchtliche Bibliothek zu sammeln, die er freilich schon in den nächsten Jahren als Notpfennig betrachten und wieder veräußern mußte. Die wichtigsten Erträgnisse der (bis 1765 währenden) Breslauer Zeit waren das Lustspiel »Minna von Barnhelm, oder das Soldatenglück« (Berl. 1767) und »Laokoon, oder über die Grenzen der Malerei und Poesie« (das. 1766, erster Teil; der zweite ward nie vollendet): ersteres das klassische Lustspiel der Deutschen, nach Goethe »die wahrste Ausgeburt des Siebenjährigen Krieges, die erste aus dem bedeutenden Leben gegriffene Theaterproduktion«; letzterer eine der ästhetisch-kritischen Hauptschriften Lessings, durch die er die Überschätzung der beschreibenden Poesie beseitigte, die Handlung in der Poesie und damit die dramatische und erzählende Dichtung in ihr Recht einsetzte und nach der literarischen Seite hin klärend und grundlegend im höchsten Sinne wirkte. Der Satz, daß der Dichter nicht malen solle, gehört seitdem, um mit Vischer zu reden, »zum A B C der Ästhetik«.
Trotz der literarischen Stellung, die L. nach diesen Werken einnahm, wollte sich eine seiner Natur entsprechende bürgerliche Stellung für ihn nicht finden. Er war 1765 nach Berlin zurückgekehrt, wo man ihm Hoffnungen auf eine Berufung als Bibliothekar gemacht hatte. Als diese Hoffnung trotz wertvoller Fürsprache des einflußreichen Obersten Quintus Icilius an dem Widerstand Friedrichs d. Gr. gescheitert war, erschien ihm Berlin als eine »verzweifelte Galeere«; er sehnte sich hinweg und nahm daher mit Freuden eine Aufforderung an, seine Kräfte dem »Nationaltheater« zu widmen, das man soeben in Hamburg errichtete. Als Dramaturg der neuen Bühne begab er sich im April 1767 nach Hamburg, das ihm als Stadt schon beim ersten Sehen sehr behagte. Seine Hauptaufgabe sollte die Abfassung einer kritischen Zeitschrift sein, die »jeden Schritt begleiten sollte, den die Kunst sowohl des Dichters als des Schauspielers tun würde« und als »Hamburgische Dramaturgie« in der Tat 1. Mai 1767 ins Leben trat. Die schlecht vorbereitete und schlecht geleitete, vom unreifen Publikum jener Tage noch schlechter unterstützte Unternehmung brach indes schon nach kurzer Zeit zusammen; ihr größter Ruhm bleibt, zu Lessings »Dramaturgie« den äußern Anlaß gegeben zu haben. Während ihres Erscheinens entfernte sich L. immer mehr von seiner ursprünglichen Absicht. In den ersten 25 Nummern (Stücken) kritisiert er eingehend die Schauspieler, namentlich Ekhof. Später wurde ihm diese Seite seiner Tätigkeit, die er mit großem Glück durchgeführt hatte, durch kleinliche Empfindlichkeiten, besonders der ersten Schauspielerin der Bühne, Frau Hensel, verleidet. Er sprach nur noch über die Dichter, und zwar sehr eingehend, indem er die Gelegenheit benutzte, den reichen Schatz seiner Gedanken über die dramatische Kunst, namentlich seine Ansichten über Aristoteles' »Poetik«, über Shakespeare, über die französische Tragödie und ihr Verhältnis zu Shakespeare und zum antiken Drama ausführlich darzulegen. Der zeitliche Abstand zwischen den einzelnen Stücken und den besprochenen Aufführungen wurde immer größer, das letzte Stück (im April 1768) behandelte eine Ausführung, die nach Lessings Angabe am 28. Juli, in Wahrheit am 11. Aug. 1767 stattgefunden hatte. So wurde die »Dramaturgie«, wie L. mit Recht bemerkt, etwas andres, als man anfangs beabsichtigt hatte, aber wahrlich nichts Schlechteres. Nach dem Scheitern des Theaters setzte L. noch kurze Zeit hindurch Hoffnungen auf den Erfolg eines Verlagsgeschäfts, das er mit Chr. Gode begründet hatte. Als auch dieser ausblieb, fand L., daß es ihm unmöglich sein werde, »des Sperlings Leben auf dem Dach« in dem geliebten Hamburg fortzusetzen, und entschloß sich im Herbst 1769, die ihm angetragene Stellung als Bibliothekar der herzoglichen Bibliothek in Wolfenbüttel anzunehmen. Die letzte Zeit in Hamburg war durch die Abfassung der »Briefe antiquarischen Inhalts« (Berl. 1768–69) bezeichnet gewesen. In ihnen wurde der ränkesüchtige Professor Chr. A. Klotz, der sich als Führer einer literarischen Clique hohler und anmaßlicher Gesellen hervorgetan, mit unglaublicher Schärfe, aber auch mit gründlichster Gelehrsamkeit angegriffen. Auch die Untersuchung: »Wie die Alten den Tod gebildet« (Berl. 1769) ging aus den Klotzschen Händeln hervor. Kurz vor seiner Abreise von Hamburg hatte L. dann noch die Freude, dort mit Herder zusammenzutreffen.
In Wolfenbüttel, wo L. sein Amt im Frühjahr 1770 antrat, begann er eine Reihe von Veröffentlichungen aus den handschriftlichen Schätzen der Bibliothek, von denen die Schrift über »Berengarius Turonensis« (Braunschw. 1770) den Anfang machte, während sich die Abhandlungen und Fragmente »Zur Geschichte und Literatur« (das. 1773–81, 6 Bde.) über eine Reihe von Jahren erstreckten. Wie wertvoll einzelne dieser Publikationen auch sein mochten, so war es für die deutsche Literatur wichtiger, daß L. gleich in der ersten Zeit nach seiner Niederlassung in Wolfenbüttel ein poetisches Meisterwerk wie seine Tragödie »Emilia Galotti« (Berl. 1772) vollendete, deren Anfänge ins Jahr 1757 zurückreichen. Hier erscheint die Charakterzeichnung, die packende Lebenswahrheit, die epigrammatische Knappheit der Sprache auf gleicher Höhe wie in »Minna von Barnhelm«, die Diktion ist sogar geistreicher und gedankenhaltiger als in irgend einer andern Dichtung Lessings; dagegen wird gegen die tragische Lösung der Verwickelung jederzeit ein gewisser Einwand der Logik und Empfindung übrigbleiben, was die Wahrheit der Goetheschen Worte nicht aufhebt, daß in diesem Drama eine ungeheure Kultur enthalten sei. Auch ließ L. damals den ersten Band einer neuen Sammlung seiner »Vermischten Schriften« erscheinen (1771), der außer kleinern Gedichten auch eine eindringende und scharfsinnige Abhandlung über das Epigramm enthält. Leider gestalteten sich die Lebensverhältnisse Lessings nicht danach, ihm Lust und Mut zum poetischen Schaffen zu erhöhen. Er hatte das Amt in dem »stillen Winkel« Wolfenbüttel mit deshalb übernommen, weil er, wie es scheint zum erstenmal im Leben, den starken Wunsch empfand, sich zu vermählen. Die Witwe eines ihm befreundeten Hamburger Kaufmanns, die geistesklare, willenskräftige Eva König (geb. 22. März 1736 in Heidelberg), wurde seine Verlobte. Da sie aber das ausgebreitete Geschäft ihres verstorbenen Gatten zu leiten und zu liquidieren hatte, um ihren Kindern einen Teil ihres Vermögens zu retten, und sich die Entscheidung dieser Dinge jahrelang hinzog, da inzwischen auch er mit mancherlei Mißhelligkeiten zu kämpfen hatte, so schlossen die Jahre zwischen 1771 und 1776 vielerlei bittere Erfahrungen und trübe Stimmungen für L. ein. Pläne, eine andre Stellung zu gewinnen, kamen über den ersten Entwurf nicht hinaus. Im Anfang 1775 riß sich L. für kurze Zeit von Wolfenbüttel los, ging über Dresden und Prag nach Wien, wo er seine Verlobte nach langer Trennung wiedersah. Die Aufnahme, die er in Wien in allen Kreisen und selbst bei der Kaiserin Maria Theresia fand, war durchaus ehrenvoll. Trotzdem sehnte er sich nach Wolfenbüttel zurück, weil sich die Aussichten für eine endliche Verbindung mit Eva König günstiger gestaltet hatten. So nahm er es mit geteilter Empfindung auf, daß ihn Prinz Leopold von Braunschweig aufforderte, als Reisegefährte mit ihm Italien zu besuchen. Er glaubte es seinem Verhältnis zum braunschweigischen Hof und seiner Zukunft schuldig zu sein, dem Verlangen des Prinzen zu willfahren. Die ursprünglich auf wenige Monate berechnete Reise, die sich bis nach Neapel und nach Korsika ausdehnte, und von der L. erst 23. Febr. 1776 in Braunschweig wieder eintraf, genoß er so unter eigentümlichen Umständen und, da die Korrespondenz mit Eva König völlig ins Stocken geriet, nur halb; tiefere Eindrücke der Reise auf sein geistiges Leben können nicht nachgewiesen werden. Nachdem er im Sommer 1776 eine mäßige Gehaltserhöhung und den Titel eines Hofrats erhalten, fand im Oktober d. J. auf dem York bei Hamburg seine Hochzeit statt. Ein friedvolles, glückliches Jahr (1777) war L. beschieden. Im Januar 1777 unternahm er eine Reise nach Mannheim, wo man ihm Hoffnungen auf eine Anstellung als Dramaturg gemacht hatte, die sich indessen nicht erfüllten. Am 10. Jan. 1778 starb Eva L. infolge der Geburt eines Sohnes, der nur wenige Stunden am Leben geblieben war. In tiefster Erschütterung sah sich L. wiederum und tiefer als zuvor vereinsamt. Noch in dem Jahre des Verlustes seiner Frau ward er in neue härtere und erbittertere Streitigkeiten als je zuvor verwickelt. In seinen Publikationen aus den handschriftlichen Schätzen der Bibliothek zu Wolfenbüttel hatte er schon 1774 ein Bruchstück: »Von Duldung der Deisten, Fragment eines Ungenannten«, mitgeteilt, dem er 1777 und 1778 weitere »Fragmente« (die Offenbarung, die Geschichte der Auferstehung etc. betreffend) folgen ließ. Verfasser des Manuskripts war der 1768 verstorbene Gymnasiallehrer Sam. Hermann Reimarus (s. d.) in Hamburg, ein rationalistischer Deist nach dem Muster der englischen und französischen Deisten und Freidenker des 18. Jahrh. L., der auch in andern den Drang zur Wahrheit am höchsten achtete, stimmte keineswegs mit den Anschauungen des Fragmentisten unbedingt überein. Als indes die unduldsamen Zionswächter der alten Orthodoxie begannen, die Beschuldigung gegen ihn zu schleudern, daß er »feindselige Angriffe gegen unsre allerheiligste Religion« verfaßt und unter seinen Schutz genommen, als namentlich der Hamburger Hauptpastor Johann Melchior Goeze (s. d.) gegen L. zu polemisieren begann, nahm dieser den hingeworfenen Fehdehandschuh auf und verfocht das Recht der Skepsis gegenüber dem geistlosen Buchstabenglauben, pfäffischer Verdammungssucht und hochmütigem Dünkel. Die Streitschriften Lessings: »Nötige Antwort auf eine sehr unnötige Frage«, »Axiomata«, »Anti-Goeze« (sämtlich Braunschw. 1778), ausgezeichnet durch Schärfe der Logik, hinreißende Beredsamkeit und unvergleichlichen Reiz des Stiles, überlebten den Kampf und seinen Anlaß. Am Ende wurde L., da er nicht zu besiegen war, durch Denunziationen bei seiner Regierung zum Schweigen gebracht und so genötigt, »seine alte Kanzel, das Theater« noch einmal zu besteigen, um ein letztes Work zu gunsten der Toleranz und des Humanitätsgedankens zu sprechen. Auf Subskription ließ er die Dichtung »Nathan der Weise« (o. O. 1779) erscheinen. Hier kehrte L. zur Form der gebundenen Rede zurück und wählte die Form des fünffüßigen Jambus, die er bis dahin nur in unvollendet gebliebenen Entwürfen (»Kleonnis«, »Fatime«) verwendet hatte. Dies Drama hat seine Stärke nicht in der straffen Schürzung und Lösung der Handlung. sondern neben der meisterhaften, psychologisch tiefen Charakteristik wirkt das Pathos edelster Gesinnung und reinster Überzeugung mit unwiderstehlicher Gewalt. Der »Nathan« war Lessings letzte große dichterische Tat. Im nächsten Jahr veröffentlichte er noch die Schrift »Die Erziehung des Menschengeschlechts« (Berl. 1780; vgl. Knittel, G. E. Lessings »Erziehung des Menschengeschlechts«, Vened. 1893) und vollendete »Ernst und Falk, Gespräche für Freimaurer« (Wolfenb. 1778–80), in beiden die Hauptideen wiederum darlegend, die ihn in den letzten Jahren erfüllt und bewegt hatten. Seine physische Kraft war seit dem Tode seiner Gattin gebrochen, flackerte bei einzelnen Ausflügen nach Hamburg und Braunschweig gleichsam nur wieder auf. Bei einem Besuch in Braunschweig erkrankte und starb er 15. Febr. 1781. Den ersten Nachruf, der seinem ganzen Verdienst gerecht wurde, widmete ihm Herder in Wielands »Merkur«.
Lessings Persönlichkeit gehört zu denen, die lebendig und fruchtbar nachwirkend im Bewußtsein ihres Volkes bleiben. Sein Streben und Schaffen ist für die Entwickelung des geistigen Lebens der Deutschen, ja man darf sagen aller heutigen Kulturvölker, von unermeßlichem Einfluß gewesen. Sein poetisches Talent bewährte sich ganz überwiegend auf dem dramatischen Gebiet. Lessings lyrische Gedichte stammen zum größten Teil aus seinen Jünglingsjahren und stehen hinter den besten Leistungen seiner Zeitgenossen zurück. Unter seinen sämtlichen kleinen Reimereien hat nur das Lied: »Gestern, Brüder, könnt ihr's glauben« sich im Gedächtnis der Nachkommen erhalten. Lehrhafter Scherz und lehrhafter Ernst sind neben der Präzision und Reinheit des Ausdrucks das Beste, was wir in seinen oft epigrammatisch zugespitzten lyrischen Erzeugnissen antreffen. Höher stehen seine Fabeln, obwohl auch bei ihnen seine der Weitschweifigkeit und behaglichen Breite von damals bewußt entgegengesetzte Knappheit und Kürze das Hauptverdienst ist. Auch seine Epigramme, die sich meist an überlieferte Motive anlehnen, überragen die bessern gleichzeitigen nur in einzelnen schärfern Pointen. Die poetische Produktion auoll bei L. nicht unmittelbar aus dem Gefühl. Er selbst hat bekanntlich in einer viel erörterten Stelle der »Dramaturgie« sich das dichterische Genie abgesprochen. »Ich fühle«, sagt er dort, »die lebendige Quelle nicht in mir, die durch eigne Kraft sich emporarbeitet, durch eigne Kraft in so reichen, so frischen, so reinen Strahlen aufschießt: ich muß alles durch Druckwerk und Röhren aus mir herauspressen.« Doch ist zu erwägen, daß L. sich hier wie anderwärts in absichtlich schroffen Gegensatz gegen das neue Geniewesen stellt, das bald darauf in der Sturm- und Drangperiode zur Herrschaft gelangte und die messende und abwägende Tätigkeit des poetischen Künstlers geringschätzte. Größere, ja unvergängliche Verdienste hat sich L. auf dem Felde der poetischen Theorie und Kritik erworben. Seiner reformatorischen Tätigkeit in der Literatur steht die in der Theologie bedeutsam zur Seite. Schon die Wittenberger »Rettungen« zeigen L. bemüht, die Freiheit prüfender Forschung in Glaubenssachen als heiliges Recht der Menschheit zu vindizieren. Der weitere Entwickelungsgang Lessings, den wir an der Hand einiger, erst nach seinem Tode veröffentlichter Aufsätze, wie »Gedanken über die Herrenhuter« und »Christentum der Vernunft«, verfolgen können, mußte ihn von jenem Punkt aus notwendig zum Bruch mit der Offenbarung führen. Immer mehr lernte er den Wahn, daß die echte Religiosität ohne kirchliche Orthodoxie unmöglich sei, vom Standpunkt der Logik und der Humanität aus als töricht und verderblich erkennen. Zu einer in sich einstimmigen und abgeschlossenen Weltanschauung hat er sich jedoch nicht durchgerungen; in der Hauptsache schloß er sich wie die meisten seiner Zeitgenossen an Leibniz an; in der letzten Zeit schenkte er auch Spinozas Philosophie größere Aufmerksamkeit. Aber die kritische Negation überwog durchaus bei L. Was seinen Schriften unvergänglichen Wert verleiht, ist nicht sowohl die Darlegung einer gefestigten philosophischen oder religiösen Überzeugung, als die vernichtende Abwehr aller den Menschengeist fesselnden Dogmatik. Anderseits war ihm die Geringschätzung des Kirchenglaubens durch Halbgebildete durchaus zuwider; er kannte die theologische Literatur zu gründlich, um nicht Achtung vor der darin aufgespeicherten Geistesarbeit zu hegen.
L. steht als der mannhafteste Charakter der deutschen Literaturgeschichte da; sein Leben ist ein fast ununterbrochener Kampf gewesen. Die gewaltige geistige Kraft, die ihn zu diesem befähigte, zeigte sich auch in seiner leiblichen Erscheinung ausgeprägt. Eine ungemeine Freundlichkeit und ein vollkommen anspruchsloses Wesen zeichneten ihn trotz seiner so entschiedenen Eigenartigkeit aus. Tiefe Abneigung gegen Unwahrhaftigkeit und Heuchelei, gegen alles leere Scheinwesen machte einen der hervorstechendsten Grundzüge seines Wesens aus. Nicht hoch genug wissen die Freunde seine Unterhaltungsgabe zu rühmen: sehr begreiflich, wenn man erwägt, mit welch wunderbarer Meisterschaft der Darstellung L. als Schriftsteller auch den trockensten Materien eine Anziehungskraft zu leihen verstand, die uns noch heute für Schriften und Bildwerke, die im übrigen längst verschollen sind, das lebendigste Interesse abgewinnt. Der Stil keines Schriftstellers ist so anregend wie der Lessings. Wir vernehmen in seinem Vortrag, nach Vilmars treffender Charakteristik, »ein geistreiches, belebtes Gespräch, in welchem gleichsam ein Gedanke auf den andern wartet, einer den andern hervorlockt, einer von dem andern abgelöst, durch den andern berichtigt, gefördert, entwickelt und vollendet wird; Gedanke folgt auf Gedanke, Zug um Zug, im heitersten Spiel und dennoch mit unbegreiflicher Gewalt auf uns eindringend, uns mit fortreißend, beredend, überzeugend, überwältigend«. – Unter den Bildnissen Lessings behaupten das angeblich von Tischbein gemalte (s. Tafel »Deutsche Klassiker des 18. Jahrhunderts«, beim Artikel »Klassiker«), wahrscheinlich aus der Breslauer Zeit herrührende (jetzt in der Berliner Nationalgalerie befindlich), das für Gleim angefertigte Halberstädter, dem Maler May zugeschriebene Porträt und das von A. Graff 1771 in Berlin gemalte den obersten Rang. Statuarisch verherrlichen ihn das bekannte Meisterwerk Rietschels in Braunschweig (seit 1853; s. Tafel »Bildhauerkunst XVI«, Fig. 4), die sitzende Statue von Schaper auf dem Gänsemarkt in Hamburg (seit 1880) und die Statue von Otto Lessing im Berliner Tiergarten (seit 1890; s. Tafel »Berliner Denkmäler II«, Fig. 4). In seiner Vaterstadt Kamenz wurde zu seinem Andenken 1826 das Lessing-Stift, ein Hospital für Bedürftige aller Konfessionen, gegründet.
[Ausgaben, Briefwechsel.]L. hat nach der ersten Sammlung seiner »Schriften« (1753–55, s. oben) keine Gesamtausgabe veranstaltet; die Ausgabe, deren erster Band 1771 erschien, wurde erst nach seinem Tode von seinem Bruder fortgesetzt (Berl. 1771–94, 30 Bde.); sodann (hrsg. von Schink, mit Biographie) daselbst 1825–26, 30 Bde.; später folgten die »Gesammelten Werke« (Leipz. 1841 u. ö.). Die erste philologisch korrekte Ausgabe der »Sämtlichen Schriften« war die von Lachmann (Berl. 1838–40, 13 Bde.; 2., verschlechterte Ausg. von W. v. Maltzahn, Leipz. 1853–57, 12 Bde.; 3., gute Ausg. von Muncker, das. 1886–1904, Bd. 1–17 und Bd. 19, auch die Briefe enthaltend). Wertvoll ist auch die Hempelsche Ausgabe, namentlich in den von Boxberger, Redlich und Schöne besorgten Teilen (Berl. 1868–79, 20 Tle.). Noch andre Ausgaben veranstalteten Gosche und Boxberger (illustriert, Berl. 1875–76, 8 Bde.), H. Göring (Stuttg. 1885, 20 Bde.), Muncker (das. 1886, 6 Bde.), Boxberger-Blümner (in Kürschners »Deutscher Nationalliteratur«, das. 1883 ff., 14 Bde.). Eine Auswahl, besorgt von F. Bornmüller, erschien in Meyers Klassikerausgaben (Leipz. 1884, 5 Bde.); eine Ausgabe der drei dramatischen Hauptdichtungen, mit Einleitung, von H. Hettner (das. 1869). Der Briefwechsel Lessings wurde gut von Redlich (in der Hempelschen Ausgabe; auch separat, Berl. 1884; Nachträge 1886) und von Muncker (in seiner großen Ausgabe der Werke, s. oben) veröffentlicht, der Briefwechsel zwischen L. und seiner Frau von Schöne (2. Aufl., Leipz. 1886) neu herausgegeben. Lessings »Übersetzungen aus dem Französischen Friedrichs des Großen und Voltaires« veröffentlichte E. Schmidt (Berl. 1892). Von Einzelausgaben und Erläuterungsschriften zu einzelnen Werken seien erwähnt: die »Abhandlungen über die Fabel«, hrsg. von Prosch, Wien 1890 (vgl. A. Fischer, Lessings Fabelabhandlungen, kritische Darstellung, Berl. 1891); »Laokoon«, herausgegeben von Cosack (4. Aufl., das. 1890), von Blümner (2. Aufl., das. 1880); »Hamburgische Dramaturgie«, herausgegeben von Schröter und Thiele (Halle 1877–78; Ausg. für Schule und Haus, das. 1895); vgl. Cosack, Materialien zu Lessings »Hamburgische Dramaturgie« (2. Aufl., Paderb. 1891); K. Werder, Über Lessings. Nathan' (Berl. 1892); F. Naumann, Literatur über Lessings ›Nathan‹ (Dresd. 1867).
[Biographische Literatur etc.]Die erste ausführliche Biographie Lessings schrieben Danzel u. Guhrauer: »L. Sein Leben und seine Werke« (Leipz. 1850–54, 2 Bde.; Danzels Anteil wertvoll, aber schwerfällig, Guhrauers von weit geringerer Bedeutung; 2. Aufl. von v. Maltzahn und Boxberger, Berl. 1880); das beste Werk ist Erich Schmidts »L., Geschichte seines Lebens und seiner Schriften« (das. 1884 bis 1892, 2 Bde.; 2. Aufl. 1899). Mehr populäre Haltung haben die Lessing-Biographien von A. Stahr (9. Aufl., Berl. 1886, 2 Bde.), Düntzer (Leipz. 1881, fast ausschließlich den äußern Lebenslauf darstellend), Baumgartner (Freib. 1877, ultramontan), Borinski (Berl. 1900), Ernst (Stuttg. 1903), Kiy (Halle 1904) und die unnötigerweise auch in deutscher Sprache bearbeiteten englischen von Sime (Lond. 1877; deutsch von Strodtmann, Berl. 1879) und Helen Zimmern (Lond. 1878; deutsch, Celle 1878). Aus der übrigen Literatur über L. sind noch folgende Schriften hervorzuheben: Fr. Schlegel, Lessings Geist aus seinen Schriften (Leipz. 1804, 3 Bde.); Kuno Fischer, L. als Reformator der deutschen Literatur (Stuttg. 1881, 2 Bde.; 4. Aufl. 1896); Cherbuliez, Etudes de littérature et d'art (Par. 1873); Grucker,Histoire des doctrines littéraires et esthétiquesen Allemagne, Bd. 2: Lessing (Nancy 1896); über Lessings Philosophie und Weltanschauung: Hebler, Lessing-Studien (Bern 1862); R. Mayr, Beiträge zur Beurteilung Lessings (Wien 1880); Ritter, Lessings philosophische und religiöse Grundsätze (Götting. 1847); Rehorn, Lessings Stellung zur Philosophie des Spinoza (Frankf. 1877); Spicker, Lessings Weltanschauung (Leipz. 1883); Wundt, L. und die kritische Methode (in den »Essays«, das. 1885); über Lessings Theologie: K. Schwarz, L. als Theologe (Halle 1854); Bergmann, Hermäa (Leipz. 1883); Reinkens, L. über Toleranz (das. 1883); Dühring, Die Überschätzung Lessings und dessen Anwaltschaft für die Juden (Karlsr. 1881); Nieten, Lessings religionsphilosophische Anschauungen bis zum Jahre 1770 (Dresd. 1896); Sell, Die Religion unsrer Klassiker (Tüb. 1904); ferner: Kont, L. archéologue (Par. 1894); Gottschlich, Lessings aristotelische Studien (Berl. 1876); Crouslé, L. et le goût françaisen Allemagne (Par. 1863); Belling, Die Metrik Lessings (Berl. 1887); Düsel, Der dramatische Monolog in der Poetik des 17. und 18. Jahrhunderts und in den Dramen Lessings (Hamb. 1897); Bulthaupt, Dramaturgie des Schauspiels, Bd. 1 (10. Aufl., Oldenb. 1904); Kettner, Lessings Dramen im Lichte ihrer und unsrer Zeit (Berl. 1904); Saitschick, Genie und Charakter. Shakespeare, L., Schopenhauer, R. Wagner (das. 1900); Kalischer, L. als Musikästhetiker (Dresd. 1889); Mönckeberg, L. als Freimaurer (Hamb. 1880); P. Albrecht, Lessings Plagiate (das. 1891 ff., unvollendet); B. A. Wagner, Lessingforschungen (Berl. 1881, Untersuchungen über anonym Erschienenes aus Lessings Jugendzeit); E. Consentius, Der Wahrsager. Zur Charakteristik von L. und Mylius (Leipz. 1900), L. und die Vossische Zeitung (das. 1902) und Freigeister, Naturalisten, Atheisten. Ein Aufsatz Lessings im »Wahrsager« (das. 1899); Braun, L. im Urteile seiner Zeitgenossen (Berl. 1884–97, 3 Bde.).
Lessings jüngerer Bruder, Karl Gotthelf, geb. 1740 in Kamenz, gest. 17. Febr. 1812 als Münzdirektor in Breslau, verfaßte eine Biographie seines Bruders Gotthold (1793) und einige dramatische Dichtungen, z. B.: »Der stumme Plauderer«, »Die Mätresse« (Neudruck, Heilbr. 1887) u.a., die gesammelt als »Schauspiele« (Berl. 1777–80, 2 Bde.) erschienen. Von H. L. Wagners »Kindermörderin« veranstaltete er eine eigenmächtige Umarbeitung. Vgl. Wolff, Karl Gotthelf L. (Berl. 1886). – Ein andrer Bruder, Theophilus, mit dem L. in Wittenberg zusammen studierte, geb. 12. Nov. 1732, seit 1778 Konrektor in Chemnitz, gest. 6. Okt. 1808, erwarb sich einigen Ruf als lateinischer Dichter. Vgl. Kirchner, Theophilus L. und das Chemnitzer Lyzeum (Chemn. 1882).
Briefe, die neueste Literatur betreffend
Erster Teil
1759
Einleitung
Der Herr von N.** ein verdienter Officier, und zugleich ein Mann von Geschmack und Gelehrsamkeit, ward in der Schlacht bei Zorndorf verwundet. Er ward nach Fr** gebracht, und seine Wundärzte empfohlen ihm nichts eifriger, als Ruhe und Geduld. Langeweile und ein gewisser militärischer Ekel vor politischen Neuigkeiten, trieben ihn, bei den ungern verlassenen Musen eine angenehmere Beschäftigung zu suchen. Er schrieb an einige von seinen Freunden in B** und ersuchte sie, ihm die Lücke, welche der Krieg in seine Kenntnis der neuesten Literatur gemacht, ausfüllen zu helfen. Da sie ihm unter keinem Vorwande diese Gefälligkeit abschlagen konnten, so trugen sie es dem Herrn Fll. auf, sich der Ausführung vornehmlich zu unterziehen.
Wie mir, dem Herausgeber, die Briefe, welche daraus entstanden, in die Hände geraten, kann dem Publico zu wissen oder nicht zu wissen, sehr gleichgültig sein. Ich teile sie ihm mit, weil ich glaube, daß sie manchem sowohl von dem schreibenden, als lesenden Teile der sogenannten Gelehrten, nützlich sein können.
Ihre Anzahl ist bereits beträchtlich, ob sie gleich ihren Anfang nur vor drei oder vier Monaten können gehabt haben. Sie werden auch hoffentlich bis zur Wiederherstellung des Herrn von N.** fortgesetzt werden.
Ich habe völlige Gewalt sie drucken zu lassen, wie und wenn ich will. Der Verleger meinte, daß es am füglichsten wöchentlich geschehen könnte; und ich lasse ihm seinen Willen.
O.
I. Den 4 Jenner 1759
Erster Brief
Etwas werden Sie freilich nachzuholen haben; aber nicht viel. Die zwei gefährlichen mühsamen Jahre, die Sie der Ehre, dem Könige und dem Vaterlande aufopfern müssen, sind reich genug an Wundern, nur nicht an gelehrten Wundern gewesen. Gegen hundert Namen, – und hundert sind noch zu wenig – die alle erst in diesem Kriege als Namen verdienstvoller Helden bekannt geworden; gegen tausend kühne Taten, die vor Ihren Augen geschahen, an welchen Sie Teil hatten, die zu Quellen der unerwartesten Veränderungen wurden, – kann ich Ihnen auch nicht ein einziges neues Genie nennen, kann ich Ihnen nur sehr wenige Werke schon bekannter Verfasser anführen, die mit jenen Taten der Nachwelt aufgehalten zu werden verdienten.
Es gilt dieses von uns Deutschen vor allen andern. Zwar hat der Krieg seine blutigste Bühne unter uns aufgeschlagen, und es ist eine alte Klage, daß das allzunahe Geräusch der Waffen, die Musen verscheucht. Verscheucht es sie nun aus einem Lande, wo sie nicht recht viele, recht feurige Freunde haben, wo sie ohnedem nicht die beste Aufnahme erhielten, so können sie auf eine sehr lange Zeit verscheucht bleiben. Der Friede wird ohne sie wieder kommen; ein trauriger Friede, von dem einzigen melancholischen Vergnügen begleitet, über verlorene Güter zu weinen.
Ich rufe Ihre Blicke aus dieser finstern Aussicht zurück. Man muß einem Soldaten sein unentbehrliches Geschäft durch die bejammernswürdigen Folgen desselben nicht verleiden.
Lieber will ich Sie und mich mit dem süßen Traume unterhalten, daß in unsern gesittetern Zeiten der Krieg nichts als ein blutiger Prozeß unter unabhängigen Häuptern ist, der alle übrige Stände ungestöret läßt, und auf die Wissenschaften weiter keinen Einfluß hat, als daß er neue Xenophons, neue Polybe erwecket. Lieber will ich für Sie auch die leichtesten Spuren der unter uns noch wandelnden Musen aufsuchen, und ihnen bis in die glücklichern Reiche nachspüren, aus welchen sie, nicht längst, einen kürzern Weg zu uns gefunden zu haben scheinen.
Die Umstände, unter welchen Sie diese Arbeit von mir verlangen, machen sie mir zu einem Vergnügen, auf welches ich stolz zu sein Ursache habe. Kann sich derjenige weigern, Ihre Schmerzen durch kleine Zerstreuungen zu lindern, der Sie gern mit Ihnen geteilt hätte? etc.
Fll.
Zweiter Brief
Wenigstens ist die Gelehrsamkeit, als ein Gewerbe, unter uns in noch ganz leidlichem Gange. Die Meßverzeichnisse sind nicht viel kleiner geworden; und unsere Übersetzer arbeiten noch frisch von der Faust weg.
Was haben sie nicht schon alles übersetzt, und was werden sie nicht noch übersetzen! Eben itzt habe ich einen vor mir, der sich an einen englischen Dichter – raten Sie einmal an welchen! – gemacht hat. O Sie können es doch nicht erraten! – An Popen.1
Und in Prosa hat er ihn übersetzt. Einen Dichter, dessen großes, ich will nicht sagen größtes, Verdienst in dem war, was wir das Mechanische der Poesie nennen; dessen ganze Mühe dahin ging, den reichsten, triftigsten Sinn in die wenigsten, wohlklingendsten Worte zu legen; dem der Reim keine Kleinigkeit war – einen solchen Dichter in Prosa zu übersetzen, heißt ihn ärger entstellen, als man den Euklides entstellen würde, wenn man ihn in Verse übersetzte.
Es war auch ein bloßer Buchhändlereinfall; wie der Übersetzer selbst gestehet. Und was geht es diesem an, womit jener ihn Geld verdienen läßt, und selbst Geld zu verdienen denket? Freilich sollte so ein blindlingsgefälliges Werkzeug eine bescheidenere Sprache führen, als unser Übersetzer des Pope führet. Er sollte nicht sagen: »Ich habe mir eingebildet, meinen Dichter völlig zu verstehen, und mich darauf verlassen, daß meine eigene kleine Dichtergabe, so geringe sie auch sein mag, mir zu Hülfe kommen würde, das Verstandene so auszudrücken, daß der Schwung und die Deutlichkeit nicht zu viel verlören-«
Denn je größer er sich selbst macht, desto unbarmherziger wird ihm der Leser sein törichtes Unternehmen aufmutzen, desto höhnischer wird er ihm jeden Fehler vorwerfen, der seinem Eigenlobe widerspricht. Z.E.
Pope will die Nachahmung der Alten rechtfertigen. Man verlangt, sagt er, und erwartet von einem Dichter, daß er ein gelehrter, und in den Werken der Alten belesener Mann (a Scholar) sei; und ist gleichwohl unwillig, wenn man findet, daß er wirklich so ein Mann ist – Was meinen Sie wohl, daß aus dieser feinen Anmerkung unter der Feder des Übersetzers geworden ist? Er hat Scholar, als ein wahrer Schüler, durch Schüler übersetzt und sagt: »2In der Tat ist es sehr unbillig, daß man aus uns Schüler haben will, und dennoch unwillig wird, wenn man uns als Schüler befindet.«
Pope vergleicht den Virgil mit seinem Muster, dem Theokrit. Der Römer, sagt er, übertrifft den Griechen an Regelmäßigkeit und Kürze, und ist ihm in nichts nachzusetzen, als in der Einfalt des eigentümlichen Ausdrucks (simplicity and propriety of style). Pope meinet, daß der Stil in den Virgilischen Eklogen uneigentlicher, verblümter sei, als in den Theokritischen; und der Vorwurf ist nicht ohne Grund. Allein wie ihn der Übersetzer ausdrückt, ist er es gänzlich. Er gibt nämlich Propriety durch Richtigkeit; und welcher Schriftsteller, selbst keiner von den alten ausgenommen, ist dem Virgil in der Richtigkeit des Stils (Correctness) vorzuziehen?3
Pope erzählt die Geschichte seiner Autorschaft. Ich schrieb, sagt er, weil es mich angenehm beschäftigte; ich verbesserte, weil mir das Verbessern eben so viel Vergnügen machte, als das Schreiben; ich ließ drucken, weil man mir schmeichelte, daß ich Leuten gefallen könnte, deren Beifall einen guten Namen4 verschaffte. – Der Übersetzer aber läßt ihn sagen: »daß ich denen gefallen könnte, denen ich zu gefallen wünschte.«
Virgil, der sich den Theokrit zum Muster vorgestellt – sagt Pope, und der Übersetzer: Virgil der den Theokrit ausschreibt.
Dieses sind noch lange nicht alle Fehler, aus der bloßen Vorrede und Abhandlung von der Schäferpoesie, aus den ersten und leichtesten, nämlich prosaischen, Stücken des ersten Bandes.5 Urteilen Sie, wie es tiefer herein aussehen mag.
Was der Übersetzer zur Entschuldigung seiner oft undeutschen Wortfügungen anführt; wie er sich in dieser Entschuldigung verwirrt und sich unvermerkt selbst tadelt, ist auf der 17ten Seite des Vorberichts lustig zu lesen. Er verlangt, daß man, ihn zu verstehen, die Kunst zu lesen besitze. Aber da diese Kunst so gemein nicht ist; so hätte er die Kunst zu schreiben verstehen sollen. Und wehe der armen Kunst zu lesen, wenn ihr vornehmstes Geschäft sein muß, den Wortverstand deutlich zu machen! etc.
Fll.
Dritter Brief
Wollen Sie einen andern kennen lernen, dessen guter Wille uns nun schon den zweiten englischen Dichter verdorben hat? – Verdorben klingt hart; aber halten Sie immer dem Unwillen eines getäuschten Lesers ein hartes Wort zu gute.
Von des Herrn von Palthen Übersetzung der Thomsonschen Jahrszeiten werden Ihnen frühere Urteile zu Gesichte gekommen sein. Nur ein Wort von seinen Fabeln des Gay.6
Ein guter Fabeldichter ist Gay überhaupt nicht, wenn man seine Fabeln nämlich nach den Regeln beurteilet, welche die Kunstrichter aus den besten Fabeln des Äsopus abstrahieret haben. Bloß seine starke Moral, seine feine Satyre, seine übrigen poetischen Talente machen ihn, trotz jenen Regeln, zu einem guten Schriftsteller.
Schade um so viel mehr, daß so manche feine Satyre dem Übersetzer unter der Arbeit verflogen ist! Und es muß eine sehr eilfertige Arbeit gewesen sein! Sehr oft hat er sich auch nicht die Zeit genommen, die Worte seines Originals recht anzusehen. Wenn Gay sagt:
The Miser trembling lock'd his chest;
(der Geizhals verschloß zitternd seinen Kasten)so sieht er lock'd für loock'd an, und übersetzt: Der Geizhals blickte zitternd auf seinen Kasten.7
Das englische Chamäleon rühmt sich, es habe eines jeden Höflings Leidenschaft zu treffen gewußt:
I knew to hit each courtier's passion,
Und das deutsche sagt: ich vermied eines jeden Höflings Leidenschaft zu berühren. Dieses folglich ist kaum halb so geschickt als jenes. Verstehen etwa die deutschen Schmeichler ihr Handwerk weniger, als die Schmeichler einer andern Nation?8
Gay beschreibt ein unglückliches Ehepaar. Er der Mann, sagt er,9 liebt das Befehlen; und die Frau das Widersprechen. Sich sklavisch zu unterwerfen, ist durchaus nicht ihre Sache. Sie will ihren Willen haben, oder will ihre Zufälle bekommen. –
She 'll have her will, or have her fits.
Der letzte Zug ist ungemein fein, und eine richtige Bemerkung. Sie werden krank, die lieben eigensinnigen Weiberchen, wenn man nicht tut, was sie haben wollen. – Nun sehen Sie, was der Herr von Palthen daraus macht: »Sie will entweder ihren Willen haben, oder auch umwechselnd die Herrschaft führen.« – O dreimal Glücklicher, dessen Gattin sich mit dem letztern begnügt!
Die kleinsten Partikeln werden oft unserm Übersetzer zum Anstoß. – Doch es muß Sie in die Länge verdrießen, daß ich mich mit solchen Kleinigkeiten aufhalte.
Lernen Sie nur noch aus einem einzigen Exempel, wie weit die Unverschämtheit der gelehrten Tagelöhner unter uns, geht. Ein gewisser C. G. Bergmann hat Bolingbroks Briefe über die Erlernung und den Gebrauch der Geschichte übersetzt,10 und er ist es, von dem man sagen kann, daß er alles, was die Welt noch bis itzt von elenden Übersetzern gesehen hat, unendlich weit zurück lässet. – Ich muß den Beweis versparen. Er fordert mehr Raum als mir übrig ist.
Fll.
II. Den 11. Jenner 1759
Vierter Brief
Unsere Übersetzer verstehen selten die Sprache; sie wollen sie erst verstehen lernen; sie übersetzen sich zu üben, und sind klug genug, sich ihre Übungen bezahlen zu lassen. Am wenigsten aber sind sie vermögend, ihrem Originale nachzudenken. Denn wären sie hierzu nicht ganz unfähig, so würden sie es fast immer, aus der Folge der Gedanken abnehmen können, wo sie jene mangelhafte Kenntnis der Sprache zu Fehlern verleitet hat. Wenigstens geschieht es durch diese etwanige Fähigkeit, daß ihr Leser oft mehrere als nur die gröbsten bemerkt; und die folgenden des Herrn Bergmanns sind gewiß nicht, erst durch die ängstliche Zusammenhaltung des Originals, entdeckt worden.
Bolingbroke, wenn er von Männern, die zwar selbst durch ihre Studien weder weiser noch besser werden, andere aber in den Stand setzen, mit mehr Bequemlichkeit und in nützlichern Absichten zu studieren, von den Herausgebern verlegener Handschriften, den Wortforschern u.s.w. redet, gedenkt mit Beifall eines Gelehrten, den man einst in der Kirche, in seiner Kapelle, unter der stückweisen Erwägung göttlicher Wohltaten, dergleichen bei frommen Leuten nicht ungewöhnlich ist, Gott auch dafür danken gehört, daß er die Welt mit Lexikonsmachern versehen habe. – Vergleichen Sie nunmehr dieses11 mit folgender Übersetzung: »Ich billige daher die Andacht eines gelehrten Mannes aus der christlichen Kirche gar sehr, der in seiner Kapelle vergessen hatte, sich mit Gott zu beschäftigen, wie es bei andächtigen Personen gar nichts unerhörtes ist, und der unter andern besondern Danksagungen, wodurch er sich gegen die Gütigkeit Gottes erkenntlich bezeigte, der Welt Wörterbüchermacher verschaffte.« – – So viel Zeilen, so viel unverzeihliche Fehler.
Bolingbroke fährt in seiner philosophischen Laune fort: Diese Leute wollen eben so gern berühmt sein, als andere von größeren Talenten, und wenden die Mittel dazu an, so gut sie ihnen Gott verliehen hat etc. Sie verdienen Aufmunterung, so lange sie nur bloß zusammentragen, und weder dabei witzig sein, noch vernünfteln wollen.12 – Und Bergmann fährt fort, zu verhunzen: »Diese Leute erwerben sich Ruhm so wohl als solche, die höher sind als sie, durch diejenigen Mittel, so ihnen Gott gegeben hat, denselben zu erlangen etc. Sie verdienen aber dennoch Aufmunterung, weil sie beständig zusammen tragen, und weder auf Witz noch Vernunft Anspruch machen.«
Bolingbroke vergleicht die Systeme der alten Zeitrechnung und Geschichte mit bezauberten Schlössern. Sie scheinen, sagt er, etwas zu sein, und sind nichts als Phantome; löse die Bezauberung auf, (dissolve the charm) und sie verschwinden aus dem Gesicht, wie jene. – Hat ihn Bergmann verstanden? »Alle diese Systeme, läßt er ihn sagen, sind so viele bezauberte Schlösser; sie erscheinen als etwas, und sind nichts als Erscheinungen. Ihre Reize fliegen gleich diesen auseinander, und verschwinden aus unserm Gesichte.« –
O Bergmann ist ein ganz anderer Zauberer! Jene Stümper lassen verschwinden, was bloß da zu sein schien. Bergmann macht sein hocus pocus, und alle Gedanken, alle Einfälle, die wirklich da waren, sind weg! Ohne alle Spur, weg!
Das allertollste aber ist dieses, daß er – – (wie soll ich mich gleich rund genug ausdrucken? Ich will, mit Ihrer Erlaubnis, einen Ausdruck aus dem Hudibras borgen) daß er seinem Autor die Krätze gibt, um ihn reiben zu können. Das ist: er versteht ihn unrecht, und straft ihn in gelehrten Anmerkungen, wegen einer Ungereimtheit, die er selbst in ihn gelegt hat. Hören Sie nur!
Bolingbroke redet in seinem dritten Briefe von der Bibel, als eine Quelle der Geschichte betrachtet. Er kömmt auf die sogenannte Übersetzung der siebenzig Dolmetscher, und sagt: Die hellenistischen Juden erzählten von dieser Übersetzung, um sie in Ansehen zu bringen, ja gar zu heiligen, eben so viel wunderbare Dinge, als die andern Juden von dem Esra, welcher den Kanon ihrer Schriften zu machen anfing, und von Simon dem Gerechten erzählt hatten, welcher diesen Kanon zu Ende brachte. Diese heiligen Romane, fährt Bolingbroke fort, wurden zur Tradition, und die Tradition ward zur Geschichte; die Väter unserer christlichen Kirche ließen es sich nicht zuwider sein, Gebrauch davon zu machen. Der heil. Hieronymus etc. etc. Diese heiligen Romane? Was nennt Bolingbroke so? Was sonst, als die frommen Märchen, deren er gleich vorher gedenkt?
Und doch will sein elender Übersetzer, daß er unter diesen Romanen die heiligen Bücher selbst, und nicht die jüdischen Fabeln von ihrer Erhaltung, und ihrer Verdolmetschung verstehe. »Hier sieht man, ruft er lächerlich aus, die Folgerung des Verfassers! Er hatte vorher ganz und gar nicht beweisen können, daß die biblischen Bücher nicht schon da gewesen wären, oder daß sie verfälscht worden, izt aber nennt er sie heilige Romanen, ohne uns zu sagen, wodurch sie sich in Romanen hätten verwandeln können etc.«
Possen! Wir wissen es freilich, daß Bolingbroke oft ziemlich cavalierement von der Bibel spricht; aber hier tut er es doch nicht. Der Herr verspare wenigstens sein Collegium auf eine andere Stelle.
Und nun sagen Sie mir, ist das deutsche Publikum nicht zu betauern? Ein Bolingbroke fällt unter die Hände seiner Knaben; sie schreien Kahlkopf über ihn, die Kahlkinne! Will denn kein Bär hervor kommen, und diese Buben würgen?
Bergmann muß nicht allein das Englische nicht wissen; er muß gar nichts wissen. Wenn Bolingbroke sagt: die Chronologie ist eine von den Wissenschaften, welche bloß a limine salutandae sind; so macht jener daraus: »welche man schon von weiten empfangen muß.« Wenn Bolingbroke von dem Kanon des Marshams redet, redet jener von Marshams Sätzen, und muß nicht wissen, daß das Buch dieses Gelehrten hier gemeinet wird, welches den Titel Canon chronologicus führt. Wenn Bolingbroke von dem Kanon der heiligen Bücher spricht, macht jener die Ordnung der heiligen Bücher daraus. Ich möchte wissen, was Herr Bergmann studierte? Ob die Theologie?
Schade, daß sich die gelehrte Welt des weltlichen Arms noch weniger bedienen darf, als die Kirche! Wäre es sonst nicht billig, daß man die Handlung, welche diese jämmerliche Übersetzung drucken lassen, mit Gewalt anhielte, uns eine bessere zu liefern, und jene ins Makulatur zu werfen? Sie müßte sich des Schadens wegen an den Übersetzer halten können.
Fll.
Fünfter Brief
Der Übersetzer des Gay hat sich zu gleicher Zeit auch als Verfasser gezeigt, und »Versuche zu vergnügen«,13 herausgegeben.
Ich denke so: mir nützlich zu sein, möchte man so oft und viel versuchen, als man nur immer wollte; wenn ich nur die Versuche mich zu vergnügen verbitten könnte. Laßt uns lieber den wilden Bart tragen, ehe wir zugeben, daß die Lehrlinge der Barbierstuben an uns lernen!
Der »Lenz« des Herr von Palthen scheinet eine Sammlung von alle dem zu sein, was er bei Übersetzung des Thomsonschen Frühlings, schlechteres gedacht hat; eine Sammlung von Zügen und Bildern, die Thomson und Kleist, und selbst Zachariä verschmähet haben. Er malt Mücken,14 und der Himmel gebe, daß uns nun bald auch jemand Mückenfüße male! Doch nicht genug, daß er seine Gegenstände so klein wählt; er scheint auch eine eigene Lust an schmutzigen und ekeln zu haben. – Die aufgeschürzte Bauermagd mit Blutdurchströmeten Wangen, und derben sich zeigenden Waden, wie sie am abgespannten Leiterwagen stehet, mit zackigter Gabel den Mist darauf zu schlagen. – Der erhitzte brüllende Stier, mit der breiten Brust, und dem bucklichten Rücken, der die ihm nicht stehende Geliebte verfolgt, bis er endlich mit einem gewaltigen Sprunge über sie herstürzt und unwiderstehlich sie hält. – Der Ackersmann, der sein schmutziges Tuch löset, woraus er schmierigen Speck und schwarzes Brod hervor ziehet. – Die grunzende Sau, mit den fleckigten saubern Ferkeln. – Der feurige Schmatz einer Galathee. – – Zu viel, zu viel Ingredienzen für ein Vomitiv! Hier ist eine Herzstärkung! Ein Projekt zu einem immerwährenden Frieden! »Aber keine Herzstärkung für mich; werden Sie sagen. Der Mann will mir das Handwerk legen!« – Ach nicht doch! Er meint es so böse nicht. Sein Haupteinfall ist diesen ein allgemeines Parlament oder Tribunal zu errichten, dessen Ausspruch sich alle europäische Staaten gefallen ließen. – Merken Sie nun, daß der Herr von Palthen ein Rechtsgelehrter ist? Aber, als jener alte Offizier seinen Vorschlag zur Verkürzung der Prozesse tat, und die alten gerichtlichen Duelle wieder einzuführen riet, nicht wahr, da verriet sich der Offizier auch? – Doch dieses bei Seite! Wenn sich nun unter den europäischen Mächten Halsstarrige fänden, die dem Urteile des Tribunals Genüge zu leisten sich weigerten? Wie da? O der Herr von Palthen hat vollstreckende Völker, er hat militarische Exekution. Hat er die? Nun wohl, so hat er Krieg; und Sie sollen Zeit genug weiter avancieren. Werden Sie nur bald gesund!
Was soll ich Ihnen von seinen drei ersten Oden des Horaz sagen? Gleich vom Anfange heißt es:
Und wenn ihr Wagen ohne Fehl
Mit heißer Achs zum Ziel gelanget.
Metaque fervidis evitata rotis. Das Ziel zu erreichen, war das wenigste. Sie mußten um das Ziel herum! – Lassen Sie uns nicht weiter lesen.
Und wie oft zeiget der Herr von Palthen, ich weiß nicht, welche eingeschränkte Kenntnisse! – – Petrarch sagt von sich:15 »Ich habe nie an Schmausen ein Vergnügen gefunden, sondern habe bei mäßiger Kost und gewöhnlichen Speisen ein vergnügteres Leben geführt, als alle Nachfolger des Apicius.« Und der Herr v. P. setzt in einer Anmerkung hinzu: »Es wird hier auf den Apicius Caelius gezielet, welcher zehn Bücher von der Kochkunst geschrieben etc.« – Allein, muß denn ein Mann, der Gerichte zubereiten lehrt, notwendig ein Schlemmer sein? Er hätte, wie bekannt, einen ganz andern Apicius hier anführen sollen, und würde unter drei berühmten Schlemmern dieses Namens die Wahl gehabt haben. Das Projekt des Abts von St. Pierre zu einem beständigen Frieden, sagt der Herr v. P., sei ihm nicht zu Gesichte gekommen. Die ganze Welt kennt es. Es ist unendlich sinnreicher als seines, und läuft auf eine proportionierliche Herabsetzung der Kriegsheere aller europäischen Staaten hinaus.
Fll.
III. Den 18. Jenner 1759
Siebender Brief
Sie haben Recht; dergleichen schlechte Übersetzer, als ich Ihnen bekannt gemacht habe, sind unter der Kritik. Es ist aber doch gut, wenn sich die Kritik dann und wann zu ihnen herabläßt; denn der Schade, den sie stiften, ist unbeschreiblich. – Wenn durch eine große, wunderbare Weltveränderung auf einmal alle Bücher, die deutsch geschriebenen ausgenommen, untergingen; welch eine erbärmliche Figur würden die Virgile und Horaze, die Shaftesburys und Bolingbroks bei der Nachwelt machen!
Oder meinen Sie, daß bei einem so allgemeinen Schiffbruche der Wissenschaften, die deutsche Gelehrsamkeit nur immerhin auch mit versinken möchte?
Das wäre zu bitter geurteilet! Man verachtet keinen Baum wegen seiner unansehnlichen Blüte, wenn er wegen seiner Frucht zu schätzen ist. Unsere schöne Wissenschaften würden zu vergessen sein; aber unsere Weltweisheit nicht. Noch zu bitter! – Nein, auch in jenen fehlt es uns nicht an Männern, die alsdenn an die Stelle der großen Ausländer, und der noch größern Alten treten müßten und könnten! Klopstock würde Homer; Cramer, Pindar; Utz, Horaz; Gleim, Anakreon; Geßner, Theokrit; Wieland, Lucrez –
Wieland, Lucrez? So geht es, wenn man träumet! Es finden sich im Traume Dinge oft wieder zusammen, die man seit vielen Jahren, nicht miteinander gedacht hat. Herr Wieland hätte es längst gern aus unserm Gedächtnis vertilgt, daß er der Verfasser der »Natur der Dinge« ist, und aus dem meinigen schien es auch wirklich vertilgt zu sein –
Erlauben Sie mir, Ihnen von diesem Manne, der ohne Widerrede einer der schönsten Geister unter uns ist, mehr zu sagen; ich mag zu meinem vorigen Gegenstande nicht zurückkehren. Denn warum schriebe ich Briefe?
Wenige Gelehrte werden eine mehr doppelte Rolle gespielt haben, als Herr Wieland. Ich mag es nicht wieder erzählen, was Leute, die ihn in K** B** persönlich gekannt haben, von ihm zu erzählen wissen. Was geht uns das Privatleben eines Schriftstellers an? Ich halte nichts davon, aus diesem die Erläuterungen seiner Werke herzuholen. So viel ist unwidersprechlich, daß jenes Lehrgedicht, und die »Moralischen Briefe« uns den Herrn Wieland auf einem ganz andern Wege zeigten, als ihm hernach zu betreten beliebt hat. Wenn diese Veränderung durch innere Triebfedern, (mich plump auszudrücken) durch den eigenen Mechanismus seiner Seele erfolgt ist; so werde ich nicht aufhören, mich über ihn zu verwundern. Ist sie aber durch äußere Umstände veranlaßt worden, hat er sich, aus Absichten, mit Gewalt in seine itzige Denkungsart versetzen müssen, so betauere ich ihn aus dem Innersten meiner Seele.-
Sie wissen es schon zum Teil, wie schlecht er sich gegen den Herrn Utz aufgeführet hat. – Herr Utz, nach der Freiheit, zu der jeder seines gleichen berechtiget ist, erklärte sich wider eine gewisse Art von Dichtern; Herr Wieland hielt sich beleidiget, und anstatt seinen Gegner gleichfalls von der Seite des Schriftstellers anzugreifen, fiel er mit so frommer Galle, mit einem so pietistischen Stolze auf den moralischen Charakter desselben; brauchte so hämische Waffen; verriet so viel Haß, einen so verabscheuungswürdigen Verfolgungsgeist16, daß einen ehrlichen Mann Schauder und Entsetzen darüber befallen mußte.
Er hatte sogar das Herz, einen verehrungswürdigen Gottesgelehrten zum Werkzeug seiner Erbitterung brauchen zu wollen. Doch dieser fand auch hier Gelegenheit, seine edle Mäßigung, seine philosophische Billigkeit zu zeigen. Denn ohne Zweifel ist er allein Ursache, daß Herr Wieland in der Sammlung seiner »Prosaischen Schriften«? aus der Zuschrift der Empfindungen des Christen? die härteste Stelle weggelassen hat.
Ich sende Ihnen hier diese Sammlung,17 in welcher Sie manchen neuen Aufsatz finden werden. Sie müssen sie alle lesen; denn wenn man einen Wieland nicht lesen wollte, weil man dieses und jenes an ihm auszusetzen findet; welchen von unsern Schriftstellern würde man denn lesen wollen? –
Fll.
Achter Brief
Auch mir sind unter den Wielandischen Schriften die »Empfindungen des Christen« das anstößigste gewesen.
Empfindungen des Christen, heißen Empfindungen, die ein jeder Christ haben kann, und haben soll. Und von dieser Art sind die Wielandischen nicht. Es können aufs höchste Empfindungen eines Christen sein; eines Christen nämlich, der zu gleicher Zeit ein witziger Kopf ist, und zwar ein witziger Kopf, der seine Religion ungemein zu ehren glaubt, wenn er ihre Geheimnisse zu Gegenständen des schönen Denkens macht. Gelingt es ihm nun hiermit, so wird er sich in seine verschönerte Geheimnisse verlieben, ein süßer Enthusiasmus wird sich seiner bemeistern, und der erhitzte Kopf wird in allem Ernste anfangen zu glauben, daß dieser Enthusiasmus das wahre Gefühl der Religion sei.
Ist er es aber? Und ist es wahrscheinlich, daß ein Mensch, der den Erlöser am Kreuze denket, wirklich das dabei denket, was er dabei denken sollte, wenn er seine Andacht auf die Flügel der Horazischen Ode setzt und anhebt: »Wo ist mein entzückter Geist? Welch ein furchtbares Gesicht um mich her! – Schwarze Finsternis, gleich der ewigen Nacht, liegt auf dem bebenden Erdkreis. – Die Sonne ist erloschen, die verlassene Natur seufzt; ihr Seufzen bebet gleich dem schwachen Wimmern des Sterbenden durch die allgemeine Todesstille. – Was seh ich? Erbleichte Seraphim schweben aus dem nächtlichen Dunkel hier und da hervor! Sie schauen mit gefaltenen Händen, wie erstarret herab! Viele verbergen ihr tränendes Antlitz in schwarze Wolken. – O des bangen Gesichts! Ich sehe, ich sehe den Altar der Versöhnung, und das Opfer, das für die Sünde der Welt verblutet.« –18
Schön! – Aber sind das Empfindungen? Sind Ausschweifungen der Einbildungskraft Empfindungen? Wo diese so geschäftig ist, da ist ganz gewiß das Herz leer, kalt.
So wie es tiefsinnige Geister gab, und noch gibt, welche uns die ganze Religion platterdings wegphilosophieren, weil sie ihr philosophisches System darein verweben wollen: so gibt es nun auch schöne Geister, die uns eben diese Religion wegwitzeln, damit ihre geistlichen Schriften auch zugleich amüsieren können.
Der Ton der Psalmen, welchen die Empfindungen des Herrn Wielands oft annehmen, hat mich an Petersens »Stimmen aus Zion« wieder erinnert.
Eine Vergleichung zwischen Petersen und Wielanden würde diesem auf keine Weise schimpflich sein. Petersen war ein sehr gelehrter und sinnreicher Mann, und kein gemeines poetisches Genie. Seine »Uranias« ist voll trefflicher Stellen; und was kann man mehr zu ihrem Lobe sagen, als daß Leibniz sie zu verbessern würdigte, nachdem er selbst den Plan dazu gemacht hatte?
Seine erstgedachten Stimmen sind hundert prosaische Lieder, die er selbst Psalmen nennt. Erlauben Sie mir, Ihnen einige kleine Stücke daraus vorzulegen:
Drei und vierzigster Psalm
»Wie ist die Welt doch so überweise worden! Wie hat sich die Magd über die Frau erhoben!
Die Weisheit des Fleisches waffnet sich gegen die göttliche Einfalt; und die Vernunft ficht wider den Glauben.
Die Weltweisheit setzet sich gegen die göttliche Torheit; sie meistert Gottes Weisheit und verfälscht sein großes Wort.