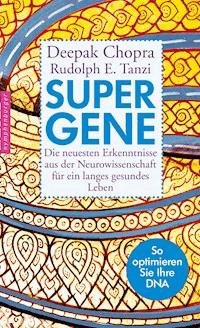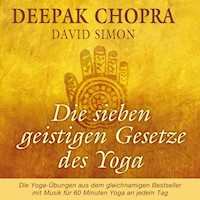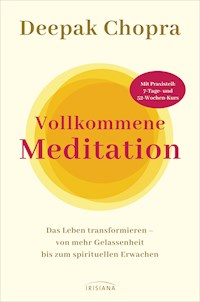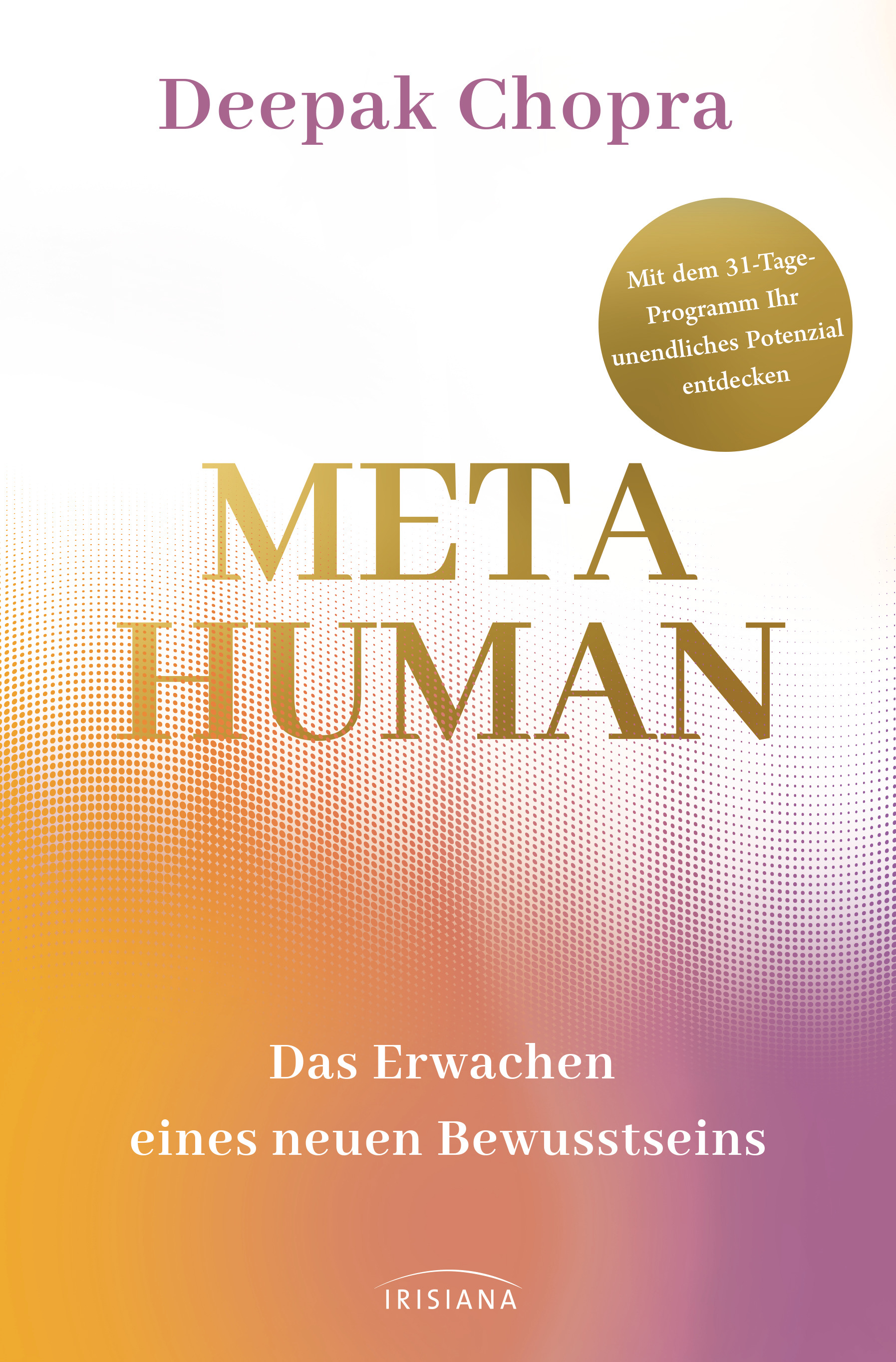4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur MensSana eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Liest man diesen großartigen Roman von Bestseller-Autor Deepak Chopra, bleibt von dem üblichen glatten Buddhabild nichts mehr übrig. Sein Roman gibt der entrückten Gestalt des Religionsgründers erstmals ein menschliches Gesicht und zeigt einen Mann von fast erschreckender Konsequenz. Deepak Chopra schildert das weltliche Leben des Fürstensohnes, sein fast zum Tod führendes Asketenleben und schließlich seinen Durchbruch zur wahren Meisterschaft des Erwachten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 439
Ähnliche
Deepak Chopra
Buddha
Biographischer Roman
Aus dem Englischen von Bernd Seligmann
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Wer mich sieht, sieht die Lehre.
BUDDHA
Vorwort des Autors
Mit diesem Buch wagte ich den Schritt, neue Gestalten und Ereignisse im Leben eines Menschen zu erfinden, der zu den berühmtesten Figuren zählt, die je gelebt haben, wohlbekannt und doch voller Geheimnisse. Mein Ziel war, Buddha aus dem Nebel der Zeiten zu heben und ihn mit Fleisch und Blut zu versehen, ohne jedoch sein Mysterium zu zerstören. In der Geschichte des Prinzen, der zum lebendigen Gott werden sollte, mischen sich Fakten und Phantasie schon seit vielen Jahrhunderten. Oder ist »Gott« vielleicht genau das, was er nicht sein wollte? War es vielleicht sein tiefster Wunsch, aus der materiellen Welt zu verschwinden und nur als Inspiration der Vollkommenheit erinnert zu werden?
Der Geschichte des Buddha wurden im Laufe ihrer Entwicklung über zwei Jahrtausende immer mehr Wunder und Götter aufgepfropft, obwohl Buddha selbst solche Wunder oder Götter niemals erwähnte, wenn er von sich sprach. Über beides hatte er seine Zweifel. Er hatte kein Interesse an Personenkult. Er erwähnte nie seine Familie, noch offenbarte er überhaupt irgendwelche persönlichen Dinge, in keiner seiner vielen Reden. Ganz anders als Christus im Neuen Testament sah er sich gewiss nicht als ein Gottwesen.
Vielmehr betrachtete er sich als »jemand, der aufgewacht ist«, denn das ist die Bedeutung des Wortes Buddha, und dieser Erwachte ist es, den ich in diesem Buch mit Leben zu füllen versuche. In ihm, in all seinem Mysterium, erblicken wir das erste Menschenwesen, das je Erleuchtung erlangte und sein langes Leben damit verbrachte, uns andere zu erwecken. Alles, was er wusste, wusste er aus schwerer, zuweilen bitterer Erfahrung. Er durchlebte äußerstes, fast tödliches Leid, und wurde am Ende etwas unglaublich Kostbares: Buddha wurde die Wahrheit. »Wer mich sieht, sieht die Lehre«, sagte er, »und wer die Lehre sieht, sieht mich.«
Dieses Buch beschreibt eine heilige Reise, erfunden in vielen Äußerlichkeiten, doch wahrhaftig, so hoffe ich, in der Psychologie des Suchenden. In allen drei Phasen seines Lebens – als Siddhartha der Prinz, Gautama der Mönch und Buddha der Barmherzige – war er so sterblich wie Sie und ich, und doch erlangte er Erleuchtung und Unsterblichkeit. Das Wunder ist, dass er auf dieser Reise einem Herzen folgte, das so menschlich war wie Ihres und meines, und ebenso verletzlich.
Deepak Chopra
Teil Eins
Siddhartha der Prinz
1
Das Königreich Shakya, 563 v.u.Z.
Es war ein frischer Frühlingstag. König Suddhodana drehte sich im Sattel und blickte über das Schlachtfeld. Er suchte nach einer Schwachstelle, die er ausnutzen könnte, und er war sicher, der Feind bot ihm eine solche Stelle, denn das tat er immer, und darauf konzentrierte er sich nun mit all seinen Sinnen. Die Schreie der Verwundeten und Sterbenden mischten sich mit den rauen Stimmen seiner Offiziere, die ihre Befehle brüllten und die Götter um Hilfe ersuchten. Das Schlachtfeld, aufgewühlt von Pferdehufen und Elefantenfüßen und zerfurcht von eisenumringten Wagenrädern, triefte von Blut, als wäre die Erde selbst tödlich verwundet.
»Mehr Soldaten! Ich will mehr Soldaten! Sofort!« Ohne darauf zu warten, dass jemand seinem Befehl folgte, schrie Suddhodana weiter: »Wer sich aus meiner Hörweite entfernt, den werde ich eigenhändig töten!«
Wagenfahrer und Infanterie schleppten sich auf den König zu, geschunden und so dreckig nach langer Schlacht, dass sie wie Götzenfiguren wirkten, Statuen aus blutigem Schlamm.
Suddhodana war ein Kriegerkönig, doch noch wichtiger: Er hielt sich für einen Gott. Er kniete wohl mit seiner Armee im Tempel und betete, bevor er in die Schlacht zog, verließ sich jedoch nie auf göttlichen Beistand. Wenn er die Tore seiner Hauptstadt hinter sich ließ und in den Krieg zog, wandelte sich sein Geist mit jeder Meile, die er sich von seiner Heimat entfernte. Auf dem Schlachtfeld schließlich, inmitten des Lärms und der Gerüche des Krieges, von Stroh und Blut, Soldatenschweiß und sterbender Pferde, fand er sich in einer anderen Welt, in der sein einziger Glaube war, dass er niemals verlieren könne.
Das galt auch für den gegenwärtigen Feldzug, obwohl der ihm eher aufgezwungen worden war. Ravi Santhanam, ein Kriegerfürst aus dem Nordland entlang der Grenze zu Nepal, hatte eine von Suddhodanas Handelskarawanen überfallen, worauf der König sofort zur Vergeltung ausgeholt hatte. Die Männer des Kriegerfürsten hatten den Vorteil des hohen Geländes und kämpften auf heimatlichem Boden, doch Suddhodanas Streitkräfte drangen immer weiter auf feindliches Terrain vor. Pferde und Elefanten zertrampelten die Gefallenen, tot oder gerade noch lebendig und zu schwach, davonzukriechen. Suddhodana ritt nahe eines sich aufbäumenden Elefantenbullen, in dessen Bauch ein halbes Dutzend Pfeile steckten, und entkam um Haaresbreite den zu Boden donnernden Füßen der rasenden Bestie.
»Ich will hier noch eine Reihe Streitwagen, in dichter Ordnung!« Er hatte die Stelle entdeckt, wo die feindliche Front erschöpft war und aufzuweichen begann. Ein Dutzend Streitwagen holperte mit knirschenden Rädern vor die Massen der Infanteriesoldaten. Die Fahrer hatten Bogenschützen hinter sich auf dem Trittbrett, die ihre Pfeile nun auf die feindliche Armee prasseln ließen.
»Bildet eine Angriffswand«, rief Suddhodana. »Ich will ihre Front zerschmettern!«
Seine Wagenfahrer waren erfahrene Veteranen, unerbittliche Krieger mit harten Gesichtern. Suddhodana ignorierte den Lärm der Schlacht, die nicht weit entfernt tobte, und ritt langsam vor ihnen entlang. Er sprach mit ruhiger Stimme. »Die Götter gebieten, dass es nur einen König geben kann. Aber ich schwöre, ich bin nicht besser als jeder gemeine Soldat und ihr seid so gut wie Könige. Jeder Mann hier ist ein Teil von mir. Was kann der König also noch sagen? Nur zwei Worte – die zwei Worte, die eure Herzen hören wollen: Sieg und Heimat!«
Dann hallte sein Befehl wie Peitschenknall. »Alle zusammen – vorwärts!«
Die beiden Armeen stürmten brüllend aufeinander los wie zwei Ozeane. Gewalt schenkte Suddhodana inneren Frieden. Sein Schwert wirbelte durch die Luft und spaltete einem Mann den Schädel. Seine Angriffswand rollte voran und wenn die Götter es wollten – und sie mussten es wollen –, würde sich die feindliche Front bald öffnen, Leichnam für Leichnam, und Suddhodanas Fußtruppen würden auf Feindesblut durch die Bresche gleiten. Der König hätte gelacht über jeden, der bestritt, dass er, Suddhodana, der Mittelpunkt der Welt sei.
Zur gleichen Stunde wurde Suddhodanas Frau, die Königin, in einer Sänfte durch tiefen Wald getragen. Sie war im zehnten Monat schwanger, nach Meinung der Astrologen ein Zeichen, dass es sich nicht um ein gewöhnliches Kind handeln konnte. Doch daran dachte Königin Maya nicht. Für sie war nur die Furcht außergewöhnlich, die sie in ihrer Umgebung sah, seit sie auf einen Impuls hin beschlossen hatte, zum Haus ihrer Mutter heimzukehren, um das Kind zu gebären.
Suddhodana war dagegen gewesen. Es war zwar Sitte, dass Mütter ihre Kinder in ihrem eigenen Elternhaus gebaren, doch der König und Maya waren unzertrennlich. Er wollte es ihr verbieten, bis Maya auf ihre unschuldige Art vor versammeltem Hofe um seine Erlaubnis bat. So öffentlich konnte er der Königin keinen Wunsch abschlagen, trotz aller Gefahren, die die Reise mit sich brachte.
»Wer wird dich begleiten?«, fragte er mit scharfer Stimme, in der Hoffnung, er könnte sie von ihrem närrischen Plan abschrecken.
»Meine Frauen.«
»Frauen?« Er hob resigniert beide Hände. »Also gut. Ich werde dir aber auch eine Hand voll Männer mitgeben, so viele, wie ich entbehren kann.« Maya lächelte und zog sich zurück. Suddhodana mochte nicht mit ihr streiten, denn in Wirklichkeit war sie ihm ein Geheimnis. Nichts konnte ihr Angst machen, was immer die Gefahren waren. Die greifbare Welt war für sie wie ein dünner Film, auf dem sie wie eine Mücke auf einem Teich glitt. Die Welt konnte Maya zwar berühren, bewegen und gar verletzen, jedoch niemals ändern oder von etwas abbringen.
Die Königin verließ Kapilavastu einen Tag vor der Armee. Kumbira, die Älteste der Hofdamen, ritt an der Spitze der kleinen Prozession durch den Wald. Die Eskorte war schwach, nur sechs Soldaten, alle zu alt für den Krieg, ihre Klepper zu gebrechlich, um den Feind zu jagen. Hinter den Soldaten schleppten vier barfüßige Träger ihre Last auf dem steinigen Pfad – die mit Quasten und Perlen behängte Sänfte der jungen Königin. Von Maya hinter den schaukelnden Seidenvorhängen war kein Laut zu hören, nur dann und wann ein kleiner, unterdrückter Schrei, wenn ein Träger stolperte und die Sänfte einen Ruck erfuhr. Drei junge Zofen, leise klagend, dass sie zu Fuß gehen mussten, bildeten das Ende des jämmerlichen Zuges.
Die grauhaarige Kumbira blickte ständig hin und her, nur allzu gewahr der Gefahren, die überall lauerten. Der Weg, auf dem sie reisten, ein schmaler, in einen Granithang gehauener Felsensteg, war ursprünglich ein Schmugglerpfad, auf dem die Häute gewilderter Tiere, Gewürze und andere Waren nach Nepal gebracht wurden. Die Gegend war immer noch ein Lieblingsversteck von Banditen. Auch Tiger fanden ihre Beute unter unglücklichen Reisenden, selbst am helllichten Tag. Um sich die Bestien vom Leib zu halten, hatten sich die Träger Masken aufgesetzt, deren Gesichter rückwärts schauten. Der allgemeine Glaube war, dass Tiger stets nur von hinten angreifen und niemals eine Person anspringen, die sie direkt anschaut.
Kumbira ritt vor, bis sie neben Balgangadhar war, dem Anführer der Eskorte. Der Krieger blickte die alte Frau stoisch von der Seite an. Er stöhnte leise, als die Königin wieder aufschrie.
»Sie kann nicht mehr lange durchhalten«, sagte Kumbira.
»Und ich kann den Weg nicht kürzer machen, als er ist«, brummte Balgangadhar.
»Aber du könntest ein wenig schneller reiten«, schnappte sie. Sie wusste, er schämte sich, dass er nicht mit seinem König in der Schlacht war, doch Suddhodana hatte darauf bestanden, dass wenigstens einer seiner Elitesoldaten die Königin begleitete.
Mit einer fast unmerklichen Verbeugung, wie es die Etikette vorschrieb, entgegnete der Offizier: »Ich werde voranreiten und einen Lagerplatz auskundschaften. Etwas höher am Berg gibt es einen Einschlag mit ein paar Holzfällerhütten.«
»Nein, wir bleiben zusammen«, sagte Kumbira.
»Die anderen Männer können euch beschützen, während ich fort bin.«
»Tatsächlich?« Kumbira blickte skeptisch über die Schulter zu den armseligen Gestalten, die ihre Eskorte darstellten. »Und wer wird sie beschützen?«
Man sagt, Maya Devi – die Göttin Maya, als die sie bekannt werden sollte – sei im Mondschein im Wald von Lumbini angekommen, einem der heiligsten Orte im ganzen Königreich. Man sagt auch, es sei kein Zufall gewesen, dass sie ihr Kind in diesem Wald zur Welt brachte. Die Bestimmung habe sie dorthin geführt. Sie habe verkündet, sie wolle den heiligen Wald besuchen, weil dort ein mächtiger Baum stand, wie eine Säule zum Ruhme der Muttergöttin. Mayas Vorahnung sei gewesen, dass diese Geburt geheiligt sein würde.
In Wirklichkeit war sie eine verängstigte und zerbrechliche junge Frau, nahezu verirrt in der Wildnis. Und der heilige Baum? Maya krallte sich einfach in den nächstbesten Salbaumstamm auf der Lichtung. Balgangadhar hatte den geschützten Ort gerade rechtzeitig gefunden, denn als die königliche Sänfte ankam, war Maya schon in den letzten Wehen. Die Hofdamen formten einen dichten Kreis um sie. Die Königin klammerte sich an den Baumstamm und wurde in tiefer Nacht vom Sohn ihres Königs entbunden, dem Sohn, den der König sich so gewünscht hatte.
Als die Legenden aufkamen, war Kumbira schon lange tot. Deshalb erscheint sie nicht in ihnen, wie sie ihre Befehle an die hektischen Frauen brüllt, die Männer mit Fußtritten verscheucht und sich fast an dem heißen Kessel verbrennt, in dem sie das Wasser vom Lagerfeuer holt. Doch sie war es, die das Kind als Erste hielt und zärtlich das Blut von dem winzigen Körper wusch, bevor sie das schreiende Neugeborene ihrer Königin zeigen konnte. Maya lag schlaff auf dem Waldboden, fast teilnahmslos. Die erste Stillung, ein wichtiges Ritual in ihrem Volk, musste am Morgen erfolgen. Trotz der anscheinend guten Gesundheit des Säuglings war Kumbira besorgt und zuckte bei jedem nächtlichen Laut zusammen. Vor allem machte sie sich Sorgen, weil die Geburt so lang und qualvoll gewesen war.
»Jetzt wird er endlich glücklich sein, mein Gatte«, flüsterte Maya mit matter Stimme. »Und ich werde nicht verflucht sein, wenn ich nicht mehr bin.« Kumbira erschrak. Wie konnte Maya in diesem Augenblick an den Tod denken? Kumbiras Blicke huschten durch die Dunkelheit des ungeschützten Lagers. Die jüngeren Zofen priesen die tapfere Mutter, erleichtert, dass die Qual ein Ende hatte, und froh, dass sie bald wieder heimkehren konnten zu ihren weichen Betten und hübschen Liebhabern. Noch glücklicher waren sie dann, als der Vollmond über den Baumwipfeln aufstieg – ein gutes Omen.
»Hier, Hoheit.« Utpatti, eine der Zofen, beugte sich über die Königin. »Das müsst Ihr jetzt tun.«
Bevor sie jemand zurückhalten konnte, öffnete Utpatti Mayas Gewand und entblößte ihre Brüste. Beschämt und verwirrt raffte Maya mit einer Hand ihr Kleid zusammen.
»Was tust du?«, fragte sie die junge Frau.
Utpatti wich ein wenig zurück. »Ich wollte Euch mit der Milch helfen, Hoheit«, flüsterte sie unsicher. Sie schaute hilfesuchend zu den anderen Frauen. »Mondschein auf den Brüsten. Das hilft. Alle Landfrauen wissen das.«
»Bist du denn eine Landfrau?«, fragte Maya sie.
Die anderen kicherten. Utpatti tat so, als kümmerte sie sich nicht darum, und sagte ernst: »Ja, das war ich einmal.«
Maya legte sich wieder zurück und offenbarte ihre vollen Brüste, schon schwer von Milch, dem vollen Mond.
»Ich spüre es«, flüsterte sie, gar nicht mehr schwach, die Stimme ekstatisch, der Schmerz verschwunden. Wenn sie nicht selbst eine Göttin war, hatte sie gewiss die Gabe, die Berührung einer Göttin, des Mondes, zu empfangen. Sie nahm ihr Kind und hielt es hoch.
»Seht ihr, wie ruhig er jetzt ist? Er spürt es auch.« In diesem Augenblick glaubte Maya in ihrem Herzen, dass alle ihre Wünsche in Erfüllung gegangen waren. In Sanskrit gibt es einen Namen, der dieses Gefühl ausdrückt. Sie hielt das Kind höher.
»Siddhartha«, sagte sie. Er, der alle Sehnsüchte erfüllt sieht. Die Hofdamen begriffen die Bedeutung dieses Augenblicks und beugten den Kopf, selbst die stets wachsame Kumbira.
2
Die Türme der Heimatstadt erschienen vor Suddhodana und seinen Männern im grauen Regenguss. Der Wachmann rief seine Parole und das große, hölzerne Stadttor öffnete sich vor ihnen. »Schnell, schnell, Marsch, in die Stadt!«, riefen die Sergeanten. Nur wenige Bürger waren zu ihrer Begrüßung erschienen. Die Frauen, die in kleinen Gruppen am Straßenrand kauerten, starrten in die Gesichter der Soldaten, ängstlich hoffend, ihre Männer und Söhne mögen unter den Überlebenden sein.
Die Königin war an diesem Morgen früh aufgestanden, um die Rückkehr ihres Gatten nicht zu versäumen, doch dann hatte der Regen begonnen und alles verzögert. Den Abstieg aus den Bergen hatte sie wie im Rausch erlebt, wie in Ekstase, und dieses Gefühl war danach noch stärker geworden, sogar als ihr Körper schon zu versagen begann. Es gab viel Geflüster am Hof, da sie die Dienste einer Amme abgelehnt hatte. »Es kann nicht sein, dass meine Liebe zu dem Kind mich umbringen wird«, hatte sie gesagt.
Maya dachte wieder an den Traum, den sie zehn Monate zuvor gehabt hatte. Darin war sie in ihrem Schlafzimmer aufgewacht, geblendet von einem Licht, das den ganzen Raum erfüllte. Aus diesem Licht waren drei engelhafte Gestalten erschienen, drei lächelnde Jungfrauen. Maya setzte sich auf und erkannte sofort, was die Besucherinnen waren – Devas, Himmelsgeschöpfe.
Die drei Devas luden sie ein, sich ihnen anzuschließen. Verwundert, dass sie sie auserwählt hatten, stieg Maya aus ihrem warmen Bett und folgte ihnen. Sie blickte noch einmal über die Schulter und trat dann durch die Wand ihres Schlafgemachs als wäre sie aus Rauch, ohne etwas zu spüren. Draußen ergriff sie ein starker Sog und die Palastgärten und die Welt verschwammen unter ihr. Strahlendes Licht lockte sie weiter und sie sah, dass es die Sonne war, gespiegelt auf gleißendem Schnee, reflektiert in den Eiskristallen, die einen Bergsee bedeckten, umringt von wachenden Gipfeln.
Die Himalayaberge – denn sie war sicher, das war der Ort, wohin die Devas sie gebracht hatten – hatten sie ihr ganzes Leben lang begleitet – fern, doch allgegenwärtig. Nie hätte sie aber geglaubt, dass sie sich einmal inmitten dieser Gipfel finden würde. Jetzt führten die drei Jungfrauen sie zu einem Kiesstrand am anderen Ufer des Sees, der hell und klar glänzte wie ein Spiegel.
Die Devas begannen, sie zu entkleiden. Maya hatte keine Angst, sondern fühlte sich immer entspannter. Sobald sie sie ihrer Kleider entledigt hatten, hüllten die Devas sie in die feinsten Gewänder, die sie je gesehen hatte.
Dann tasteten sie lächelnd nach Mayas Bauch. Die Berührung war warm und erregend. Sie ging in den See, tiefer und tiefer. Dann wachte sie auf und saß in ihrem Bett, als hätte sie es nie verlassen, außer dass nun ein Geschöpf bei ihr war, das ihr ganzes Schlafzimmer zu füllen schien und dessen Blick sie in seinen Bann zog. Aus seinem Auge kam ein Weiß, das allmählich die Form eines riesigen, schneeweißen Elefanten annahm. Das Geschöpf sah sie an, ein Blick voll warmer, unerschütterlicher Weisheit. Dann hob es den Rüssel, wie zum Gruß. Maya spürte plötzlich brennenden Hunger. Sie wachte wieder auf und saß aufrecht im Bett. Das Zimmer war jetzt leer, doch das ungewohnte, unstillbare Verlangen erfüllte sie immer noch.
Sie sprang aus dem Bett, warf sich zitternd einen Umhang über und lief in das Schlafgemach ihres Gatten. Im schwachen Kerzenschein sah sie Suddhodana unter seinen Tüchern gekrümmt. Nach Jahren vergeblichen Hoffens auf einen Sohn schlief er nun oft allein. Ein anderer König hätte sich eine Konkubine genommen, die ihm einen Sohn geschenkt hätte. Ein anderer König hätte seine Königin ermorden oder für verrückt erklären lassen, um die Ehe aufzulösen. Doch nicht Suddhodana, der in seiner Liebe so entschlossen und loyal war wie in seinen Kriegen.
Diese Nacht wird alles anders sein, sagte Maya sich. Ich bin gesegnet. Sie legte sich vorsichtig neben ihn, damit er nicht aufschreckte, und streichelte sein Gesicht, um ihn sanft zu wecken. Zuerst ballte er die Fäuste, dann öffnete er die Augen und blickte sie an. Er wollte sprechen, doch sie legte ihm einen Finger auf die Lippen.
Sie empfand kein wildes Verlangen, war nicht Gefangene oder Sklavin ihres Geschlechts; sie wollte nicht Erquickung, sondern Vereinigung. Sie ermutigte ihn mit Worten, wie sie ihr noch nie über die Lippen gekommen waren: »Liebe mich nicht wie ein König. Liebe mich wie ein Gott.«
Die Wirkung war dramatisch. Er zog sie an sich und sie sah die Verblüffung in seinem Blick. So lange war ihr Verkehr mechanisch und oberflächlich gewesen, da sie beide die Hoffnung verloren hatten, er würde je Früchte tragen. Doch in dieser Nacht empfanden sie gemeinsam den starken Glauben, der in ihr erwacht war.
Als sie bereit war, schob sie ihm ihr Becken entgegen und nahm ihn in sich auf. Ihr Atem stockte. Sie erreichte den Höhepunkt, den Augenblick, wo der Mensch erahnen kann, was Unsterblichkeit ist, und dann stöhnte sie und entspannte, noch in der Umarmung ihres Königs, der sie an sich zog, als wollte er sein Fleisch mit ihr verschmelzen. Sie küssten und streichelten einander und nur die Erschöpfung hinderte Maya daran, das auszusprechen, was sie nun sicher wusste: Sie hatten ein Kind gezeugt.
Der Traum, der ihr während der grausamen Reise durch den Wald und der Qualen der Geburt geholfen hatte, kehrte nun wieder, doch jeden Tag gespenstischer. Sie ließ ihren Kopf ins Kissen sinken. Es ist immer noch ein wunderbarer Traum, dachte sie, ein Ausweg aus dieser großen Müdigkeit. Vielleicht wäre es besser, nur noch in diesem Traum zu leben, dachte sie. Ach könnte ich nur.
Suddhodana stand in der königlichen Kinderstube und schaute in Ehrfurcht und Liebe auf seinen Sohn. Der Säugling war in scharlachrote Seide gewickelt. Der König war sicher, das Kind erkannte ihn. Er bildete sich sogar ein, Siddhartha hätte zum ersten Mal die Augen geöffnet, als sein Vater über ihm stand, eine Vorstellung, die ihm keiner zu rauben wagte.
»Ist es gut, dass er so viel schläft? Warum tropft seine Nase? Wenn ihr ihn auch nur einen Augenblick allein lasst, werde ich euch auspeitschen lassen.« So machte Suddhodana die Kindermädchen mit seinen unablässigen Einmischungen verrückt. Wie es damals Sitte war, blieb Maya den Monat nach der Geburt in Quarantäne, in der sie Waschungen und religiösen Ritualen unterzogen wurde. Suddhodana missfiel das sehr, doch er konnte nichts daran ändern. Wenn er seine Frau für ein paar Augenblicke sehen wollte, musste er sich nachts im Kerzenschein in ihr Quartier stehlen, nachdem sie eingeschlafen war. Er fragte sich, ob junge Mütter wohl immer so blass und müde aussahen, verdrängte aber seine Sorge um sie.
»Er soll immer in Seide gekleidet sein. Wenn die Tücher schmutzig sind, werft sie weg, und wenn euch die Seide dafür ausgeht, zerreißt die Saris der Hofdamen und schneidert ihm daraus Kleider und Windeln.« Nach Suddhodanas Willen sollte nichts die Haut seines Sohnes berühren, was auch nur eine Spur Schmutz zeigte. Und es musste Seide sein, da Seide eine symbolische Bedeutung hatte, denn Suddhodana war auf der Seidenstraße gewesen, auf dem Heimweg, als der Bote mit der Nachricht kam, er hätte einen Sohn und Mutter und Kind wären beide wohlauf.
Jeden Morgen trat der König durch den Ring der Frauen, die dem jungen Prinzen mit ihren Schals frische Luft zufächerten, nahm seinen Sohn aus der Wiege und hielt ihn hoch. Und einmal nahm er ihm die Windel ab.
»Schaut ihn nur an.« Suddhodana zeigte den Frauen seinen Sohn in all seiner nackten Pracht. »Seht nur, wie er gebaut ist.« Die Frauen wussten, worauf er anspielte, und Kakoli, die königliche Kinderschwester, murmelte pflichtschuldigst ein paar lobende Worte. »Sehr eindrucksvoll, Kakoli«, schwärmte Suddhodana weiter, »das kann ich wohl sagen, auch ohne deine Erfahrung.« Der König lachte und bemerkte dabei, wie leicht ihm das fiel, wenn er seinen Sohn hielt. »Du brauchst nicht rot zu werden, du alte Heuchlerin. Wenn er zwanzig Jahre älter wäre und wir dir vierzig Jahre vom Buckel nehmen könnten, könntest du dich wahrscheinlich kaum halten.«
Kakoli schüttelte den Kopf und schwieg. Die jungen Zofen kicherten und erröteten, eher amüsiert als erschrocken über seine Derbheit. So dachte jedenfalls Suddhodana.
Asita erwachte im Wald und dachte an Dämonen. Das war seit vielen Jahren nicht mehr geschehen. Er konnte sich erinnern, wie er früher den einen oder anderen erspäht hatte, wenn er in die Nähe einer Hungersnot oder einer Schlacht geraten war, oder irgendwo anders, wo es Leichen zu ernten gab. Er wusste, welches Elend sie verursachten, doch solche Nöte kümmerten Asita nicht mehr. Schließlich lebte er nun seit fünfzig Jahren als Waldeinsiedler, weit weg von derart weltlichen Dingen. Manchmal verbrachte er ganze Tage in einer versteckten Höhle, wo ihn nicht einmal die Nöte der Tiere berühren konnten, geschweige denn die der Menschen.
Jetzt kniete Asita an einem Bach und dachte nach. Mit seinem geistigen Auge konnte er sie deutlich sehen, diese Dämonen. Zuerst waren sie in den Lichtflecken erschienen, als die ersten Sonnenstrahlen über seine Lider huschten. Asita schlief auf Zweigen, die er auf dem nackten Boden auszustreuen pflegte. Er liebte das Spiel von Licht und Schatten auf seinen geschlossenen Augen am frühen Morgen. In seiner Phantasie sah er dann Formen und Gestalten, die ihn an den Marktflecken erinnerten, wo er aufgewachsen war. Hinter seinen geschlossenen Augen konnte er feilschende Händler sehen, Frauen mit Wasserkrügen auf dem Kopf, Kamele und Karawanen, alles, was er wollte.
Doch keine Dämonen, niemals Dämonen, nicht vor diesem Morgen. Asita stapfte nackt bis auf ein Lendentuch in den eiskalten Gebirgsbach. Als Asket trug er keine Kleider, nicht einmal eine Mönchskutte. In letzter Zeit hatte es ihn in große Höhen gezogen, in Sichtweite der schneebedeckten Gipfel an der Nordgrenze des Königreichs Shakya. So näherte er sich den Lokas, den jenseitigen Orten, die über dieser Welt existieren. Alle Sterblichen sind auf der irdischen Ebene gefangen, doch wie die dichte Dschungelluft allmählich in die dünne Atmosphäre der Berge übergeht, so geht auch die materielle Welt in immer feinere und erhabenere Weltensphären über. Devas hatten ihren eigenen Loka, so wie die Dämonen in den ihren wohnten. Ein anderer Loka war den Geistern der Vorfahren auf der Reise von einem Leben zum nächsten vorbehalten.
Das war das Wissen, mit dem Asita aufgewachsen war. Er wusste auch, dass all diese Ebenen einander färbten wie Buntwäsche, die man zu dicht beieinander zum Trocknen aufhängt. Blau fließt in Rot und Rot in Safrangelb. Die Lokas waren zugleich getrennt und zusammen. Dämonen konnten unter Menschen wandeln, was sie auch oft taten. Der umgekehrte Fall, dass ein Mensch den Ort der Dämonen besuchte, war dagegen viel seltener.
Er steckte den Kopf unter Wasser und tauchte wieder auf, sodass das Wasser in Strömen aus seinem ungeschnittenen Bart und Haupthaar triefte. An den Tagen, wenn er Nahrung brauchte, ging Asita mit seiner Bettelschale in irgendein Dorf. Nicht einmal die kleinen Kinder fürchteten sich vor dem nackten alten Mann mit dem hüftlangen Bart und Haar. Asketen waren ein normaler Anblick, und wenn vor Sonnenuntergang ein wandernder Einsiedler an einer Haustür erschien, war es die heilige Pflicht der Haushalter, ihm Nahrung und Gastfreundschaft zu schenken.
An diesem Tag war Asita jedoch nicht hungrig. Es gab auch andere Wege, Prana, den Lebensstrom, in Gang zu halten. Wenn er den Loka der Dämonen aufsuchen wollte, brauchte er dazu sehr viel Prana, um seinen Körper zu nähren. Unter den Dämonen würde er nicht einmal die Luft finden, die seine Lungen zum Atmen brauchten.
Die strahlende Himalayasonne trocknete ihn auf seiner Wanderung über die Baumgrenze hinaus. Dämonen lebten nicht wirklich auf diesen Berggipfeln, doch Asita hatte besondere Kräfte erlernt, durch die er in ihre Anderswelt eindringen konnte, und um diese Fähigkeiten wirksam zu machen, musste er sich so weit wie möglich von allen Menschen entfernen. Wo Menschen wohnten, war die Atmosphäre dicht und schwer. In Asitas Augen war selbst das schläfrigste Dorf ein brodelndes Gebräu von Gefühlen. Jeder Mensch – die einzige Ausnahme waren Säuglinge – befand sich in einem Nebel der Verwirrung, unter einer Schicht von Ängsten, Wünschen, Erinnerungen, Phantasien und Sehnsüchten – ein Nebel so dicht, dass der Geist ihn kaum durchdringen konnte.
Im Gebirge fand Asita dagegen ungebrochene Stille. Dort konnte er sich in Leere hüllen und seinen Geist auf jeden Gegenstand konzentrieren und pfeilgerade an jeden beliebigen Ort schicken. Denn eigentlich war es sein Geist, der den Loka der Dämonen aufsuchte, doch Asita konnte solche Klarheit und Konzentration erlangen, dass er mit diesem Geist reisen konnte.
So kam es, dass der Dämonenkönig Mara plötzlich einen höchst unwillkommenen Eindringling vor sich sah. Er funkelte den nackten alten Mann an, der im Lotossitz vor seinem Thron saß. So etwas war ihm seit langer Zeit nicht widerfahren.
»Geh weg«, grollte Mara. »Dass du hierherkommen konntest, bedeutet nicht, dass ich dich nicht zerstören kann.« Der alte Mann rührte sich nicht. Seine yogische Konzentration musste sehr stark sein, denn der Umriss seines drahtigen, braunen Körpers, der zäh war wie die Sehnen, die sich unter seiner Haut abzeichneten, wurde nur noch schärfer. Mara hätte eine Horde geringerer Dämonen herbeirufen können, um den Eindringling zu peinigen, doch diesen Einsiedler wurde man nicht so leicht los. Mara unternahm also noch nichts.
Nach einer Weile öffnete der alte Mann die Augen. »Bin ich dir nicht willkommen?« Seine Stimme war sanft, doch Mara hörte die Ironie darin.
»Nein! Du hast hier nichts zu suchen!« Die Toten mochten durch Maras Reich kommen, doch sonst war es ihm zuwider, mit Sterblichen in Berührung zu kommen.
»Ich komme nicht meinetwegen. Ich komme um deiner willen«, sagte der alte Mann. Dann stand er auf und schaute sich um. Der Loka der Dämonen ist so vielfältig wie die materielle Welt, mit Regionen größerer und geringerer Pein. Asita fürchtete jedoch nichts davon und sah deshalb nur dichte, stinkende Schwaden um sich. »Ich bringe dir Neuigkeiten.«
»Das bezweifle ich.« Mara rutschte unruhig auf seinem Thron herum, der, wie in vielen Tempelgemälden dargestellt, ganz aus Totenköpfen bestand. Rote Flammen züngelten um seinen Körper. Statt eines grässlichen Gesichts besaß er vier davon und sein Kopf drehte sich wie eine Wetterfahne, sodass er abwechselnd die Gesichter von Furcht, Versuchung, Krankheit und Tod zeigte.
»Jemand wird zu dir kommen, bald, sehr bald«, sagte Asita.
»Millionen sind schon zu mir gekommen«, tat Mara die Warnung ab. »Wer bist du?«
»Ich bin Asita.« Der alte Eremit stand nun direkt vor Mara. »Buddha wird kommen.« Mara zitterte nur ganz leicht, doch Asita bemerkte es. »Ich wusste, das würde dich interessieren.«
»Ich bezweifle, dass du irgendetwas weißt.« Mara war nicht arrogant. Seine Zweifel waren echt, denn Asita war für ihn wie ein leeres Buch. Es gab nichts in ihm, wo er angreifen konnte, keine Versuchung und keine Furcht. »Wer soll dich zum Boten erkoren haben? Du bist verrückt.«
Asita ignorierte die Beleidigung und wiederholte das Wort, das Mara hatte schaudern lassen. »Buddha wird zu dir kommen. Ich hoffe, du bist bereit.«
»Still!«
Bisher hatte Mara Asita nicht mehr Aufmerksamkeit gezollt als einer kleinen, vorübergehenden Hungersnot oder einer läppischen Seuche. Jetzt aber sprang er von seinem Thron und schrumpfte zu Menschengröße und zeigte nur noch eine seiner vier Fratzen, die des Todes. »Und was ist, wenn er kommt? Er lässt damit nur die Welt im Stich, so wie du es getan hast. Sonst bedeutet es nichts.«
»Wenn du das glaubst, dann hast du vergessen, wozu Buddha fähig ist«, entgegnete Asita ruhig.
»Wirklich? Sieh!« Mara öffnete sein Maul und offenbarte die undurchdringliche Schwärze hinter seinen Fängen. Die Schwärze breitete sich aus und Asita sah all das Leid, das Mara verkörperte. Er sah unzählige Seelen, im Chaos befangen, ein Netz von Kriegen und Krankheit und allen Arten von Schmerz, die die Dämonen ersinnen konnten.
Sobald er meinte, das Spektakel hätte seine Wirkung getan, schloss Mara langsam den Mund und die Finsternis war wieder in ihm. »Buddha?«, sagte er verächtlich. »Ich werde die Menschen denken machen, dass er der Dämon ist.« Die Idee brachte ein Lächeln in seine Fratze.
»Dann lass mich als Freund zu dir sprechen und dich über die Schwäche aufklären, die dein Verhängnis sein wird«, sagte Asita. Er ließ sich wieder im Lotossitz nieder, die Beine übereinander gefaltet, und formte mit Daumen und Zeigefinger die Mudra des Friedens. »Als Monarch der Furcht hast du vergessen, selbst Furcht zu empfinden.«
Mara brüllte vor Zorn über diese Beleidigung und schwoll zu gigantischer Größe, doch der Einsiedler löste sich plötzlich in nichts auf. Mara spürte die Möglichkeit Buddhas wie das zarteste Licht vor der Morgendämmerung, war jedoch immer noch blind. Er glaubte, die Menschen würden auch diese reine Seele missachten, so wie sie alle vor ihm missachtet hatten. Das war sein Irrtum. Dieses Kind, das nun am Horizont erschien, würden die Menschen nicht ignorieren, denn es bedeutete ihre Bestimmung.
3
Kumbira riss den Seidenvorhang vor Mayas Zimmer auf und stürzte auf den Korridor. Sie war nur froh, dass sie die Erste war, die es wusste. Ihre Pantoffeln trippelten leise über das Parkett. Es war Nacht, der siebte Vollmond nach der Geburt des kleinen Prinzen, und der fahle Mondschein warf ein gespenstisches Licht auf den polierten Teakholzboden.
Suddhodana hatte sich nach dem Abendessen in die Kinderstube zurückgezogen, um mit seinem Sohn allein zu sein. Als Kumbira jetzt atemlos und sprachlos hereingelaufen kam, zeigte sie eine Miene, wie er sie nur einmal an ihr gesehen hatte, damals, als sein Vater, der alte König …
»Nein!«, entfuhr es ihm unwillkürlich. Kaltes Grauen vertrieb jedes Glücksgefühl aus seinem Herzen und beklemmte seine Brust wie eiserne Fesseln.
Kumbira zog sich den Sari vors Gesicht, um ihre Tränen zu verbergen.
»Was habt ihr Ungeheuer ihr angetan?«, schrie Suddhodana die alte Frau an. Er stürmte an ihr vorbei und stieß sie dabei zu Boden. Am Bett seiner Königin riss er den Vorhang auf und fand Maya scheinbar schlafend, vollkommen regungslos. Suddhodana fiel auf die Knie und ergriff ihre Hände, deren Kälte so flüchtig erschien, dass er sie warm reiben wollte.
Kumbira ließ eine Stunde verstreichen, bevor sie das Zimmer wieder betrat, diesmal mit einem Gefolge von Hofdamen. Die Trauer, wie alles andere in der Umgebung eines Königs, hatte einem bestimmten Ritual zu folgen. Sobald Suddhodana bereit war, den Raum zu verlassen, würden sie augenblicklich beginnen, den Leichnam mit Salben, Wickeltüchern und zeremoniellen Blumen zu präparieren. Die Klagefrauen warteten im Korridor, zusammen mit einem Dutzend Brahmanen mit Weihrauchschwenkern.
»Hoheit«, versuchte Kumbira den König aus seinen Gedanken zu wecken. Sie wartete einen Augenblick ab, ob sie ihn noch einmal ansprechen und an das Ritual erinnern musste. Suddhodana legte Maya sanft ihren Arm über die Brust. Er schauderte, nicht nur weil sie oft in dieser Stellung geschlafen hatte – ein Arm auf ihrer Brust, der andere auf ihm –, sondern auch, weil er jetzt bemerkte, wie die Leichenstarre sich einstellte. Er wusste, dies war das letzte Mal, dass er sie berühren konnte, eine Berührung, die ihm so lieb war. Schließlich nickte er kurz und vor dem Zimmer begann das Klagegeheul.
Dieses Heulen ist für Dämonen, was Musik für Sterbliche ist, und Mara, der König der Dämonen, wandelte schon durch den Palast, ungesehen und ungehört.
Der Tod hat seine eigenen strengen Regeln. Yama, der Herrscher über den Tod, nimmt jeden letzten Atemzug wahr, bevor er der Jiva, der einzelnen Seele, erlaubt, in die andere Welt überzugehen. Dort halten die Herrscher des Karma ihr Gericht über die Seele, ihre guten und bösen Taten, und weisen ihr so das nächste Leben zu. Das kosmische Urteil wird dann von den Devas vollstreckt, den Himmelsgeschöpfen, die die Seele für ihre guten Taten mit Geschenken überschütten, und von den Asuras oder Dämonen, die die Sünder mit Strafen peinigen. Die Dämonen können jedoch nicht willkürlich strafen. Das Urteil des Karma ist sehr exakt. Es bestimmt, dass nur die verdiente Strafe erteilt wird, nicht mehr und nicht weniger.
Maras Anwesenheit war also eigentlich überflüssig, da Maya schon in der Obhut der drei Devas war, die sie im Traum besucht hatten, und dann wieder in dem Augenblick, als sie ihren letzten Atemzug tat. Der Tod in der einen Welt führt zur Geburt in einer anderen. Maya verharrte aber in ihrem Körper, so lange sie konnte. Den letzten Funken ihrer Lebensenergie ließ sie durch ihre Hand in Suddhodana fließen, als er an ihrem Bett kniete und sie hielt.
All das kümmerte Mara jedoch nicht. Er ging am königlichen Schlafgemach vorbei zur Kinderstube, in dem sich jetzt weder Frauen noch Wachen noch Priester aufhielten. Das neugeborene Kind war vollkommen schutzlos. Mara ging an die Wiege und blickte auf den großäugigen Knaben hinab. Der junge Prinz lag auf dem Rücken, der Hals war entblößt. Das erste Raubtier, das vorbeikäme, hätte ihm die Kehle zerfleischen können.
Doch nicht einmal der König der Dämonen kann einen Menschen körperlich direkt verletzen. Dämonen können jedes Leid jedoch schlimmer machen, und das war es, was Mara dem Kind jetzt antun wollte. Kein Mensch wird ohne ein Körnchen Schmerz im Geist geboren, und diesen Schmerz wollte Mara nun aufschwelen sehen. Er starrte also in die Wiege und zeigte dem Säugling eine Reihe schrecklicher Masken. Du wirst deine Mutter nie wiedersehen, dachte Mara. Sie hat dich verlassen und jetzt erleidet sie furchtbare Qualen. Siddharthas Blick blieb fest, obwohl Mara sicher war, dass das Kind ihn gehört und sogar erkannt hatte.
»Gut«, sagte der Dämon, »du bist also gekommen.«
Er beugte sich tiefer über die Wiege und flüsterte dem Säugling ins Ohr: »Sage mir, was du willst. Ich lausche.« Das war stets der Schlüssel, die Sehnsüchte des Feindes, dort konnte er ihn packen. »Hörst du mich?« Das Kind strampelte mit seinen winzigen Füßchen.
»So viele Seelen brauchen dich.« Mara lehnte sich mit den Armen auf den Rand der Wiege. »Doch jetzt höre mir gut zu: Wenn du versagst, werden sie alle bei mir enden! Das verrate ich dir schon heute, damit du später nicht sagen kannst, ich hätte dich getäuscht. Werde ruhig ein Heiliger. Damit machst du dich nur zu einem besseren Werkzeug der Vernichtung. Ist das nicht wunderbar?« Wie als Antwort auf die gemeine Frage wurde das Klagegeheul um die tote Königin plötzlich lauter. Das Kind legte den Kopf auf die Seite und schlief augenblicklich ein.
Begräbnisrauch wälzte sich dick und ölig zum Himmel empor und verpestete die Luft. Mayas Leichnam brannte auf einem hohen Haufen von Sandelholzscheiten, die man im Wald geschlagen hatte. Der Ghatraj, der Begräbnismeister, war ein fetter, schwitzender Mann. Mit hochrotem Kopf schrie er nach mehr Holz, damit die Flammen noch höher lodern konnten, und befahl, mehr Ghee, das flüssige Butterschmalz aus der Milch der heiligen Kühe, auf den Leichnam zu schütten. Singende Priester gingen langsam um den Scheiterhaufen herum und Klagefrauen warfen Tausende von Ringelblumen in das Feuer. Hinter ihnen geißelten sich die bezahlten Trauergäste auf ihrer endlosen Prozession um das Feuer.
Suddhodana hasste dieses Schauspiel. Er hatte sich auch den Brahmanen widersetzt, die Maya zu den Ghats, den heiligen Badestätten am Fluss, hatten bringen wollen. Stattdessen hatte er befohlen, den Scheiterhaufen im Palastpark zu errichten. Maya hatte oft davon gesprochen, wie sie dort als Kind gespielt hatte, als eines der hochwohlgeborenen Mädchen, die zu Hofe geladen wurden, um zu sehen, ob vielleicht eine dem jungen Suddhodana gefiel. Nach Suddhodanas Willen sollte Maya ihre letzte Ruhestätte an einem Ort finden, den sie geliebt hatte. Dem König war jedoch auch bewusst, dass diese Geste nicht nur seiner Liebe entsprang, sondern auch seiner Schuld. Schließlich hatte nur er noch eine Zukunft und sie nicht.
Zum Abschluss des Rituals hob Canki, der Oberbrahmane, eine Axt – der heiligste Augenblick. Der Priester würde um die Befreiung von Mayas Seele beten, während Suddhodana den verkohlten Schädel zertrümmerte, um den Geist zu befreien, der darin wohnte. Der König kam mit versteinerter Miene an den Scheiterhaufen. Er blickte auf die Halskette aus Gold und Rubinen, die er in der Faust hielt. Diesen Schmuck, den er Maya in ihrer Hochzeitsnacht geschenkt hatte, legte er jetzt neben den Schädel.
Als Suddhodana sich dann umdrehte, ohne die Axt zu heben, legte Canki ihm, ohne zu zögern, eine Hand auf den Arm. Das konnte er, denn was dieses Begräbnis anging, war er der Herrscher.
»Ihr müsst es tun.«
Suddhodana hatte gewöhnlich keinen Hader mit dem Priesterstand. Auch war ihm bewusst, dass er einen geheiligten Brauch verletzt hatte, den er als König eigentlich ehren sollte. Das war seine Pflicht. Dennoch ekelte er sich in diesem Augenblick vor der Berührung des Priesters. Er drehte sich um und ging festen Schrittes auf den Palast zu.
Dann trat ihm eine Frau in den Weg. »Ihr müsst ihn anschauen, Majestät, bitte!«
Er brauchte einen Augenblick, bevor er begriff, dass er Kakoli, die Kinderfrau, vor sich hatte. Sie hatte Siddhartha auf dem Arm und schob ihn zaghaft seinem Vater zu. Tränen glänzten in ihren Augen. »Er ist kostbar. Er ist ein Geschenk.« Seit dem Tod seiner Königin hatte Suddhodana seinen Sohn nicht mehr sehen wollen. Er musste immer daran denken, dass Maya noch am Leben wäre, wenn der Junge nie geboren worden wäre.
»Du sagst, ich soll ihn anschauen? Soll er sich lieber das da anschauen.«
Suddhodana funkelte die Kinderfrau an und riss ihr den Säugling aus den Armen. Das Kind begann zu weinen, als sein Vater ihn über die Köpfe der Trauernden hob, damit er den verkohlten Leichnam sehen konnte.
»Majestät!« Kakoli versuchte, ihm das Kind abzunehmen, doch Suddhodana stieß sie zurück. Alle drehten sich um und starrten ihn an.
»Seine Mutter ist tot!«, rief er voller Bitterkeit. »Ich habe alles verloren. Ist das dein Geschenk?«, schrie er Kakoli an. Die alte Frau legte sich eine zitternde Hand auf den Mund, doch ihre Schwäche machte Suddhodana nur noch zorniger. Er trat auf sie zu und genoss es, wie sie erschrocken vor ihm zurückwich. »Hör auf zu flennen! Warum soll Siddhartha nicht sehen, wie schmutzig und verdorben diese Welt ist!«
Endlich gab er ihr das Kind zurück und marschierte weiter in Richtung Palast. Im großen Saal schaute er sich nach einer anderen Zielscheibe für seinen Zorn um, keine Frauen oder Priester, sondern jemand, der sich wehren und ihm einen Kampf liefern würde. Suddhodana brauchte jetzt ein Gefecht, in das er sich stürzen konnte, um zu vergessen.
Was er dann sah, ließ ihn auf der Stelle stehen bleiben. Eine alte Putzfrau kniete auf dem Boden und kratzte mit knorrigen Händen Asche aus dem Kamin. Graues Haar hing ihr wirr über die blutunterlaufenen Augen. Sie starrte ihn an und öffnete ihr Maul zu einem zahnlosen Lächeln. Suddhodana schauderte. Sein eigener, persönlicher Dämon war ihm erschienen. Er stand wie angewurzelt und fragte sich, welches Unheil sie ihm wohl zufügen wollte.
Die alte Hexe schüttelte mitleidig den Kopf. Dann nahm sie langsam eine Hand voll kalte Asche aus dem Kamin, hielt sie sich über den Kopf und ließ sie auf ihr Haar rieseln. So verhöhnte sie sowohl die Trauernden draußen im Park als auch den König.
Deine arme, schöne Frau. Jetzt ist sie bei uns. Wir lieben sie ebenso, wie du es getan hast.
Die Putzfrau rieb sich Asche ins Gesicht, dunkle Streifen und Flecke, bis nur noch der Mund und die stechenden Augen unbedeckt waren. Sie hatte ihn in der Falle. Wenn er zusammenbrach und all die Trauer und Furcht herausließ, die sich in ihm aufgestaut hatten, würde das eine Bresche in seine Verteidigung schlagen, die die Dämonen ausnutzen könnten. Jedes Mal, wenn er an Maya dächte, würden ihn grässliche Visionen heimsuchen. Andererseits, wenn er ihr widerstand und seine Trauer eisern in sich verschlossen hielt, würde er nie mehr vor den Dämonen Ruhe haben.
Die Alte wusste all das und wartete ab, wie er reagieren würde. Alle Angst wich aus Suddhodanas Blick, sein Blick wurde hart wie Feuerstein, und er stellte sich Mayas Gesicht vor. Dann nahm er eine Axt und zerschmetterte die Erinnerung an sie, ein für alle Mal. Die Luft um ihn herum stank nach dem Rauch, der aus dem Park hereintrieb. Sein Weg war der Weg des Kriegers.
Hundert Öllichter flackerten im Empfangssaal. Die Höflinge reckten die Hälse, um besser sehen zu können. Zuerst war es recht ruhig, doch als die Tieropfer begannen, änderte sich die Atmosphäre im Saal unter den Schreien der neugeborenen Ziegen und im Funkeln der Klingen. Die Höflinge begannen rastlos umherzulaufen und schwatzten so laut, dass sie fast die Gesänge der Brahmanen übertönten.
Suddhodana stand mitten in diesem Trubel. Er wurde allmählich ungeduldig. Der Anlass war die offizielle Namensgebung für seinen kleinen Sohn. Vor allem aber würden die Hofastrologen, die Jyotishis, an diesem Tag das Geburtshoroskop des Säuglings laut verlesen. Dieser Augenblick würde Siddharthas Schicksal und sein ganzes Leben beeinflussen. Doch die Astrologen ließen sich Zeit mit ihrem Urteil. Die vier alten Männer standen über die Wiege gebeugt, strichen sich die Bärte und plapperten Allgemeinplätze. »Venus steht günstig. Das zehnte Haus sieht vielversprechend aus; aber der Vollmond befindet sich in Konjugation mit Saturn. Sein Geist wird also seine Zeit brauchen, um sich zu entwickeln.«
»Wie viele von euch sind noch am Leben?«, brummte Suddhodana. »Wart ihr nicht früher fünf?«
Die unterschwellige Drohung ging jedoch ins Leere. Astrologen waren sonderbare Leute, die aber in hohen Ehren gehalten wurden. Sie gehörten der Kaste der Brahmanen an. Der König war zwar ihr Herr und konnte sie berufen und entlassen, doch in den Augen Gottes war er auch ihr Untergebener, da er nur zur Kriegerkaste, den Kshatriyas, gehörte. Nach Mayas Verbrennung hatte Suddhodana viele Tage in der Einsamkeit seines Schlafgemachs zugebracht. Doch es gab immer noch ein Königreich, um das er sich kümmern musste, und eine Thronfolge, die er der Welt und den Feinden, die an den Grenzen lauerten, präsentieren konnte. Es wäre ein Zeichen der Schwäche für die ganze Dynastie, wenn die Astrologen irgendwelche finstere Prophezeiungen aussprächen.
»Wird er leben oder wird er sterben? Sprecht schon!«, forderte Suddhodana sie auf.
Der Älteste unter den Jyotishis schüttelte den Kopf. »Es war das Karma der Mutter, dass sie sterben müsse, doch der Sohn wird leben.« Dies waren machtvolle Worte und jeder im Saal hörte und glaubte sie. Sie würden den Attentäter abschrecken, falls jemand einen solchen gedungen hatte, um den Prinzen zu ermorden, da in den Sternen stand, dass jeder Mordversuch scheitern musste.
»Weiter«, befahl der König. Der Lärm im Saal legte sich und bald herrschte erwartungsvolle Stille.
»Das Horoskop ist das eines Mannes, der einmal ein großer König sein wird«, intonierte der älteste Jyotishi klangvoll, damit möglichst viele der Versammelten ihn hören konnten.
»Warum hast du das nicht gleich gesagt? Weiter, lass uns alles hören!«, brüllte Suddhodana zornig, obwohl er im Stillen eine ungeheure Erleichterung empfand.
Die Astrologen wechselten besorgte Blicke. »Es gibt da gewisse … Komplikationen.«
»Komplikationen? Was wollt ihr damit sagen?« Suddhodana funkelte sie an. Sollten sie etwa wagen, etwas von ihrer Prophezeiung vor ihm zurückzunehmen? Der älteste Jyotishi räusperte sich. Canki, der höchste Brahmane, trat näher, bereit, einzuschreiten, falls es nötig würde.
»Vertraut Ihr uns, Majestät?«, fragte der älteste Jyotishi.
»Natürlich vertraue ich euch. Schließlich habe ich erst einen von euch hinrichten lassen, oder waren es zwei? Was wollt ihr also sagen?«
»Das Horoskop zeigt, dass Euer Sohn niemals der Herrscher über Shakya sein wird.« – Dramatische Stille. Der König fluchte in sich hinein. »Er wird vielmehr über alle vier Erdteile herrschen.«
Die Worte des Jyotishi zeigten die beabsichtigte Wirkung: Große Bestürzung, den Höflingen stockte der Atem, manche applaudierten, die meisten waren sprachlos. Nur Suddhodana schien unbeeindruckt.
»Wie viel bezahle ich euch? Zu viel. Erwartet ihr etwa, dass ich so etwas glaube?«, fragte er mit spöttischer Stimme. Er wollte den alten Mann auf die Probe stellen.
Bevor der Jyotishi antworten konnte, kam wieder Unruhe auf. Die Öllampen, die wie Wandersterne hin und her durch das Halbdunkel gezogen waren, standen plötzlich still. Die Höflinge machten eine Gasse frei und verbeugten sich, offenbar für jemanden, der soeben den Saal betreten hatte – eine Eminenz.
Asita, Asita, ging das Geflüster.
Suddhodana kannte den alten Einsiedler. Sie hatten sich schon einmal getroffen, vor langer Zeit, als Suddhodana sieben Jahre alt war. Damals hatten Soldaten ihn mitten in der Nacht geweckt und zu seinem Vater geführt, der im Hof auf ihn wartete. Der alte König saß auf einem schwarzen Hengst und hielt ein Pony für seinen Sohn. Der alte König sagte kein Wort, nickte nur und der kleine Zug ritt aus dem Palast. Suddhodana fürchtete sich, ein Gefühl, das sein Vater oft in ihm hervorrief. Sie ritten mit einer Leibgarde auf das Hochgebirge zu und hielten erst wieder an, als der Knabe fast im Sattel eingeschlafen war. Der alte König nahm den Jungen auf den Arm und ging allein mit ihm einen Geröllhang hinauf zu einer Höhle, die hinter Büschen und Felsbrocken versteckt lag, deren Ort der Vater jedoch genau zu kennen schien.
Er stand in der Morgendämmerung und rief: »Asita!« Nach einem Augenblick kam ein nackter Einsiedler aus der Höhle, seine Haltung war weder unterwürfig noch herausfordernd. »Du hast meine Familie seit Generationen gesegnet. Nun segne meinen Sohn«, sagte der König. Der Knabe starrte den nackten Mann an. Nach seinem Bart zu urteilen, der noch nicht vollkommen grau war, konnte er nicht älter als fünfzig sein. Wie konnte er die Familie seit Generationen gesegnet haben? Der alte König setzte ihn ab und Suddhodana lief zu dem Einsiedler und kniete vor ihm.
Asita beugte sich zu ihm hinab. »Willst du wirklich meinen Segen?« Der Junge war verwirrt. »Sei ehrlich.«
Suddhodana hatte in seinem kurzen Leben so manchen Segen empfangen. Die Brahmanen wurden bei dem kleinsten Wehwehchen herbeigerufen, selbst wenn dem Kronprinzen nur die Nase tropfte. »Ja, ich will deinen Segen«, sagte er deshalb ohne weiteres Nachdenken.
Asita blickte ihn an. »Nein. Du willst töten. Töten und erobern.« Der Knabe wollte widersprechen, doch Asita schnitt ihm das Wort ab. »Ich sage nur, was ich sehe. Du brauchst keinen Segen für dein Vernichtungswerk.« Der Einsiedler hielt seine Hände über das Haupt des Jungen, während er diese Worte sprach, als wäre dies der Segen, um den er gebeten worden war. Er nickte dem alten König zu, der etwas abseits stand, außer Hörweite.
»Empfange also den Segen des Todes«, sagte Asita, »das ist der Segen, den du verdienst und der dir in Zukunft gute Dienste leisten wird. Und jetzt geh.«
Der Knabe stand auf, verblüfft, aber nicht beleidigt, und lief zu seinem Vater zurück. Der schien mit allem zufrieden. Mit den Jahren erkannte der Junge, dass sein Vater ein schwacher König war, ein Vasall unter anderen Herrschern mit größeren und stärkeren Armeen. Er begann sich deswegen zu schämen, und obwohl er nie ganz begriff, was Asita mit dem Segen des Todes gemeint hatte, fand er es ganz natürlich, dass er zu einem grausamen und ehrgeizigen Mann heranwuchs.
»Dein Besuch ehrt uns.« Suddhodana fiel auf die Knie, als Asita auf ihn zukam. Der Einsiedler sah älter aus, jedoch nicht die drei Jahrzehnte älter, die vergangen waren, seit er ihn das letzte Mal gesehen hatte. Asita ignorierte den König und ging direkt zu der Wiege, blickte in sie hinab und wandte sich an die Jyotishis.
»Das Horoskop.« Er wartete, bis ihm die Schafhautrolle überreicht wurde und betrachtete die Zeichnungen für eine Weile.
»Ein großer König. Ein großer König«, sprach Asita mit matter, kalter Stimme. »Das wird er niemals sein.«
Im Saal herrschte gespanntes Schweigen.
Asita fuhr fort. »Doch was kümmern mich schon Throne und Königreiche?« Er schien den König kaum zu beachten, blickte immer nur auf das Kind.
»Die Sterne sagen eindeutig, dass er einmal ein großer Herrscher sein wird«, bekräftigte der älteste Jyotishi.
»Siehst du das nicht?«, fragte Suddhodana nervös.
Der Eremit benahm sich eigenartig. Er antwortete nicht, sondern kniete mit gebeugtem Haupt vor dem Säugling nieder. Siddhartha, der bis dahin ruhig gewesen war, wurde lebhaft, als das neue Gesicht über ihm erschien. Er strampelte mit den Füßchen und einer davon streifte Asitas Scheitel. Plötzlich rollten dem Alten Tränen über die Wangen, und Suddhodana beugte sich zu ihm hinab und zog ihn auf die Beine. Der ehrwürdige Asket ließ diese Geste zu, die einen Heiligen unter normalen Umständen tief beleidigt hätte.
»Was hast du gesagt?«, fragte er, plötzlich ein gebrechlicher alter Mann.
»Mein Sohn – warum wird er nicht über dieses Königreich herrschen? Wird er jung sterben? Sage es mir.«
Asita schaute den König an, als bemerkte er ihn jetzt zum ersten Mal. »Ja, er wird sterben. Für dich wird er sterben.« Die Höflinge traten unruhig auf der Stelle und murmelten einander zu, doch Suddhodana, der all diese Fragen im Geheimen hätte stellen sollen, kümmerte sich nicht mehr darum, wer ihn hörte oder nicht. »Erkläre, was du meinst«, verlangte er.
Asita bemerkte die Verwirrung und Sorge in der Miene des Königs. So erklärte er: »Die Bestimmung des Knaben ist zweierlei. Eure Jyotishis haben nur einen der beiden Wege richtig erkannt.«
Asita sprach zum Vater, schaute aber stets nur den Sohn an. »Du willst ihn zu einem König machen, doch vielleicht wird er den anderen Weg wählen, seine zweite Bestimmung.«
Suddhodana war vollkommen perplex. »Seine zweite Bestimmung?«
»Die Herrschaft über seine eigene Seele.« Ein erleichtertes Lächeln huschte über Suddhodanas Züge, worauf Asita sagte: »Glaubst du, das sei so einfach?«
»Ich glaube, nur ein Dummkopf würde die Welt für ein solches Schicksal eintauschen, und ich werde gewiss dafür sorgen, dass mein Sohn nicht zu einem Dummkopf heranwächst.«
»Wenn er erst für dich gestorben ist, wird dir nichts mehr gewiss sein.« Der König lächelte nicht mehr. Asita fuhr fort:
»Du irrst. Die Welt zu beherrschen ist ein Kinderspiel. Wer aber seine Seele wahrhaft beherrscht, beherrscht damit die ganze Schöpfung. Er ist mächtiger als die Götter.«
Das war noch nicht alles, was der Einsiedler zu sagen hatte. »Auch du erscheinst in seinem Horoskop. Du wirst entweder um deinen Sohn leiden, wie noch kein Vater je gelitten hat, oder du wirst dich ihm unterwerfen.«
»Du bist es, der irrt, alter Mönch!«, brüllte Suddhodana. »Ich kann ihn zu allem machen, was ich will!« Suddhodanas Gesicht war fleckig vor Zorn. »Und jetzt raus! Alle raus!«
Selbst für die sensationslüsternen Höflinge war dies zu viel des Dramas. Viele der Öllichter waren schon spotzend verloschen und in dem Schummerlicht wirkten die Gestalten, die sich nun tief verbeugt von ihrem König zurückzogen, wie gespenstische Schatten, die Jyotishis vorneweg unter unzähligen Entschuldigungen und ängstlichen Segenswünschen. Canki wollte der Letzte sein, der den Saal verließ, doch der König bedachte ihn mit Blicken wie Dolchstiche, sodass der Priester es für ratsam erachtete, ebenfalls schnellstens zu verschwinden.
So war nach einem Augenblick nur noch Asita übrig, und Suddhodana, endlich ohne Publikum, konnte schließlich offen reden. »Stimmt das alles, was du soeben gesagt hast? Ich kann nichts daran ändern?«
»Ganz gleich, was ich sage, du wirst dennoch versuchen, es zu ändern.« Als der König nichts entgegnete, machte Asita ebenfalls Anstalten, sich zurückzuziehen, doch Suddhodana rief ihn zurück.
»Sage mir eines: Weshalb die Tränen, als du meinen Sohn erblicktest?«
»Weil ich nicht lange genug leben werde, um die unsterbliche Wahrheit zu hören, die Buddha verkünden wird«, war Asitas Antwort.
4
Am nächsten Morgen war Suddhodanas Trübsal wie verflogen. Er ließ sein Schlachtross kommen und ritt zu dem imposanten Tempel des Shiva hinauf, den sein Vater auf dem Hügelkamm hatte errichten lassen.