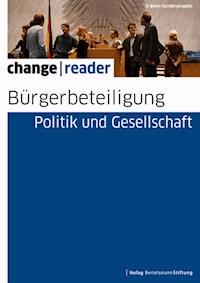
Bürgerbeteiligung - Politik und Gesellschaft E-Book
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Bertelsmann Stiftung
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Bürgerbeteiligung ist das neue Schlüsselwort im 21. Jahrhundert. Die Menschen wollen frühzeitig und aktiv in die Diskussionsprozesse und Entscheidungen gesellschaftspolitischer Ideen und Projekte eingebunden werden. Diesem Wunsch sollte in einer Demokratie von allen Seiten offen und konstruktiv begegnet werden. Für die Politik sind aktive Bürgerinnen und Bürger eine großartige Chance, Entscheidungen auf eine breitere und nachhaltige Basis zu stellen. Der E-Book-Reader "Bürgerbeteiligung - Politik und Gesellschaft" ergänzt die Schwerpunktausgabe "Bürgerbeteiligung" unseres Magazins change im Juni 2011. Die Beiträge beleuchten das Thema Bürgerbeteiligung in seinen unterschiedlichen Facetten in Politik und Gesellschaft. Das gesellschaftliche Engagement besonders von älteren Menschen ist dabei ein Schwerpunkt. Bei den Beiträgen handelt es sich um Auszüge aus Büchern des Verlags Bertelsmann Stiftung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Bürgerbeteiligung ist das neue Schlüsselwort im 21. Jahrhundert. Die Menschen wollen frühzeitig und aktiv in die Diskussionsprozesse und Entscheidungen gesellschaftspolitischer Ideen und Projekte eingebunden werden. Diesem Wunsch sollte in einer Demokratie von allen Seiten offen und konstruktiv begegnet werden. Für die Politik sind aktive Bürgerinnen und Bürger eine großartige Chance, Entscheidungen auf eine breitere und nachhaltige Basis zu stellen.
Der E-Book-Reader „Bürgerbeteiligung – Politik und Gesellschaft“ ergänzt die Schwerpunktausgabe „Bürgerbeteiligung“ unseres Magazins change im Juni 2011. Die Beiträge beleuchten das Thema Bürgerbeteiligung in seinen unterschiedlichen Facetten in Politik und Gesellschaft. Das gesellschaftliche Engagement besonders von älteren Menschen ist dabei ein Schwerpunkt. Bei den Beiträgen handelt es sich um Auszüge aus Büchern des Verlags Bertelsmann Stiftung. Weitere Informationen zu unseren Verlagsprodukten finden Sie unter www.bertelsmann-stiftung.de/verlag.
Wir freuen uns über Ihr Interesse und wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.
Karin SchlautmannLeiterin Kommunikationder Bertelsmann Stiftung
Älter werden – aktiv bleiben (Leseprobe)
Auszug aus:Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) Älter werden – aktiv bleibenBeschäftigung in Wirtschaft und Gesellschaft Carl Bertelsmann-Preis 2006 Gütersloh 2006 ISBN 978-3-89204-906-7 © Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh
Bürgerschaftliches Engagement in der zweiten Lebenshälfte: Freiwillige Tätigkeiten in Wechselwirkung zur Erwerbsarbeit
Gerd Placke, Birgit Riess
Einführung
Wachstumsbereich Engagement
Freiwilliges und bürgerschaftliches Engagement ist in Deutschland entgegen allen periodischen Unkenrufe von Seiten der Medien (»Die Gesellschaft auf dem Ego-Tripp« und Ähnliches mehr) ein Wachstumsbereich: Der im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend durchgeführte zweite Freiwilligensurvey von 2004 ergab, dass die Gesamtzahl der aktiven Bundesbürger seit der ersten Befragung aus dem Jahre 1999 um zwei Prozentpunkte auf 36 Prozent (aller Bürger ab 14 Jahre) angestiegen ist. Das sind mehr als 23,4 Millionen Menschen. Dabei stellen erfreulicherweise die Jugendlichen die Gruppe, in der das höchste Potenzial an Engagement herrscht, während innerhalb der Alterskohorte ab 60 Jahre das Engagement am meisten gegenüber den ersten Ergebnissen gestiegen ist – von 26 auf 30 Prozent. Und in der Gruppe der jüngeren Senioren im Alter von 60 bis 69 Jahren erhöhte sich das Engagement sogar von 31 auf 37 Prozent, ebenso begleitet von einem starken Anstieg des Engagementpotenzials (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2005: 15 – 17, ausführlich 303 – 345).
Neue Rollenfindung in der Nacherwerbsphase
In dieser Hinsicht besteht also kein Grund zur Beunruhigung – es existiert eine hohe Engagementbereitschaft in der Bevölkerung über alle Generationen hinweg, und es gibt auch ein tatsächlich hohes Engagement in der Nacherwerbszeit, genährt durch das hier stereotyp wiedergegebene Phänomen, dass viele Menschen kurz nach der Verrentung merken, dass ein sinnerfülltes Leben sich nicht darin erschöpft, dass man morgens länger schlafen, ausführlich Zeitung lesen und lange Spaziergänge machen kann, wenn man nicht mehr täglich zur Arbeit muss, was bedeutet, dass die Nacherwerbszeit mit einer neuen Rollenfindung einhergeht.
Frühverrentung und Engagementquote
Mit Nachdruck muss man für Deutschland allerdings in Rechnung stellen, dass diese hohe Engagementquote auch vor dem Hintergrund einer hohen Zahl von Frühverrentungen zu sehen ist und die Leistungsfähigkeit der Älteren sicherlich genauso gut in der Erwerbsarbeit zum Tragen kommen könnte. Diese These wiegt umso schwerer, weil dieses dritte Lebensalter historisch gesehen eine neue Herausforderung darstellt. Denn erstmals haben Menschen nach Beendigung ihrer Erwerbstätigkeit noch 20 oder 30 Jahre aktives Leben vor sich, für die keine vorgegebenen Rollenmuster vorherrschen (Wouters 2005). Deswegen kann es in der Debatte um die Vitalität der älteren Generation nicht darum gehen, die Tatsachen eines frühen Ausscheidens aus dem Berufsleben zu akzeptieren und die Menschen zur Übernahme freiwilliger Tätigkeiten zu animieren. Wir brauchen stattdessen neue »hybride« und alternsgerechte Arrangements zwischen Erwerbsarbeit und Engagement, die Menschen individuelle Lösungen ihrer Lebensgestaltung ermöglichen.
»Corporate volunteering«
Weil diese Lösungen auch in vielfältigen Mischformen zwischen Arbeit und Engagement zu suchen sind, verbinden wir im Folgenden mit dem Begriff »bürgerschaftliches Engagement« nicht nur die gering formalisierten freiwilligen Einsätze in unterschiedlichen Organisationsformen bis hin zur Ausübung klassischer (Wahl-)Ehrenämter und zu anderen gemeinwohlbezogenen Tätigkeiten in Gruppen oder Initiativen. Wir subsumieren hierunter zudem diejenigen Engagementformen, die mit Begriffen wie »freiwilliges Arbeitnehmerengagement« oder »corporate volunteering« beschrieben werden. Sie sind Ausdruck einer allgemein verstandenen Verantwortungsübernahme durch die Wirtschaft. Wir wollen mit dieser begrifflichen Inklusion herausstellen, mit welchen Möglichkeiten Unternehmen Beiträge zu gesellschaftlichem Zusammenhalt aus wohlverstandem Eigennutz leisten können. Es sei angemerkt, dass es bei diesen Formen von Arbeitnehmerengagement fließende Übergänge hin zur Erwerbsarbeit gibt, bei denen die eindeutige Zuordnung schwierig ist. Bei genauem Hinsehen birgt dieses Arbeitnehmerengagement aber Potenziale, die für eine spätere Aktivierung von freiwilligen Tätigkeiten in der Nacherwerbszeit nutzbar gemacht werden können. Weitgehend unberücksichtigt bleiben im Artikel hingegen die vielen informellen Engagementformen, die in Nachbarschaft und Familie durch Ältere erbracht werden (Enquete-Kommission 2002: 73 – 76).
Notwendigkeit des Umdenkens
»Eindeutige« Begriffe und fest gefügte Vorstellungen helfen also nicht mehr weiter. Wir stehen vor gesellschaftlichen Herausforderungen, bei denen alle gesellschaftlichen Akteure umdenken müssen. Dies betrifft einerseits die Menschen selbst, wenn Sie sich häufig genug »von heute auf morgen« damit konfrontiert sehen, mit eigenen Anstrengungen einen neuen Lebenssinn suchen zu müssen. Sie sind aufgefordert, sich im Angesicht immer unsicherer werdender Erwerbsbiographien und einer langen Nacherwerbszeit rechtzeitig und aktiv mit diesem Lebensabschnitt auseinanderzusetzen.
Andererseits betrifft es aber auch die Wirtschaft, die zum einen – bisweilen übereilig – auf den Erfahrungsschatz älterer Mitarbeiter verzichtet und zum anderen in der Vergangenheit wenig Anstrengungen unternommen hat, für ihre Mitarbeiter Übergangsmanagement zur Vorbereitung auf die dritte Lebensphase zu leisten. Sie ist aufgefordert, das humane Kapital des Unternehmens besser zu binden, es über solche Angebote auch für den Betrieb zu motivieren und frühzeitig auf die nächste Lebenszeit vorzubereiten. Nicht zuletzt betrifft es die Politik, die diesen Aspekt des demographischen Wandels neu gestalten muss. Sie ist aufgefordert, die Rahmenbedingungen innerhalb der letzten Phase der Erwerbsarbeitszeit sowie innerhalb des bürgerschaftlichen Engagements so einzurichten, dass Menschen für die Zeit nach der Erwerbstätigkeit Orientierungshilfen bekommen. Gleichzeitig kommt auf sie die Aufgabe zu, die zu entwickelnden Vorhaben in so etwas wie ein Konzept eines »lebenslangen Lernens und Ausübens« von bürgerschaftlichem Engagement einzubinden, denn alle Untersuchungen bekunden, dass Engagement früh gelernt und stetig (re-)animiert werden muss, um das soziale Kapital einer Gesellschaft zu steigern (Offe und Fuchs 2001: 432 – 441).
Schwerpunktsetzung
Im Folgenden soll zunächst der Schwerpunkt auf einige infrastrukturelle Voraussetzungen und Rahmenbedingungen gelegt werden, die das bürgerschaftliche Engagement in der zweiten Lebenshälfte bestimmen. Der Fokus liegt auf dem in der sozialwissenschaftlichen Forschung festgestellten »Strukturwandel des Ehrenamts«. Besondere Berücksichtigung erfahren danach die Wechselwirkungen zwischen Erwerbsarbeit und bürgerschaftlichem Engagement, denn zwischen diesen Tätigkeitssphären verwischen die Grenzen zunehmend und verändern sich auch die Bedeutungszuschreibungen von gesellschaftlich nützlicher Arbeit insgesamt. Wenn sich corporate-volunteering-Aktivitäten diese wechselseitigen Dynamiken zunutze machen, haben sie positive Auswirkungen auf die Beschäftigungs- und Engagementfähigkeit von Menschen und können dementsprechend Durchlässigkeiten für die Zeit nach der Erwerbsarbeit generieren. Deshalb gehen wir schließlich ausführlich auf die Möglichkeiten der Wirtschaft bei der Förderung bürgerschaftlichen Engagements in der zweiten Lebenshälfte ein.
Infrastrukturelle Voraussetzungen und Rahmenbedingungen bürgerschaftlichen Engagements bei der älteren Generation
Strukturwandel des Ehrenamts
Bürgerschaftliches Engagement befindet sich nicht in der Krise, es befindet sich in einem Wandlungsprozess seiner Strukturen und Bedingungen. In unserer Gesellschaft, mit ihrer Signatur Pluralisierung von Lebensentwürfen und Sinndeutungen (Stichwort: Individualisierung), ist ein Wandel zu beobachten, der sich auf das Engagement auswirkt. Dieser Wandel besteht in einer veränderten Einstellung der Freiwilligen zu ihrer Tätigkeit: Das traditionelle Ehrenamt war (und ist dort, wo es noch stattfindet, weiterhin) durch ein ausgeprägtes Maß an Pflichtbewusstsein und Selbstlosigkeit charakterisiert und findet seinen Ausdruck in einer langfristigen ehrenamtlichen Tätigkeit. Seine Motivation bezieht es aus (christlicher) Nächstenliebe und/oder dem Bewusstsein, gemeinsam verantwortlich für die Lösung sozialer Probleme zu sein.
Selbstentfaltungswerte
In den letzten Jahrzehnten hat sich eine Haltung Bahn gebrochen, bei der Engagement anderen und sich selber nützen soll. Pflichtwerte nehmen ab, Selbstentfaltungswerte nehmen zu. Daher findet gegenwärtig eine Neuverteilung der Ressourcen statt. Am Freizeitverhalten der Menschen orientiertes Engagement nimmt zu, wenn es in zeitlich übersichtlichen Projekten erfolgt, während soziales, ehrenamtliches Engagement tendenziell abnimmt, wenn die Angebote sich nicht diesen Bedingungen anpassen. Dieser Wandel beinhaltet für die Gemeinwohlorganisationen also die Chance, die Attraktivität ihrer Engagementangebote zu erhöhen und damit auch wieder die Zahl freiwillig Engagierter in ihren Organisationen. Partizipation an Entscheidungsprozessen, Berücksichtigung von Bedürfnissen und Erfahrungen der freiwillig Tätigen sowie Initiierung und Förderung neuer Engagementformen sind in dieser Hinsicht bedeutsame Faktoren.
Das »neue« Engagement
Auch für die älteren Engagierten gelten diese allgemeinen Trends, die das Engagement insgesamt kennzeichnen: höheres Selbstbewusstsein, gestiegene Ansprüche an das Engagement und seinen organisatorischen Rahmen und die zunehmende Bereitschaft, sein Engagement auch zu wechseln oder zu beenden, wenn die Bedingungen nicht stimmen.
Engagement von Senioren
Aber es gibt auch viele eigenständige Charakteristika des Engagements von Senioren gegenüber den Einstellungen von Jugendlichen und Erwachsenen. Zunächst vertreten Ältere im öffentlichen Raum stark ihre persönlichen Wertorientierungen und engagieren sich stärker politisch als andere Altersgruppen. Diese Haltung liegt sicherlich in der Tatsache begründet, dass für sie Pflichterfüllung einen hohen Wert darstellt und dementsprechend ihr Engagement weiterhin mit einer hohen Selbstverpflichtung einhergeht.
Im Gegenzug unterscheiden Ältere sich zudem deutlich von Menschen im Alter von unter 60 Jahren, indem sie ihre eigenen persönlichen Interessen weniger an das freiwillige Engagement herantragen als diese. Damit bewahren sie in ihrer Haltung Engagementerfahrungen, die häufig nicht zu den Engagementwünschen von Jüngeren passen, die erlebnisorientierter sind und neuen Erfahrungen offener gegenüberstehen. Die spezifische Lebenssituation der Älteren kommt auch darin zum Ausdruck, dass sie ihr Engagement zum Knüpfen von Kontakten nutzen. Sie neigen wohl deshalb – ähnlich wie die Jugendlichen – zu der eigenen Peergroup: Wenn ältere Menschen sich um eine bestimmte Zielgruppe kümmern, dann bevorzugt um Menschen nahezu gleichen Alters (Enquete-Kommission 2002: 340 – 346).
Förderung von Freiwilligendiensten
Hier bleibt es Aufgabe der zivilgesellschaftlich und politisch Beteiligten, nach mehr Möglichkeiten zu suchen, wie Alt und Jung generationenübergreifend aktiv werden können, um dem anhaltenden Trend sich auflösender sozialer Milieus neue Formen gesellschaftlichen Zusammenhalts entgegenzusetzen. Die Bundesregierung setzt diesbezüglich neuerdings auf Freiwilligendienste, die allen Generationen offenstehen (www.bmfsfj.de), und hat 2002 das bis Mitte 2006 laufende Bundesmodellprogramm »SeniorTrainer – Erfahrungswissen für Initiativen« initiiert. Anhand dieses Modellprojekts soll deutlich gemacht werden, mit welchen innovativen Angeboten kompetente ältere Menschen in Zukunft für eine Tätigkeit rekrutiert werden können und wie diese Angebote auf die Veränderungen im Freiwilligensektor reagieren.
»SeniorTrainer – Erfahrungswissen für Initiativen«
Das Ziel des in zehn Bundesländern laufenden Modellprogramms »Erfahrungswissen für Initiativen« ist es zu zeigen, was Ältere mit ihrem Wissen, das sie im Laufe ihres Lebens gesammelt haben, in der Rolle des SeniorTrainers für die Gesellschaft leisten können, wenn sie für die Bedürfnisse des Freiwilligensektors gut ausgebildet werden. Dazu werden sie in neuntägigen Kursen für Leitungs- und Multiplikatorenfunktionen im freiwilligen Engagement qualifiziert. Sie unterstützen, beraten und begleiten anschließend Freiwilligeninitiativen, Einrichtungen, Vereine und Verbände bei ihrer Arbeit oder bauen eigene Projekte auf. Die von ihnen in verschiedenen Engagementbereichen wahrgenommenen Tätigkeiten und Funktionen lassen sich nach den im Internet dokumentierten Ergebnissen auf diese Betätigungen verdichten: Berater und Unterstützer, Initiator von Projekten, Anreger und Vernetzer von bürgerschaftlichem Engagement und Wissensvermittler. Vielerorts schließen sie sich zu Kompetenzteams zusammen, in denen sie sich gegenseitig bei ihren freiwilligen Tätigkeiten mit Rat und Austausch unterstützen. Nach Aussagen der Projektverantwortlichen waren circa 1000 Ältere daran beteiligt. Von den SeniorTrainern sollen bereits über 1000 Projekte aufgebaut oder betreut worden sein (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2006: 3).
Förderung neuer Altersbilder
Das Programm berücksichtigt ein optimistisches Altersbild, das zur Weiterentwicklung der Bürgergesellschaft beitragen soll und eine gesellschaftliche Balance zwischen Alt und Jung unterstützt. Damit soll der Orientierung zur eigenen Peergroup entgegengesteuert werden, um gesellschaftlichen Zusammenhalt über die Altersgrenzen hinweg zu fördern. Gleichzeitig sollen neue Potenziale der Älteren aktiviert und für die Mitwirkung gewonnen werden. SeniorTrainer sind in diesem Sinne »Pioniere einer stärker zivilgesellschaftlichen Orientierung des bürgerschaftlichen Engagements der Älteren«, wie die Website des Modellprogramms postuliert (www.efi-programm.de).
Neue Zugangswege zum Engagement
Das Modellprogramm liefert auch einen Beitrag zur Debatte um zeitgemäße Zugangswege zum (neuen) Engagement, wenn soziale Milieus nicht mehr länger, wie in der Vergangenheit, quasi naturwüchsig Menschen ins Engagement bringen. In den vergangenen Jahren sind hier neben Selbsthilfekontaktstellen und Seniorenbüros Freiwilligenagenturen hervorgetreten, die durch neue und niedrigschwellige Beratungen und Informationen Wege zur Freiwilligentätigkeit im lokalen Umfeld ebnen und dieses Engagement verstetigen, indem sie Menschen begleiten und Organisationen »fit machen« für die »neuen Freiwilligen«.
Institutionelle Unterstützung
Diese drei so genannten »infrastrukturfördernden Einrichtungen« des bürgerschaftlichen Engagements stehen den SeniorTrainern nach ihrer Ausbildung als lokale Berater und Moderatoren zur Seite. Sie stellen ihnen Büroinfrastruktur und Internet-Zugänge zur Verfügung. Sie unterstützen sie beim Zugang zu Institutionen, bei der Öffentlichkeitsarbeit und fördern die Selbstorganisation sowie den Erfahrungsaustausch der SeniorTrainer. Auf diese Weise arbeiten Ältere mit den Agenturmitarbeitern als Co-Produzenten für lokales Engagement (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2006: 13).
Wechselwirkungen zwischen Erwerbsarbeit und Engagement
Wirkungen von Engagement
Anhand aller Altersgruppen kann man die förderlichen Wirkungen des bürgerschaftlichen Engagements für den Arbeitsmarkt aufzeigen, weil in freiwilligen Einsätzen Kommunikations- und Teamfähigkeit, soziale Kompetenz und Führungskompetenz sowie die Fähigkeit zur Bewältigung komplexer Situationen vermittelt wird: Für junge Menschen erhöht freiwilliges Engagement die Chancen, eine erste Anstellung zu finden, bei älteren Arbeitnehmern dient ehrenamtliches Engagement als Orientierungsinstrument sowohl im Hinblick auf die letzte Phase des Berufslebens als auch auf die nachberufliche Zeit. Im Falle von Erwerbstätigen im mittleren Alter offeriert es Möglichkeiten, sich innerhalb der Arbeit fortzubilden oder gar Perspektiven für einen Jobwechsel zu entwickeln. Diese letztgenannte Tatsache hat beispielsweise in den Niederlanden zur Folge, dass es vor dem Hintergrund einer niedrigeren Arbeitslosenrate als in Deutschland tarifvertragliche Vereinbarungen gibt, freiwillig engagierte Mitarbeiter in gemeinnützigen Organisationen bei entsprechendem Interesse als interne Bewerber auf Stellenausschreibungen zu berücksichtigen.
Anerkennung von Freiwilligenarbeit
Anders als in den Niederlanden ist man in Deutschland noch nicht so weit, bürgerschaftliches Engagement zum Thema von Tarifverhandlungen zu machen. Es ist zudem noch weitgehend ungeklärt, wie Fähigkeiten öffentlich anerkannt werden sollen, die außerhalb der traditionell zuständigen Institutionen erworben werden. Nicht zuletzt die Ergebnisse der PISA-Studie haben die schon länger existierende Einsicht verstärkt, dass Noten und Zeugnisse nur bedingt Abbilder tatsächlichen Leistungsvermögens sind. Dieser Umstand hat in vielen Unternehmen dazu geführt, dass die Aussagekraft von »harten« Qualifikationsnachweisen relativiert wird. So spielt die Erfassung, Anerkennung und Bewertung außerhalb der Schule erworbener Qualifikationen bei der Einstellung von Arbeitskräften und Auszubildenden in der Personalbeurteilung insgesamt eine zunehmend wichtigere Rolle. Deshalb fängt auf Seiten der Unternehmen der strategische Umgang mit bürgerschaftlichem Engagement wohl dort an, wo man sich systematisch darüber Gedanken macht, in welcher Wertigkeit freiwilliges Engagement und die dabei erworbenen Kompetenzen bei einer Bewerbung und in der Personalentwicklung insgesamt berücksichtigt werden sollen. Dabei ist davon auszugehen, dass etwa eine betriebsöffentliche Aufwertung von engagierten Mitarbeitern als mögliche erste Maßnahme in diese Richtung sie bindet und motiviert.
Erwerbsarbeit und Engagement
Auch wenn also in der öffentlichen Diskussion Erwerbsarbeit und bürgerschaftliches Engagement bisweilen als zwei Pole gesellschaftlicher Gestaltung einander gegenübergestellt werden, demnach Erwerbsarbeit innerhalb der Arbeitszeit stattfindet, entlohnt wird und einen gesellschaftlichen Status garantiert und die Facetten bürgerschaftlichen Engagements indessen der Freizeit zugeordnet werden, nicht entlohnt und vordergründig »uneigennützig« sind: Eine genaue Prüfung der Konfliktlinien zwischen Erwerbsarbeit und bürgerschaftlichem Engagement macht deutlich, dass die Bedeutungszuschreibungen nicht so eindeutig sind und angesichts der demographischen Herausforderungen ein neues Denken Platz greifen könnte, das auf die reziproken Verstärkungseffekte setzt.
Konfliktlinien
Die Konfliktlinien zwischen Engagement- und Erwerbstätigkeiten kann man in konzentrierter Form auf drei Ebenen mit jeweils zwei Konstatierungen darstellen (Kistler, Rauschenbach 2001: 152):
Erste Ebene: Substitutionseffekte Ehrenamt führt in die Erwerbsarbeit (Professionalisierung) versus Erwerbsarbeit wird von Ehrenamt verdrängt (Billigkonkurrenz)Zweite Ebene: Effekte der Komplementarität und Brückenfunktion Ehrenamtliches Engagement wird durch den Beruf befördert (Komplementarität), gleichzeitig werden Berufschancen durch das Ehrenamt befördert (Brückenfunktion)Dritte Ebene: Vereinbarkeit Entgrenzung der Erwerbsarbeit verdrängt Ehrenamt (Zeitkonkurrenz) versus Flexibilisierung der Erwerbsarbeit fördert Ehrenamt (Zeitfenster)Corporate volunteering
Corporate-volunteering-Aktivitäten machen sich auf ihre Weise die positiven Wechselwirkungen zwischen Arbeit und Engagement zunutze. So kann eine Freiwilligentätigkeit, die sich an der Berufstätigkeit des freiwillig Aktiven orientiert, das berufliche Engagement verstärken und ergänzen. Daneben wirkt sie ausgleichend, wenn Menschen nach alternativen Gestaltungsmöglichkeiten für die nachberufliche Zeit suchen. Im Ruhestand bekommt sie dann häufig den Charakter einer alternativen Aufgabe (Schumacher: 190 f.).
Die Rolle der Wirtschaft bei der Förderung bürgerschaftlichen Engagements
Ergebnisse des 2. Freiwilligensurveys
Der zweite Freiwilligensurvey ermöglicht auch erstmals für die Bundesrepublik einen repräsentativen Überblick über die Unterstützung von freiwilligem Engagement durch die Arbeitgeber aus Sicht der befragten Freiwilligen. Generell betrachtet, scheint aus deren Sicht Unterstützung nicht üblich zu sein, weil das Verhältnis von Unterstützung zu ausbleibender Unterstützung bei 29 zu 53 Prozent als unausgeglichen zu bezeichnen ist und eindeutig Verbesserungsbedarf besteht.
Binnenansichten
Nichtsdestoweniger ermöglicht eine ausführlichere Analyse interessante Binnenansichten von der Situation zur Förderung freiwilligen Engagements am Arbeitsplatz. So erhalten Vorarbeiter, Meister, Angestellte im öffentlichen Dienst sowie höhere Beamte und leitende Angestellte generell mehr Unterstützung für ihr Engagement als andere Gruppen. Nach Sektoren geordnet, gab es im gemeinnützigen und kirchlichen Bereich eine besonders hohe Unterstützungsquote. Sie lag sicherlich deshalb bei 50 Prozent, weil in diesem Bereich ehrenamtliche Arbeit konstitutiv für das Tätigkeitsfeld ist und man deshalb von einem Selbstverständnis ausgehen kann, das beispielsweise Freistellungen eher ermöglicht als anderswo. Demgegenüber liegt die Unterstützungsquote für freiwilliges Engagement in der privaten Wirtschaft bei 21 Prozent. Am selbstverständlichsten scheint die Unterstützung hier im Handwerksbereich zu sein (31 Prozent), während die Industrie nur eine Rate von 21 Prozent vorweisen kann, wobei kleinere Betriebe dies eher ermöglichen als große Unternehmen (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2005: 182 – 186).
Schlüsselfunktion der Wirtschaft
Auch wenn die Zahlen des Freiwilligensurveys noch keine breite Unterstützung des freiwilligen Arbeitnehmerengagements erkennen lassen, kommt der Wirtschaft in dieser Hinsicht zukünftig sicherlich eine Schlüsselfunktion zu. Unternehmen engagieren sich in Deutschland traditionell in ihrem sozialen Umfeld. Insbesondere für mittelständische und eigentümergeführte Unternehmen ist es selbstverständlich, als »guter Bürger« uneigennützig mit Geld- und Sachspenden lokale gemeinwohlorientierte Projekte zu unterstützen. Die inhaltliche Ausrichtung dieses Engagements ist meist auf persönliche Kontakte oder Präferenzen der Eigentümer zurückzuführen. Eine strategische Verknüpfung mit den Unternehmenszielen war bisher in den meisten Fällen damit nicht intendiert. Das bürgerschaftliche Engagement von Mitarbeitern wird überwiegend als reine Privatsache betrachtet, die keinen Bezug zum Unternehmen aufweise.
»Corporate social responsibility«
Seit wenigen Jahren wird diese philanthropisch geprägte Grundhaltung auch hierzulande zunehmend ergänzt durch eine strategische Herangehensweise an gesellschaftliche Verantwortungswahrnehmung von Unternehmen, die im angloamerikanischen Kontext eine lange Tradition hat. Vor dem Hintergrund der Globalisierung des Wirtschaftens und des sozialstaatlichen Wandels wird die Rolle des Unternehmens in der Gesellschaft unter den Begriffen »corporate social responsibility« und »corporate citizenship« neu diskutiert. Darin kommt die veränderte Erwartungshaltung der so genannten Stakeholder – gesellschaftlicher Akteure, die ein erkennbares, genuines Interesse an der Thematik besitzen, wie z.B. Aktionäre, Kunden, Mitarbeiter, Politik, Nonprofit-Organisationen – an unternehmerisches Handeln zum Ausdruck. Unternehmen sind aufgefordert, stärkere Verantwortung für ihr soziales, ökologisches und gesellschaftliches Umfeld zu übernehmen. Und dies liegt im wohlverstandenen Eigeninteresse des Unternehmens, um Reputation und Marktchancen zu sichern. Gesellschaftliches Engagement wird dementsprechend insbesondere bei großen Unternehmen mit wirtschaftlichen Zielen verknüpft und dient der Absicherung des operativen Geschäfts.
Zunahme des »corporate volunteering«
Mit einer solchen strategischen Herangehensweise ändert sich in der Regel auch die Art des gesellschaftlichen Engagements. In diesem Sinne entwickeln Unternehmen Programme, um das bürgerschaftliche Engagement ihrer Mitarbeiter gezielt zu fördern. Im Gegensatz zu den USA ist das so genannte »corporate volunteering« eine neue und nicht sehr verbreitete Entwicklung (Backhaus-Maul 2004: 27), aber die Veröffentlichungen guter Unternehmenspraxis in jüngster Zeit lassen den Schluss zu, dass immer mehr Unternehmen diese Engagementform für sich entdecken. Unternehmen verbinden mehrere Zielsetzungen mit corporate volunteering:
Folgen
Gesellschaftlicher Nutzen
Aber corporate volunteering birgt auch hohen gesellschaftlichen Nutzen und kann zu effektiven Problemlösungen beitragen. Darüber hinaus beinhalten entsprechende Programme ein hohes Potenzial, bürgerschaftliches Engagement im Allgemeinen und das Engagement Älterer im Besonderen zu fördern:
Erwerbstätige sind deutlich häufiger engagiert als Erwerbslose (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2005: 67). Daher ist das Unternehmen besonders geeignet, hier eine Multiplikatorfunktion zu übernehmen.Der Grundstein für bürgerschaftliches Engagement wird während des mittleren Erwachsenenalters gelegt und beginnt damit in der Erwerbsphase (Barkholdt 2004: 39). Unternehmen können ihre Mitarbeiter frühzeitig an ein Engagement, das sich zum Beispiel in der Nacherwerbsphase »auszahlen« könnte, heranführen. Der Übergang in den Ruhestand kann aktiv gestaltet werden, um zu verhindern, dass die Mitarbeiter mit Eintritt in den Ruhestand in ein »Sinn-Loch« fallen. Stattdessen sollten sie frühzeitig sinnstiftende Perspektiven entwickeln können.Vielfältige Engagementformen
In der Praxis zeichnen sich vielfältige Engagementformen im Bereich corporate volunteering ab. Die Ausgestaltung hängt insbesondere mit der vom Unternehmen damit verbundenen Zielstellung ab. Auf einige Engagementformen, die besonders geeignet sind, der älteren Mitarbeiterschaft im Blick auf die Nacherwerbsphase Orientierungshilfen zu geben – sowohl für die altersangemessene Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit im restlichen Erwerbsleben als auch für die Förderung einer »Engagementfähigkeit« von Älteren für die Nacherwerbszeit – sei an dieser Stelle besonders hingewiesen.
»Secondment«
Zunächst ist hier ein längerfristiges Modell der Einbeziehung bürgerschaftlichen Engagements in die Erwerbsarbeit zu nennen – das so genannte »Secondment«. Es bezeichnet die zweckgebundene Freistellung eines Mitarbeiters durch den Arbeitgeber. Der freigestellte »Secondee« soll eine zwischen seinem Unternehmen und einer gemeinnützigen Organisation vereinbarte Aufgabe für einen bestimmten längeren Zeitraum innerhalb der Partnerorganisation übernehmen. Während dieser Zeit bezieht er sein Gehalt von seinem Arbeitgeber weiter und darf die organisatorisch-technischen Möglichkeiten seiner Firma in Anspruch nehmen. Voraussetzung für ein Secondment ist dabei einerseits, dass der Betrieb für das vereinbarte Projekt ausreichend Ressourcen in technischer oder finanzieller Hinsicht zur Verfügung stellen kann und dass andererseits ein geeigneter Mitarbeiter, der die notwendigen Fachkenntnissen mitbringt, sich freiwillig zur Verfügung stellt.
Ältere Secondees können während dieser Zeit ihre betriebswirtschaftlichen Denkweisen und ihr immenses Erfahrungswissen in der Umgebung der gemeinnützigen Organisation anwenden, schärfen und weitergeben. Sie erhalten Gelegenheit, bisher schlummernde Fähigkeiten zu entwickeln. Das ausgiebige Kennenlernen einer gemeinnützigen Organisation kann sie animieren, nach Ablauf ihrer betrieblichen Karriere Engagements zu übernehmen. Mit anderen Worten, der Secondee entwickelt durch die Mitarbeit im gemeinnützigen Bereich im Umgang mit dem Thema der Organisation ein seismographisches Gespür für gesellschaftliche Probleme, das ihn für die spätere Übernahme eines Engagements sensibilisiert. Ferner lernt er, sich mit unterschiedlichen Konzepten, Idealen, Werten und Lebensformen auseinanderzusetzen, was ohnehin ein wesentlicher Bestandteil der Orientierung nach der Pensionierung ist. In Deutschland ist das Secondment ein verhältnismäßig neues Instrument, das insbesondere von Unternehmen mit amerikanischen Wurzeln eingesetzt wird. So arbeitete ein Secondee von IBM Deutschland für ein Jahr in einer Behindertenwerkstatt mit und entwickelte eine verbesserte Vermarktungsstrategie für die Produkte der Werkstatt.
Insbesondere die Altersteilzeit bietet sich als Arbeitszeitreduzierung oder als befristete Freistellung für ein Secondment an. Durch die Finanzierungsstruktur der Altersteilzeit kann auch der Kostenaufwand für das Unternehmen gering gehalten werden und daher auch für kleine und mittelständische Unternehmen attraktiv sein.
Freiwilligentag
Weniger zeitintensiv als ein Secondment kann auch ein vom Unternehmen angeregter Freiwilligentag, bei dem eine Gruppe von Kollegen für einen Tag ein für sie gestaltetes Projekt in einer sozialen Einrichtung durchführt, eine Facette aufweisen, die den Charakter eines Übergangsmanagements bekommt. Indem es Angebote für ältere Kollegen entwickelt, können diese sich an einem Tag in einer konkreten »bürgerschaftlichen« Aktivität erproben und gleichzeitig ihren Erfahrungshorizont im Blick auf die Personalentwicklung von Teams, die bei solchen Ereignissen im Mittelpunkt steht, in die Ein-Tages-Praxis einbringen.
Mentorentätigkeiten
Zur systematischen Vorbereitung auf den Ruhestand kommen aber auch Mentortätigkeiten am Ende der Berufstätigkeit in Betracht. Diese Aufgaben können von der Begleitung von Migranten oder sozial schwacher Kinder in ihrer Lernentwicklung bis hin zur Unterstützung Jugendlicher in ihrer Berufswahlorientierung reichen. Ältere Mitarbeiter können sich so zielgerichtet ein neues sinnstiftendes Betätigungsfeld in der Nacherwerbsphase erschließen, frühzeitig Kontakte zu Gemeinwohlorganisationen knüpfen und Netzwerke für das neue Engagement aufbauen.
Einbeziehung der eigenen Pensionäre
Einige Unternehmen beziehen »ihre« Pensionäre und Vorruheständler explizit mit in die corporate-volunteering-Programme mit ein. Damit kann dieser Personenkreis über interessante Engagementmöglichkeiten auf dem Laufenden gehalten werden. Die Pensionäre können ihrerseits den Kontakt zu ehemaligen Kollegen weiter pflegen, womit ein bruchloser Übergang zwischen Erwerbsarbeit und Ruhestand sicherlich erleichtert wird.
Beispiele guter Unternehmenspraxis
Einige Beispiele guter Unternehmenspraxis sollen unterschiedliche corporate-volunteering-Ansätze näher beleuchten. Ihnen allen ist die neue Qualität unternehmerischen Engagements in der systematischen Verknüpfung von betrieblichen mit gemeinwohlorientierten Interessen gemeinsam.
1. Henkel – Miteinander im Team (MIT) Initiative
Henkel unterstützt seit 1998 mit der MIT Initiative das ehrenamtliche Engagement seiner Mitarbeiter und Pensionäre je nach Bedarf mit Sach-, Produkt-und Geldspenden oder auch durch eine bezahlte Freistellung. Insgesamt konnten seitdem 3383 Projekte weltweit gefördert werden. Neben Community-Projekten, die von einer lokalen Jury ausgewählt und durch die lokalen Henkel-Gesellschaften unterstützt werden, wird seit 2001 zusätzlich das Engagement für Kinder zentral mit einer Million Euro jährlich gefördert. Die Henkel-Initiative greift das persönliche sozial-karitative oder kulturelle Engagement der Mitarbeiter auf und nutzt ihr Wissen um den Bedarf an Hilfe vor Ort.
2. General Electric – Elfun
GE Elfun ist ein Verein aktiver und pensionierter Mitarbeiter, in dem sich weltweit 45 000 Mitglieder dafür engagieren, das soziale Umfeld zu stärken. Seit 2001 besteht Elfun auch in Deutschland. Seitdem sind gut 70 000 Euro und über 1000 Arbeitsstunden in die Sanierung von Freizeiteinrichtungen, Kindergärten, Asylantenwohnheimen, in das Coaching von Jugendlichen und in Spendensammlungen geflossen. Ganz in der Tradition der amerikanischen Mutter ist die Unterstützung des Mitarbeiter-Engagements auch bei GE Deutschland eng mit der Erwartung verknüpft, das Ansehen des Unternehmens in seinem lokalen Umfeld zu stärken.
3. Ford-Werke – Community Service
Im Rahmen des Community Service, der in Deutschland seit dem Jahr 2000 besteht, stellt Ford Mitarbeiter für 16 Stunden im Jahr bezahlt für gemeinnützige Arbeit frei. Das Unternehmen definiert dabei den Rahmen für das Engagement. Die Projekte werden meist in Teams durchgeführt und sind auf sechs Bereiche bezogen: Umwelt und Naturschutz, Bildung und Wissenschaft, Hilfs- und Rettungsdienste, Sport, Kunst und Kultur, Gesundheit und Soziales. Ford sieht in dem Programm die Möglichkeit, die Mitarbeiter aktiv in die Unternehmenskultur einzubinden und Teamprozesse zu fördern.
Resümee
Erwerbsarbeit und Nacherwerbsphase
Schlüsselrolle der Unternehmen
Verantwortung der Wirtschaft
Zwischen Erwerbsarbeit und bürgerschaftlichem Engagement gibt es Übergänge und wechselseitige Beeinflussungen. Diese Modelle gilt es für eine aktive Teilhabe möglichst vieler zu nutzen. Was wir in unserer Gesellschaft benötigen, ist eine stärkere Verbindung von Erwerbsarbeit und Nacherwerbsphase – sowohl für die Menschen als auch für das Gemeinwesen. Bürgerschaftliches Engagement ist im Wissen um die Individualisierungstendenzen in unserem Gemeinwesen eine Ressource, die ihren negativen Auswirkungen »sozialen Zusammenhalt in neuer Form« entgegensetzt. Den Unternehmen kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Auch sie können bürgerschaftliches Engagement fördern und damit frühzeitig den Grundstein für ein Engagement im Alter legen. Sie können Zugänge bereitstellen, bei denen Menschen sich für eine freiwillige Tätigkeit entscheiden und gleichzeitig eine neue Einstellung zu ihrer bezahlten Tätigkeit finden können. Diese Rolle der Unternehmen ist umso bedeutender, als ihre traditionelle Integrationsfunktion – beispielsweise die Schaffung von Arbeitsplätzen – verloren zu gehen scheint. Die Integrationsfunktion von Unternehmen könnte sich auf diese Weise auf neue Felder verschieben: Warum nicht auf das eines Promotoren bürgerschaftlichen Engagements? Eine stärkere Verantwortungsübernahme der Wirtschaft ist überdies allein schon deshalb wünschenswert, weil die Absicht »mit zentraler, gar staatlicher Lenkung von oben die Zivilgesellschaft beleben zu wollen, ohnehin paradox [wäre]« (Nolte 2005: 79). Mit anderen Worten: Die stärkere Einbeziehung aller gesellschaftlichen Gruppen und eine neue Verantwortungsverschränkung zwischen den gesellschaftlichen Sektoren Wirtschaft, Staat und Gesellschaft könnten neue Antworten auf die bedeutende Frage liefern, was unsere Gesellschaft in Zukunft eigentlich zusammenhalten soll.
Literatur
Backhaus-Maul, Holger. »Corporate Citizenship im deutschen Sozialstaat«. Aus Politik und Zeitgeschichte B 14/2004. 23 – 30.
Barkholdt, Corinna. Umgestaltung der Altersteilzeit von einem Ausgliederungszu einem Eingliederungsinstrument. Expertise im Auftrag der Altenberichtskommission . Dortmund 2004.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.). Freiwilliges Engagement in Deutschland 1999 – 2004. Ergebnisse einer repräsentativen Trenderhebung zu Ehrenamt, freiwilligem und bürgerschaftlichem Engagement. Durchgeführt im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Vorgelegt von TNS Infratest Sozialforschung, Thomas Gensicke, Sybille Picot, Sabine Geiss. München 2005. www.bmfsfjde/RedaktionBMFSFJ/Arbeitsgruppen/Pdf-Anlagen/freiwilligen-survey-langfassungproperty=pdf,bereich=,rwb=true.pdf. (Download 11.6.2006).
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.). Potenziale der Älteren in Kommunen nutzen – Ergebnisse des Bundesmodellprogramms »Erfahrungswissen für Initiativen«. Berlin 2006.
Enquete-Kommission »Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements«. Deutscher Bundestag (Hrsg.). Bürgerschaftliches Engagement: Auf dem Weg in eine zukunftsfähige Bürgergesellschaft. Opladen 2002.
Janning, Heinz, und Thomas Naujokat. »Wechselwirkungen – Zeit für Bürgerengagement und Impulse für den Arbeitsmarkt«. Vorgelegt für den Senat der Freien und Hansestadt Bremen von der Freiwilligen-Agentur Bremen 2000/2001. Unveröffentlicht.
Kistler, Ernst, und Thomas Rauschenbach. »Ehrenamt und Erwerbsarbeit – Forschungsfragen und Methodenprobleme«. WSI Mitteilungen. Monatszeitschrift des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in der Hans-Böckler-Stiftung 3 2001. 151 – 156.
Nolte, Paul. Generation Reform. München 2005.
Riess, Birgit, und Gerd Placke. »Corporate Citizenship Strategien zur Förderung von Beschäftigungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt«. Handbuch Corporate Citizenship Management. Hrsg. André Habisch und René Schmidtpeter. Berlin, Heidelberg 2006 (im Erscheinen).
Schöffmann, Dieter (Hrsg.). Wenn alle gewinnen. Bürgergesellschaftliches Engagement von Unternehmen. 2. Auflage. Hamburg 2003.
Schumacher, Ulrike. »Kombinationen von bürgerschaftlichem Engagement. Zur Rolle freiwilliger Tätigkeiten in der Krise der Arbeitsgesellschaft«. Arbeit(en) im Dritten Sektor. Europäische Perspektiven. Hrsg. Sandra Kotlenga, Barbara Nägele, Nils Pagels und Bettina Ross. Mösslingen-Talheim 2005. 188 – 200.
Wouters, Gerlinde. Zur Identitätsrelevanz von freiwilligem Engagement im dritten Lebensalter – Anzeichen einer Tätigkeitsgesellschaft? Herbolzheim 2005.
Offe, Claus, und Susanne Fuchs. »Schwund des Sozialkapitals? Der Fall Deutschland«. Gesellschaft und Gemeinsinn. Hrsg. Robert D. Putnam. Gütersloh 2001. 417 – 514.
Links
www.efi-programm.de (Download 13.6.2006).
www.bmfsfj.de (Download 13.6.2006).
Produktives Potenzial jenseits der Erwerbsarbeit – Ehrenamtliches Engagement von Älteren in Deutschland und Europa
Marcel Erlinghagen, Karsten Hank, Anja Lemke, Stephanie Stuck
Einleitung
Wachsendes Engagement bei Älteren
Parallel zur Debatte um die wachsende »Alterslast« ist in den vergangenen Jahren auch der Bedeutung produktiver »nachberuflicher Tätigkeitsfelder« älterer Menschen – und hier insbesondere dem Ehrenamt – zunehmend Aufmerksamkeit geschenkt worden (vgl. Caro und Bass 1995; Künemund 2001). Obwohl die Ergebnisse einer Vielzahl von Studien darauf hinweisen, dass Rentner sich nicht häufiger in Ehrenämtern engagieren als Erwerbstätige (z. B. Mutchler, Burr und Caro 2003; Smith 2004), belegen neueste Zahlen für die Bundesrepublik, dass die Bevölkerung im Alter von 60 bis 69 Jahren die größte Wachstumsgruppe des freiwilligen Engagements darstellt (Gensicke 2006: 14). Betrachtet man darüber hinaus die Intensität des Engagements, das heißt die geleisteten Arbeitsstunden, zeigt sich, dass Senioren signifikant mehr Zeit für »informelle« produktive Tätigkeiten aufwenden als Jüngere (z. B. Gallagher 1994).
Positive Effekte von Engagement
Ergebnisse der sozial-gerontologischen Forschung belegen, dass sich der produktive Charakter ehrenamtlicher Tätigkeiten besonders auf ältere Aktive positiv auswirkt, zum Beispiel hinsichtlich ihrer Zufriedenheit und ihres gesundheitlichen Wohlbefindens (z. B. Siegrist, von dem Knesebeck und Pollack 2004; Van Willigen 2000; zum individuellen Nutzen ehrenamtlicher Tätigkeiten im Allgemeinen vgl. Erlinghagen 2003; Freeman 1997). Gleichzeitig stellt die Bereitschaft der älteren Generation, sich zu engagieren und zu beteiligen, eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Chance dar. Dies wird inzwischen auch von der Politik erkannt, und es wird diskutiert, wie das grundsätzlich vorhandene produktive und ehrenamtliche Potenzial älterer Bürger genutzt werden kann (vgl. Baldock 1999; Braun und Bischoff 1999; Schmidt 2004).
Determinanten
Ob Menschen sich ehrenamtlich engagieren, hängt in entscheidendem Maß von den Ressourcen ab, über die sie verfügen. Verschiedene Studien haben in den vergangenen Jahren gezeigt, dass Einkommen, Bildung und Gesundheit hierbei wesentliche Determinanten darstellen (vgl. Wilson und Musick 1997; Erlinghagen 2000a). Andere Autoren verweisen insbesondere im Hinblick auf das Engagement älterer Menschen des Weiteren auf die Bedeutung des Lebensverlaufs. Wer in jungen Jahren bereits ehrenamtlich aktiv gewesen ist, zeigt auch im Alter eine höhere Engagementbereitschaft (vgl. Choi 2003; Warburton et al. 2001). Hinzu kommt, dass Freiwilligenarbeit nicht isoliert vom breiteren gesellschaftlichen Kontext, in dem sie stattfindet, betrachtet werden darf (vgl. Bühlmann und Freitag 2004). So stellen zum Beispiel Anheier und Salamon (1999: 43) fest: »[...] as a cultural and economic phenomenon, volunteering is part of the way societies are organized, how they allocate social responsibilities, and how much engagement and participation they expect from citizens.« Ehrenamtliches Engagement (auch) von Älteren ist also ein Produkt aus der individuellen Verfügbarkeit von Ressourcen, dem individuellen Lebensverlauf sowie dem institutionellen und kulturellen Kontext, in den die Akteure eingebettet sind.
Ziel des Beitrags
Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, mehr über die Bedeutung des Dreiklangs »Ressourcen – Lebensverlauf – Kontext« im Hinblick auf die Ausübung ehrenamtlicher Arbeit zu erfahren.
Begriffsdefinition
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Begriffsdefinition von »Ehrenamt« oder »Freiwilligenarbeit« in der Literatur keineswegs einheitlich und die Abgrenzung »ehrenamtlicher Tätigkeiten« als Forschungsgegenstand komplex und nicht unproblematisch ist. In der wissenschaftlichen Literatur wurde bislang versäumt, den Begriff »Ehrenamt« im weitesten Sinne einheitlich zu definieren (vgl. dazu auch Beher, Liebig und Rauschenbach 1998; Kistler, Priller und Sing 2000; zur begrifflichen Abgrenzung von und Überschneidung mit Begriffen wie »Freiwilligenarbeit« oder auch »bürgerschaftlichem Engagement« vgl. Schüll 2004: insb. Kapitel 2). Da im weiteren Verlauf unseres Beitrags eine prinzipiell mögliche Unterscheidung verschiedener Ehrenamtsformen (vgl. dazu Erlinghagen 2000b; 2003) von untergeordneter Bedeutung ist, definieren wir ehrenamtliche Arbeit vor allem durch folgende drei Kriterien (vgl. Hank, Erlinghagen und Lemke 2006; Schwarz 1996): (a) Ehrenamtliche Tätigkeiten sind an den institutionellen Rahmen einer Organisation außerhalb des Haushalts (der Familie) gebunden, (b) ehrenamtliche Tätigkeiten sind unbezahlte Aktivitäten, wobei eine Kosten- oder Aufwandsentschädigung nicht als Bezahlung gilt, und (c) die ehrenamtlich erbrachten Leistungen kommen (in erster Linie) Dritten bzw. der Allgemeinheit zugute.
Aufbau des Artikels
Im Folgenden werden zunächst einige Zahlen präsentiert, die die zeitliche Entwicklung ehrenamtlichen Engagements von Älteren in Deutschland nachzeichnen. Daran anschließend wird ein internationaler Vergleich vorgenommen, der deutlich macht, dass das Ausmaß ehrenamtlichen Engagements von Älteren in Europa stark variiert und deutsche Senioren einen guten Mittelfeldplatz einnehmen. Hierbei haben offenbar länderspezifische Kontextfaktoren einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf den Grad der Aktivierung älterer Menschen. Im Anschluss rückt dann die Frage nach dem Einfluss des individuellen Lebensverlaufs in den Mittelpunkt unseres Interesses. Auf Basis der präsentierten Befunde diskutieren wir abschließend mögliche Perspektiven für eine Aktivierung bislang ungenutzter Potenziale der Freiwilligenarbeit im Alter.
Die Entwicklung ehrenamtlichen Engagements von Älteren in Deutschland
Wachsende Engagementbereitschaft
Hatte man Ende der 90er Jahre noch befürchtet, dass insbesondere aufgrund von Individualisierungsprozessen die Bereitschaft, sich sozial zu engagieren, deutlich zurückgegangen sein müsste, zeigten empirische Analysen ein dieser Annahme entgegengesetztes Bild. So hat sich seit Mitte der 80er Jahre der Anteil der Engagierten deutlich erhöht, sodass zum Jahrtausendwechsel rund ein Drittel der Erwachsenen in Deutschland ehrenamtlich aktiv gewesen ist. Allerdings ist diese Steigerung in erster Linie durch ein verstärktes sporadisches, nicht regelmäßiges Engagement zu erklären (vgl. Erlinghagen 2002).
Abbildung 1 zeigt in diesem Zusammenhang, wie sich der Bevölkerungsanteil ehrenamtlich Engagierter seit 1985 (Westdeutschland) bzw. seit 1990 (Ostdeutschland) verändert hat. Die Ergebnisse basieren auf repräsentativen Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP; vgl. dazu SOEP Group 2001) und unterscheiden zwischen Jüngeren (16 bis 49 Jahre) und Älteren (50 Jahre und älter). Die dunklen Teilbereiche der Säulen im Diagramm stellen den Anteil regelmäßig ehrenamtlich Aktiver (das heißt mindestens einmal im Monat) dar, während die hellen Teilbereiche den Anteil sporadisch (nicht regelmäßig) ehrenamtlich Aktiver dokumentieren. Entsprechend addieren sich regelmäßiges und sporadisches Engagement zum Anteil ehrenamtlich Aktiver insgesamt. Dabei zeigt sich, dass der Anteil sowohl jüngerer als auch älterer Aktiver in Westdeutschland sich zwischen 1985 und 2003 erhöht hat. In Ostdeutschland ist demgegenüber nach der Wende zunächst ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen, wobei sich dann nach 1992 auch in den neuen Bundesländern ein Aufwärtstrend feststellen lässt.
Zuwachs regelmäßig engagierter Senioren
Bemerkenswert ist hierbei zunächst, dass die Anteile der Aktiven unter den Senioren insbesondere in Westdeutschland im Zeitverlauf besonders zunehmen – und dass dies, anders als bei den Jüngeren, insbesondere dem wachsenden Anteil regelmäßig Engagierter geschuldet ist. Waren beispielsweise 1985 lediglich rund zwölf Prozent der über 50-Jährigen in den alten Bundesländern regelmäßig ehrenamtlich aktiv, stieg dieser Anteil bis 2003 auf etwa 17 Prozent, was einen Zuwachs von mehr als 40 Prozent bedeutet. Und auch in den neuen Ländern ist ein, wenn auch nicht so deutlicher Zuwachs regelmäßig engagierter Senioren zu beobachten. Die Tatsache, dass im Vergleich zu Jüngeren heute ein tendenziell größerer Anteil der Senioren regelmäßig ehrenamtlich arbeitet, ist somit ein deutliches Zeichen für die (wachsende) Bedeutung der Produktivität Älterer jenseits der Erwerbsarbeit (siehe auch Caro und Bass 1995).
Abbildung 1: Anteil ehrenamtlich Tätiger in Ost- und Westdeutschland nach Alter (in Prozent)
Quelle: SOEP 1985 – 2003 (querschnittsgewichtet), eigene Berechnungen
Ehrenamtliches Engagement von Älteren im internationalen Vergleich
»SHARE«
Die Analysen der SOEP-Daten zeigen, dass derzeit etwa 15 Prozent der älteren Bevölkerung in Deutschland regelmäßig ein Ehrenamt ausüben. Die Frage ist nun, wie sich diese Engagementquote im internationalen Vergleich bewerten lässt. Ein solcher Vergleich ist auf Basis der Daten des 2004 erstmals erhobenen Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE (vgl. Börsch-Supan et al. 2005; Börsch-Supan und Jürges 2005) – möglich. Dabei lassen sich hinsichtlich des allgemeinen Niveaus ehrenamtlichen Engagements im Wesentlichen drei Ländergruppen unterscheiden (vgl. Abbildung 2).
Internationalele Unterschiede
Erstens die Mittelmeerländer, die durch eine insgesamt geringe Beteiligung an Ehrenämtern gekennzeichnet sind. Während in Italien immerhin noch sieben Prozent der Befragten angeben, im vergangenen Monat ehrenamtlich aktiv gewesen zu sein, trifft dies nur auf zwei bis drei Prozent der Griechen und Spanier zu. Deutschland, Belgien, Frankreich, Österreich und die Schweiz bilden eine zweite Gruppe von Ländern, die mit einem Anteil von neun bis 15 Prozent Freiwilligen in der Bevölkerung 50+ ein mittleres Engagement aufweisen. Die verbleibenden Länder mit einer hohen Aktivitätsquote sind, drittens, Schweden und Dänemark (mit jeweils 17 Prozent) sowie die Niederlande mit über 20 Prozent ehrenamtlich aktiven Älteren. Etwa ein Fünftel (18 Prozent) der Freiwilligen war fast täglich aktiv, knapp die Hälfte (45 Prozent) hat sich fast jede Woche engagiert, und ein gutes Drittel (37 Prozent) war innerhalb des vergangenen Monats seltener als wöchentlich ehrenamtlich tätig (vgl. Erlinghagen und Hank 2006 für einen ausführlichen Tabellenanhang mit detaillierten Ergebnissen).
Abbildung 2: Räumliches Muster ehrenamtlichen Engagements von Älteren in Europa
Quelle: SHARE 2004, eigene Berechnungen
Zusammenhang Bildungsstand und Engagement
Während es zwischen Männern und Frauen oder zwischen Verheirateten und Unverheirateten in den meisten Ländern eher geringe Unterschiede hinsichtlich ihrer Beteiligung an Ehrenämtern gibt (Erlinghagen und Hank 2006), variiert jedoch das Bildungsniveau des Freiwilligenanteils in der Bevölkerung deutlich. Ungeachtet einzelner Detailunterschiede zeigt sich in allen Ländern eine mit dem Bildungsstand anwachsende Beteiligung an ehrenamtlicher Arbeit (Abbildung 3a).
Demgegenüber ergibt sich hinsichtlich des Einflusses des Erwerbsstatus kein eindeutiger Befund: Im Ländervergleich zeigen sich in der Regel nur relativ kleine Unterschiede (in der Größenordnung von zwei bis drei Prozentpunkten) zwischen Erwerbstätigen, Rentnern und anderen nicht Erwerbstätigen (Abbildung 3b).
Zusammenhang Gesundheit und Engagement
Ferner zeigt Abbildung 3c den in allen Ländern deutlich ausgeprägten Zusammenhang zwischen dem (subjektiven) Gesundheitszustand und dem ehrenamtlichen Engagement: Je schlechter sich die Befragten fühlen, desto seltener sind sie auch ehrenamtlich aktiv (vgl. Hank, Erlinghagen und Lemke 2006 für eine ausführliche Diskussion der Ergebnisse). Diese rein deskriptiven Befunde lassen natürlich keine Aussagen über Kausalzusammenhänge zu. So schreibt etwa Wilson (2000: 237) über den Zusammenhang von Ehrenamt und Gesundheit: »Volunteering improves health, but it is also most likely that healthier people are more likely to volunteer. Good health is preserved by volunteering; it keeps healthy volunteers healthy.«
Institutionelle Rahmenbedingungen entscheidend
Die hier in aller Kürze vorgestellten Befunde machen zum einen deutlich, dass in allen untersuchten europäischen Ländern der Umfang ehrenamtlichen Engagements entscheidend von der Ressourcenausstattung der Individuen abhängt. Die beobachteten allgemeinen Länderunterschiede könnten demnach auf eine unterschiedliche Ressourcenausstattung der Senioren in den einzelnen Ländern zurückzuführen sein. Jedoch zeigen weitergehende Analysen der SHARE-Daten von Erlinghagen und Hank (2006) eindeutig, dass ein solcher Gruppenkompositionseffekt nicht ursächlich für die bestehenden Länderunterschiede ist. Vielmehr scheinen institutionelle Rahmenbedingungen eine wesentliche Rolle für die individuelle Beteiligung an Ehrenämtern zu spielen.
Abbildung 3: Ehrenamtliches Engagement von Älteren in Europa, differenziert nach Bildung, Erwerbsstatus und Gesundheit (Angaben in Prozent)
Quelle: SHARE 2004, eigene Berechnungen
Parallelen zu Regimetypologien
Dabei gibt es auf den ersten Blick augenfällige Parallelen zu in den Sozial-und Wirtschaftswissenschaften weit verbreiteten Regimetypologien, die bei der Erklärung internationaler Unterschiede helfen sollen (vgl. Hank, Erlinghagen und Lemke 2006). Hier sind die auf Esping-Andersens Typologie der »Wohlfahrtsstaatsregime« (Esping-Andersen 1990) zurückgehenden Arbeiten ebenso zu nennen wie die Analysen, die auf unterschiedliche »Spielarten des Kapitalismus« (Hall und Gingerich 2004) verweisen. Ferner lässt sich auch an Typologien anknüpfen, die sich unter dem Stichwort »Geschlechterregime« herausgebildet haben und die insbesondere arbeitsmarkt-, bildungs-und familienpolitische Institutionen und deren Einfluss auf die Reproduktion im Kontext des privaten Haushalts ins Zentrum stellen (z. B. Dingeldey 2004; Sainsbury 1996).
In direkter Anlehnung an die Typologie der »Wohlfahrtsstaatsregime« von Esping-Andersen und auf Grundlage des von ihnen entwickelten »social origins«-Ansatzes identifizieren Salamon und Anheier (1998) schließlich vier Regime-Typen zur Charakterisierung von Nonprofit-Sektoren: die drei auch von Esping-Andersen genannten liberalen (z. B. Großbritannien), konservativ-korporativen (z. B. Deutschland) und sozialdemokratischen (z. B. Schweden) Regime sowie den so genannten »staatsdirigistischen« Typ (z. B. Japan).
Funktion des Ehrenamts
Der Zusammenhang zwischen einem bestimmten Nonprofit-Regime-Typ und der Verbreitung des Ehrenamts ist jedoch komplex. Um die beobachteten Niveauunterschiede ehrenamtlichen Engagements zwischen einzelnen Ländern erklären zu können, müssen zusätzlich die unterschiedlichen Funktionen berücksichtigt werden, mit denen Ehrenämter belegt sein können. Salamon und Sokolowski (2001) stellen zum Beispiel fest, dass ehrenamtliches Engagement tendenziell in jenen Ländern stärker verbreitet ist, in denen dem Ehrenamt primär eine »expressive« Funktion zugeschrieben wird, wie zum Beispiel in Schweden, den Niederlanden, aber auch in Deutschland. Dort werden ehrenamtliche Tätigkeiten insbesondere im Kultur- oder Freizeitbereich ausgeübt. Eine geringere Beteiligung an Ehrenämtern kann hingegen dort beobachtet werden, wo deren Dienstleistungsfunktion, etwa im sozialen Bereich, im Vordergrund steht. Dies trifft unter anderem auf Italien oder Spanien zu.
Kontextabhängige Länderunterschiede
Es scheint also sowohl aus theoretischer als auch aus empirischer Sicht Klarheit darüber zu bestehen, dass es kontextabhängige Länderunterschiede hinsichtlich der unterschiedlichen Beteiligung an ehrenamtlicher Arbeit gibt. Unstrittig scheint auch, dass die in verschiedenen Typologien unterschiedlich stark betonten Sphären »Erwerbsarbeit«, »privater Haushalt und Familie« sowie »Wohlfahrtsstaat« auch hinsichtlich der Frage ehrenamtlicher Arbeit von wesentlicher Bedeutung sind.
Forschungsbedarf
Auch wenn es bereits erste Hypothesen über die Zusammenhänge zwischen Kontextfaktoren und individuellem Engagement gibt, besteht unseres Erachtens jedoch gerade in diesem Punkt weiterhin erheblicher Forschungsbedarf. Dies ist nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht von Interesse. Ein besseres Verständnis der relevanten Kontextfaktoren kann darüber hinaus für eine gezielte Aktivierung des ehrenamtlichen und produktiven Engagements älterer Bürger durch politische und gesellschaftliche Akteure besonders nützlich sein (vgl. Braun und Bischoff 1999).
Ehrenamtliches Engagement von Älteren im Lebensverlauf
Lebensverlauf und Engagement im Alter
Neben den wichtigen Fragen, welchen Einfluss die individuelle Ressourcenausstattung sowie der institutionelle bzw. kulturelle Kontext auf das ehrenamtliche Engagement Älterer ausüben, ist ebenso von Interesse, welche Rolle eine im Lebensverlauf vorausgegangene »Ehrenamtskarriere« für die Beteiligung älterer Menschen spielt.
Schlechte Datenlage
Die Analyse von Lebensverlaufsprozessen stellt jedoch hohe Anforderungen an das zugrunde zu legende Datenmaterial. Es muss Längsschnittanalysen erlauben, die etwas über die ehrenamtliche Beteiligung als dynamischen Prozess aussagen können. Leider liegt unseres Wissens bislang kein solcher Datensatz vor, der international vergleichende Untersuchungen unter diesem Gesichtspunkt erlauben würde.
Wollen wir dennoch etwas mehr über die Beteiligung Älterer im Lebensverlauf aus internationaler Perspektive lernen, bleibt uns nur die altersgetrennte Betrachtung von Aktivitätsquoten. Dies soll im Folgenden auf Basis der bereits zuvor vorgestellten SHARE-Querschnittsdaten erfolgen. Konzentriert man sich hingegen auf Deutschland, so sind hier aufgrund des Panelcharakters der SOEP-Daten sehr wohl Lebensverlaufsanalysen möglich, sodass hierzu weiter unten einige erste Befunde dargestellt werden sollen.
Ehrenamtliche Beteiligung unterschiedlicher Altersgruppen im internationalen Vergleich
Länderunterschiede beim Engagement Älterer
Abbildung 4 zeigt die Engagementquote für die Altersgruppen »50 bis 64 Jahre«, »65 bis 74 Jahre« sowie »75 Jahre und älter« im Vergleich der SHARE-Länder. Augenfällig sind dabei deutliche Länderunterschiede. Während der Anteil schweizerischer, österreichischer und italienischer Ehrenamtlicher im Alter von 65 bis 74 um vier bis sechs Prozentpunkte niedriger ist als in der Gruppe der 50- bis 64-Jährigen, findet sich ein umgekehrtes Verhältnis in Schweden, Dänemark und den Niederlanden, wo der Anteil der freiwillig Aktiven in der mittleren Altersgruppe sogar um etwa drei Prozentpunkte steigt. Wenn jedoch Personen im Alter von 75 Jahren oder älter betrachtet werden, sinkt die Engagementquote überall um mindestens ein Drittel (in den Niederlanden sogar um zwei Drittel, von einem allerdings sehr hohen Ausgangsniveau) auf ein durchschnittliches Niveau von fünf Prozent. Bemerkenswert ist, dass sich in den skandinavischen Ländern immer noch 12 bis 13 Prozent der über 75-jährigen Bevölkerung in Ehrenämtern engagieren – also mehr als der gesamteuropäische Durchschnitt über alle Altersklassen.
Abbildung 4: Ehrenamtliches Engagement in Europa, differenziert nach Alter (Angaben in Prozent)
Quelle: SHARE 2004, eigene Berechnungen
Auch wenn auf Basis dieser Querschnittsanalysen keine Kausalzusammenhänge identifiziert werden können und auch wenn sich hinter den altersspezifischen Differenzen teilweise ein Kohorteneffekt verbergen mag: Offensichtlich gibt es dennoch Länder, in denen es (a) besser gelingt, Ältere nach ihrer aktiven Erwerbsphase zu ehrenamtlichem Engagement zu animieren, und die es (b) schaffen, das ehrenamtliche Engagement von Senioren über gewisse Altersgrenzen hinaus in nennenswertem Umfang aufrechtzuerhalten.
Vom Ausland lernen
Es ist nochmals zu betonen, dass diese Interpretationen kaum mehr als eine auf empirische Befunde gestützte Konkretisierung von Hypothesen bedeuten, die in Zukunft näher untersucht werden müssen. Ein besseres Verständnis des Zusammenhangs von institutionellen Rahmenbedingungen und individuellem Lebensverlauf hinsichtlich des ehrenamtlichen Engagements von Senioren ist nicht nur von großem wissenschaftlichem Interesse. Es liegt auf der Hand, dass es außerdem für zu diskutierende Aktivierungsstrategien von höchster Relevanz ist, von den Erfahrungen anderer Länder zu lernen, denen eine dauerhafte Aktivierung älterer Menschen für ehrenamtliches Engagement mutmaßlich besser gelingt (vgl. Hank, Erlinghagen und Lemke 2006).
Ehrenamtliche Beteiligung von Älteren im Lebensverlauf – Das Beispiel Deutschland
Aktivität älterer Männer
Aktivität älterer Frauen
Abbildung 5 zeigt für die im Jahr 2003 ehrenamtlich tätigen westdeutschen über 50-Jährigen die Verteilung der Dauer ihres ununterbrochenen Engagements getrennt für Männer und Frauen. Dabei findet sich eine zum Teil bemerkenswerte Konstanz der Aktivität. So sind etwa 30 Prozent der 2003 ehrenamtlich tätigen über 50-jährigen Männer seit mehr als 16 Jahren kontinuierlich ehrenamtlich aktiv. Gleichzeitig haben rund 23 Prozent dieser Gruppe erst im Laufe des vorangegangenen Jahres ihr aktuelles Ehrenamt übernommen. Ältere Frauen zeigen demgegenüber eine weniger kontinuierliche Beteiligung an Ehrenämtern. Mehr als ein Drittel der 2003 tätigen Frauen haben ihr Engagement erst im Laufe des Vorjahres übernommen, während lediglich 15 Prozent von einem extrem stabilen, seit mehr als 16 Jahren bestehenden Engagement berichten.
Bevor wir uns näher mit den Gründen für diese geschlechtsspezifischen Unterschiede – und den hieraus resultierenden Folgen – befassen können, muss ein zentraler Punkt herausgestellt werden. Geht man bei einem mindestens sechsjährigen kontinuierlichen Engagement von – in Lebensverlaufsperspektive – stabilem Engagement aus, so sind immerhin 50 Prozent der Männer und 40 Prozent der Frauen der Altersgruppe der über 50-Jährigen kontinuierlich aktiv.
Abbildung 5: Dauer des zurückliegenden, ununterbrochenen ehrenamtlichen Engagements im Jahr 2003 (Westdeutschland, Personen 50 Jahre und älter, Angaben in Prozent)
Quelle: SOEP (längsschnittgewichtet), eigene Berechnungen
Geschlechtsspezifische Unterschiede
Trotz des – wie wir meinen – hohen dauerhaften Engagements steht dennoch eine Erklärung für die beobachteten geschlechtsspezifischen Unterschiede aus. Die deutlich geringeren Werte des sehr stabilen Engagements von Frauen scheinen dabei nicht primär auf einem Kohorteneffekt zu beruhen, da auch bei einem Vergleich von jüngeren Männern und Frauen (aus Platzgründen hier nicht dokumentiert) der Anteil sehr kontinuierlich engagierter Männer deutlich über dem Anteil der Frauen rangiert.
Unterschiedliche Rollenzuweisungen
Methodische Phänomene
Insofern liegt es nahe, die Differenzen durch unterschiedliche Rollenzuweisungen zu erklären, da möglicherweise »weiblich« dominierte Ehrenämter inhaltlich nicht ohne Weiteres mit »männlich« geprägten Ehrenämtern verglichen werden können. Außerdem könnte es sein, dass insbesondere Frauen zugeschriebene Verpflichtungen beispielsweise im Bereich der Hausarbeit und der Kinderbetreuung diese dazu zwingen, ihr ehrenamtliches Engagement nach einer gewissen Zeit aufzugeben bzw. zu unterbrechen, wie wir es aus der Analyse von Erwerbsverläufen bereits kennen. Hinzu kommt ein methodisches Phänomen, das auch aus der Arbeitsmarktforschung bekannt ist (Erlinghagen und Mühge 2006). So kann der Anteil der sehr regelmäßig engagierten Frauen allein dadurch sinken, dass es überdurchschnittlich viele »Neueinsteigerinnen« in der jüngeren Vergangenheit gegeben hat. Dafür sprechen die hohen Anteile der weniger als ein Jahr lang engagierten Frauen, auch wenn es hier noch weiteren Klärungsbedarf gibt.
»Überlebensquoten«
Eine andere interessante Frage ist, wie lange es dauert, bis zunächst inaktive Menschen ein Ehrenamt neu übernehmen. Abbildung 6 zeigt daher so genannte »Überlebensquoten« für jene Personen, die im Jahr 1985 mindestens 50 Jahre alt und zu diesem Zeitpunkt nicht ehrenamtlich aktiv waren. Ausgehend von diesem Personenkreis ist nun für jedes folgende Erhebungsjahr der Anteil der weiterhin Inaktiven abgetragen. So übten im Jahr 1986 87 Prozent der älteren Männer und rund 92 Prozent der älteren Frauen weiterhin kein Ehrenamt aus; anders ausgedrückt haben ein Jahr nach dem ersten Erhebungszeitpunkt 13 Prozent der zuvor nicht aktiven Männer und acht Prozent der zuvor nicht aktiven Frauen eine ehrenamtliche Betätigung aufgenommen.
Komplexe Dynamik des Ehrenamtssektors
Am Ende des Untersuchungszeitraums wird somit klar, dass ausgehend vom Jahr 1985 etwa 46 Prozent der Frauen und sogar 54 Prozent der Männer in einem Zeitraum von insgesamt 18 Jahren zumindest kurzzeitig einmal ein Ehrenamt ausgeübt haben. Diese Werte machen deutlich, dass die Konzentration allein auf stichtagsbezogene Engagementquoten die Dynamik des Ehrenamtsektors unterschätzt.
Abbildung 6: Überlebensquoten der im Jahr 1985 ehrenamtlich Inaktiven (= 100 Prozent) (Westdeutschland, Personen 50 Jahre und älter)
Quelle: SOEP (längsschnittgewichtet), eigene Berechnungen
Fazit
Weiteres Wachstumspotenzial
Betrachtet man die Entwicklung ehrenamtlichen Engagements zunächst isoliert für Deutschland, zeigt sich, dass die Beteiligung älterer Menschen in den vergangenen 20 Jahren deutlich zugenommen hat. Dieser Anstieg speist sich dabei in erster Linie nicht aus der unregelmäßigen Beteiligung, sondern ist auf die Zunahme der regelmäßig Aktiven zurückzuführen. Gleichzeitig verweist der internationale Vergleich darauf, dass es ganz offensichtlich ein weiteres Wachstumspotenzial gibt, denn ältere Menschen in Skandinavien sind deutlich stärker ehrenamtlich aktiv als deutsche Senioren. Ein dementsprechend ungleich höheres Wachstumspotenzial ist sogar in den südeuropäischen Ländern zu finden.
Kontextfaktoren und Lebensverlauf
Gleichwohl hat sich aber auch gezeigt, dass jenseits unterschiedlicher Kontextfaktoren nach wie vor die individuelle Ressourcenausstattung – etwa mit Humankapital oder guter Gesundheit – ein wesentlicher Bestimmungsfaktor für die ehrenamtliche Beteiligung auch von Senioren darstellt. Als dritte relevante Dimension ist der individuelle Lebensverlauf identifiziert worden. Anhand der hier beispielhaft dargestellten geschlechtsspezifischen Unterschiede ist ersichtlich, dass die Aktivierung älterer Menschen kein monokausaler Akt, sondern vielmehr ein multidimensionaler Prozess ist.
Aktivierung von Produktivitätspotenzialen
Ob es zukünftig gelingen wird, bislang mutmaßlich brachliegende Produktivitätspotenziale zu aktivieren, hängt somit von drei Faktoren ab. Erstens stellt sich die Frage, inwieweit es den europäischen Bevölkerungen gelingen wird, gesund zu altern. Zweitens ist entscheidend, in welchem Umfang für ältere (und gebrechlichere) Freiwillige angemessene – und gleichzeitig »profitable« – Betätigungsmöglichkeiten geschaffen werden können. Drittens muss im Zusammenspiel zwischen individueller Ressourcenausstattung und aktivierenden Institutionen der Lebensverlauf der zu Aktivierenden berücksichtigt werden.
Eigennutzen von Freiwilligenarbeit
Nur wenn alle drei Dimensionen adäquat einbezogen werden, kann sich der Nutzen sowohl für die älteren Menschen selbst als auch für die Gesellschaft insgesamt vergrößern. In der Diskussion um den gesellschaftlichen Nutzen des Ehrenamts dürfen daher keinesfalls die positiven Aspekte ehrenamtlicher Tätigkeiten für die freiwillig Aktiven selbst aus dem Blick geraten (vgl. Siegrist, von dem Knesebeck und Pollack 2004): Ältere Menschen sollen nicht zum Vorteil Dritter »ausgebeutet« werden, sondern sie selbst sollen durch ihre aktive Teilnahme an gesellschaftlichen Aufgaben eine Verbesserung der eigenen Lebensqualität erfahren.
Danksagung
Wir bedanken uns bei der Fritz Thyssen Stiftung für die finanzielle Unterstützung des Projekts »Informelle Arbeit von Älteren in Deutschland und Europa«, in dessen Rahmen der vorliegende Beitrag entstanden ist. Die hier verwendeten Daten des »Sozio-oekonomischen Panels« wurden durch das DIW Berlin bereitgestellt. Die Daten des »Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe« stammen aus dem vorläufigen Release 1 der ersten Welle 2004. Die SHARE-Datenerhebung wurde hauptsächlich durch das 5. Rahmenprogramm der Europäischen Union finanziert. Weitere Finanzmittel wurden vom US National Institute on Aging zur Verfügung gestellt. Die Datensammlung in Österreich (durch den Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) und der Schweiz (durch BBW/OFES/UFES) wurde national finanziert.
Literatur
Anheier, Helmut K., und Lester M. Salamon. »Volunteering in Cross-National Perspective. Initial Comparisons«. Law and Contemporary Problems 62 1999. 43 – 65.
Anheier, Helmut K., und Stefan Toepler. »Bürgerschaftliches Engagement in Europa«. Aus Politik und Zeitgeschichte 9 2002. 31 – 38.
Baldock, Cora Vellekoop. »Seniors as Volunteers. An International Perspective on Policy«. Ageing & Society 19 1999. 581 – 602.
Beher, Karin, Reinhard Liebig und Thomas Rauschenbach. Das Ehrenamt in empirischen Studien – ein sekundäranalytischer Vergleich. Stuttgart u. a. 1998.
Börsch-Supan, Axel, et al. (Hrsg.). Health, Ageing and Retirement in Europe – First Results from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Mannheim 2005.
Börsch-Supan, Axel, und Hendrik Jürges (Hrsg.). The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – Methodology. Mannheim 2005.
Bühlmann, Marc, und Markus Freitag. »Individuelle und kontextuelle Determinanten der Teilhabe an Sozialkapital«. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 56 2004. 326 – 349.
Braun, Joachim, und Stefan Bischoff. Bürgerschaftliches Engagement älterer Menschen – Motive und Aktivitäten. Schriftenreihe des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 184. Stuttgart 1999.
Caro, Francis G., und Scott A. Bass. »Increasing Volunteering among Older People«. Older and Active. How Americans over 55 Are Contributing to Society. Hrsg. Scott A. Bass. New Haven 1995. 71 – 96.
Choi, Lona H. »Factors Affecting Volunteerism Among Older Adults«. Journal of Applied Gerontology 22 2003. 179 – 196.
Cutler, Stephen J., und Jon Hendricks. »Age Differences in Voluntary Association Memberships. Fact or Artifact«. Journals of Gerontology – Social Sciences 55B 2000. 98 – 107.
Dingeldey, Irene. »Koordination zwischen Staat, Markt und Familie? Kritik der selektiven Perspektiven in der vergleichenden Wohlfahrts- und Arbeitsmarktforschung«. Wohlfahrtsstaat – Transformation und Perspektiven. Hrsg. Susanne Lütz und Roland Czada. Wiesbaden 2004. 107 – 126.
Erlinghagen, Marcel. »Arbeitslosigkeit und ehrenamtliche Tätigkeit im Zeitverlauf. Eine Längsschnittanalyse der westdeutschen Stichprobe des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) für die Jahre 1992 und 1996«. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 52 2000a. 291 – 310.
Erlinghagen, Marcel. »Informelle Arbeit. Ein Überblick über einen schillernden Begriff«. Schmollers Jahrbuch 120 2000b. 239 – 274.
Erlinghagen, Marcel. »Konturen ehrenamtlichen Engagements in Deutschland. Eine Bestandsaufnahme«. Sozialer Fortschritt 51 2002. 80 – 86.
Erlinghagen, Marcel. »Die individuellen Erträge ehrenamtlicher Arbeit. Zur sozioökonomischen Theorie unentgeltlicher, haushaltsextern organisierter Produktion«. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 55 2003. 737 – 757.
Erlinghagen, Marcel, und Karsten Hank. »The Participation of Older Europeans in Volunteer Work«. Ageing & Society (26) 4 2006. 567 – 584.
Erlinghagen, Marcel, und Gernot Mühge. »Wie kann man die Beständigkeit von Beschäftigungsverhältnissen messen? Durchschnittliche Betriebszugehörigkeitsdauer und Überlebensrate: zwei Messkonzepte im Vergleich«. Wirtschaftswissenschaftliches Studium 35 2006. 308 – 315.
Esping-Andersen, Gosta. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton 1990.
Freeman, Richard B. »Working for Nothing. The Supply of Volunteer Labor«. Journal of Labor Economics 15 1997. 140 – 166.
Gallagher, S. K. »Doing Their Share. Comparing Patterns of Help Given by Older and Younger Adults«. Journal of Marriage and the Family 56 1994. 567 – 578.
Gensicke, Thomas. »Bürgerschaftliches Engagement in Deutschland«. Aus Politik und Zeitgeschichte 12 2006. 9 – 16.
Hall, Peter A., und Daniel W. Gingerich. »Spielarten des Kapitalismus und institutionelle Komplementaritäten in der Makroökonomie – Eine empirische Analyse«. Berliner Journal für Soziologie 14 2004. 5 – 32.
Hank, Karsten, Marcel Erlinghagen und Anja Lemke. »Ehrenamtliches Engagement in Europa. Eine vergleichende Untersuchung am Beispiel von Senioren«. Sozialer Fortschritt 55 2006. 6 – 12.
Hirschman, Albert O. Engagement und Enttäuschung. Über das Schwanken der Bürger zwischen Privatwohl und Gemeinwohl. Frankfurt am Main 1984.
Kistler, Ernst, Eckhard Priller und Dorit Sing. »Notwendigkeiten, Möglichkeiten und Wege zur Aktivierung sozialwissenschaftlicher Forschung im Bereich von zivilgesellschaftlichem Engagement«. Informelle Ökonomie, Schattenwirtschaft und Zivilgesellschaft als Herausforderung für die Europäische Sozialforschung. Hrsg. Bundesministerium für Bildung und Forschung. Bonn 2000. 137 – 150.
Künemund, Harald. Gesellschaftliche Partizipation und Engagement in der zweiten Lebenshälfte. Empirische Befunde zu Tätigkeitsformen im Alter und Prognosen ihrer zukünftigen Entwicklung. Berlin 2001.
Mutchler, Jan E., Jeff A. Burr und Frank G. Caro. »From Paid Worker to Volunteer. Leaving the Paid Labor Force and Volunteering in Later Life«. Social Forces 81 2003. 1267 – 1293.
Sainsbury, Diane. Gender, Equality, and Welfare States. Cambridge 1996.
Salamon, Lester M., und Helmut K. Anheier. »Social Origins of Civil Society. Explaining the Nonprofit Sector Cross-Nationally«. Voluntas 9 1998. 213 – 248.
Salamon, Lester M., und Wojciech Sokolowski. »Volunteering in Cross-National Perspective. Evidence from 24 Countries«. Working Papers of the Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project No. 40. Baltimore 2001. Schmid, Josef. Wohlfahrtsstaaten im Vergleich. Soziale Sicherung in Europa.
Organisation, Finanzierung, Leistungen und Probleme. 2., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage. Opladen 2002.
Schmidt, Renate. »Förderung der Potenziale im Alter als Zukunftsthema der Politik«. Sozialer Fortschritt 11 – 12 2004. 326 – 328.
Schüll, Peter. Motive Ehrenamtlicher. Eine soziologische Studie zum freiwilligen Engagement in ausgewählten Ehrenamtsbereichen. Berlin 2004.
Schwarz, Norbert. »Ehrenamtliches Engagement in Deutschland. Ergebnisse der Zeitbudgeterhebung 1991/92«. Wirtschaft und Statistik 4 1996. 259 – 266.
Siegrist, Johannes, Olaf von dem Knesebeck und Craig E. Pollack. »Social Productivity and Well-Being of Older People. A Sociological Exploration«. Social Theory and Health 2 2004. 1 – 17.
Smith, Deborah B. »Volunteering in Retirement. Perceptions of Midlife Workers«. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 33 2004. 55 – 73.
SOEP Group. »The German Socio-Economic Panel (GSOEP) after more than 15 years – Overview«. Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 70 1 2001. 7 – 14.
Van Willigen, Marieke. »Differential Benefits of Volunteering Across the Life Course«. Journals of Gerontology – Social Sciences 55 B 2000. 308 – 318.
Warburton, Jeni, Deborah J. Terry, Linda S. Rosenman und Margaret Shapiro. »Differences between Older Volunteers and Nonvolunteers«. Research on Aging 23 2001. 586 – 605.
Wilson, John. »Volunteering«. Annual Review of Sociology (26) 2000. 215 – 240.
Wilson, John, und Marc Musick. »Who Cares? Towards an Integrated Theory of Volunteer Work«. American Sociological Review 62 1997. 694 – 713.
Länger leben, arbeiten und sich engagieren (Leseprobe)
Auszug aus:Jens U. Prager, André Schleiter (Hrsg.) Länger leben, arbeiten und sich engagierenChancen werteschaffender Beschäftigung bis ins Alter Gütersloh 2006 ISBN 978-3-89204-913-5 © Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh
Gesellschaftliches Engagement älterer Menschen als Potenzial
Harald Künemund
1 Einleitung
Ausweitung der Altersphase
In historischer Perspektive hat sich eine bislang einmalige Situation ergeben: Indem sich ein Lebenslaufregime herausgebildet und durchgesetzt hat, das um das Erwerbssystem herum organisiert ist, wurde der »Ruhestand« zu einer biographisch erwartbaren, sozialstaatlich abgesicherten und für eine individuelle Gestaltung weitgehend offenen Lebensphase (Kohli 1985). Die steigende durchschnittliche Lebenserwartung und das gleichzeitig sinkende Berufsaustrittsalter haben in jüngster Zeit zu einer enormen Ausweitung dieser Phase im individuellen Lebenslauf geführt. Zusätzlich hat der Geburtenrückgang dazu beigetragen, dass der Anteil der älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung stark gestiegen ist – und noch weiter steigen wird.
Der Ruhestand ist heute keine »Restzeit« mehr, die eine kleine gesellschaftliche Gruppe durchlebt, sondern ein eigenständiger Lebensabschnitt von erheblicher Dauer, in dem sich bald fast ein Drittel der deutschen Bevölkerung befindet (Höhn et al. 1994: 50), und zwar mit zunehmend besserer Bildung, besserer Gesundheit und – zumindest bislang – auch mit besserer materieller Absicherung.
Alternative Partizipationsformen notwendig
Für dieses »neue Alter« stellt sich die Frage der gesellschaftlichen Partizipation in besonderer Form. Zwar bleibt der Ruhestand in vielfältiger Weise mit dem Erwerbssystem verbunden, beispielsweise durch die Kontinuität der gesellschaftlichen Position oder durch die Finanzierung der Renten über den erwerbstätigen Teil der Bevölkerung. Dennoch ist diese Lebensphase genau durch den Fortfall der Erwerbsarbeit definiert, und damit rücken alternative Partizipationsformen in den Vordergrund (Kohli et al. 1993).
Aktivierung statt Betreuung
In jüngerer Zeit werden zunehmend die Kompetenzen, Potenziale und Chancen »erfolgreichen« und »produktiven« Alterns diskutiert, womit dem lange vorherrschenden »Defizitmodell« des Alters etwas entgegensetzt werden soll. Die Organisation entsprechender Aktivitäten – z. B. über »Seniorenexperten«, die ihre Kompetenzen und ihr Erfahrungswissen zur Verfügung stellen, oder die Seniorenbüros zur Koordinierung und Vermittlung neuer Formen produktiver Betätigung – hat die traditionelle »Altenbetreuung« tendenziell verdrängt. Es geht heute vor allem um Aktivierung, nicht mehr allein um Betreuung.
Effekte von Aktivität
Dabei kann man sich auf zahlreiche Befunde stützen, nach denen z. B. Gedächtnisfunktionen und psychomotorische Funktionen durch Training verbessert werden können (Oswald, Rupprecht und Gunzelmann 1996). Es wurde sogar belegt, dass freiwilliges Engagement einen lebensverlängernden Effekt hat (Musick, Herzog und House 1999). Dies allerdings nur, sofern dieses Engagement nicht 40 Stunden im Jahr übersteigt. In der Tendenz weist dieser Befund somit nicht nur auf einen positiven Effekt von Aktivität hin, sondern auch auf einen negativen, der letztlich für ein »Vitamin-Modell« (Kiefer 1997: 136 ff.) sprechen würde: Zu viel Aktivität kann ebenfalls ungesund sein. Grundsätzlich aber ist auch in der Biologie und Medizin die positive Wirkung von Aktivität und Training und für die Entwicklung bzw. Rehabilitation der körperlichen Leistungsfähigkeit betont worden (Fries 1989).
»Produktives Altern«
Im Folgenden sollen einige Aktivitäten in den Blick genommen werden, die unter dem Begriff der »produktiven« Tätigkeiten vor allem in den USA in der Diskussion »produktiven Alterns« gebräuchlich sind. Hauptsächlich werden diese Begriffe genutzt, um darauf hinzuweisen, dass auch im Alter Aktivität und gesellschaftliches Engagement, die Nutzen für andere stiften, einen großen Platz einnehmen. Damit soll der ausschließlichen Typisierung Älterer als Kostgänger des Sozialstaates – die den öffentlichen Diskurs über intergenerationelle Gerechtigkeit prägt – begegnet werden.





























