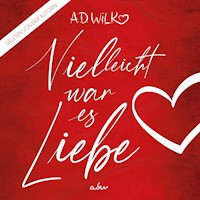4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: adw
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Das Schwanken des Bootes ist Cloe vertraut, doch die Menschen darauf sind es nicht. Nicht einmal sich selbst erkennt sie. Als sie mit hämmernden Kopfschmerzen aufwacht, sieht sie in das Gesicht einer Fremden. Und der Mann, ihr Vater, macht ihr Angst. Doch noch viel mehr fürchtet sie sich vor der Leere in ihrem Kopf. Der Leere in ihrem Herzen. Nur das Führen der Segel und der Junge mit den blauen Augen, der sie Nacht für Nacht in ihren Träumen besucht, können diese Leere füllen. Als sie vor dem Leben, an das sie sich nicht erinnern will, flieht und vollkommen auf sich allein gestellt durch die Meere segelt, findet sie tief in sich jedoch ein weiteres Leuchten. Und dieser noch nicht greifbare Traum wird zu ihrem Wegweiser über die tosenden Wellen, in die sich die andere Cloe hatte stürzen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Erhalte ein ganz besonderes Extra zu diesem Buch, wenn du dich für meinen Newsletter anmeldest.
adwbuecher.de/cloe-newsletter
Danke!
…
Für die Träume,
die wir
nicht loslassen.
PROLOG
Wir hätten nicht rausfahren sollen.“ Ich schrie, weil das Tosen des Sturms meine Stimme verschluckte. Weil die Wellen sie mit sich rissen, sie unter sich begruben.
Er hörte mich nicht, zerrte an dem Segel, das sich nicht hatte bergen lassen. Dabei war allein der Versuch von seiner Position aus sinnlos. Er war sechzehn, damit zwei Jahre älter als ich. Aber er benahm sich wie ein Baby. Er wusste nicht, was er tat.
„Du machst es nur noch schlimmer.“ Ich sicherte das Vorsegel, das ich allein hatte einrollen können, und eilte in seine Richtung.
„Was verstehst du schon davon?“ Gischt peitschte über das Boot. Sein Haar war nass und klebte an seiner Stirn. Im Hintergrund sah ich die Positionslichter eines anderen Segelbootes. Wir waren nicht allein hier draußen und doch würde uns niemand helfen können.
„Deutlich mehr als du, wie du weißt.“ Ich ging weiter auf ihn zu, hielt mich an der Reling fest und hörte über dem Tosen des Meeres ein weiteres Geräusch. Ich sah an ihm vorbei. „Der Motor? Hast du ihn gestartet?“
Er erwiderte nichts, aber sein Blick war Antwort genug. Seine rechte Hand umklammerte die Pinne, hielt uns weiter auf einem Kurs, auf dem ich nicht segeln wollte. Ich wollte überhaupt nicht segeln. Ich wollte, dass das Boot stehen blieb, sonst würden wir die Segel niemals einholen können.
„Du bist so ein verdammter Idiot.“
Sein Kinn hob sich etwas. „Ich bin ein Idiot?“
„Ja! Schalte den Motor aus und dann richte das Boot endlich so aus, dass der Wind von vorne kommt.“
Er reagierte nicht. Warum reagierte er nicht?
„Es ist zu viel Druck auf dem Segel, verdammt.“ Als wolle es meine Worte bestätigen, krängte das Boot in Richtung der Segel. Aus dem Rumpf drangen Schreie und dann rief jemand: „Bekommt ihr das da oben hin, oder habt ihr was Besseres zu tun?“ Gelächter.
Ich fasste noch immer die Reling, so wie mein Vater es mir hunderte Male erklärt hatte. Allerdings hatte er mich auch davor gewarnt, bei Wetter wie diesem aufs Meer hinauszufahren. Und er hatte mir beigebracht, den Wetterbericht zu checken, bevor ich auf ein Boot stieg. Wie man so die Flucht ergriff, dass man sich nicht in Lebensgefahr begab, hatte er mir nicht beigebracht. Vermutlich hatte er nicht geglaubt, dass das jemals nötig sein würde.
Auch der Junge war in Richtung Meer gerutscht und klammerte sich an einen Handlauf. Angst stand in seinen Augen.
„Nun macht schon. Der Alkohol muss weg, bevor er sich im Boot verteilt.“ Alle drei lachten. Selbst der Idiot. Keiner von ihnen war alt genug, um zu trinken, und nur zwei waren älter als ich.
„Der Motor. Schalt ihn aus! Und lenk das Boot in den Wind.“
Er rührte sich nicht.
Wut stieg in mir auf und ich schob mich selbst weiter zum Cockpit, eine Hand an der Reling. Es war kein besonders großes Boot. Das Boot meines Vaters war fünf Meter länger. Und so erreichte ich das Cockpit und den Jungen, dem das Lachen wieder vergangen war, mit wenigen Schritten. Er trug im Gegensatz zu mir keine Schwimmweste und ich hoffte, dass er seinen Griff nicht löste, bevor ich das Boot aus seiner Schräglage befreit hatte.
Ich schaltete den Motor aus und als der Fahrtwind nachließ, richtete sich das Boot etwas auf und der Wind blies mein nasses Haar seitlich gegen meinen Hinterkopf. Wir fuhren mit Raumwind. Wind schräg von hinten. Ich setzte mich auf die Bank, riss ihm die Pinne aus der Hand und sah auf, um noch einmal zu kontrollieren, aus welcher Richtung der Wind wehte.
Der Junge löste seine Hände, sein Gesicht noch immer angstverzerrt im fahlen Schein des Mondes, der zwischen den an ihm vorbeirasenden Wolken hervorlugte. Und dann stolperte er über das Deck zum Kabineneingang. Als er einen halbwegs stabilen Stand gefunden hatte, fand er auch seine innere, arrogante Haltung wieder. Wie hatte ich mich nur auf das hier einlassen können?
„Wenn du alles so viel besser weißt, mach es doch allein. Alter, du führst dich auf wie mein Vater.“ In Richtung der Kabine rief er: „Ich hoffe, ihr habt mir was übrig gelassen. Es sieht so aus, als hätten wir statt einer Vierzehnjährigen eine Dreißigjährige an Bord geholt.“ Noch einmal sah er hochmütig zu mir. „Bring uns sicher nach Hause, Mami.“ Dann verschwand er in der Kabine.
Unbändige Wut erfüllte mich. Doch ich konnte sie nicht herauslassen. Er hatte mir die Kontrolle über das Schiff überlassen und ich hatte keine Lust, damit gegen ein anderes Boot zu knallen. Und es waren andere Boote unterwegs. Ich erinnerte mich an die Positionslichter, die ich vor wenigen Minuten gesehen hatte. Und nicht jeder dachte daran, sie einzuschalten. Ich sah zum Horizont und konnte sie noch immer ausmachen. Kamen sie nicht sogar näher?
Mein Herzschlag beschleunigte sich und ich atmete tief durch. Das Boot raste weiter durch die Nacht. Und dann traf eine Böe es von der Seite. Ich schob die Pinne in Richtung der Segel, um die neuerliche Krängung auszugleichen, und löste zeitgleich die Großschot. Das Segel riss auf und von mir weg. Ich steuerte weiter in Richtung Wind, der jetzt wieder nachließ.
Das Segel schlug zurück und ich rief nach dem Jungen, weil ich es nicht ohne seine Hilfe bergen konnte. Jemand musste das Boot im Wind halten. Niemand reagierte und vor Zorn sprang ich auf, eilte zum Mast und startete einen neuen Versuch, es herunterzuholen. Doch der Wind drehte wieder, schlug das Segel zurück gegen meinen Oberkörper. Ich stemmte mich dagegen, presste mit all der Kraft dagegen, die ich in den vergangenen Jahren im Kampfsport-Training mit Jake und beim Segeln aufgebaut hatte, doch gegen die unendliche Gewalt der Natur hatte ich keine Chance.
Die Böe wurde stärker und trieb mich und das Segel weiter. Über die Reling. Ich klammerte mich an den Baum, streckte meine Beine aus, um die Reling mit den Füßen zu fassen, und schaffte es irgendwie. Die Böe ließ nach, das Segel schlug zurück. Ich wähnte mich sicher, trat mit den Füßen auf die Bank und ließ den Baum los, der sofort in die andere Richtung ausschlug. Die Kunststoffbank war rutschig und mein Fuß glitt darüber. Dabei streifte ich die Pinne. Das Boot steuerte backbord in meine Richtung.
Ich sah den Baum kommen, doch ich konnte meine Hände nicht schnell genug heben, versuchte, mich zu ducken, und schaffte auch das nicht ausreichend. Das harte Metall schlug gegen meinen Kopf und ich verlor das Gleichgewicht und das Bewusstsein.
EINS
CLOE
Ich schwankte. Oder … vielmehr … Ich befand mich in etwas Schwankendem. Das Gefühl war vertraut und ich ließ mich davon auffangen, fiel hinein in die Sicherheit, die das vertraute Gefühl auslöste.
Da war etwas in mir, das sich falsch anfühlte. Panik stieg in mir auf und mit ihr ein hämmernder Schmerz in meinem Kopf. Er verdrängte das Schwanken und damit die Sicherheit. Das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, schwoll mit ihm an. Er ließ mein Herz Schlag für Schlag beschleunigen, bis es so heftig gegen meine Brust hämmerte, als wollte es die Rippen sprengen, die es schützten.
Ich konnte den Mund nicht länger geschlossen halten, weil mein Atem sich beschleunigte, und hechelte mehr, als dass ich atmete.
In diesem Moment legte sich eine Hand auf meine Stirn und durch das Toben in meinem Inneren hörte ich eine sanfte Stimme: „Schhh… es ist alles okay. Du bist in Sicherheit.“ Um die Stimme herum war alles ruhig. So als wäre ich selbst eine tosende Welle, die über einen glatten See polterte.
Ich wollte Teil dieser Ruhe sein, wollte mich von ihr beruhigen lassen.
Also öffnete ich die Augen und hoffte, mich sofort wieder in die Vertrautheit des Schwankens fallen lassen zu können.
Doch die Augen, die mich besorgt ansahen, kannte ich nicht. Ich ließ den Kopf von links nach rechts schnellen und mir wurde schwindelig. Um mich herum entdeckte ich nichts, das mir vertraut war.
„Wo bin ich?“ Die Worte lösten sich mit einem losen Krächzen aus meiner Kehle.
„Du bist ins Wasser gefallen.“ Auch den Klang ihrer Stimme kannte ich nicht.
„Wann?“ Noch immer nur ein Krächzen. Ich richtete mich auf. „Wo bin ich?“ Ich hustete.
Sie reichte mir ein Glas Wasser und lächelte mich liebevoll an. Ihr Blick fiel auf meinen Hals. „Cloe.“
Ich runzelte die Stirn und nickte. Richtig. Cloe. Das war mein Name. Es war, als hätte ich ihn vergessen gehabt.
Mein Herz begann wieder zu rasen. Erneut sah ich mich um, versuchte, der Frau vor mir einen Namen zuzuordnen. Doch ich fand keinen. Ich fand nichts. Ich fand ihren Namen nicht. Ich fand den Namen meiner Mutter nicht? Das war sie doch, oder? Ich erschrak. Wie konnte ich das nicht wissen? Was war hier los?
Um mich zu beruhigen, sah ich mich um. Ich befand mich in einer Schiffskabine. In einer Schlafkajüte, die gerade genug Platz für ein Doppelbett bot. Kein Boden, auf dem man gehen konnte. Kein großer Schrank, in dem man seine Kleider verstauen konnte. Nur ein paar Fächer für Bücher und vielleicht ein paar T-Shirts.
Ich griff nach der silbernen Kette, auf die die Frau gerade geschaut hatte, klammerte mich an den Anhänger, auf dem mein Name stand. Ich war Cloe. Cloe … Ich kniff die Augen zusammen, kämpfte mich an dem Schmerz in meinem Kopf vorbei zu dem Ort, an dem ich weitere Informationen finden musste. Doch ich suchte vergebens. Da war nichts.
Hektisch riss ich die Augen wieder auf. „Wie ist mein Nachname?“
Sie runzelte die Stirn. Besorgnis trat in ihren Blick. Mehr noch als zuvor. „Du weißt nicht, wie du heißt?“
Ich stemmte die Hände in die Matratze und setzte mich aufrecht hin. Nun musste ich die Augen schließen, denn der Schmerz drohte, meine anderen Sinne zu betäuben. Langsam schüttelte ich den Kopf, hoffte dabei, Worte und Bilder wieder an die Stelle schütteln zu können, an der ich sie sehen konnte. Nichts. Da war nichts. Cloe. Nichts außer Cloe. Ja, ich war Cloe. Aber was noch? Was war das für ein Boot? Warum war ich ins Wasser gefallen?
Panisch riss ich die Augen wieder auf. „Nein, ich weiß nicht, wie ich heiße. Ich weiß nicht, warum ich ins Wasser gefallen bin. Ich … Ich …“ Ich suchte nach weiteren Informationen und fand eine einzige. Ein Datum. An der Wand vor mir hing ein Kalender, dessen Tage bis zum fünften Juni durchgestrichen waren. Es war also Juni.
„Ich habe am 23. Juni Geburtstag. Ich werde fünfzehn.“
Sie nickte lächelnd, als wüsste sie, wovon ich sprach.
Angestrengt suchte ich nach weiteren Informationen. Doch auch nachdem Minuten verronnen waren, hatte ich nichts gefunden.
Sie hielt die gesamte Zeit über meine Hand. Ihr Blick wurde von Sekunde zu Sekunde ernster und besorgter. Sie machte sich Sorgen um mich. Kannte sie mich? Sollte ich sie kennen?
„Bist du … bist du meine …“ Es war so absurd, diese Frage zu stellen. Wie konnte ich die Antwort darauf nicht kennen? „Bist du meine Mutter?“
Ihr Mund öffnete sich leicht und sie wirkte erschrocken. Der Druck ihrer Hand wurde etwas fester. Und dann erklang ein Poltern aus einem anderen Teil des Bootes.
„Na, ist die kleine Wasserratte endlich aufgewacht?“ Ein Mann, alt genug, um mein Vater zu sein, erschien im Türrahmen. Er hatte dunkles dichtes Haar und braune Augen. Es fiel mir auf, weil ich mein eigenes Haar auf meiner Brust liegen sah. Es war auch dunkel und dicht. Welche Farbe hatten meine Augen? Verdammt, warum kannte ich die Farbe meiner Augen nicht?
„Sie kann sich an nichts erinnern.“
Ich sah wieder zu der Frau. Sie war blond und hatte blaue Augen.
„Was denn? Du weißt nicht mehr, wie du bei dem Sturm letzte Nacht ins Wasser gefallen bist?“ Auch er klang besorgt. Oder?
Ich versuchte, meinen Atem zu beruhigen, doch ich schaffte es nicht. Schneller und schneller sog ich die Luft ein. „Wer seid ihr? Wo bin ich hier?“ Dann stellte ich die alles entscheidende Frage: „Wer bin ich?“ Und ich setzte hinzu: „Warum weiß ich das nicht?“
Die Frau fing mich auf, schloss mich in eine Umarmung, die sich nicht vertraut anfühlte, und doch ließ ich sie zu. Nach und nach wurde mein Atem flacher, der Abstand zwischen den einzelnen Zügen länger. Dafür hämmerte der Schmerz heftiger in meinem Kopf. Er hinderte mich daran, klar zu denken. Mich zu erinnern. Ja, vielleicht war es nur der Schmerz.
Der Mann setzte sich auf das Bett. Der winzige Raum gab kaum genug Platz für uns drei her, doch den beiden schien es nichts auszumachen. Für sie schien es in Ordnung zu sein, mir so nah zu sein.
„Du hast da eine ziemlich heftige Verletzung am Kopf. Vielleicht ist dadrin ein bisschen was durcheinandergeraten.“ Auch seine Stimme war mir nicht vertraut. Doch seine Worte ergaben Sinn.
„Wie schlimm ist denn meine Verletzung?“ Vorsichtig tastete ich meinen Kopf ab und fand einen Verband. „Was ist passiert?“
Er räusperte sich. „Wir sind auf offener See, Kleines.“ Er schob einen Vorhang zur Seite und eröffnete mir damit einen Blick nach draußen. Es dämmerte und ich erkannte Wellen und Himmel. Sonst nichts. „Erinnerst du dich an den Sturm?“
Ich suchte in meinem Kopf nach der Erinnerung, doch da war keine. Ich fasste mir mit beiden Händen in die Haare. Dicht und schwarz. „Nein, ich erinnere mich nicht.“
Die beiden sahen sich besorgt an.
„Ihr seid meine Eltern, oder? Und ich erkenne euch nicht.“ Wieder Panik. Und Tränen. Erst jetzt stiegen Tränen in mir auf.
Die Frau streckte wieder die Arme nach mir aus, doch ich wich zurück, fühlte mich allein und fiel nun, ohne die Gewissheit, dass mich etwas auffangen würde. Ich kauerte mich in die Ecke des Bettes, versteckte mein Gesicht hinter meinen Händen und hoffte, dass ich einfach einschlafen würde. Ich wollte aus diesem Alptraum aufwachen.
ZWEI
CLOE
Wieder empfing mich das Schwanken. Wieder ließ ich mich in das vertraute Gefühl fallen. Dieses Mal kam mit dem Schmerz die Erinnerung an mein letztes Aufwachen. Ich war Cloe, hatte dichtes schwarzes Haar und ich war vierzehn. Ich hielt die Luft an, presste die Lippen aufeinander und versuchte auf diese Weise, noch mehr in meinem Kopf zu finden. Nichts. Da war nichts. Nur die blonden Haare der Frau und die braunen Augen des Mannes.
Inmitten der Leere wirkte beides vertraut.
Ich öffnete die Augen.
Die Frau lag neben mir. Den Mann konnte ich schnarchen hören.
Vorsichtig schob ich mich an der Frau vorbei. Sie erwachte nicht und auch der Mann, der in einer noch kleineren Kajüte im Bug des Schiffes lag, schien nicht zu bemerken, wie ich die Türen zum Deck öffnete.
Er hatte recht. Wir befanden uns auf offener See. Kein Berg, keine Insel, kein anderes Schiff waren in Sicht.
Meine Beine fühlten sich an wie Gummi. Ich hielt mich an der Reling fest und spürte … Vertrauen. Das war mir vertraut. Ein flappendes Geräusch erregte meine Aufmerksamkeit und ich blickte nach oben. Die Segel schlugen hin und her. Es war fast windstill. Doch die Dünung des Meeres ließ den Segler rollen. Der Motor war ausgeschaltet.
Einem Instinkt folgend, holte ich zunächst das Vorsegel und dann das Großsegel ein. Auch das fühlte sich vertraut an und ich suchte nach einer Erinnerung, nach Bildern, Worten. Nach irgendetwas, das mir erklärte, woher dieses Vertrauen rührte. Nichts. Ich wusste nur, dass es nicht gut für die Segel war, wenn sie hin und her schlugen.
„Was tust du da?“ Im Tageslicht wirkte er älter. Vielleicht lag es aber auch daran, dass er geschlafen hatte und auf der Haut in seinem Gesicht noch die Abdrücke seines Kopfkissens waren.
Ich deutete nach oben. „Die Segel haben geschlagen.“
Eine tiefe Falte zog sich auf seiner Stirn zusammen. „Wo ist sie?“
Seine Frage ließ mich aus zwei Gründen zusammenzucken. Zum einen war da seine plötzliche Wut, die ich fast spüren konnte. Und zum anderen eröffnete er mir die Chance, ihn direkt zu fragen. „Du meinst, meine Mutter? Ist sie das? Bist du mein Vater?“
Er atmete durch und setzte sich. „Du erinnerst dich noch immer nicht.“
Ich schüttelte den Kopf und wieder stiegen Tränen in mir auf.
Ein sanftes Lächeln legte sich auf seine Lippen und er strich mir über die nasse Wange. Dann deutete er zum Mast. „Das mit den Segeln hast du von mir gelernt. Ich habe es dir erklärt, als du noch ganz klein warst.“
Ich schluckte, suchte nach dem Bild, das zu seinen Worten gehörte. Nichts. Wieder war da einfach nichts. Oder doch? Ganz tief in mir schien sich etwas an seine Worte zu klammern, als wollte es sie bestätigen. Ja, mein Vater konnte es gewesen sein, der mir beigebracht hatte, wie man die Segel schonte.
„Du erinnerst dich nicht.“
Ich schüttelte den Kopf, ließ ihn hängen und sah meinen Tränen zu, wie sie das alte Holz dunkel färbten. „Ich erinnere mich an gar nichts.“
„An überhaupt nichts?“
Ich sah wieder auf. „Ich bin Cloe und vierzehn Jahre alt.“
Er lächelte. „Bald bist du fünfzehn.“
Ich nickte. „Ja, bald bin ich fünfzehn.“
„Ich sag dir was: Ich wette, wenn du fünfzehn bist, weißt du wieder, wer du bist.“
„Warum bist du dir da so sicher?“
„Weil so etwas nie lange dauert. Du hast den Baum gegen den Kopf bekommen. Das war ein ziemlich harter Schlag. Das wird schon wieder. Ruh’ dich ein paar Tage aus und dann sehen wir weiter.“ Sein Lächeln war aufmunternd, aber es reichte mir nicht.
„Sollten wir nicht zu einem Arzt gehen?“
„Deine Mutter ist Krankenschwester. Sie kümmert sich um dich.“
„Nein, ich meine, ein Arzt, der sich mit so etwas auskennt.“ Ich zog die Stirn in Falten, versuchte wieder, etwas im Gesicht des fremden Mannes zu erkennen, das mir vertraut war. Nichts. Nur die schwarzen Haare. War ich zu misstrauisch?
„Das machen wir, wenn wir das nächste Mal an Land gehen, okay?“
„Warum nicht jetzt?“
Es dauerte ein paar Sekunden, bis er antwortete, und ich hatte das Gefühl, dass ihm meine Fragerei nicht gefiel. „Weil wir auf dem offenen Meer sind.“ Er machte eine Handbewegung, als hätte ich es bis jetzt nicht mitbekommen.
„Wir könnten direkt Land ansteuern.“ Ich schloss die Augen, weil mich das Gespräch anstrengte.
Seine Hand strich sanft über meinen Arm. „Hör zu, Kleines. Du hast da eine heftige Beule. Wir kriegen das auch allein hin. Wir … wir sind nicht so die Ärzte-Gänger, verstehst du?“
Ich schüttelte den Kopf. „Nein, das verstehe ich nicht.“
Er atmete tief ein und genervt wieder aus. Ganz so, als hätte er dieses Gespräch schon einmal mit mir geführt. „Ich vertraue Ärzten nicht, okay? Sie wollen einem Operationen und Medikamente aufquatschen. Den meisten Scheiß braucht man nicht.“
Ich sah ihn an. Und dann glitt mein Blick über das Boot, das schon ein paar Jahre auf dem Wasser unterwegs war. Es war gepflegt, ja, aber es gab einige Teile, die erneuert werden mussten. Wieder sah ich zu ihm. Auch seine Klamotten waren an manchen Stellen zerschlissen. Und dann verstand ich. Er hatte Angst vor den Kosten. Vielleicht waren wir nicht einmal krankenversichert.
Langsam nickte ich. Was blieb mir auch anderes übrig? Wenn wir das nächste Mal Land anfuhren, würde er mich zu einem Arzt bringen. Bis dahin konnte ich kaum etwas tun.
Schritte drangen aus dem Inneren des Bootes und kurz darauf erschien die blonde Frau mit den blauen Augen. Sie gähnte und streckte die Fäuste in Richtung Himmel. „Wie schön, dass ihr wach seid.“ Ihr Blick fixierte mich. „Wie geht es dir, Cloe?“ Und nach einem kurzen Blickwechsel mit ihm, mit … mit meinem Vater, fragte sie: „Erinnerst du dich inzwischen, wer wir sind?“
Wieder stiegen Tränen in mir auf, als ich den Kopf schüttelte.
Sie setzte sich neben mich. Ich lehnte meinen Kopf an ihre Schulter, auch wenn es sich fremd anfühlte.
„Das wird schon wieder, mein Schatz. Mein Onkel Mario hatte das auch mal.“
Hoffnungsvoll sah ich auf.
Sie missdeutete meinen Blick. „Du erinnerst dich an Onkel Mario?“
Ich schüttelte den Kopf. „Nein, aber ich wollte hören, was mit ihm passiert war.“ Ein schlechtes Gewissen erfasste mich. Ich hatte ihr falsche Hoffnungen gemacht.
Sie schluckte. „Nun ja, er … er hat einen Spaten gegen den Kopf bekommen.“
„Einen Spaten?“ Meine Augen weiteten sich.
Mein … Vater machte ein seltsames Geräusch.
„Er hatte einen Streit.“ Sie räusperte sich. „Auf jeden Fall konnte er sich eine Woche lang nicht an seinen Namen erinnern. Und auch an nichts anderes.“ Sie lächelte mich aufmunternd an. „Da bist du doch schon viel weiter.“
Ich nickte, weil es stimmte. „Wie hat er sich dann wieder erinnert?“
„Einfach so. Er wachte morgens auf und wusste wieder, wo er sein Kleingeld versteckt hatte.“ Sie lachte auf. Ich konnte nicht mit einstimmen.
Eine Woche.
„Seit wann … wann bin ich aus dem Boot gefallen?“
„Das war vor zwei Tagen.“
Wieder versuchte ich mich zu erinnern. Doch stattdessen fand ich eine Information, die nichts mit mir zu tun hatte. Irgendwoher wusste ich, dass Menschen sich oft nicht an Unfälle erinnerten. Selbst wenn ich also mein Gedächtnis wiederbekam, war es möglich, dass ich mich an den Unfall selbst nie erinnern würde.
„Was ist eigentlich passiert?“
Die beiden tauschten einen Blick. Einen langen Blick.
„Was? Warum sagt ihr es mir nicht?“ Wieder schlug mein Herz schneller.
„Die Sache ist die, Kleines.“ Er legte eine Hand auf mein Knie. Es war nackt. Ich trug Shorts. Unverschlissene Shorts. Sie wirkten fast neu. Mein Blick glitt mein Bein hinab und ich sah eine lange Narbe, konnte ihr aber keine Erinnerung zuordnen. Natürlich nicht.
„Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Du hast alle deine Sachen in einen Rucksack gestopft und bist an Deck gestürmt. Direkt in den Regen und den Wind.“
„Warum?“
„Nun, sagen wir es mal so: Du warst nicht einverstanden mit unseren Reiseplänen.“ Er legte den Kopf schief und lächelte.
„Reisepläne? Rucksack?“
„Wir haben unser Haus verkauft und so ziemlich alles, was sich darin befand. Dafür haben wir uns diesen Segler zugelegt und sind jetzt auf der Suche nach einem neuen Heim.“
Ich runzelte die Stirn. „Und das wollte ich nicht?“
„Das wolltest du nicht.“
„Und deswegen habe ich meinen Rucksack gepackt? Es wäre doch alles nass geworden.“
„Du warst wahnsinnig wütend und es war ein wasserdichter Rucksack. Von Beginn der Reise an hast du damit gedroht, vom Schiff zu springen, wenn wir Ernst machen.“ Er lächelte warm. „Ich hab dir das nicht geglaubt und das hat dich noch wütender gemacht. Was das angeht, bist du mir sehr ähnlich.“
Er sagte es, als wäre es ein Kompliment, doch es fühlte sich nicht danach an.
„Und was ist dann passiert?“ Ich sah zu der Frau, die meine Mutter war, doch sie sagte nichts. Ihre Augen waren gerötet.
„Du bist mit dem Rucksack an Deck gestürmt, hast deine Schwimmweste angezogen und dich an die Reling gestellt. Ich bin sofort zu dir gegangen, hab das Ruder nicht mehr kontrolliert und der Baum hat uns beide von Bord gerissen. Ich konnte dich und eine Leine greifen und Tini und ich haben dich wieder ins Boot gebracht. Dein Rucksack ist allerdings verschwunden. Und damit auch all deine Sachen. Du hast nichts zurücklassen wollen.“
Tini. Das war also ihr Name.
„Danke.“ Meine Stimme krächzte fast so wie am Tag zuvor. „Du hast mir das Leben gerettet.“
„Und ich würde es immer wieder tun.“ Er grinste mit einem Mundwinkel. „Vielleicht könntest du dir beim nächsten Mal aber eine weniger stürmische See aussuchen.“
Ich nickte nur und ging nicht auf seinen Witz ein. Ich hatte hier verschwinden wollen. Ich war bereit gewesen, in einem Sturm von Bord zu springen. Oder nicht? „Wäre ich wirklich gesprungen?“
Endlich sagte sie etwas. „Nein, mein Schatz. Du wolltest uns nur drohen. Du warst so verzweifelt, weil du all deine Freunde zurücklassen musstest.“
Ich sah hoffnungsvoll auf. „Könnte ich einen von ihnen anrufen?“ Ein anderes Paar blauer Augen schob sich vor ihre. Doch es formte sich kein Gesicht um sie herum.
„Wir können hier draußen nicht telefonieren.“
Ich nickte und glaubte ihm. „Aber wenn wir es wieder können, möchte ich einen von ihnen anrufen.“
Er deutete auf den Ozean. „Zu blöd, dass dein Handy mit all den Telefonnummern jetzt Fischfutter ist.“
Missmutig ließ ich die Schultern sinken. „Habt ihr denn keine Nummern von ihnen oder ihren Eltern?“
„Mein Telefon ist bei der Rettungsaktion untergegangen.“
Ich presste die Lippen aufeinander und sagte dann: „Es tut mir leid.“
„Ist schon okay.“
„Was ist mit dir?“ Ich sah zu Tini.
„Leider hast du unser einziges Ladegerät in deinen Rucksack gelegt. Der Akku ist seit gestern Mittag leer.“
„Es tut mir leid“, wiederholte ich und plötzlich übermannte mich eine schwere Müdigkeit. Ich lehnte mich zurück und suchte eine bequeme Position für meinen Kopf, fand sie gegen die Reling jedoch nicht. Das war vertraut.
„Leg dich wieder hin, Kleines. Du brauchst viel Schlaf. Sicher geht es dir besser, wenn du wieder aufwachst.“ Sie sah mir nicht in die Augen, sondern hielt den Blick aufs Meer gerichtet.
Ich nickte und blieb dann doch sitzen.
„Komm, ich bring dich hinein.“ Er stand auf und mir wurde bewusst, dass ich nicht einmal seinen Namen kannte.
Ich sah zu ihm auf. Er war nur einen Kopf größer als ich, schmal gebaut und doch zeigten sich starke Muskeln unter den Ärmeln seines T-Shirts. „Wie heißt du?“
Sein Mund verzog sich und ich bereute meine Frage. Andererseits brachte ich es nicht über mich, ihn Papa oder dergleichen zu nennen.
„Es tut mir leid. Es ist nur …“
Er lächelte, doch ich erkannte, dass es ihm schwerfiel. „Ist schon okay. Mein Name ist Eduardo. Aber meine Freunde nennen mich Eddie.“
Ich ließ den Namen durch meinen Kopf wandern, suchte nach einer Erinnerung, nach Gefühlen. Wieder war da nichts und ich seufzte erschöpft. Mehr als alles andere zehrte diese Sucherei an meinen Kräften. Vielleicht hatten die beiden recht. Vielleicht sollte ich einfach abwarten.
„Du brauchst mich nicht zu bringen, Eddie. Ich schaffe das allein.“ Ich erhob mich und schritt langsam die Treppe ins Innere des Bootes hinunter. Unten angekommen, sah ich zu den beiden auf und sagte: „Ich will nicht länger euer Bett belegen.“ Ich deutete nach rechts, auf die Steuerbordseite. „Ich nehme an, das hier ist mein Zimmer.“
Eddie lächelte liebevoll. „Ja, das sollte es sein.“
Ich nickte. „Dann werde ich ab sofort dort schlafen.“ Es war kaum ein Schritt notwendig, um in die winzige Kajüte zu krabbeln. Als ich es geschafft hatte, zog ich die Tür hinter mir zu und rollte mich so zusammen, dass ich durch eines der Fenster das Meer sehen konnte. Ich zog die Decke über meinen Körper und verfolgte die Dünung des Meeres, die das Boot noch immer hob und senkte.
Und dann löste sich eine einzelne Träne aus meinem Auge, tropfte auf das Kopfkissen und wartete auf die nächste. Eine nach der anderen floss meine Wangen hinab, bis ein Schluchzen meiner Kehle entwich. Ich hielt mir die Hand vor den Mund, wollte nicht, dass Tini und Eddie mich hörten.
Ich wollte sie nicht sehen. Ich wollte nicht, dass sie mir Trost spendeten, der doch nicht trösten konnte. Ich wollte nicht in ihre enttäuschten und sorgenvollen Gesichter sehen, deren Ausdruck so anders war als ihre Worte.
Sie hatten Angst. Und auch ich hatte Angst. Ich hatte Angst, für immer so zu bleiben. Würde ich mich je wieder erinnern? Würde ich mich hier bei Eddie und Tini zu Hause fühlen, wenn ich mich nicht erinnerte? Und was war geschehen, dass ich in einem Sturm vom Boot springen wollte, das war doch lebensgefährlich.
Die Aussicht, mit einer Yacht über die Ozeane zu fahren, fühlte sich jedoch ganz und gar nicht wie ein Alptraum an. Sollte mein altes Ich so anders gefühlt haben? Oder war da etwas anderes?
Das Schluchzen war verklungen und ich wischte die letzten Tränen von meinen Wangen. Ich sehnte mich so sehr danach, zu Hause zu sein. Doch wie sollte ich das, ohne zu wissen, wer ich war?
Ich schloss die Augen. Die Dunkelheit dahinter empfing mich wie ein wärmendes Kissen. Doch auch der Schmerz in meinem Kopf meldete sich wieder. Ich versuchte, meine Aufmerksamkeit von ihm weg hin zu dem vertrauten Gefühl zu lenken, das das schwankende Boot nun wieder in mir hervorrief.
Es gelang mir mehr und mehr und ich ließ mich von den Wogen des Meeres in den Schlaf schaukeln. In dem Bewusstsein, dass sie das schon unzählige Male getan hatten.
Seine Augen sind so blau wie das Meer. Ich kann nicht glauben, dass seine Hand meine hält. Hier auf unserem Steg. Sie ist deutlich größer als meine, die Haut an seinen Fingern ist rau. Wovon, vermag ich nicht zu sagen. Die Sonne geht unter, verschwindet zwischen den Bäumen. In ein paar Minuten wird sie in den See tauchen und das Licht des rosafarbenen Himmels wird dem Schwarz der Nacht weichen. Ob er trotzdem hier mit mir sitzen bleibt? Wir reden nicht. Da ist nur seine Hand, die meine hält. Nur die sanfte, warme Brise, die über unsere Körper rollt. Und das Kribbeln in meinem Bauch. Der Wunsch, näher zu ihm zu rücken. Meinen Kopf an seinen Arm zu lehnen. Ihm nah zu sein. Doch ich bleibe sitzen und genieße das Gefühl seiner rauen Haut auf meiner weichen. Ich genieße es, dass wir allein sind. Ich genieße es, ihn von der Seite zu betrachten, bis er den Kopf zu mir wendet und ein unsicheres Lächeln auf seinen Lippen erscheint. Ich erwidere es, hoffe, dass es mehr bedeutet, als ich vermute. Er wendet den Kopf wieder auf den See und ich folge seinem Blick. Der Himmel ist nicht nur rosafarben, sondern auch orange, gelb, rot, blau und lila. All die Farben verweben sich miteinander und tauchen die Welt in das Licht der Träume. Ich lasse mich fallen.
DREI
CLOE
Als ich erwachte, war es dunkel. Jemand hatte die Vorhänge wieder vor die Fenster gezogen, aber auch dahinter schien es nicht mehr hell zu sein. Ich streckte die Hand aus, um sie zurückzuziehen, und hielt dann in der Bewegung inne, um dem Geräusch zu lauschen, das mich geweckt hatte.
Ich lauschte in die Dunkelheit. Stimmen. Sie waren nicht besonders laut und ich verstand die Worte nicht, aber es war deutlich, dass sie stritten. Ein Mann und eine Frau. Langsam fügten sich Ausschnitte in meinem Kopf zu einem Bild zusammen. Tini und Eddie. Meine Eltern. Noch immer fühlte ich keine verbindende Wirkung, wenn ich ihnen diese Bezeichnung gab.
Ich rührte mich nicht, versuchte, Wortfetzen auseinanderzubröseln, doch der Inhalt ihres Streits blieb hinter den Türen.
Ich schloss die Augen, wollte wieder einschlafen, der erinnerungslosen Dunkelheit entfliehen. Hatte ich nicht in meinem Traum die Vertrautheit gespürt, nach der ich in der Realität suchte?
Doch dann machte sich ein anderes Bedürfnis nur allzu deutlich bemerkbar. Ich musste pinkeln. Ich hatte die Toilette am Vortag gesehen, aber nicht benutzt. Sie befand sich neben der Kajüte, in der ich die erste Nacht nach dem Unfall geschlafen hatte. Wenn ich jetzt aufstand, würden sie mich bemerken und wüssten, dass ich ihren Streit mitgehört hatte.
Andererseits musste ihnen dieses Risiko auf so einem kleinen Boot bewusst sein. Vielleicht versuchten sie normalerweise gar nicht, ihre Streits vor mir zu verbergen.
Ich schob die Decke von meinem Körper und krabbelte zur Tür. Als ich sie öffnete, hörte ich weitere Geräusche, die mich erstarren ließen. Das waren keine Stimmen mehr. Etwas klatschte und dann war da ein dumpfer Knall. Es folgte Stille und schließlich ein Aufschluchzen, das von Eddies Stimme unterbrochen wurde. Ich verstand seine Worte nicht.
Vorsichtig schloss ich die Tür erneut. Der Druck auf meiner Blase war so stark, dass ich fürchtete, einzupinkeln, doch um nichts in der Welt wollte ich jetzt da hinausgehen. Um nichts in der Welt wollte ich, dass er wusste, dass ich gehört hatte … Was hatte ich gehört?
Wieder fragte ich mich, warum die Cloe, die diese Welt kannte, vom Schiff hatte springen wollen. In einem Sturm.
Ich schob den Vorhang zur Seite. Der Mond beleuchtete die Wellen, die schäumend brachen. Der Wind schien aufgefrischt zu haben. Ich lauschte erneut in die Dunkelheit und vernahm das Geräusch des Windes, der an den Segeln vorbeiströmte.
Minutenlang konzentrierte ich mich auf diese Vertrautheit. Das Schaukeln. Der Wind. In all der Fremde spürte ich zu beidem eine Verbindung, die mich Mut schöpfen ließ. Nicht alles von mir war im Nebel vergessen.
Ich war Cloe, vierzehn Jahre alt. Ich hatte schwarzes dichtes Haar und ich wusste, wie man segelte. Der Wind und ich, wir waren Freunde.
Ich hätte hinzufügen können, dass meine Eltern Tini und Eddie waren, doch das fühlte sich nicht so richtig an wie die anderen Dinge.
Ich döste ein und erwachte erneut, als Schritte über meinem Kopf ertönten. Jemand war an Deck. Der Druck auf meiner Blase war nun so stark, dass ich es nicht länger zurückhalten konnte. Ich krabbelte wieder zur Tür, stieß sie auf und eilte zum Badezimmer. Das Boot fuhr mit leichter Schräglage, doch auch das fühlte sich vertraut an. Ich pinkelte nicht daneben.
Zurück in der Hauptkabine suchte ich nach etwas zu trinken und fand im Kochbereich eine Wasserflasche. Mit ihr in der Hand stieg ich die Treppe zum Deck hinauf. Es dämmerte und war hell genug, um die verblichenen Holzbretter zu erkennen, aus denen das Deck gezimmert worden war. Sie mussten abgeschliffen und neu versiegelt werden.
„Zieh dir eine Schwimmweste an. Du kennst die Regeln.“ Eddie kam vom Bug am Mast vorbei zu mir.
„Nein, ich kenne die Regeln nicht.“ Fast wurde ich wütend. Hatte er wirklich vergessen, dass ich mich an nichts erinnerte? Allerdings war mir der Gedanke vertraut, mich auf dem Boot nur mit Schwimmweste zu bewegen. Und in gewisser Weise fühlte ich mich nackt, weil ich keine trug.
„Tut mir leid. Ich dachte, wenn ich so mit dir rede, wie ich es immer getan habe, würde das in deinem hübschen Köpfchen ein paar Glocken zum Läuten bringen.“
So hatte er immer mit mir gesprochen? In diesem Kommandoton? Ich schüttelte den Kopf. „Nein, das hat es nicht. Wie sind denn die Regeln?“
Er öffnete die Klappe einer der Backskisten, auf denen ich am Vortag im Cockpit gesessen hatte, und deutete auf die darin liegenden neonorangefarbenen Westen. Mein Herz machte einen kleinen Sprung. Die Westen waren mir vertraut. Zumindest jene, die ganz oben lag.
„Wer an Deck geht, trägt eine Schwimmweste. Ab Windstärke sechs werden alle auf Deck mit einer Lifeline an der Reling angebunden.“
„Du trägst keine Schwimmweste.“ Ich überlegte. „Und gestern hatten wir auch keine an.“
„Gestern hättest du dem Boot hinterher schwimmen können.“
Ich schüttelte den Kopf. „Das glaubt man, aber eigentlich ist es unmöglich. Schon die kleinste Brise kann das Boot auch ohne gehisste Segel davon treiben lassen. Und dann noch die Strömung.“ Ich riss die Augen auf und grinste.
Auch Eddie grinste. „Na, das sieht doch ganz so aus, als hättest du nicht alles vergessen.“
Ich schüttelte den Kopf und griff nach meiner Weste. „Nein, das habe ich nicht.“
„Nun gib mir schon auch eine.“
Ich nahm die größere der beiden verbliebenen, deutlich verschlisseneren heraus, schloss die Bank wieder und setzte mich. Für eine Weile beobachtete ich das Wasser und die Segel. Der Wind wehte von backbord, doch die Wellen strömten von dort und von achtern auf das Boot zu. Eine Kreuzsee.
Ich griff nach der Pinne. Auch das war vertraut.
Eddie sah mich skeptisch an. „Bekommst du das hin?“
„Solltest du das nicht besser wissen als ich?“ Ich grinste schief und automatisch steuerte ich das Boot in Richtung Wind, als uns eine Welle von hinten traf.
Anerkennend nickte er mir zu. „Sieht so aus, als hätte der Baum die Seglerin nicht aus dir herausbekommen.“
Ich sah zum Segel, suchte nach einer Delle im Metall des Baumes, doch natürlich fand ich nichts. Mein Kopf war nicht hart genug, um dem Material Schaden zuzufügen. Meine freie Hand fuhr zu meiner Stirn. Tini hatte die Wunde mit einem Pflaster beklebt, das an den Rändern abpellte.
Meine Wunde. Tini.
Erschrocken sah ich zu Eddie auf, der noch immer stand und ebenfalls das Segel betrachtete.
Was hatte ich in der letzten Nacht gehört? Warum war er so wütend gewesen? Warum hatten sie gestritten? Und was war passiert, als sie sich ihm nicht mehr widersetzt hatte?
Ich erinnerte mich an den vergangenen Morgen. Er war wütend gewesen, als er mich hier an Deck gefunden hatte. Aber seine Wut hatte nicht mir gegolten.
„Eddie?“
Er sah zu mir. „Was ist?“
„Wechseln wir uns nachts mit dem Steuern ab?“
Er schien zu überlegen und dann lächelte er. „Sag du es mir.“
Ich runzelte die Stirn. „Das kann ich nicht. Ich erinnere mich nicht.“
Er setzte sich zu mir und wirkte aufgeregt. „Versuch es. Vielleicht ist das der richtige Weg, um dein Gedächtnis wiederzufinden.“
„Ich verstehe.“ Ich atmete tief durch. Die Seeluft war mir vertraut. Der herbe Geruch von Eddie, der nun viel zu dicht neben mir saß, nicht. Ich wollte nicht von ihm abrücken, denn das hätte ihn womöglich verletzt. Also ignorierte ich das Gefühl, bedrängt zu werden, und dachte über meine Frage nach. Wer steuerte das Boot nachts? „Du willst nicht, dass ich es nachts allein mache, oder?“ Ich war nicht sicher, hatte kein Gespräch im Kopf, das dieser Vermutung zugrunde lag, und doch war es der erste Gedanke gewesen.
Lächelnd nickte er. „Ganz genau.“
„Was ist mit Tini?“ Wieder hörte ich das Schluchzen der vergangenen Nacht.
Sein Blick verfinsterte sich. „Wir wechseln uns ab, aber sie verschläft ihre Schichten. Deshalb musstest du gestern die Segel einholen und heute Nacht habe ich das Reff ins Großsegel gesetzt.“
Ich nickte nur. Deshalb war er so wütend gewesen.
Für eine Weile saßen wir schweigend nebeneinander. Eddie übernahm das Steuern und ich ließ meinen Blick über die wilde See gleiten. Die Dünung war nicht hoch, die Wellen dafür kurz und steil.
„Wie sehen die Wetterprognosen aus?“
Wieder lächelte er. Vermutlich hatte er mir auch das beigebracht. Wie man Wetterkarten las und das Segel durch ein Reff verkleinerte, wenn der Wind zu stark blies. „Der Wind wird weiter auffrischen. Wir werden uns also gut festhalten müssen.“ Er zwinkerte mir zu und ich verstand es als einen Wink auf den Fluchtversuch der alten Cloe. „Aber alles ist besser als die Flaute von gestern, oder?“
Ich nickte, obwohl ich gar nicht sicher war, ob Cloe Sturm oder Flaute bevorzugte.
Er schien mit meiner Antwort zufrieden zu sein.
Wieder schwiegen wir eine Weile und mehr und mehr fühlte sich das Beieinandersitzen so an, als hätten wir es schon oft getan.
„Wie geht es deinem Kopf?“
„Er ist noch immer leer.“
Es war nicht als Scherz gemeint, doch Eddie lachte laut auf. Irgendwann stimmte ich mit ein und nach ein paar atemlosen Sekunden stellte sich auch damit ein Gefühl der Verbundenheit ein. Hoffnung keimte in mir auf. Vielleicht war der Fluchtversuch der alten Cloe ja doch nichts weiter als eine Drohung gewesen. Vielleicht hatte sie gar nicht über Bord springen wollen.
Nach einer Weile verstummte unser Lachen und Eddie wiederholte seine Frage: „Also, wie geht es deinem Kopf? Tut er noch weh? Brauchst du Schmerzmittel?“
Stirnrunzelnd sah ich ihn an. „Hatte ich die noch nicht?“
„Du hast die meiste Zeit geschlafen. Um ehrlich zu sein, habe ich bisher nicht daran gedacht. Tini hat sich um diese Sachen gekümmert. Sie ist Krankenschwester, weißt du?“
Ich erinnerte mich an das Gespräch vom vergangenen Morgen. Daran, wie er mir erklärt hatte, dass es nicht notwendig wäre, einen Arzt zu sehen. „Das hast du gestern schon erzählt.“
Er lächelte nachsichtig, als hätte ich etwas sehr Dummes gesagt. „Das stimmt. Aber ich weiß ja nicht, ob diese neuen Informationen in deinem Kopf bleiben.“ Er tätschelte meine Haare. Meine Haare, die genauso schwarz und dicht waren wie seine.
„Welche Farbe haben meine Augen?“
Er runzelte die Stirn. „Auch das hast du vergessen?“
„Ich habe alles vergessen.“
„Fast alles.“ Er betrachtete mich. „Sie sind grün. In der Mitte braun. Wenn helles Licht darauf fällt, so wie jetzt, funkeln sie wie Bernsteine.“
Ich schluckte. „Das hast du schön gesagt.“
Er lächelte. „Also, brauchst du ein Schmerzmittel?“
Ich spürte in mich. Suchte nach dem pochenden Schmerz der vergangenen Tage und fand nur ein zartes Hämmern. Ich schüttelte den Kopf. „Nein, ich denke nicht.“
In diesem Moment trat Tini in den Türrahmen. „Wer möchte Frühstück?“
„Wie wäre es mit einem Guten Morgen?“ Eddie erhob sich und beugte sich nach vorn, um sie zu küssen.
Es war kaum wahrnehmbar, doch weil ich die beiden nach der vergangenen Nacht genau musterte, fiel mir auf, wie sie sich leicht zurückzog. Wie über ihr Gesicht ein Schatten verlief. Sie war zurechtgemacht, trug Make-up und ihre Haare waren zu einem langen Zopf geflochten. Und doch sah ich die dunklen Ringe unter ihren Augen, die Rötung darin und ihre verkrampften Lippen, die sich nur für einen kurzen Moment von Eddies berühren ließen.
Ich schluckte.
„Guten Morgen.“ Sie wich meinem Blick aus. Hatte sie meinen bemerkt?
„Guten Morgen, Tini.“ Wieder schluckte ich und besann mich. Ich wollte ihr ein gutes Gefühl an diesem Morgen geben. „Ich meine, guten Morgen, Mama.“ Das Wort drang spröde aus meinem Mund. So, als gehörte es dort nicht hin. Als wüssten meine Lippen nur theoretisch, wie sie es formen sollten.
Auch Tini schien mit diesem Vorstoß nicht viel anfangen zu können. Eine Falte hatte sich auf ihrer Stirn gebildet und ich ruderte zurück. „Oder … wie … habe ich dich nicht so genannt? Wie …“
Ein gequältes Lächeln legte sich auf ihr Gesicht. Sie sah flüchtig zu Eddie und dann wieder zu mir. Diese kurzen Blickwechsel irritierten mich. Ich wollte nicht, dass die beiden Informationen hinter meinem Rücken austauschten.
„Ist schon okay, Kleines. Du kannst mich nennen, wie du möchtest.“
Eddie sprang ihr zu Hilfe. „Es klang einfach fremd.“ Er strich mir über die Schulter und seine Hand verweilte auf meinem Oberarm, als er weitersprach. „Vielleicht ist es das Beste, wenn du erst mal bei unseren Vornamen bleibst. Oder, Schatz?“
Er sah zu Tini und ich folgte seinem Blick. Sie starrte auf seine Hand, die noch immer auf meinem Arm lag. Schwer und warm. Dann hob sie langsam den Kopf und ich erschrak über den Ausdruck in ihren Augen, konnte ihn aber nicht deuten.
„Sicher.“ Ihre Stimme klang monoton und sie wandte sich an mich. „Hilfst du mir, Cloe?“ Mit einem weiteren Blick zu Eddie fügte sie hinzu: „So gut wie du brät keiner von uns ein Rührei.“
VIER
CLOE
Fünf Tage. Fünf Tage war es her, seit ich im Bett meiner Eltern erwacht war und ihre Gesichter nicht hatte zuordnen können. Inzwischen kannte ich jede Falte darin. Erinnerungen an eine gemeinsame Zeit hatte ich noch immer nicht.
Ich bat Eddie immer wieder, Geschichten aus meiner Kindheit zu erzählen. Keine von ihnen erzeugte Bilder, mit denen ich etwas anfangen konnte.
Die meiste Zeit des Tages verbrachte ich an Deck. Ich half, kleinere Reparaturen vorzunehmen, steuerte das Boot, wenn Eddie schlief, und half Tini beim Zubereiten des Essens. Ein paar Mal versuchte ich zu lesen, doch mein Gehirn schien noch nicht in der Lage zu sein, sich auf diese Weise zu konzentrieren. Nach ein paar Seiten hatte ich das meiste wieder vergessen und war mit den Gedanken bei den Fragen, die mir seit dem Unfall durch den Kopf rasten: Warum hatte die alte Cloe wirklich fliehen wollen?
Worüber stritten Eddie und Tini? Schlug er sie? Wenn ich dabei war, ging er liebevoll mit ihr um. Immer wieder zog er sie an sich und machte ihr Komplimente über ihr Aussehen oder ihre Kochkünste. Doch in der Nacht hörte ich die beiden streiten und darauf folgte Tinis Schluchzen. Sie verließ die gemeinsame Schlafkabine und setzte sich nur wenige Meter von mir entfernt in den Küchenbereich. Dort trank sie Wein.
In jeder Nacht wollte ich zu ihr gehen, doch ich traute mich nicht. Eddie würde uns hören und ich fürchtete, dass er wütend auf sie werden würde. Ich hatte ihren Körper auf Blutergüsse und Schrammen gescannt. Doch Tini trug langärmlige Shirts und Hosen, die bis zu den Knöcheln reichten, egal, wie warm es war. Und jetzt Mitte Juni stieg die Temperatur tagsüber bis an die dreißig Grad.
Ich lag in meinem Bett und starrte aus dem kleinen Fenster. Die Sonne erhob sich über den Horizont und malte den Himmel mit jedem Meter, den sie emporstieg, in einer weiteren Farbe an. Ich dachte an meinen Traum, in den ich mich nun in jeder Nacht flüchtete. Wenn ich am Abend die Augen schloss, setzte ich mich zu dem Jungen auf den Steg und hielt seine Hand. Gemeinsam betrachteten wir die Farben des Himmels, die jenen, die ich jetzt gerade sah, so ähnlich waren.
Und doch waren es die Farben des Sonnenuntergangs. Als würde mit dem Traum etwas zu Ende gehen. Als würde jetzt etwas Neues beginnen.
Gab es ihn? Ich konnte sein Gesicht nicht erkennen. Nur von seinen blauen Augen hatte ich ein so klares Bild, dass ich sie hätte zeichnen können. Ich horchte in mich. Zeichnen. War das etwas, das die alte Cloe getan hatte? Hatte sie in ihrem Rucksack ein wasserdicht verpacktes Skizzenbuch verstaut? Ich würde Eddie und Tini fragen. Sie würden es wissen.
Der Junge half mir auch in der Nacht, wenn ich durch das Zischen von Eddies wütender Stimme erwachte. Dann griff ich etwas fester nach seiner Hand. Wenn es ihn wirklich gab, hatte ich ihm sicher von meinen Eltern erzählt. Er kannte sie. Er wusste, wie sie miteinander umgingen.
Er wusste mehr als ich.
Schritte auf dem Deck.
Ich seufzte und wappnete mich für einen neuen Tag, an dem ich mich auf zweierlei Arten verloren fühlte. Ich wusste nicht, wer ich war. Und ich spürte immer mehr, warum die alte Cloe nicht hatte hierbleiben wollen. Gerade als ich die Tür öffnen wollte, polterte Eddie daran vorbei zurück ins Schiff. Mein Herzschlag beschleunigte sich, als ich hörte, wie er die Tür zur anderen Kabine öffnete. Dieses Mal verstand ich seine Worte genau: „Du dumme Kuh!“
Vorsichtig öffnete ich meine eigene Tür. Nur einen schmalen Spalt weit, der es mir erlaubte, zu sehen.
Eddie hatte Tini am Arm gepackt und dicht zu sich gezogen. „Du hast die scheiß Sitzkissen draußen gelassen.“ Er stieß sie von sich auf das Bett.
Ich schluckte, wollte die Tür wieder schließen, doch in diesem Moment traf mich Tinis Blick. Er war angsterfüllt.
Eddie beugte sich über sie und gab ihr eine Ohrfeige, die so laut schallte, dass sie das Rauschen des Blutes in meinem Kopf übertönte. Doch er beließ es nicht dabei. Noch einmal schlug er zu, sein Körper hing drohend über ihr. Und nun wusste ich, warum sie jede Nacht weinte.
Eine seiner Hände fuhr an ihren Hals. „Ich habe es dir schon tausend Mal gesagt. Lass das Zeug nicht draußen liegen.“
Panik erfüllte Tinis Blick und ich dachte nicht länger nach, stieß die Tür auf und schrie: „Hör auf! Lass sie sofort los!“ Meine Stimme brach und Tränen strömten über meine Wangen.
Ruhig drehte Eddie sich zu mir. „Geh wieder ins Bett, Kleines. Das hier geht nur mich und deine Mutter etwas an.“
Ich atmete schnell, sah zu Tini und erkannte erleichtert, dass Eddie die Hand von ihrem Hals genommen hatte.
„Doch, es geht mich etwas an. Ich war es. Ich habe die Kissen liegen lassen.“ Das stimmte nicht. Doch ich hoffte, dass er mir nicht wehtun würde. Ich hoffte, dass er seine Tochter mehr liebte als seine Kissen. Nur für den Fall, dass das nicht so war, fügte ich hinzu: „Ich hatte es vergessen. Ich wusste nicht mehr, dass wir die Kissen abends einräumen. Vielleicht waren es auch die Kopfschmerzen, die gestern wieder schlimmer geworden sind. Ich weiß es nicht. Aber Mama ist nicht schuld.“ Ich stockte, weil ich das Wort gesagt hatte. Und weil es sich noch immer schal anfühlte. Aber vielleicht löste es etwas in Eddie aus. Vielleicht erinnerte er sich daran, dass wir eine Familie waren und man seine Frau nicht schlug.
Er atmete schwer. „Du warst das?“
Ich nickte hektisch. „Sie kann nichts dafür. Ich kaufe neue. Ich meine … also …“
„Es ist nur eins über Bord gegangen.“
Ich nickte, obwohl mich die Verwirrung packte. Wegen eines einzelnen Kissens regte er sich so auf? Und dann lachte er auch noch. „Wisst ihr was, ich fand sie sowieso hässlich. Wenn wir im Hafen sind, besorge ich neue.“
Mein Mund öffnete sich und ich sah zu Tini, die meine stumme Frage auch nicht beantworten konnte. Noch vor wenigen Minuten hatte er seine Frau, meine Mutter, gewürgt, weil eines der Kissen verschwunden war. Und jetzt wollte er neue kaufen?
Mehr und mehr konnte ich nachvollziehen, warum die alte Cloe hier weggewollt hatte. Was war ihr Ziel gewesen? Der Junge mit den blauen Augen?
Doch dann echote der letzte Satz seiner Worte in meinem Kopf. „Hafen? Wir steuern einen Hafen an?“ Meine Hoffnung stieg. In einem Hafen konnten wir ein neues Ladegerät für Tinis Handy kaufen. Wir konnten jemanden anrufen, der mich kannte. Bestimmt hatte die alte Cloe eine beste Freundin.
„Ja, ich habe dort einen geschäftlichen Termin.“
Ich musterte ihn. Geschäftlicher Termin? „Was machst du denn beruflich?“ Tini war Krankenschwester, doch er hatte nie darüber gesprochen, wie er sein Geld verdiente.
Tini schnaubte und fing sich damit einen drohenden Blick von Eddie ein. Die Spannung in der Kabine zog erneut an. Wie hatte ich das durch so eine harmlose Frage bewirken können?
„Das ist etwas komplizierter.“
Ich kniff die Augen zusammen. „Wie meinst du das?“
„Lass das mal meine Sorge sein, wie ich mein Geld verdiene.“ In seinen Worten stand eine Drohung und die Art, wie sein Blick mich fixierte, schüchterte mich ein.
Also nickte ich. „Okay.“
Unangenehmes Schweigen klang meinen Worten nach. Ich wollte zurück in meine Koje. Ich wollte die Augen schließen und endlich aus dieser Starre aufwachen, die sich mehr und mehr in einen Alptraum verwandelte.
„Wann werden wir ankern?“ Da war Hoffnung in Tinis Stimme. Ganz leise hörte ich sie hoffen.
„Morgen Abend. Wir verbringen eine Nacht in einem Hotel.“ Er sah uns an, als würden damit Ostern und Weihnachten auf denselben Tag fallen.
Und Tini reagierte entsprechend: „Ein Hotel? Wie wunderbar.“ Sie sah zu mir. „Dann können wir eine heiße Dusche nehmen und bis in die Nacht fernsehen.“
Ich spürte in mich, überlegte, ob mich diese Dinge reizten. Doch das Einzige, was ich wollte, war ein Telefon, mit dem ich jemanden anrufen konnte, der wusste, warum ich hatte abhauen wollen.
„Ich würde gern noch etwas schlafen.“ Mit dem Finger deutete ich auf meinen Kopf und log: „Der da tut wieder weh und ich glaube, es täte ihm gut, wenn ich mich wieder hinlege.“ Ich hoffte, dass ich dadurch die Dringlichkeit eines Arztbesuches hervorheben konnte. Irgendjemand musste mir helfen, mein Gedächtnis wiederzubekommen. „Ich frühstücke später.“ In meinem Kopf hallte die Frage Wenn das okay ist?, nach. Doch ich stellte sie nicht. Ich würde mich von Eddie nicht so herumschubsen lassen, wie Tini es tat. War er mit der alten Cloe genauso umgegangen?
Zurück in meinem Bett und hinter verschlossener Tür ließ ich die Gedanken erneut um die Frage kreisen, warum ich hatte abhauen wollen. Hatte er die alte Cloe auch geschlagen?
Ich blickte aus dem Fenster. Das Meer schob sich bleiern an das Boot heran. Hob es an und ließ es auf dem Rücken einer jeden Welle wieder hinabsinken.
Eine Träne löste sich aus meinem Auge. Eine weitere folgte und irgendwann weinte ich tonlos. Ich zog die Knie zur Brust, umarmte meinen Körper und schloss die Augen, um Trost bei dem Jungen auf dem Steg zu finden.
FÜNF
CLOE
Wir erreichten den Hafen gegen sieben Uhr abends. Eddie füllte den Diesel- und den Süßwassertank, ließ uns auf dem Boot, um uns beim Hafenmeister anzumelden, und Tini und ich packten ein paar Sachen zusammen, die wir im Hotel brauchen würden. Duschbad, frische Klamotten, ein paar Bücher.
Sie wirkte fahrig und sprach kaum ein Wort mit mir.
Ich beobachtete, wie sie Dinge aus den Schränken nahm. Für mich gab es nichts zu packen. Alles, was mir gehört hatte, lag auf dem Grund des Meeres. Ich trug noch immer die Klamotten, die ich in der Nacht angehabt hatte, als der Baum mich vom Boot gerissen hatte. Tinis Sachen waren zu klein für mich. Diese zierliche Person trug T-Shirts, die einer Zehnjährigen passen würden.
„Was packst du da alles ein?“ Verwirrt betrachtete ich das Sitzkissen. Das zweite Sitzkissen. Jenes, das nicht von Bord geweht worden war.
„Eddie will doch Neue kaufen. Da kann das Alte direkt weg.“
Ich glaubte ihr kein Wort. Sie war eine schlechte Lügnerin.
„Außerdem weiß man nie, wie das in so einem Hotel ist, oder?“
Ich hob eine Augenbraue. „Du glaubst, du könntest dort ein Sitzkissen brauchen?“
Unser Wortwechsel hätte witzig sein können, doch in Tinis Gesicht wuchsen Sorge und Panik heran. „Lenk mich nicht ab. Ich will fertig sein, wenn Eddie zurückkommt.“
„Wie lange dauert das überhaupt?“ Ich sah auf die Uhr an meinem Handgelenk. Sie war wasserdicht und hatte den Tauchgang unbeschadet überstanden. „Es ist gleich zehn.“
„Vermutlich taucht er in irgendeiner Bar unter.“ Sie riss an dem Reißverschluss ihrer Tasche und sah sich dann unschlüssig um. „Ich werde ihn suchen gehen.“
„Ich komme mit.“ Augenblicklich sprang ich von der Bank auf, auf der ich bisher gesessen hatte.
Doch Tini schüttelte den Kopf. „Nein. Er wird wütend, wenn niemand auf dem Boot ist, wenn er zurückkommt.“ Die Hektik in ihrer Stimme ließ mich aufhorchen.
„Tini, warum lässt du dich von ihm schlagen?“
Sie sah mich an, die Lippen zu einer dünnen Linie zusammengepresst.
„Warum wehrst du dich nicht?“
Nun schüttelte sie den Kopf, betrachtete mich für ein paar Sekunden und kam mit der Tasche über der Schulter zu mir. Sie strich über mein Haar, das so anders war als ihres. „So einfach ist das nicht.“ Sie zögerte, als wollte sie mir noch etwas sagen, schüttelte aber nur ein weiteres Mal den Kopf.
Ich wollte nicht auf dem Boot bleiben, doch ich fürchtete, dass Eddie Tini dafür verantwortlich machen würde, wenn ich mit ihr ging. Also setzte ich mich wieder auf die Bank mit dem weichen, durchgesessenen Polster, das knisterte, wenn man sein Gewicht verlagerte, und beobachtete, wie sich Tini mit der Tasche über der Schulter durch die schmale Tür zwängte.
„Bis später.“
Sie drehte sich noch einmal um und wirkte fast überrascht. Ganz so, als hätte sie vergessen, dass ich noch hier war. „Ja, bis später.“
Grinsend deutete ich auf ihre Tasche. „Willst du die nicht nachher mitnehmen?“
Sie winkte ab. „Ach, die ist nicht so schwer. Vielleicht kann ich direkt in das Hotel gehen und es uns schon etwas gemütlich machen. Eddie mag es, wenn alles vorbereitet ist. Ich kann eine Dusche nehmen und wenn ihr kommt, ist das Bad frei.“ Sie lächelte, doch es wirkte gequält.
Etwas in mir veranlasste mich, aufzustehen. Ich folgte ihr auf das Deck und beobachtete, wie sie etwas unbeholfen auf den Steg kletterte. Es mochte an der großen Tasche liegen, doch ich hatte nicht den Eindruck, dass sie das schon sehr oft getan hatte.
Laternenlicht beleuchtete das verwitterte Holz und als sie die Tasche darauf abstellte, um ihre Kleidung zu richten, sah ich es. Ihre Bluse war verrutscht, ließ einen Blick auf ihren Bauch und die Unterarme frei. Beides war übersät mit blauen Flecken.
Mein Mund öffnete sich und in mir breitete sich Horror aus. „Tini.“ Ich deutete auf ihren Körper, doch wieder winkte sie ab.
„Du siehst doch selbst, wie oft ich gegen einen Tisch oder den Mast knalle.“
„Das stimmt nicht.“ Ich richtete mich auf. „Du darfst das nicht mit dir machen lassen. Wir müssen …“
„Wir müssen gar nichts.“ Zorn erklang zwischen ihren Worten. „Lass mich jetzt deinen Vater suchen und dann machen wir uns einen schönen Abend, ja?“
„Einen schönen Abend machen? Tini, Eddie hätte dich gestern fast erwürgt.“
Sie lachte bitter auf. „Nun mach dich nicht lächerlich.“
„Du kannst mir nichts vormachen. Ich höre, wie er mit dir redet. Und ich habe gesehen, wie er dich behandelt hat. Du musst zur Polizei gehen. Wir müssen ihn anzeigen.“
„Nein!“ Es war ein leiser Schrei. „Nein, wir gehen nicht zur Polizei. Er ist nicht immer so. Gerade hat er viel Stress wegen … wegen des Auftrags. Weshalb wir hier sind, weißt du?“ Sie nickte, als würde das ihre Worte wahr machen.
„Das ist doch egal! Wir gehen jetzt …“
„Du gehst nirgendwohin. Du bleibst hier und wartest.“ Sie atmete und redete schnell. „Wenn er das Boot leer vorfindet, wird er wieder auf mich losgehen. Das willst du doch nicht, oder?“
„Wenn wir sofort zur Polizei gehen, kann es uns egal sein, wie er das Boot vorfindet.“
„Ich sage es dir zum letzten Mal. Ich gehe nicht zur Polizei.“ Hektisch wandte sie sich zum Land um. In diesem Moment wurde mir bewusst, dass ich keine Ahnung hatte, wo wir uns befanden. Und ich wusste auch nicht, woher wir kamen. Warum hatte ich diese Frage bisher nicht gestellt?
„Wenn du also nicht möchtest, dass er mich deinetwegen ein weiteres Mal schlägt, tust du jetzt, was ich dir sage.“
Ich schluckte und in mir wehrte sich alles dagegen, ihren Worten zu folgen. Hatte die alte Cloe auch davor fliehen wollen? Vor der schwachen Mutter? Hatte sie Angst gehabt, genauso zu werden?
Ich erwiderte nichts.