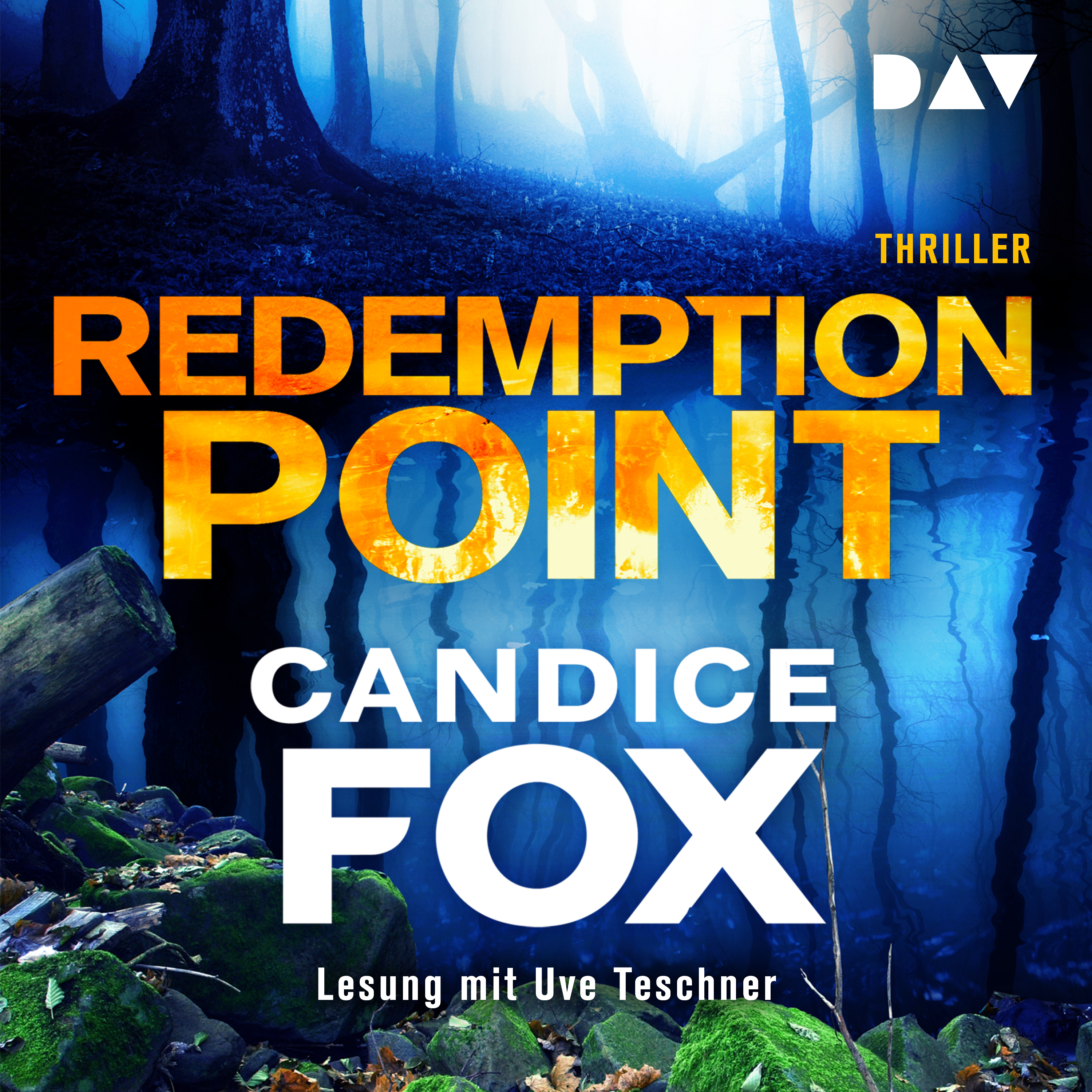9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Crimson-Lake-Serie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
12.46 Uhr: Die dreizehnjährige Claire Bingley steht alleine an einer Bushaltestelle.
12.47 Uhr: Ted Conkaffey hält mit seinem Wagen neben ihr.
12.52 Uhr: Das Mädchen ist verschwunden …
Sechs Minuten – mehr braucht es nicht, um das Leben von Detective Ted Conkaffey vollständig zu ruinieren. Die Anklage gegen ihn wird zwar aus Mangel an Beweisen fallengelassen, doch alle Welt glaubt zu wissen, dass einzig und allein er es gewesen ist, der Claire entführt hat. Um der gesellschaftlichen Ächtung zu entgehen, zieht sich der Ex-Cop nach Crimson Lake, einer Kleinstadt im Norden Australiens, zurück.
Dort trifft er Amanda Pharrell, die ganz genau weiß, was es heißt, Staatsfeind Nr. 1 zu sein. Vor Jahren musste sie wegen angeblichen Mordes ins Gefängnis. Nun tun sich die beiden Außenseiter zusammen und arbeiten als Privatdetektive. Ihr Fall: Ein berühmter Schriftsteller mit Doppelleben und kaputter Familie ist verschwunden, die örtliche Polizei behindert die Arbeit der beiden mit harschen Methoden. Dann platzt das Inkognito von Conkaffey, die Medien erzeugen Hysterie. Lynchstimmung macht sich breit. Während er den Fall seiner neuen Partnerin wieder aufrollt und sie versucht, ihn zu entlasten, nimmt der Fall des Schriftstellers überraschende Wendungen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 497
Ähnliche
Candice Fox
CRIMSON LAKE
Thriller
Aus dem australischen Englisch vonAndrea O’Brien
Herausgegeben vonThomas Wörtche
Suhrkamp
Für Gaby und Bev
PROLOG
Als ich die Gans fand, steckte ich in einer richtig düsteren Phase. Monatelang hatte ich nur in Gesellschaft meiner Pistole verbracht, und wenn man zu lange mit diesen Dingern zusammen ist, fangen die schon mal an, mit einem zu sprechen. Während ich in meinem leeren Haus herumgeisterte, folgte mir ihr schwarzes Waffenauge auf Schritt und Tritt, registrierte, dass ich die Umzugskartons im Flur immer noch nicht ausgepackt hatte, oder verurteilte mich, wenn ich trank. Eines Abends, ich hatte schon eine halbe Flasche Wild Turkey intus, fragte ich die Pistole, ob sie vielleicht eine bessere Lösung wisse, wenn sie sich schon für so verdammt schlau halte. Eine Waffe weiß immer eine Lösung – es ist stets dieselbe.
Am Abend zuvor war wieder ein Stein durchs Fenster geflogen, der dritte seit meiner Ankunft in Crimson Lake. Diesmal flickte ich das Loch jedoch nicht, sondern musterte es eine Weile und zog mich schließlich auf die rückwärtige Veranda zurück, wo ich die untergehende Sonne betrachtete, die rot über die Sümpfe flackerte und auf dem nassen Sand tanzte. Das Haus war eine Bruchbude, deshalb hatte ich es auch so billig bekommen. Bei der hinteren Veranda hatten sich die Vorbesitzer allerdings richtig Mühe gegeben. Dort standen eine breite Holzbank und stabile Stühle, und am Ende des Grundstücks gab es einen soliden Krokodilschutzzaun.
Zäune waren mir wohlvertraut. Ich war es gewohnt, die Welt durch Maschendraht zu betrachten.
Dort verbrachte ich also meine Nächte. Gelegentlich fragte ich mich, ob auch die Vorbesitzer sich hier verschanzt und die Berechenbarkeit der Abenddämmerung ebenso geschätzt hatten wie ich. Die Schwüle. Das Crescendo der Insekten. Das bei schwindendem Licht einsetzende Bellen der Krokodile, die durch den nassen Sumpf glitten und mich auf der Veranda witterten.
Vorn lauerte die so genannte Bürgerwehr, hinten die Krokodile, und ich saß in der Klemme dazwischen. Fast wieder wie im Gefängnis, aber nicht so schlimm, weil irgendwie sicherer. Fluchtgedanken waren überflüssig, vor meiner Straftat gab’s kein Entrinnen. Und die Pistole, die neben mir auf dem ausgedörrten, zerborstenen Holz lag, erinnerte mich daran, dass mir immer ein Hintertürchen offen stand. Gerade hatte ich der Waffe zustimmend zugenickt und den letzten Schluck Bourbon runtergekippt, da hörte ich den Vogel am Zaun.
Zuerst hielt ich sie für einen Schwan. Sie gab Laute von sich, die ich noch nie von einem Vogel gehört hatte: eine Art keuchendes Kreischen, als hätte sie eine Rakete im Rachen. Als ich hügelab durchs hohe Gras hastete, kam sie mir völlig unerwartet auf der anderen Seite des Zauns entgegen und gab den Blick auf den versprengten Haufen graugelber Küken frei, die bei jedem Schritt um sie herumwirbelten und tollpatschig übereinanderpurzelten. Kaum stand sie vor mir, schien sich die Gänsedame ihrer Strategie auf einmal nicht mehr sicher, wich zischend zurück und flatterte wie wild mit einer weißen Schwinge.
»Meine Güte, du dumme Gans!«, rief ich.
Das tat ich oft, wenn ich betrunken war. Mit Dingen reden. Mit meiner Waffe. Mit Vögeln. Allerdings war sie wirklich total bescheuert, verwundet und fettgefressen an den Ufern der Sumpfgebiete von Cairns herumzuwatscheln, wo es vor Krokodilen nur so wimmelte. Mit einem raschen Blick übers Wasser öffnete ich das Gatter.
Das hatte ich noch nie getan. Als ich vor dreißig Tagen in die Bruchbude gezogen war, hatte ich den Makler gefragt, wozu die Vorbesitzer ein Gatter gebraucht hatten. So etwas wäre höchstens von Nutzen gewesen, wenn sie ein Boot besaßen, aber danach sah es nicht aus. Im Wasser wartete nur der sichere Tod. Der Mann war mir die Antwort schuldig geblieben. Als ich zögernd hinaustrat, versanken meine nackten Füße im schlammigen Sand, und Luftblasen stiegen aus den Krebslöchern empor.
»Komm her!« Eine Hand am Gatter, winkte ich dem Vogel zu. Die Gans flatterte und kreischte. Ihr Nachwuchs versammelte sich rasch um sie, ein panischer Federhaufen. Wieder ließ ich den Blick übers Wasser schweifen, das sich hundertfach zu kräuseln schien. Unzählige schwarze Krokodilsaugen waren auf uns gerichtet. Die Sonne stand tief, jetzt war ihre Zeit. »Komm her, du bescheuertes Mistvieh.«
Ich holte tief Luft, dann stürzte ich los, grapschte ins Leere, hechtete erneut vor und erwischte sie schließlich irgendwo, sodass sie fast kopfüber zwischen meinen Fingern hing, ein Knäuel aus Knochen, Gliedmaßen, Krallen und Federn, und nach meiner Nase, meinem Ohr, meiner Augenbraue schnappte, bis ich blutete. Die Küken stoben auseinander, kamen wieder zusammen, ihr Glucksen und Kreischen wie eine kindliche Version der Laute ihrer Mutter. Ich wandte mich um und schleuderte das Tier in meinen Garten. Die Küken folgten wie am Schnürchen. Kaum waren sie drin, schlug ich das Gatter zu, flitzte auf die Veranda und schnappte mir ein Handtuch vom Geländer. Die Pistole ließ ich auf der Treppe liegen.
Als ich meine Patientin und ihre Küken zum Tierarzt fuhr, drangen entsetzliche Schreie aus ihrem Karton. Herzzerreißende Notsignale. Irgendwann hielt ich es nicht mehr aus und rief: »Halt endlich die Klappe, blöde Gans!«
Weil die Gans einen Namen brauchte, taufte ich sie Woman.
Im kalten Neonlicht der Tierarztpraxis wirkte sie irgendwie kleiner, wie sie so aus dem Karton hervorspähte, um den Mann zu mustern, der mir die Tür geöffnet hatte. Sie und ihre Küken kauerten geschlossen am Boden, ein atmendes Häufchen zerknickter Federn in der Dunkelheit. Ich trat zurück, damit der Arzt meine Fahne nicht roch, doch die gestrenge Miene, mit der er meine plumpen Einparkversuche und nackten, sandigen Füße taxiert hatte, ließ darauf schließen, dass er mich bereits entlarvt hatte. Also verschränkte ich die Arme und bemühte mich, trotz meiner beachtlichen Körpergröße nicht zu viel Platz in seinem beengten Untersuchungszimmer einzunehmen. Weil er mich offenbar noch nicht erkannt hatte, riskierte ich eine Bemerkung, während er das wild um sich schnappende Vieh aus dem Karton zog.
»Mit dem Fuß da kann sie nicht auftreten.«
»Jepp. Ist wohl gebrochen. Dieser Flügel auch.«
Unter seinen Händen fand die Gans zu ihrer normalen Form zurück, er fügte das fast völlig aus dem Leim gegangene Federvieh wieder zusammen, bis die beiden Füße wieder rechts und links unter dem ausladenden Balg herausragten und die Flügel flach an beiden Seiten anlagen. Der Vogel spähte mit gejagtem Blick aus den blanken Augen im Zimmer umher. Der Arzt tastete behutsam den Körper ab, hob ihren Schwanz und untersuchte das flauschige Hinterteil.
»Ich lass sie wohl am besten hier«, sagte ich und klatschte abschließend in die Hände, was das Tier zusammenschrecken ließ.
»Nun, das überlasse ich ganz Ihnen, Mr …«
»Collins«, log ich.
»… ganz Ihnen, Mr Collins. Aber ich möchte Sie darauf hinweisen, dass wir keine kostenlose Behandlung anbieten.«
»Ach so. Das war mir nicht bekannt.«
»Nein, dazu fehlen uns die Ressourcen. Ohne Bezahlung können wir dieses Tier nicht versorgen.«
Ich kratzte mich am Kopf. »Aber ich habe sie nur gefunden.«
»Ja«, sagte der Arzt.
»Ich meine, sie gehört mir nicht.«
»Das sagten Sie bereits.«
»Also ist das nicht meine Gans.« Ich deutete auf Woman und bemühte mich nach Kräften, nicht zu lallen und das Missverständnis sachlich auszuräumen. »Und die auch nicht«, fügte ich hinzu, den Finger auf die Küken gerichtet. »Sie wurden … wahrscheinlich ausgesetzt. Einfach irgendwo abgeladen. Kümmern sich Leute wie Sie nicht um ausgesetzte Tiere?«
»Leute wie ich?«
»Tierärzte.«
Er musterte mich eindringlich. »Diese Gans ist nicht in Australien beheimatet. Es handelt sich um eine Hausgans, anser domesticus. Die Spezies wurde eingeschleppt, daher werden sich die Wildhüter auch nicht um sie kümmern.«
»Was würden Sie mit ihr anstellen?«, fragte ich. »Wenn ich sie einfach hierließe?«
Der Arzt musterte mich erneut. Das Sirren des grellen Neonlichts erfüllte das Zimmer wie Gas.
»Meine Güte«, sagte ich schließlich. »Na gut. Das hier ist kein Wohltätigkeitsverein. Sie können nicht alle Tiere umsonst retten.« Ich zog meine Geldbörse hervor und befingerte die roten und lilafarbenen Scheine. »Wie viel kostet es, eine zerbrochene Gans wieder zu flicken?«
»Viel, Mr Collins«, sagte der Arzt, während er den langen, schlanken Hals des Tieres fester drückte.
Siebenhundert Dollar später befand ich mich als frisch gebackener Besitzer einer Gänsefamilie zitternd und mit flauem Gefühl in der Magengegend auf dem Heimweg. Das Zittern war allerdings nicht dem Umstand geschuldet, dass ich jetzt nur noch neunundfünfzig Dollar besaß. Der Tierarzt hatte den Namen auf meiner Kreditkarte gelesen. Conkaffey, nicht Collins. Ein ungewöhnlicher Name. Einen, den man nicht so schnell vergaß. Der noch vor einem Monat durch die nationale Presse gegeistert war. Seine Miene hatte sich verhärtetet. Die Falten um seinen Mund waren tiefer geworden, dann hatte er den Blick gehoben. Das reichte. Ich hatte den Karton geschnappt und war verschwunden.
Diesen Blick hatte ich satt.
1
Ich war in meiner mittlerweile vertrauten Verandaecke an der Hauswand auf einer alten Decke eingeschlafen, als ein Schatten über mein Gesicht fiel. Erschreckt fuhr ich hoch und griff nach meiner Pistole, überzeugt, jemand wolle mich angreifen. Doch es war nur Sean.
»Was für ein trauriger Anblick«, sagte mein Anwalt. Die Morgensonne strahlte hinter seinem Rücken hervor.
»Sie sehen aus wie ein Engel«, sagte ich.
»Wieso schlafen Sie hier draußen?«
»Weil es herrlich ist.« Ich seufzte und streckte mich. Das war nicht gelogen. Es war traumhaft, die heißen Nächte unter dem Moskitonetz auf der Veranda zu verbringen. Donnergrollen in der Ferne. Lachende Kinder, die irgendwo am Ufer Lagerfeuer machten. Außerdem war die alte Decke fast so dick wie die Matratze in der Zelle.
Nachdem Sean sich vergeblich nach einem Stuhl umgesehen hatte, auf dem er sein feinbetuchtes Hinterteil hätte parken könnte, wählte er schließlich einen Platz auf der Stufe. Er stellte die beiden Pappbecher mit Kaffee und seine Tasche neben sich ab und wischte pingelig über den Holzboden. Der Mann hüllte sich stets in Seide, selbst hier im schwülen Cairns. Ich ließ mich neben ihm nieder und kratzte mich am Kopf, um richtig wach zu werden. Woman hauste mit ihren Küken in einem seitlich gekippten Karton in der Verandaecke, die Öffnung hatte ich mit einem Handtuch verhängt. Ihr lautes Fauchen ließ Sean herumfahren.
»Was …?«
»Das ist eine Gans«, erklärte ich. »Anser domesticus.«
»Ach so. Ich dachte schon, Sie hätten sich eine Schlange zugelegt.« Die Hand des Anwalts wanderte zu seiner Krawatte, die er mit besänftigenden Bewegungen glattstrich. »Was zum Teufel machen Sie mit einer Gans?«
»Es sind mehrere Gänse. Ist ’ne lange Geschichte.«
»Ja, das überrascht mich nicht.«
»Was machen Sie hier? Seit wann sind Sie hier?«
»Seit gestern. Ich bin auf dem Weg nach Cairns, da wollte ich kurz vorbeikommen. Einer meiner Klienten hat sich abgesetzt. War wegen eines Sexualdelikts auf Bewährung frei, jetzt muss ich ihn überzeugen, mit mir zurückzukommen. Alle verschwinden Richtung Norden.«
»Wenn man was zu verbergen hat, versteckt man sich besser dort, wo’s warm ist.«
»Ja ja.« Sean sah mich an. »Ich habe gute Neuigkeiten, Ted. Abgesehen von einem feinen Carepaket für meinen Lieblingsklienten überbringe ich hiermit die Nachricht, dass man Ihr Vermögen offiziell freigegeben hat.«
Mein weißhaariger Anwalt drückte mir eine Tüte mit Geschenken in die Hand: Bücher und diverse Delikatessen. Ich erzählte ihm lieber nicht, dass ich gar keinen Kühlschrank besaß. In seiner Tasche steckte ein fetter Umschlag vom Umfang eines Wörterbuchs. Er reichte mir einen Kaffee, herrlich duftend, allerdings nicht mehr heiß. Kein Wunder, denn der nächste Laden, in dem man Kaffee zum Mitnehmen bekam, lag mindestens zwanzig Minuten entfernt. Aber egal. Trotz der furchteinflößenden Formulare und des kalten Kaffees war ich hocherfreut, Sean zu sehen. Einundzwanzig Millionen Menschen in Australien hielten mich für schuldig. Nur ein Anwalt in feinem Zwirn tat das nicht.
»Ich nehme an, die Formulare sind von Kelly?«
»Anpassungen an die Scheidungsvereinbarung. Wieder mal. Wortklaubereien. Reine Hinhaltetaktik.«
»Man könnte fast meinen, sie will sich gar nicht von mir trennen.«
»Ich glaube eher, sie lässt Sie gern zappeln.«
Ich trank meinen Kaffee und blickte hinaus auf die Sumpflandschaft. Flach wie Glas lag sie da, die gegenüberliegenden Berge blau im Morgendunst.
»Und was ist mit …?«
»Nein, Ted. Das Sorgerecht ist nicht eingeschlossen. Damit kann sie sich Zeit lassen.«
Ich strich mir übers Kinn. »Vielleicht sollte ich mir einen Bart wachsen lassen.«
Wir betrachteten den Horizont.
»Sehen Sie sich an«, sagte Sean plötzlich, »ich bin stolz auf Sie. Ein alleinstehender, gut aussehender Mann Ende dreißig, der noch mal neu anfängt. Sie haben ein Haus und sogar Haustiere, wenn auch ein paar zu viele. Sie stehen nicht schlechter da als die meisten anderen da draußen.«
Ich schnaubte. »Wer’s glaubt, wird selig.«
»Ich mein’s ernst. Sie haben die Chance auf einen Neubeginn. Tabula rasa.«
Träum weiter, mein Freund.
»Sind das Wachgänse?«, fragte er auf einmal unvermittelt.
Zuerst wusste ich nicht, worauf er hinauswollte.
»Die Nazis benutzten Gänse, um ihre Konzentrationslager zu bewachen«, erklärte er.
»Tatsächlich?«
»Darf ich mal sehen?«
Ich machte eine Geste in Richtung Karton. Er näherte sich vorsichtig, ging in die Hocke und streckte die manikürten Finger nach dem Handtuch aus. Der Mann trug Socken mit Hahnentrittmuster. Wahrscheinlich aus Alpaka. Aus dem dunklen Versteck ertönte ein Kieksen. Sean lachte.
»Wow«, sagte er.
»Leben sie noch?«
»Sieht so aus.«
»Ich werde sie mästen und braten. Die Küken kommen aufs Brot.«
»Haben sie schon einen Namen?«
»Moment. Wie wär’s mit Weiß, Sauerteig, Vollkorn, Mehrkorn.«
»Bevor es so weit kommt, kriegen Sie hoffentlich Ihren Hintern hoch.« Er setzte sich neben mich. »Suchen Sie Arbeit?«
»Nein, es ist noch zu früh.«
Die Gänseküken piepsten und raschelten im Karton herum. Krallen auf Pappe.
»Würden Sie mir einen Gefallen tun?«, fragte Sean.
»Kommt drauf an.«
»Treffen Sie sich mit einem Mädchen namens Amanda Pharrell. Sie wohnt hier im Ort.«
»Ich soll mich mit einem Mädchen treffen?«, fragte ich ungläubig.
Sean seufzte und lächelte beschwichtigend. »Mit einer Frau. Könnten Sie sich bitte mit dieser Frau treffen?«
»Wer ist das?«
Sean zuckte die Achseln. »Einfach eine Frau.«
»Wozu soll das gut sein?«
»Fragen über Fragen. Tun Sie einfach, was ich Ihnen sage. Sie wird Ihnen guttun, ganz einfach. Es geht nicht um eine romantische Bekanntschaft, sondern um ein harmloses Treffen.«
»Nichts Romantisches?«
»Nein«, sagte Sean.
»Was zum Teufel ist es dann?«
Sean lachte. »Meine Güte, Ted«, sagte er. Dann kam der altbekannte Spruch, den er auch gebracht hatte, als er mich auf die Verhandlung vorbereitete. »Ich bin Ihr Anwalt. Fragen Sie nicht, tun Sie’s einfach!«
Ich schwieg.
Wir unterhielten uns noch eine Weile über seine Angelegenheiten in Cairns und die Dauer seines Aufenthalts. Sean schwitzte in seine Seidenhose. Die hinterhältige tropische Sonne, die sich durch die feuchte Luft herabstahl, hatte dem arglosen Mann aus Sydney bereits die Nase verbrannt. Nach nur einem Monat auf der Veranda mit gelegentlichen Ausflügen ins Einkaufszentrum, um meine Whiskyvorräte aufzustocken, war meine Haut schon tiefbraun. Das würde mir hoffentlich bei der Integration behilflich sein und dazu führen, dass in mir niemand mehr den Mann erkannte, der wochenlang die Titelseite des Telegraph geziert hatte. Diesen breitschultrigen, brutalen Kerl im Anzug, der mit gebeugtem Haupt und gefängnisbleich an der Tür zum Gerichtssaal stand. Ein Bart wäre auch nicht schlecht. Und Zeit. Davon hatte ich genug.
2
Ich hatte unzählige Erinnerungen. Und alle waren falsch. Nachträglich inszeniert, zusammengesetzt aus Bruchteilen, Anklageschriften, Zeitungsartikeln und dem, was man mir während der Untersuchungshaft zugeflüstert hatte. Einige Versatzstücke stammen sicher aus meinen Alpträumen – möglicherweise wirkte der herannahende Sturm gar nicht so bedrohlich, und ihre Augen waren nicht so groß und schön. Doch diese tragischen Momente haben sich mir mit nahezu surrealer Schärfe ins Gedächtnis gebrannt. Kein Produkt der Geschichte, sondern der Fantasie, gewoben aus vielen bunten Erzählsträngen. Nichts kann das Gespinst zerstören, selbst wenn sich einzelne Fasern nach Jahren zu lösen beginnen und kleine Löcher aufreißen würden. Ich glaubte daran. Obwohl ich wusste, dass es nicht stimmte.
Sie stand am Straßenrand, auf exakt derselben Höhe wie die Leitpfosten, die sie kaum überragte. Sie war dreizehn, sah aber aus wie zehn. Das Mädchen war so blass und ihr Haar vom Licht der grellen Nachmittagssonne so hell erleuchtet, dass sie fast mit den Pfosten verschmolz wie ein weißer Wachposten am Rand des einsamen Highways. Zuerst sah ich sie gar nicht, sondern nur die Bushaltestelle und die Furchen, die die großen Fahrzeuge in die trockene Erde gegraben hatten. Ich verlangsamte mein Tempo und bog vom Highway in die Haltebucht ab. Das Mädchen stand nur zehn bis fünfzehn Meter von meinem Wagen entfernt.
Aus südlicher Richtung kam ein blauer Hyundai Getz und fuhr an uns vorbei. Am Steuer saß Marilyn Hope, 37, daneben ihre Tochter Sally, 14. Beide würden später aussagen, mein Wagen habe »plötzlich den Highway verlassen« und sei »direkt vor dem Mädchen« zum Stehen gekommen. Das sei um zwölf Uhr siebenundvierzig gewesen. Sally Hope könne den Zeitpunkt so genau benennen, weil sie just in jenem Moment auf die Uhr neben dem Tacho geschaut und errechnet habe, dass ihr noch dreizehn Minuten bleiben würden, um pünktlich zur Tanzstunde zu erscheinen.
Erst als ich ausstieg, entdeckte ich das blasse Mädchen am Straßenrand. Es sah mich an. Sein rosafarbener Rucksack lag am Boden neben ihm.
Wo kommt die denn auf einmal her?, war mein erster Gedanke.
Dieses nervige Geräusch muss aufhören, mein Zweiter.
Der bezog sich auf meine Angel, die während der Fahrt permanent gegen die Heckscheibe meines Corolla geklackert hatte. Ich öffnete die linke Fondtür, kletterte halb hinein, und zog Angel und Spinnerkasten über den Sitz zu mir herüber, sodass der Griff in den Spalt zwischen Rückbank und Fahrersitz rutschte und die Rutenspitze die Scheibe nicht mehr berührte.
In diesem Moment passierte ein roter Commodore die Haltestelle. Der Fahrer Gary Fisher, 51, in nördlicher Richtung auf dem Highway unterwegs, war Zeuge Nummer drei. Bei der Befragung würde er zu Protokoll geben, mein Wagen habe mit geöffneter, linker Fondtür auf dem Seitenstreifen gestanden. Die offene Tür sei dem Mädchen am nächsten gewesen.
Auf dem Boden hinter dem Fahrersitz stieß ich zwischen allerlei Müll und Pappbehältern auf ein Erinnerungsschreiben meiner Kfz-Versicherung. Ich lag halb auf der Rückbank, als ich das blassgrüne Schreiben las.
Zu diesem Zeitpunkt war Michael Lee-Renalds, 48, mit seinem Lastwagen in südlicher Richtung auf dem Highway unterwegs. Zeuge Nummer vier. Wie Gary würde er später aussagen, er habe meinen Wagen mit geöffneter Fondtür neben dem Mädchen stehen gesehen. Ein großer, breitschultriger Mann, dessen Beschreibung auf mich passte, hätte halb auf der Rückbank seines Wagens gelegen.
Ich richtete mich wieder auf, stopfte das Schreiben in die Hosentasche. Dann sah ich das Mädchen an. Es beobachtete mich. Mittlerweile hatte Sprühregen eingesetzt und der auffrischende Wind zerstob die feinen Tropfen, die im Sonnenlicht um sie herumtanzten wie winzige goldene Insekten. Sie kickte im Schmutz herum, spielte mit dem Saum ihres dunkelgrünen Rocks, und wandte sich schließlich ab. Das Mädchen war ziemlich mager, daran erinnere ich mich noch am deutlichsten. Genau das hatte ich der Polizei bei den ersten Verhören immer wieder gesagt. Sie war mager, ja dürr, und blass. Was ich sonst noch wusste über das Mädchen, das mein Leben ruiniert hatte, stammte von den Prozessfotos. Die großen Zähne kannte ich von den Aufnahmen »vor dem Angriff«. Daher wusste ich auch, dass sie beim Lächeln die Nase krauszog.
An diesem fürchterlichen Tag stand ich am Straßenrand und spähte zum Horizont, wo sich der Himmel über den Bäumen dunkellila verfärbt hatte.
»Gleich gießt’s«, sagte ich.
Ein roter Kia, in südlicher Richtung unterwegs, fuhr an uns vorbei. Darin saßen die Schwestern Jessica und Diana Harper, vierunddreißig und sechsunddreißig Jahre alt. Zeugen Nummer fünf und sechs würden später angeben, sie hätten mich mit dem Mädchen sprechen sehen. Allerdings könnten sie keine genauen Angaben darüber machen, ob die Seitentür offen oder geschlossen gewesen sei. Es war zwölf Uhr neunundvierzig.
»Ja«, erwiderte das Mädchen.
»Kommt dein Bus bald?«, fragte ich.
»In einer Minute«, sagte sie lächelnd. Dabei zog sie die Nase kraus. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht mehr.
»Dann ist ja gut«, sagte ich. Zwei weitere Fahrzeuge mit mehreren Zeugen fuhren an uns vorbei, die sich allerdings nicht einig waren, ob ich dem Mädchen mit der rechten Hand zum Abschied gewunken oder es zu mir hergewunken hatte. Die Zeugenbefragung zu diesem einen Punkt dauerte drei ganze Tage.
Am Ende einigte man sich darauf, dass ich vor der Fondtür gestanden und eine nicht klar einzuordnende Handbewegung gemacht hatte. Vor der Tür, die dem Mädchen am nächsten gewesen war.
Ich ging zur Fahrertür zurück, stieg ein, ließ den Motor an und fuhr davon. Warf keinen Blick zurück.
Um zwölf Uhr zweiundfünfzig kam der Bus. Das GPS-System des Fahrzeugs protokollierte den genauen Zeitpunkt. Der Rucksack stand noch am Boden, darüber waren sich Fahrer und Fahrgäste einig.
Aber ein Mädchen sahen sie nicht.
An jenem Sonntagnachmittag wurde die am Rand des Highways bei Mount Annan auf den Bus wartende Claire Bingley verschleppt. Jemand fuhr mit ihr über mehrere Feldwege an Rinderfarmen und verlassenen Grundstücken vorbei zu einem nur fünf Minuten vom Highway entfernten Stück Buschland. Im dichten Unterholz wurde sie brutal vergewaltigt und dann so lange gewürgt, bis sie das Bewusstsein verlor. Der Angreifer muss sie für tot gehalten haben, doch das Mädchen, mit dieser manchen Kindern eigenen, unfassbaren Zähigkeit und Widerstandskraft ausgestattet, überlebte. Allen Widrigkeiten zum Trotz verharrte Claire mehrere Stunden reglos in der Dunkelheit, weil sie fürchtete, ihr Angreifer könnte zurückkehren. Es wurde Nacht und ein neuer Morgen dämmerte am Horizont. Irgendwann rappelte das Mädchen sich auf, stolperte aus dem Busch heraus und machte sich auf den Weg. Etwa zehn Kilometer südlich von der Stelle, wo sie verschwunden war, landete sie schließlich völlig verstört auf dem Highway. Es war sechs Uhr früh. Claire wurde seit elf Stunden vermisst.
Ein alter Mann, der sich auf dem Weg nach Chifley befand, wo er seinem Sohn beim Umzug helfen wollte, entdeckte sie, nackt und zusammengekrümmt auf dem Seitenstreifen. Ihr Gesicht war so blutverschmiert, dass er zunächst glaubte, sie trage eine rote Maske. Wegen der schweren Verletzungen am Kehlkopf konnte sie nicht sprechen, nicht beschreiben, was ihr zugestoßen war.
In den sozialen Netzwerken brach ein Sturm los, der sich schon am Vorabend, zwei Stunden nach ihrem Verschwinden, angekündigt hatte. In den Abendnachrichten wurde über den Fall berichtet, das ganze Land wusste Bescheid. Claires Eltern sorgten dafür, dass alle Nachrichtensender die Meldung verbreiteten. Sie stellten eine Vermisstenanzeige mit Foto ins Internet, das Ganze wurde achthundertausendmal geteilt, und sogar Menschen in San Francisco verfolgten das Geschehen. Claire sei entführt worden, sagten die Eltern, da seien sie sicher. Ihre Tochter würde nicht einfach davonlaufen. Ihr sei etwas Schreckliches zugestoßen. Die Eltern sollten recht behalten.
In den Kommentarspalten der sozialen Netzwerke war zum ersten Mal von einem Verdächtigen die Rede. Unter Claires Vermisstenfoto hatte jemand gepostet, er sei an jenem Tag auf dem Highway unterwegs gewesen. »Ich habe den Kerl gesehen«, schrieb er.
Dieser Kerl war ich.
3
Es regnete, als ich zum Laden lief. So war das manchmal in Cairns. Ohne Vorwarnung gab es einen Wolkenbruch, und das Wasser prasselte wie ein Kugelhagel auf einen herab. Es gab keinerlei Unterschlupf auf dem etwa sechs Meter breiten Feldweg, der sich kilometerweit zwischen den wie die Mauern einer verborgenen Stadt aufragenden, gelben Zuckerrohrfeldern hindurchschlängelte. Grashüpfer in allen erdenklichen Farben sprangen und tänzelten vergnügt über die heiße Erde. Hunderte Schwalben drängten sich auf durchhängenden Stromleitungen. Ich atmete die dampfige Luft ein und marschierte tapfer weiter, eine Stunde lang, den Blick auf die Wolkenmassen gerichtet.
Ich hatte Crimson Lake nicht bewusst als Versteck ausgewählt, sondern war einfach mit Sack und Pack aus Sydney Richtung Norden geflohen, getrieben von panischer Angst und der Überzeugung, in meiner Stadt um mein Leben bangen zu müssen. Ich wollte erst anhalten, wenn ich mich wieder in Sicherheit wähnte, an einem Ort, wo die Menschen mich nicht erkannten, so lautete mein Plan. Die fünf oder sechs Tage nach meiner Entlassung brachte ich damit zu, Journalisten zu entkommen, die mich von Hotel zu Hotel jagten, bis ich schließlich auf der Straße landete. Kelly hatte verfügt, dass ich das Haus nur in polizeilicher Begleitung betreten durfte, also nahm ich nach der Entlassung nur das Nötigste mit. Die Menschen in Sydney waren zornig. Jeder Fernsehkanal berichtete über mich. Jeder Radiosender. Mein Gesicht prangte auf den Titelseiten. Ich aß kaum. Wenn ich es doch wagte, mit eingezogenem Kopf in einen Imbiss zu flitzen, wurde ich meist erkannt. Irgendwann gab ich es auf.
In den Kleinstädten weiter nördlich wurde es etwas einfacher. Je abgelegener der Ort, desto geringer war das Interesse der Leute an fremden Angelegenheiten.
Als ich irgendwann in Crimson Lake aufschlug, stellte ich zu meiner Erleichterung fest, dass die Einwohner sich nicht nur einen feuchten Kehricht um Nachrichten aus der Stadt scherten, sondern dass in dieser Kleinstadt offenbar die Zeit stehengeblieben war. Hier traf ich auf ein Stück karge Zivilisation im ständigen Kampf mit dem hungrigen Regenwald, der sie zu verschlingen drohte. Überall wucherte es, an den unmöglichsten Orten sprossen Flechten, rankten Kletterpflanzen. Entlang der Flüsse kauerten verfallene Häuser im Buschwerk, die leeren Türhöhlen wie gähnende Mäuler. Perfekt getarnt in ihrem üppigen Laubkleid, das sich über jeden Stein, jeden Holzbalken gelegt hatte, spähten sie aus dem Dickicht hervor. Hier war eine Stadt, in der jede Schuld, die ein Mensch auf sich geladen haben mochte, mit der Zeit unter einer grünen Decke verschwinden würde. Die allgegenwärtige Feuchtigkeit, die regelmäßigen Regenfälle, die immer wieder anschwellenden Flüsse und Seen, die an den Straßenrändern nagten, vielleicht könnten sie auch Lebensgeschichten wegspülen und die Menschen reinwaschen von ihren Sünden. Dieser Ort schien sich selbst verzehren zu wollen wie ein warmer, grüner Schlund. Ich konnte es gar nicht erwarten, mich hineinzustürzen.
Mein neues Heim fand ich am Ufer des Sees, nach dem der Ort benannt war und der sich wie ein glatter Spiegel in die verschlungene Vegetation der Feuchtgebiete schmiegte. Die Besitzer hatten das Haus geerbt, waren aber zu alt, um es selbst zu beziehen. So hatte es jahrelang leer gestanden. Damals, als der Makler mir das Anwesen zeigte, stand ich auf der Veranda und schaute über den See. Am fernen Ufer rodeten die Zuckerrohrfarmer ihre Felder, und die tief hängende Sonne kämpfte sich durch die Rauchschwaden. Ein rotes Auge im blutverschmierten Wasser.
Jetzt stand ich hier in meiner klatschnassen Jeans unter dem Vordach des nächstgelegenen Ladens und studierte die ausgehängten Handzettel und Kleinanzeigen. Geflügelfutter, Maschendraht. Ein mobiler Schlachter bot seine Dienste feil. Gitarrenunterricht und Poolreinigung, daneben eine sechs Monate alte Traueranzeige für eine Frau, die offenbar bei einem Unfall ums Leben gekommen war. Teresa Miller, Mutter und Ehefrau, geliebt und unvergessen. Die Ladenglocke schrillte über der Tür, als ich eintrat und mich an einem der alten, vergilbten Computer niederließ. Ganz in der Nähe lag ein Zeitungsstapel, den ich geflissentlich ignorierte.
Eine ganze Weile schlich ich wie eine Katze um den heißen Brei und unterdrückte den Drang, im Internet nach Amanda Pharrell zu suchen, die Frau, die ich Seans Meinung nach unbedingt treffen sollte. Ich konnte mir keinen rechten Reim auf die Sache machen, wollte den alten Mann aber auch nicht zu eindringlich befragen. Sean und ich waren uns einig, dass eine romantische Beziehung zu diesem Zeitpunkt völlig absurd wäre. Wenn es sich also nicht um ein Date handelte, würde ich eigentlich lieber die Finger davon lassen. War diese Pharrell eine Art Therapeutin? Hatte man auch sie zu Unrecht einer Straftat beschuldigt, acht Monate ins Gefängnis gesteckt und danach einfach wieder ins Leben zurückgespuckt? Glaubte Sean, wir würden uns prima verstehen und darüber austauschen, wie wir in den Duschräumen ständig von Vergewaltigern bedroht wurden? War sie darauf spezialisiert, Sexualstraftätern Jobs zu beschaffen, bei denen sie nicht mit Menschen zu tun hätten, die sie wegen ihres Verbrechens lynchen wollten? Mir gefiel keine dieser Möglichkeiten. Ehrlich gesagt wollte ich am liebsten nie wieder was mit Fremden zu tun haben. Es war einfach zu gefährlich.
Am Ende siegte meine Neugier, und ich startete trotzdem eine Google-Suche. Auf der ersten Seite stieß ich nur auf Zeitungsberichte. Noch während ich sie überflog, machte ich mir weis, dass es mich nicht interessierte.
Tragischer Tod einer Schülerin
Eine Überlebende bei Tragödie am Kissing Point
Polizei jagt Killer von Kissing Point
Verdächtige im Mordfall Kissing Point festgenommen
Nachdem ich mir ein paar ausgewählte Artikel auf den Desktop gezogen hatte, starrte ich unentschlossen auf den Bildschirm mit den vielen kleinen Icons. Meine Erschütterung erklärte ich mir damit, dass ich die vielen großen Schlagzeilen nicht gut vertrug. Dass es wohl eher an den fiesen Einzelheiten dieser entsetzlichen Geschichte lag, wollte ich mir nicht eingestehen. Das war mir alles zu vertraut. Jugendliche Unschuld. Gefängniszellen. Appelle an die Öffentlichkeit. Weinende Familien auf polierten Holzbänken. Als ich mir das Gesicht rieb, hörte ich neben mir Stühle knarren. Der vertraute Ledergeruch war mir schon in die Nase gestiegen, bevor ich die beiden Männer als Polizisten erkannte. Das Knarzen und Rasseln der Gürtel und Schnallen. Der Dickere von beiden, dem die Haare wie angeklatscht am Kopf klebten und in dunklen Zipfeln in die Stirn ragten, sprach zuerst.
»Man muss immer auf dem Laufenden bleiben, hab ich recht, Lou?«
Die beiden hatten ihre Unterhaltung offenbar schon draußen begonnen und setzten sie hier fort. Erleichtert klickte ich auf eine Sportseite.
»Da wirst du kaum was finden, Kumpel. Hier ist doch nichts los«, antwortete Lou. Sein Gesicht spiegelte sich auf meinem Bildschirm. Noch ein Fettwanst auf dem Weg zum Herzinfarkt. Jung, weiße Haut, glatt wie ein Babypo.
»Na, so soll’s auch bleiben, nicht wahr, Lou?«
»Klar, Mann.«
»Unsere Stadt soll schön ruhig und sicher bleiben.«
Mit Schweiß vermischtes Regenwasser rann mir warm über die Schläfe. Ich wischte mir übers Gesicht und klickte mich durch die Sportfotos. Betrachtete Kricketspieler, die mit hängenden Köpfen auf den Rasen starrten.
»Genau. Unsere kleinen alten Damen und schnuckeligen Kinderchen sollen glücklich sein und sich geschützt fühlen.«
»Und keine bösen Überraschungen erleben.«
»Ganz recht, Steve«, sagte Lou. »Besonders die Kinderchen.« Dann war das Spiel vorbei, und der Bulle sah mir direkt ins Gesicht. Ich räusperte mich, schloss die Seiten über Amanda Pharrell. Eine hatte ich noch nicht gelesen. Die schickte ich an den Drucker und schloss sie hastig. Kurz verharrte ich auf der Stelle. Am liebsten wäre ich abgehauen, aber ich wollte das Haus nicht umsonst verlassen haben.
Killerin eröffnet Detektivbüro
Umständlich schlängelte ich mich an den Polizisten vorbei, warf ein paar Geldstücke auf den Tresen und schnappte mir den Ausdruck.
4
Wenn die Träume kommen, gibt es kein Entrinnen.
Morris und Davo umkreisen mich im beengten Verhörzimmer wie die Haie. Frankie steht im Türrahmen, den Blick auf die Fingernägel gerichtet, als gäbe es dort etwas Spannendes zu entdecken. Krampfhaft bemüht, mir nicht ins Gesicht schauen.
Meine Kollegen. Meine Freunde. Mit diesen Leuten habe ich im Garten vor meinem fettsatten Grill Bier getrunken. Gemeinsam haben wir Türen eingetreten. Sind durch Kneipen gezogen. Als Streifenpolizisten haben wir Protestkundgebungen bewacht. Frankie und meine Frau Kelly trafen sich gelegentlich zum Kaffee, standen in regelmäßigem SMS-Kontakt. Aber jetzt zogen diese Menschen einen langsamen Schlussstrich unter unser gemeinsames Leben. Ich saß auf dem Stuhl, auf der falschen Seite des Verhörtisches. Sie waren unruhig. Fühlten sich offensichtlich unwohl mit der Situation. Erschraken vor den eigenen Worten.
»Sagt mir doch endlich, was los ist«, flehte ich sie an.
»Sonntagnachmittag«, sagte Morris. »Mount Annan. Der Highway, kurz nach der Reifenwerkstatt. Um ungefähr Viertel vor eins bist du mit deinem Corolla da vorbeigefahren, richtig?«
»Ja. Hab ich doch schon gesagt.«
Mein Magen war schwer wie ein Felsklumpen. Seit drei Stunden saß ich nun schon hier, vielleicht auch länger, und beantwortete dieselben Fragen, wieder und immer wieder. Was hatte ich am Morgen des 12.April gemacht? Was hatten Kelly und ich zueinander gesagt? Worüber hatten wir uns gestritten? Wie lange? In welche Richtung war ich gefahren, als ich das Haus verließ? Was hatte ich auf dem Weg gesehen?
Es gab keine Uhr, doch ich spürte die Minuten vorüberkriechen. Zwei Minuten hatte Burke an meinem Schreibtisch gestanden, als er mir ausrichtete, der Chef wolle mich sehen. Zehn Minuten hatte ich allein im Vorzimmer gewartet, bis der Chef mich schweigend ins Verhörzimmer brachte. Eine Dreiviertelstunde hatte ich dort gesessen, und mich seufzend gefragt, wie lange dieser Scherz wohl noch dauern würde. Das Ganze ging mir langsam auf die Nerven. Eine Stunde erschien mir allerdings recht lang für einen Scherz. Der Tag stimmte zwar nicht, aber mein Vierzigster stand bald an. Vielleicht war jemand Wichtiges an meinem Geburtstag verhindert, und man hatte die Party einfach vorgezogen. Nein, das war’s nicht. Wollte man mich etwa befördern? Ich saß allen Ernstes im Verhörzimmer und stellte mir vor, wie die anderen den Aufenthaltsraum mit Girlanden dekorierten und das Eis aus dem Gefrierschrank holten. Wie falsch ich gelegen hatte, wurde mir erst klar, als Frankie und Morris und Davo reinkamen, die Mienen todernst. So grimmig schauten sie auch drein, wenn sie Todesnachrichten überbringen mussten.
»Kann mir vielleicht jemand sagen, was hier los ist?«, fragte ich erneut. »Ich verstehe nicht, warum ich hier bin.«
»Warst du an dem Tag mit dem Auto unterwegs, ja oder nein?«
»Ja, war ich! Wie oft denn noch?«
»Du hast es niemandem geliehen?« Little Frankie, die sich erst vor ein paar Wochen abgewöhnt hatte, heimlich hinter den Spinden zu weinen, wenn ihr die Verbrecher bei Verhören mal wieder zugesetzt hatten. Little Frankie, die lauter blaue Flecken hatte von ihrem übergroßen Polizeigürtel und dem riesigen Taser, der wie eine Wasserpistole an ihrem Oberschenkel baumelte. »Überleg dir die Antwort gut, Ted.«
»Nein«, sagte ich. »Sonntagnachmittag bin ich zum Angeln gefahren. Allein. Ich hatte mich mit Kelly gestritten und wollte keine Gesellschaft. Das Auto habe ich niemandem geliehen. Ich selbst bin damit gefahren und auf dem Weg auch durch Mount Annan gekommen. Mehr gibt’s nicht zu sagen. Ich habe nichts verbrochen. Keine Ahnung, wann ich auf dem Highway war, vielleicht tatsächlich um Viertel vor eins, vielleicht um eins. Ich weiß es nicht! Es war Sonntag, deshalb habe ich nicht auf die Uhr geschaut. Wenn ihr mir sagt, was los ist, kann ich euch vielleicht helfen …«
»Ted, du behauptest, du wärst angeln gefahren. Wir glauben dir nicht. Wir haben uns den Wetterbericht angesehen. Am Sonntagnachmittag hat es gepisst wie aus Eimern.«
»Stimmt doch gar nicht! Nach zwanzig Minuten hat es wieder aufgehört«, entgegnete ich. Mittlerweile war ich schweißgebadet. »Ich wusste, dass es wieder aufklaren würde. Das konnte man deutlich erkennen.«
»Klar. Du bist ja auch ein verdammter Meteorologe!«
»Meine Güte, Davo.«
»Deine Angelgeschichte haut nicht hin, Ted. Komm schon. Niemals bist du im strömenden Regen angeln gegangen.«
»Ehrlich gesagt…«
»Ach, jetzt bist du also endlich ehrlich?«
»Es ging mir gar nicht ums Angeln.« Wie sollte ich hier nur wieder rauskommen?
»Worum denn dann, Ted?«
»Ich brauchte Abstand zu Kelly.« Wie peinlich! »Wir hatten uns gestritten, deswegen bin ich abgehauen. Irgendwohin, irgendwas machen. Egal was.«
»Also warst du ziemlich aufgebracht?«
»Meine Fresse!«, brauste ich auf. »Was geht hier ab?«
»Was hier abgeht, ist, dass du uns anlügst.«
»Wozu sollte ich lügen? Was ist passiert?«
»Du warst allein?«
»Ja.«
»Niemand hat dich gesehen?«
»Hab ich doch gerade gesagt.«
»Ich zeige dir jetzt ein paar Fotos.« Morris wuchtete sich aus dem Stuhl. Seine überbordende Energie war schwer zu ertragen, und ich zuckte zusammen, als er schwungvoll einen Umschlag aus dem Regal neben der Tür zog.
»Kann ich…«
»Gehst du oft angeln?«
»Ich habe doch gerade erklärt…«
»Beantworte die Frage.«
»Unterbrich mich nicht ständig!« Langsam wurde ich wütend. Meine Wangen glühten. Auf einmal war mir klar, dass dies kein Scherz, sondern bitterer Ernst war. Die Erkenntnis traf mich mit einer solchen Wucht, dass ich am ganzen Körper zu zittern begann, von den Fingern zu den Füßen. Mir wurde heiß und kalt. Morris, der mir ständig ins verdammte Wort fiel, reizte mich nur noch mehr. So redeten wir mit Verbrechern. Immer schon dazwischenfunken, sobald sie die Klappe aufrissen. Immer und immer wieder, bis sie schließlich hochgingen und dir am liebsten die beschissene Gurgel umdrehen würden, nur um endlich zu Wort zu kommen. »Ich versuche, deine Fragen zu…«
»Hast du auf dem Weg nach Chifley irgendwo in der Nähe von Mount Annan am Highway Rast gemacht?«
»Nein. Ich habe das Haus verlassen und bin nach Chifley gefahren. Dort habe ich mir Köder besorgt. An einer Tankstelle.«
»Ich frage dich noch mal. Denk gut nach.«
»Wozu? An diesem Nachmittag bin ich nur nach Chifley gefahren. Hat es einen Unfall gegeben? Wurde jemand verletzt?«
»Wieso fragst du, ob jemand verletzt wurde?« Morris fuhr sich nervös mit der Fotokante übers Handgelenk, bis sich rosa Striemen bildeten. Vorgetäuschte Selbstmordnarben.
»Ich habe doch gerade…«
»Hast du an der Bushaltestelle in Mount Annan gehalten?«
»Nein.«
»Das sehe ich anders. Ich behaupte sogar, dass du letzten Sonntag um circa Viertel vor eins an der Bushaltebucht in Mount Annan geparkt hast und aus dem Wagen ausgestiegen bist. Warum lügst du uns an?«
Das traf mich wie ein Schlag. Meine Reaktion war deutlich zu erkennen.
»O nein, warte mal. Ja! Ja, klar! Jetzt erinnere ich mich.« Ich lachte nervös auf.
»Willst du uns nun endlich die Wahrheit sagen?«
»Ich habe gehalten«, gab ich zu. »An dieser Bushaltestelle bei der Brücke. Stimmt. Meine Rute lag auf dem Rücksitz und hat ständig gegen die Heckscheibe geschlagen. Ich habe kurz angehalten und sie anders hingelegt, dann bin ich wieder eingestiegen und weitergefahren.«
»Also gibst du zu, den Highway um circa Viertel vor eins an der Haltestelle für die Linie372 verlassen zu haben.« Davo und Morris tauschten ernste Blicke.
»Ja.«
»Das sind ja ganz neue Töne.«
Ich schlug auf den Tisch. Frankie zuckte zusammen.
»Was ist hier los, verdammte Scheiße?«
Morris legte ein Foto auf den Tisch. Es zeigte das Mädchen, Claire Bingley.
Schweißnass schreckte ich aus dem Schlaf.
Es war noch dunkel. Die Krokodile bellten.
Zweihunderteinundvierzig Tage lang saß ich im Gefängnis. Am Morgen meiner Verhaftung hatte ich meine Frau und meine kleine Tochter zum Abschied geküsst, war zur Arbeit gefahren, hatte mir in der Kantine Toast und Kaffee genehmigt und war anschließend mit der Rolltreppe zum dritten Stock des Hauptquartiers der Polizei von New South Wales an der Charles Street in Parramatta hinaufgefahren. Es war bedeckt. Eine leichte Brise fuhr den Damen auf dem Raucherbalkon durch die Haare. Es war genau eine Woche her, dass Claire Bingley nach ihrem Martyrium im Busch bei Mount Annan am Rand des Highways wieder aufgetaucht war. Ich hatte es in den Nachrichten gesehen, aber in meiner Abteilung hatte niemand darüber geredet. Ich arbeitete im Drogendezernat, und an diesem Morgen belauschte ich das angeregte Geplapper einer libanesischen Koksdealerbande, um herauszufinden, ob sie eine neue Ladung Drogen durch den Zoll schleusen würden oder nicht. Davo, Morris, Little Frankie und ich waren den Typen schon seit einiger Weile auf den Fersen, warteten aber noch auf den besten Zeitpunkt für eine Razzia. Die übliche Routinearbeit.
Der Kaffee und der Toast sollten meine vorerst letzte in Freiheit gekaufte Mahlzeit gewesen sein. Gegen zehn bemerkte ich, dass ein Raunen durchs Büro ging. Einige Kollegen sahen mich schief an. Um elf wurden Davo, Morris und Frankie ins Verhörzimmer Nummer fünf beordert. Ich fragte mich kurz, warum sie mich nicht mitgenommen hatten, doch ich hing am Telefon fest, also konnte ich der Sache nicht nachgehen. Kurz vor Mittag kam ein Kollege aus dem Betrugsdezernat zu mir. Der Chef wollte mich im Verhörzimmer Nummer vier sehen, ich solle dort warten. Warum, sagte er nicht.
Die Vernehmung dauerte vierzehn Stunden. In dieser Zeit konnte ich nichts essen. Davo, Morris und Frankie machten den Anfang. Befangenheit spielte auf einmal keine Rolle mehr, denn meine Freunde reagierten so heftig auf die Situation, dass ihnen niemand entgegentrat, als sie ins Zimmer platzten und mich in die Mangel nahmen. Wahrscheinlich meinten alle, sie hätten ein Recht dazu. Nachdem ihre stundenlange Befragung keine befriedigenden Antworten zutage gefördert hatte, überließen sie mich den Jungs von der Mordkommission. Denn die waren zuständig. Meine Anklage: versuchter Mord. Die erste Nacht verbrachte ich hinter Gittern – in meiner Polizeiwache. Stundenlang stand ich vorm Schlitz in der Zellentür und versuchte, die Aufmerksamkeit meiner Kollegen zu erregen, damit sie mir vielleicht endlich sagen würden, was man mir vorwarf. Doch man hatte ihnen jeglichen Kontakt mit mir untersagt. In einem einzigen Tag war ich vom Freund zum Feind geworden.
Von dem Vorwurf der Vergewaltigung und des versuchten Mords an Claire Bingley wurde ich nie freigesprochen.
Das war besonders schlimm, denn für die Öffentlichkeit blieb ich ein Verbrecher. Sogar die Staatsanwaltschaft hielt die Beweislast für schwer genug, dass es für eine Verurteilung reichen würde. Dann wurde das Gerichtsverfahren plötzlich eingestellt, der Staatsanwalt erklärte, es lägen nicht genügend Beweise vor, um die Geschworenen von meiner Schuld zu überzeugen. Von Unschuld sprach niemand. Man setze das Verfahren bis auf weiteres aus, so lautete die offizielle Version. Sollten sich neue Beweise ergeben, könnte man es jederzeit wieder aufnehmen.
Ich hatte keine Ahnung, ob die Ermittlungen im Fall Claire Bingley andauerten, denn ich war kein Polizist mehr, und meine alten Freunde hatten den Kontakt zu mir abgebrochen. Jeden Tag erwachte ich mit der Furcht, man könnte mich erneut verhaften und wieder ins Gefängnis stecken.
Will man hinter Gittern überleben, bleibt einem nur eines: völlige Unterwerfung. Alles andere ist Zeitverschwendung und gefährlich für den Verstand.
Der Insasse hatte sich strikt an die Routine zu halten. Er hatte den Leitfaden für Insassen zu studieren und den Regeln zu folgen. Seine Zelle und Häftlingskleidung waren makellos sauber zu halten, alle seine Unterlagen ordnungsgemäß und pünktlich einzureichen. Der Umgang mit Personal und Mitgefangenen hatte höflich und professionell zu erfolgen. Sämtliche Situationen unterlagen den Anstaltsregeln, sei es Registrierung oder sexuelle Übergriffe. Es war also nicht nötig, eigene Entscheidungen zu treffen.
Sollte es zum Beispiel zu Prügeleien kommen, war völlig klar, wie sich der Gefangene zu verhalten hatte. Er legte sich umgehend auf den Boden, verschränkte die Hände im Nacken und wartete auf weitere Anweisungen. Während der regelmäßigen Inspektionen der Zellen hatte er still zu sein, den Anweisungen des Personals zu folgen, und alle persönlichen Gegenstände für die Inspektion zugänglich zu machen. Der Insasse hatte sich ständig über den neuesten Stand der Anstaltsregeln zu informieren und sein Verhalten entsprechend anzupassen. Unkenntnis schützte nicht vor Strafe.
Organisation vermittelte Geborgenheit. Es war bequem, keine Entscheidungen treffen zu müssen. Der Gefangene wurde zu einem Rädchen im Getriebe der stetig anwachsenden Gefängnismaschinerie. Er passte genau, drehte sich einwandfrei, ein Präzisionsprodukt.
Wer sich gehen ließ, brachte das Getriebe zum Knirschen und würde schon bald Funken schlagen. Es gab Menschen, die alles daransetzten, möglichst lange zu knirschen. Auf Dauer hielt das allerdings niemand durch.
Nach meiner Ankunft in Crimson Lake hatte ich mich gehen lassen. Ich war erst zwei Monate frei und schiss auf Regeln. Also begann ich zu trinken, kaufte mir am Rand der Zivilisation eine Bruchbude und klinkte mich aus der Gesellschaft aus. Oft wusch ich mich tagelang nicht. Aß kaum etwas. Vergaß es einfach, bis mich der Hunger daran erinnerte. Ich strauchelte, taumelte. Doch nun war der Zeitpunkt gekommen, mit dem Mist aufzuhören. Die Umzugskartons auszupacken. Nicht mehr auf einer alten Decke auf der Veranda zu schlafen wie ein räudiger Hund.
Ich saß im warmen Morgenlicht, zückte mein Handy und wählte die Nummer eines Möbelmarktes in Cairns.
Einen Fernseher bestellte ich nicht, denn ich wollte mich nicht sehen.
Unter dem Haus stieß ich auf einen verrosteten Rasenmäher, den die Besitzer mir hinterlassen hatten. Mit dem rückte ich dem Gras zu Leibe. Am Nachmittag war ich schweißüberströmt, die Gänse traumatisiert, aber der Rasen wimbledonreif. Ich ließ Woman auf der Veranda zurück und schnappte mir die Küken, die wie wild mit ihren Schwimmfüßen zwischen meinen feuchten Fingern herumpaddelten. Kaum hatte ich sie abgesetzt, watschelten sie munter pickend über den penibel geschorenen grünen Grasteppich. Ich kehrte auf die Veranda zurück und versuchte, Woman den Kopf zu tätscheln. Sie hisste und schnappte nach mir, doch ich nahm’s nicht persönlich.
Als dieser Tag zu Ende ging, besaß ich eine Waschmaschine, ein Bett, einen gefüllten Kühlschrank und ein nettes Rattansofa für die Veranda. Das war zwar nicht viel, aber mehr brauchte ich gerade nicht. Die Fenster zur Straße nagelte ich zu und fegte die Glassplitter auf. Die Gänse kuschelten sich zum Schlafen in ihren Karton. Ich ließ das Handtuch herab und betrachtete stolz mein Tagwerk. O himmlische Organisation. Ich hatte alle Regeln meines neuen Lebens erfüllt. Was sonst noch auf mich zukäme, würde ich sicher mithilfe des Leitfadens meistern.
5
Im Zeitungsartikel über Amanda Pharrell stand etwas von einem Büro in der Beale Street. Ich wusch mir das Gesicht, putzte mir die Zähne und stand geschniegelt und gebügelt in Hemd und grauer Stoffhose um Punkt acht Uhr vor ihrer Tür. Für die wilden Hunde des Ortes war es bereits zu schwül, sie hatten sich in den Schatten unter die Bäume am Crimson Lake Hotel verkrochen.
Ich konnte mir immer noch keinen Reim auf die Sache machen. Als Sean mir empfohlen hatte, Amanda aufzusuchen, hatte er mir keine konkreten Gründe dafür genannt. Während der Verhandlung hatte er festgestellt, dass mich Details nur übermäßig verunsicherten und ich mit klaren Anweisungen besser zurechtkam. Ich konnte mir nur einen einzigen Grund vorstellen, aus dem Sean mich zu Amanda schickte: Auch sie hatte eine Haftstrafe verbüßt und tat sich mit ihrem Leben als Aussätzige vielleicht genauso schwer wie ich. Möglicherweise war er damals in ihren Fall verwickelt gewesen und der Ansicht, wir könnten einander Ratschläge geben, wie man den Alltag übersteht, wenn einem neun von zehn Mitmenschen den Tod wünschten. Wenn sie noch schlechter klarkäme als ich (extrem unrealistisch), würde mich das möglicherweise aufmuntern.
Als ich mich am Abend zuvor auf meinem neuen Bett im Internet über Gänseküken informiert hatte, war ich auf eine Seite gestoßen, die empfahl, Vogeljunge, die keine Nahrung zu sich nehmen wollten, mit einem gleichaltrigen Tier in einen Karton zu setzen, damit es dessen Verhalten nachahmen könne. Verwaiste Küken, die einander zum Überleben ermutigen. Meinte Sean vielleicht, wir Schwerverbrecher sollten zusammenhalten? Ich hatte keine Ahnung.
Meine Pünktlichkeit entpuppte sich als Fehleinschätzung. Ich lungerte vor dem Gebäude herum, eine Bretterbude, eingezwängt zwischen einer Bank und einem kleinen Laden, die jemandem als Büro diente. Durch die heruntergezogenen Jalousien konnte ich zwar nichts erkennen, doch hinter der Tür meinte ich, ein Miauen zu vernehmen. Unsicher zog ich den Artikel über Amanda aus der Hosentasche und überprüfte die Adresse. Was da stand, erstaunte mich immer noch.
Killerin eröffnet Detektivbüro
Amanda Pharrell, die als Killerin von Kissing Point Schlagzeilen machte, eröffnete diese Woche unter dem Namen »Pharrell Private Investigations« ihre neue Detektei in der Beale Street in Crimson Lake. Die Lizenz als Privatdetektivin erlangte Pharrell während der achtjährigen Haftstrafe, zu der sie 2006 für den Mord an der siebzehnjährigen Lauren Freeman aus Crimson Lake verurteilt worden war. Trotz der Bedenken einiger Einwohner des Ortes ließ Gemeinderatsmitglied Scott Bosc verlauten, dass Pharrell ihrem Gewerbe ohne Einschränkungen nachgehen dürfe. Pharrell zufolge habe sie bereits drei Tage nach der Eröffnung erste Anfragen erhalten.
Im Fenster des kleinen Büros hing ein Zettel mit den Öffnungszeiten:
Beratungszeiten: Mo – So 10 bis 22 Uhr
Ansonsten finden Sie mich in der Shark Bar
Die Shark Bar war ein in die Jahre gekommenes Diner im Karibikstil inklusive eingetopfter Strelitzien und farbenfroher Hibiskus-Wandmalereien. Der Tresen war zugemüllt – Becher mit diversen Werbekugelschreibern, zerfledderte, monatealte Magazine, Broschüren fürs Korallentauchen, solarbetriebene, hüftenschwingende Hawaiipüppchen. Eine Kellnerin wischte die Tische, ansonsten gab es nur zwei Gäste: eine bunt tätowierte Drogensüchtige und eine ältere Frau mit einem Krimi in der Hand. An den Schläfen ihrer hennaroten Dauerwelle zeigte sich ein grauer Ansatz. Als ich mich zu ihr an den Tisch gesellte, blickte sie überrascht von ihrem Buch auf.
»Sie machen erst um zehn auf?«, fragte ich. »Mannomann, hier ist wirklich der Hund begraben.«
Die Frau runzelte die Stirn. »Wie bitte?«
Das verunsicherte mich ein wenig.
»Sie sind doch Amanda Pharrell, oder?«
»Wer?«
»Ach, Verzeihung«, sagte ich lachend. »War wohl eine Verwechselung.«
Ich wies beschwichtigend auf den Krimi und erhob mich rasch. Obwohl mich der ausgezehrte tätowierte Schmetterling in der gegenüberliegenden Ecke keines Blickes gewürdigt hatte, trat ich an ihren Tisch. Ihre Hand zitterte, als würde sie Münzen zählen. Pillendreher-Tremor.
»Entschuldigung, sind Sie Ms Pharrell?«
Die Frau nickte zur Kellnerin. »Ansonsten bleibt ja wohl nur noch Vicky.« Keine Ahnung, ob ich erleichtert oder enttäuscht war, doch ich setzte mich zu ihr. Zwischen uns lagen fünf Zeitungen, drei aufeinandergestapelt zu ihrer Rechten, eine unter ihren Fingern und eine zu ihrer Linken. Ich streckte ihr die Hand hin, doch sie schüttelte sie nicht, sondern starrte sie an, als wüsste sie nicht, womit sie es zu tun hatte.
»Edward Conkaffey«, sagte ich. »Nennen Sie mich Ted.«
»Ah, der Typ von Sean.« Sie musterte mich gründlich. »Hatte nicht gedacht, dass du so groß bist.«
»Und ich hatte nicht gedacht, dass Sie so …« – ich ließ den Blick über ihre Tattoos schweifen – »… bunt sind«, entgegnete ich.
Sie grinste. Dabei zuckte sie auffällig mit dem Kopf. Eine ruckartige seitliche Bewegung, die sich ein paarmal wiederholte. Ich bemühte mich, sie nicht anzustarren.
»Kennen Sie Sean?«, fragte ich.
»Nö.«
»Interessant. Und wieso haben Sie mit ihm über mich geredet?«
»Er hat mich angerufen«, sagte sie. Mehr nicht.
Wir musterten einander schweigend. Die Atmosphäre zwischen uns war ziemlich aufgeladen. Ihre Arme waren dürr, die Adern traten deutlich hervor. Trotzdem waren sie reich bebildert: Radios und Mikrofone, Vögel und Engel, üppige Dschungelpflanzen, hinter denen sich kleine herrschaftliche Prachtbauten verbargen, die an Südstaatenvillen in Louisiana erinnerten, Federschmuck und Porträts verschiedener Schönheiten, schwarz, asiatisch, alles war vertreten. Auf ihrer linken Hand prangte ein Kaninchen im schwarzen Dreireiher.
»Sean meinte, du könntest in den nächsten Tagen anfangen. Oder brauchst du noch das Wochenende?«
»Sean hat gesagt, ich würde für Sie arbeiten?«
»Jepp.«
Ich lachte.
»Ist das so witzig, Schätzchen?«
»Ja«, sagte ich grinsend. »Ist es. Zum Schießen. Lächerlich. Ärgerlich.«
»Was hattest du denn erwartet?«
Ich zuckte die Achseln. »Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Dass ich Ihnen irgendwie helfen kann, vielleicht. Von Ex-Knacki zu Ex-Knacki sozusagen. Sie sind zwar schon wieder ein paar Jahre auf freiem Fuß, aber …«
Sie prustete los. »Seh ich etwa aus, als würd ich Hilfe brauchen?«
»Nee.«
Sie tätschelte mir herablassend den Arm. »Mir geht’s blendend, Schätzchen. Schon komisch, dass du meinst, du könntest mir helfen und nicht umgekehrt. Schließlich bist du derjenige, der nach Eau de Jack Daniels duftet.«
Ich beschnüffelte meinen Kragen. »Wild Turkey«, sagte ich.
»Sean wollte, dass du deinen Hintern hochkriegst und endlich arbeitest.«
»Nett von ihm.« Ich räusperte mich. »Botschaft angekommen.«
Amanda Pharrell lächelte. Unsere Begegnung nahm langsam absurde Züge an, und ich fühlte mich zunehmend unwohl, wie bei einem schlechten Scherz. Mir juckte der Kopf. Sehnsüchtig sah ich zur Tür.
»Wenn ich das richtig verstanden habe, sind Sie alleinige Inhaberin einer Privatdetektei?«
»Korrekt.« Wieder dieses Zucken.
»Und Sean ist der Ansicht, ich sollte mich Ihnen anschließen und Fälle lösen, als sei nichts passiert?«
»Ich glaube, er ist sich durchaus klar über das, was passiert ist.« Amanda wandte sich gelangweilt der Zeitung zu. Sie studierte die Bilder gründlich, bevor sie sich dem Text widmete. »Er weiß nur zu gut, was aus deinem Leben geworden ist. Deswegen hat er wohl an mich gedacht. Weil ich die Einzige in ganz Queensland bin, die einen Straftäter deines Kalibers engagieren würde.«
Dieses Treffen schlug mir eindeutig auf den Magen. Wieder spähte ich zur Tür.
»Er meinte, bei dir wär die Kacke am dampfen«, erklärte sie lächelnd. »Nachdem ich mir deine Akte angeschaut hatte, musste ich ihm zustimmen.«
»Meine Güte. Hören Sie, Ms Pharrell, nur weil Sie die Einzige in Queensland sind, die jemanden wie mich als Detektiv einstellen würde …«
»… überhaupt einstellen würde …«, ergänzte sie.
»… überhaupt einstellen würde«, stimmte ich zu, »heißt das nicht automatisch, dass ich für Sie arbeiten will. Schließlich sind Sie …«
»… eine verurteilte Mörderin?« Sie sah mich an. »Hör zu, Herzchen. Verurteilt, freigesprochen. Schuldig, nicht schuldig. Anklage erhoben, Anklage fallenlassen. Alles egal. Da kommst du auch noch dahinter. Du brummst eine Strafe ab. Wir beide tun das.«
Ich spielte mit dem Serviettenständer.
»Denk doch mal nach«, fuhr sie fort. »Was unterscheidet uns denn letztlich voneinander?«
»Da fällt mir aber einiges ein«, sagte ich.
»Aha. Du weigerst dich also immer noch, den Tatsachen ins Gesicht zu sehen.« Sie machte eine abwertende Handbewegung und wandte sich wieder der Zeitung zu. »Das kapierst du schon noch.«
Eine Weile saßen wir schweigend am Tisch, Amanda las die Zeitung, als wäre ich gar nicht da, während ich sie genauer in Augenschein nahm, vor allem den orangeroten Ansatz ihrer schwarz gefärbten Locken. Unglaublich, wie leichtfertig sie über mein Leben plauderte. Die versengte Ödnis meiner Existenz. Sie schlürfte ihren Kaffee wie ein Kind. Ich saß verwirrt und entgeistert vor ihr wie ein Beifahrer in einem Unfallwagen, der nicht weiß, wo oben und unten ist.
»Also, ab wann bist du frei?«, fragte sie schließlich.
»Frei?«
»Einsatzbereit.«
»Eigentlich ab sofort«, sagte ich.
»Was hast du vorher gemacht?«
»Suchtkriminalität, ein paar Drogenmorde.« Plötzlich war mir schwindelig. »Ich kann noch nicht glauben, dass wir dieses Gespräch führen.«
»Wieso nicht?«
»Ist das Ihr Ernst?« Ich beugte mich verschwörerisch vor. »Wollen Sie behaupten, Sie haben echte Kunden?«
»Alles echt.« Sie feixte. »Was? Hast du gedacht, ich tu nur so?«
»Nein, ich frage mich nur … Sie sind eine verurteilte Mörderin. Halten die Leute Sie nicht für gefährlich?«
»Ich habe jemanden umgebracht«, flüsterte sie, die roten Lippen zu einem Grinsen verzogen. »Ich bin gefährlich.«
»Warum engagieren die Leute Sie dann?«
Sie zuckte die Schultern. »Keine Ahnung. Vielleicht glauben sie, ich wüsste, wie Kriminelle ticken. Weil ich mit Verbrechern auf einer Wellenlänge liege. Mit meinem speziellen Riecher für alles Superböse kann ich sie sofort erkennen, die Lügner und Betrüger und Gauner.« Sie schnüffelte wie ein Hund.
»Aha.«
»Möglicherweise hat es auch was damit zu tun, dass es außerhalb von Brisbane keine anderen Privatdetektive gibt.«
»So so.«
»Also gut«, sagte sie, lehnte sich zurück und stieß einen tiefen Seufzer aus, wie jemand, der sich erst nach reiflichem Überlegen dazu herablässt, einem Bekannten einen Gefallen zu tun. »Ich geb dir eine Chance. Aber nur, weil Sean mich so nett gefragt hat.«
»Aber Sie kennen ihn doch gar …«
»Korrekt.«
»Aber …«
»Warum probieren wir’s nicht einfach aus?«, fragte sie. »Wir können gleich ins Büro, da kannst du dir ein paar Fälle aussuchen. Als unbezahlte Arbeitsprobe sozusagen. Mal sehen, ob du’s drauf hast.«
»Was für Fälle?«
»Ach, einige. Da ist bestimmt auch was für dich dabei.« Ihr Kopf zuckte so stark zur Seite, dass sie mit dem Ohr fast die Schulter berührte. »Ehebruch, Versicherungsbetrug.«
»Das ist ja gut und schön, aber ich habe keine Lust, heimlich Fotos von nackten Ärschen in Hotelzimmern zu schießen.«
Da brach Amanda in lautes Gelächter aus. Sie war wie ausgewechselt, schlang sich die Arme um den Körper, als würde sie der Humor irgendwie trösten.
»Nackte Ärsche in Hotelzimmern, haha! Ach du Scheiße!«
»Vielleicht sollten wir’s einfach lassen. Die ganze Sache.«
Sie schlürfte geräuschvoll ihren Kaffee. »Na, ich werde dich zu nichts überreden.«
Ich betrachtete meine Finger. Dachte über gute Vorschläge nach, schlechte Entscheidungen, Sean. Und über meine finanzielle Lage.
»Ich arbeite nicht für lau. Schließlich bin ich kein Jugendlicher, der noch in der Ausbildung steckt.«
»Man kann’s ja mal versuchen, Schätzchen. Nichts für ungut.«
»Woran arbeiten Sie gerade?«
»Du. Ich bin Amanda.« Sie kicherte. »Aber von meinem Fall lässt du schön die Finger. Ich arbeite nicht gern im Team.«
»Ich auch nicht. Vergiss es einfach.«
Leider hatte sich just in dem Moment Vicky, die Kellnerin, vor unserer Diner-Bank aufgebaut, sodass ich nicht so leicht abhauen konnte. Sie stand mit gezücktem Stift und Block vor uns und lächelte erwartungsvoll. Ich sah Amanda fragend an, die meinen Blick gleichgültig erwiderte. Die Entscheidung lag bei mir. Also bestellte ich schwarzen Kaffee, und Vicky verschwand.
Amanda sah aus dem Fenster und seufzte. »Das wird nicht leicht mit uns.«
»Du hast’s erkannt.«
»Die meisten Leute in dieser Stadt haben fast vergessen, wer ich bin«, fuhr sie ungerührt fort, »und was ich getan habe. Oder zumindest regen sie sich bei meinem Anblick nicht mehr auf wie damals, als ich frisch aus dem Gefängnis kam. Sie haben sich wohl an mich gewöhnt. Aber bei dir? Wenn der Pöbel hier rauskriegt, wer du bist, dann gnade dir Gott. Deswegen glaube ich, du solltest den Bürokram übernehmen und die Nachtschichten mit den nackten Ärschen im Hotel.«
»Nein danke.«
Sie riss ein Stück Papier von der Zeitung und faltete es zu einem dicken, winzigen Päckchen. Das stopfte sie sich in den Mund und kaute darauf herum.
»Pass auf«, sagte sie nachdenklich kauend. »Ich versteh dich, Kumpel. Deshalb darfst du mich eine Zeitlang begleiten. Mal sehen, ob du mehr kannst, als Türen einzutreten. Aber halt dich bedeckt, okay? Sei unauffällig. Inkognito wie ein Moskito in einem Burrito.«
Ihr kleines Gedicht schien sie richtig zu begeistern. Mit breitem Grinsen schlürfte sie ihren Kaffee. Ich fragte mich kurz, ob ich mich vielleicht bedanken sollte.
»Vielleicht solltest du dir einen Bart wachsen lassen.«
Ich rieb meine Stoppel. »Bin schon dabei.«
»Also, bist du dabei? Sind wir Partner?«, fragte sie plötzlich mit kindlichem Enthusiasmus. Als ich die Augen verdrehte, klatschte sie vor Freude in die Hände.
»Erzähl mir von deinem Fall«, sagte ich.
Während Vicky mir den Kaffee servierte, zog Amanda ein paar Silberringe von ihrem linken Mittelfinger. Zwischen den beiden kleineren Ringen verbarg sich ein viel klobigeres Exemplar, das geräuschvoll auf dem Tisch landete. Sie ließ das schwere Schmuckstück auf mich zurollen, und ich konnte es gerade noch auffangen, bevor es herunterfiel.
»Unser Ortspromi ist verschwunden.«
6
»Es geht um Jake Scully«, sagte sie theatralisch.
»Muss ich den kennen?«
»Wenn du Bücher lesen würdest, wäre dir der Name ein Begriff«, erklärte sie. »Im Knast bin ich zur echten Leseratte mutiert. Hab jedes Buch verschlungen, das ich in die Finger bekam. Aber der größte Renner im Brisbane Women’s Correctional waren die Chroniken der Finsternis.«
»Klingen interessant.«
»Sind sie auch.«
»Worum geht’s?«
»Scully hat sich Geschichten aus dem Neuen Testament zusammengesucht und sie auf junge Leser zugeschnitten. Seine Romane sind ziemlich umstritten. Sie sind alle biblischen Motiven nachgebaut, enthalten aber eine Menge unchristliche Popkultur und cooles Teenagerzeug. Vampire, Hexen und so. Die Bibel, aber mit viel versautem Sex und Gewalt. Also genau das, worauf Jugendliche abfahren.«
»Ach ja, davon hab ich schon mal gehört. Der Typ hat Millionen davon verkauft, richtig?«
»Zehn Millionen. Echt beeindruckend.« Amanda lächelte. »Am Anfang sind Adam und Eva, die Hauptfiguren, noch ganz normale Schüler, aber dann bricht das Ende der Welt über sie herein. Am Schluss sind sie richtige Helden, die mit Zombies kämpfen und sich mit den Aposteln beratschlagen und so. Voll die Gotteslästerung. Aus biederen Bibelhelden werden grimmige, postapokalyptische Krieger – auf so was stehen Kinder aus christlichen Familien total. Alle coolen Typen aus der Heiligen Schrift sind dabei: der Erzengel Gabriel, der Heilige Christophorus – und viele sexy Dämonen.«
Amanda blickte zum Fenster hinter mir und seufzte beglückt.
»Im Frauenknast waren wir total besessen davon«, erklärte sie. »Wir lasen immer gleichzeitig, damit niemand das Ende verrät. Manchmal haben wir uns sogar abends daraus vorgelesen.«
»Und jetzt ist der Autor dieser Bücher verschwunden?«
»Wahrscheinlich ist er tot.«
»Und was ist mit dem Ring?«
»Das ist echt wie aus der Bibel. Man hat ihn im Bauch eines riesigen Salzwasserkrokodils gefunden.«
»Holla.« Ich hielt den Ehering ans Licht. Sie schnappte ihn mir aus der Hand und schob ihn sich zurück auf den Finger.
»Interessant genug?«
»Aber sicher. Wer hat dich beauftragt?«
»Jakes Frau. Sie hat die Schnauze voll von der Polizei in Queensland. Die Sache ist schon drei Wochen her, und sie sind kein Stückchen weiter. Keinen Millimeter. Niemand informiert sie über den Stand der Ermittlungen. Aber sie hat das nötige Kleingeld, um der Sache etwas nachzuhelfen.«
»Verstehe. Wo fangen wir an?«
»Nicht so stürmisch, junger Mann! Es gibt noch ein paar Regeln, über die wir uns im Vorfeld verständigen müssen.«
»Regeln?«
»Jepp.«
»Na gut, schieß los, Schwester.«
»Die erste Regel ist auch die Wichtigste: Du fasst mich nicht an. Niemals.«
»Komisch, das war mir irgendwie klar.«
Amandas Miene verhärtete sich. Granit mit Sommersprossen.
»Komm mir bloß nicht blöd. Niemand fasst mich an. Wenn ich dich betatsche, ist das was anderes, aber von mir lässt du die Finger. Und von meinen Sachen auch.« Sie zog die Zeitung zu sich heran.
»Okay.«
»Das Thema Kissing Point ist tabu.«
»Verstehe ich vollkommen. Dasselbe gilt für meinen Fall.«
»Was? Ach, nee! Komm schon, Ted.« Sie schnaubte verächtlich. »Sei doch realistisch. Natürlich will ich über Claire mit dir reden. Aus dem Grund bin ich heute überhaupt hergekommen.«