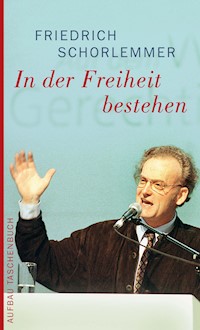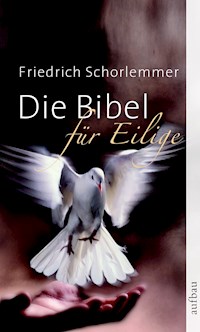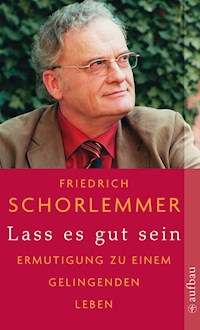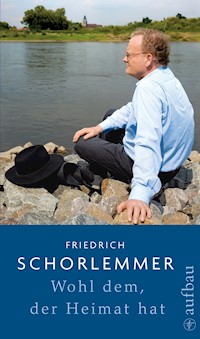9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kreuz Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Da wird auch dein Herz sein: Verstand und Herz, Gefühl und Aktivität gehören zum ganzen Menschsein dazu. Friedrich Schorlemmer zeigt, dass es sich lohnt, Stellung zu beziehen,er verlebendigt die christlichen Wurzeln und macht Lust auf das Mehr, das im Christentum liegt. Es geht um Identität und Regeln, die Frage nach dem guten Leben und der Hoffnung, auch um Schuld und Freiheit. Und letztlich auch um das Glück, das uns geschenkt ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 211
Ähnliche
Friedrich Schorlemmer
Da wird auch dein Herz sein
Engagiertes Christsein
© KREUZ VERLAG
in der Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2011
Alle Rechte vorbehalten
www.kreuz-verlag.de
Umschlaggestaltung: Christian Langohr
Umschlagmotiv: © dpa Picture-Alliance/Erwin Elsner
Datenkonvertierung eBook: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (E-Book) 978-3-451-33693-5
ISBN (Buch) 978-3-451-61026-4
Gott glauben
I.
Gott ist kein Aller-Welts-Wort. Wer dieses Wort ausspricht, muss wissen, was er tut: Er unternimmt es, das Unsagbare sagbar, das Unfassbare fassbar, das Unbegreifbare begrifflich greifbar zu machen.
Er unternimmt es, das, was über alle Dinge ist, mit allen Dingen zu verweben. Er nimmt ein in Jahrhunderten arg beschmutztes Wort wieder auf. Das bleibt ein Wagnis. Und er wird geblendet durch SEINE Erhabenheit: »Heilig, heilig, heilig!« singen die Seraphim geheimnisvoll, nicht rätselhaft, als Jesaja zum Propheten berufen wird. Und Jeremia erfährt das göttliche Wort, im Innersten erschüttert ein »fressend Feuer«. Jesus nennt ihn mit Ur-Vertrauen »Abba«. Wer Gott sagt, kann es zugleich nur tun – wie es Paulus widerfuhr – »mit Furcht und Zittern«, als ein dazu Ermächtigter, nicht als Eigen-Mächtiger, als ein um das rechte Wort Bittender, nicht als ein Selbst-Gewisser.
Es ist außerdem Vorsicht geboten – zumal nach allem Missbrauch in allen Zeiten und in allen Religionen! – ehe man neue Zuversicht gewinnt.
Das »Subjekt Gott« ist allenfalls erfassbar durch die Fülle seiner Prädikate, die uns die Heilige Schrift als ein vielgestaltiger Erfahrungsbericht mit Gott darbietet: Der Treue, der Liebende, der Barmherzige, der Gütige, der Gnädige. Der Anrufende und der Zurechtbringende, der Richtende und der Aufrichtende, der Zusprechende und der Ansprüche Stellende, der Ewige im Zeitlichen, der Vollkommene im Unvollkommenen, der Distanz Gebietende und der Nähe Versprechende, der Geber aller Gaben und unsere Begabungen Abfordernde ... Der Unbegreifliche und Dunkle (Deus absconditus) und der ganz Offenbare und Helle (Deus revelatus), der anthropomorph Erscheinende und der kosmisch Unnahbare, das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende.
Wohl dem, der aus den Tiefen seiner Seele ausrufen kann: »Oh Gott!« – »Vater unser« – »Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.« (Psalm 139)
»Das heißt ihn fassen, wenn das Herz ihn ergreift und an ihm hängt.« Denn wo dein Gott ist, da wird auch dein Herz sein; wo dein Herz ist – also worauf du dich ganz verlässt – da ist dein Gott. Selbsterdachte Wahn- und Traumbilder oder Macht, Geld, Ehre, Beliebtheit, Sicherheit vor der Welt machen aus Gott immer wieder einen Ab-Gott. Da verlässt man sich dann »aufs lautere Nichts.« (Martin Luther im Großen Katechismus 1529).
Das Wort GOTT wird somit zu einem ein Begegnungs-, Beziehungs- und Orientierungswort, zu einem Ausdruck grundlosen, über Abgründe hinweghelfenden Vertrauens.
Davon soll die Rede sein, in mehreren Anläufen: provozierend und protestantisch profilierend, Mut machend, Demut lernend, das ganz Große auch in die Niederungen des Konkreten eintragend.
II.
Wo Gott über allen Dingen steht, da lernen wir das Leben. Da sehen wir den anderen, da erfahren wir den Sinn, da können wir auf Macht verzichten.
Da fällt die Furcht ab. Da bekommt Autorität etwas Bergendes. Da wird die Welt entgöttert. Ein Gott, den wir weder haben noch machen können, wird zu dem Gott, in dem wir »leben, weben und sind«, statt all der Dinge, an die wir unser Herz hängen, an die wir uns binden, bis sie uns binden, umgarnen, umschlingen, verschlingen.
Denn Gott ist über allen Dingen. Wir sind nicht mehr versklavt an die Dinge, an die wir uns klammern und die mit uns vergehen.
»Es bleiben aber Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.« (1. Korinther 13)
Glauben heißt Vertrauen haben, einem Ruf folgen, einem Versprechen Glauben schenken. Nicht das Für-wahr-Halten kaum begreiflicher, wundersamer Tatsachen aus einer fernen, biblisch überlieferten Vergangenheit trifft das, was im christlichen Sinne Glauben heißt.
Glauben wächst aus lebendiger Vergegenwärtigung vergangener Erfahrung, verbunden mit eigenen Erfahrungen, bis der »garstige Graben der Geschichte« (Lessing) überwunden ist. Dazu bedarf es nicht zuletzt des kritischen Urteils, das Zeitbedingt-Relative vom Bleibend-Wichtigen und Bleibend-Gültigen zu unterscheiden. Kriterium ist das, was zu Christus passt. »Was Christum treibet«, das gilt, lehrte der bibelorientierte Luther. Dass Glauben Gottvertrauen ist, findet einen so sprachlich schönen wie religiös tiefgehenden Ausdruck in Psalm 23, im Vaterunser oder in einem Gospel (wie »God is so good to me«, gesungen von Mahalia Jackson) – unvergleichlich existentieller, verstehbarer und anrührender, als das im traditionellen Credo (dem sog. Apostolikum) zur Sprache kommen kann. Ich halte die liturgische Dauerzelebration dieses dogmengeschichtlichen Textes für eine unnötige und höchst fragwürdige Barriere für Menschen, die heute nach dem Gottesglauben fragen und im Gottesdienst diese Antwort erhalten.
Christlicher Glaube lässt sich kaum angemessen als verobjektivierte Tatsachen-Behauptung – fixiert in Dogmen – ausdrücken. Glaube ist eine Realisation, eine gelingende innerste Beziehung – der Liebe vergleichbar. So sollte es statt »Ich glaube an...« oder »Ich glaube, dass....« besser heißen: »Ich glaube ihm...« Glaube als (Grund-)Vertrauen verlangt den Dativ, nicht den Akkusativ!
In diesem Sinne versuche ich auszusprechen, was für mich Christus glauben bedeutet:
Nach allem, trotz allem glaube ich ihm,
Jesus aus Nazareth, Menschensohn, Bruder, Heiland.
Ich glaube dem Mann
mit der offenen Hand,
mit der offenen Wunde,
mit dem sanften Mut, auf Feinde zuzugehen,
dem Mann des Kreuzes, nicht der gekreuzten Klinge,
der Vergebung, nicht der Genugtuung.
Ich vertraue dem, der Kinder erhöht,
Grenzen missachtet
und den eisenbeschlagenen Himmel öffnet
mit der Unbestechlichkeit seiner Liebe.
Ich genieße dankbar
das Stück Brot und den Schluck Wein
und erfahre das Geheimnis des Glaubens.
Die Vögel unter dem Himmel
werden meine Lehrmeister.
Ich glaube dem Freund der Armen,
dem Helfer der Kranken,
dem Tröster der Verzagten.
Ich glaube der Kraft seines Geistes,
der dem Tode die Macht nimmt,
der Frieden schafft,
Vertrauen stärkt,
Hoffnung stiftet,
mitten unter uns.
Ja, ich glaube ihm.
Identität finden
Identität finden
»Jesus verkündete das Reich Gottes;aber es kam die Kirche.«Alfred Loisy
I.
Als hoffnungsvolle Herausforderung, gar als Verheißung galt noch vor etwa drei Jahrzehnten die Vorstellung, dass die Welt eine Welt würde. Zugleich galt und gilt die Eine Welt als große gemeinsame Aufgabe für die Menschheit, den wechselseitigen Abhängigkeiten und Bedrohungen mit einem neuen Denken und globaler Verantwortung für den Oikos zu begegnen (von Albert Einstein über Günther Anders und Fritjof Capra bis zum Club von Rom, zu Ivan Illich oder Michail Gorbatschow), von den Kirchen gebündelt ausgesprochen in den Abschlussdokumenten der »Ökumenischen Versammlungen für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung«.
1989/90 wurde zu einer zunächst glückhaft erfahrenen Zäsur: ein gewaltig-gewaltloser Aufbruch in die Demokratie im Ostblock, das friedliche Ende der Apartheid in Südafrika, die Beilegung von Bürgerkriegen in Angola, Kambodscha, Namibia.
Inzwischen sprechen wir fast nur noch von »Globalisierung«: Die ganze Welt ist nach dem Ende der Blockkonfrontation offen. Sie ist ein einziger großer Markt für Waren, Dienstleistungen und Kapital geworden. Die politisch, ökonomisch und kulturell zerrissene Menschheit steht vor völlig neuen Herausforderungen und existentiellen Gefährdungen.
Das religiös erschlaffte Europa trifft vehement auf historisch verwandte oder hierorts fremde Religionen mit deren ungebrochenen Gewissheiten, weil diese sich keinem Aufklärungsschub stellen mussten.
Die Suche nach europäischer und nach deutscher Identität kommt neu auf: Wer sind wir, woher kommen wir, was wollen wir? Bleiben im Westen Christentum, Antike und Aufklärung aneinander gekoppelt? Wo sind die blinden Flecken der Aufklärung? Und wie gehen wir Europäer mit der neuen Religiosität, wie gehen wir mit unserer so wunderbaren wie schreckenerregenden Christentumsgeschichte um?
Fortgesetzte konfessionelle »Kleinstaaterei« bei ohnehin abnehmender Akzeptanz des Christlichen überhaupt, verbunden mit geistiger Enge, lässt durchaus die Befürchtung zu, dass der Protestantismus sich aus der öffentlichen Wahrnehmung der Weltgesellschaft verabschiedet und gar als eine Fußnote der Geschichte bewertet werden wird.
Da die Traditionsvermittlung im Protestantismus gemeinhin mehr über Personen als über Institutionen samt deren ritueller Inszenierung verläuft, hat die evangelische Welt in einer von Massenmedien beherrschten Weltgesellschaft weit geringere Wirkungschancen als die katholische Weltkirche. Sich katholischem Gebaren anzugleichen, das wäre gewiss keine sinnvolle Reaktion, zumal protestantisches Kirchentum einen großen Schatz zu bewahren hat: Mitbestimmung mündig gemachter Einzelner, Unmittelbarkeit zu Gott, Konzentration auf die biblische Botschaft in ihrer Vielfalt, Freiheit der Entscheidung und Verantwortungsübernahme vor Ort. Die mit katholischen Christen – vor allem von der Basis her – gemeinsam erkannte Aufgabenstellung der Kirchen aus dem konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung ist nicht nur geblieben; sie hat sich verschärft. Und Ökumene verlangt heute nach gemeinsamem Zeugnis: angesichts weltweiter Verarmung mit neuen sozialen Konflikten, angesichts neuer Kriege und erneuter Aufrüstungsspiralen, angesichts der Flüchtlingsströme, der Umweltzerstörung, des Ressourcenverschleißes und der Klimakatastrophen sowie der globalen Verletzung elementarer Menschenrechte. Es bedarf dringend konzertierter Aktivitäten für ein einklagbares internationales Rechtsgefüge mit mehr wirtschaftlicher Gerechtigkeit für arme und armgemachte Länder. Das alles stellt unsere christliche Kirche vor besondere Herausforderungen. Dazu gehört eine partnerschaftliche ökumenische Selbstverständigung darüber, was heute zum gemeinsamen Auftrag der Kirche Jesu Christi in der einen Welt Gottes spirituell, sozial-ethisch und lebens-praktisch gehört, auch wenn es die Kirche weiterhin in verschiedenen Kirchen gibt. Das »Salz der Erde« und »Licht der Welt« zu sein, spricht Jesus den Seinen zu.
In diesem Zuspruch steckt ein einzulösender Anspruch: kritisches Element und motivierende Hoffnung in der Welt und für die Welt zu sein. Ökumene in der Einen Welt braucht einen Gleichklang, bei dem sich die geistigen und geistlichen Kräfte darauf richten, dass die friedensstiftende Funktion der christlichen Religion in einem respektvollen Umgang mit anderen Religionen und Kulturen zum Tragen kommen kann. Die politische Suche nach einem fairen globalen, rechtlich abgesicherten Interessenausgleich ist vor Ort und auf allen politischen Entscheidungsebenen zu unterstützen. Jedem erneuten Missbrauch der Religion zur Legitimation oder gar Anstachelung von Gewalt und Terror ist gemeinsam zu wehren.
Religionsfreiheit schließt gegenseitige Toleranz ein, die ihre Grenze an den Intoleranten findet. Provozierende Karikaturen gehören zur zu schützenden Meinungsfreiheit, das demonstrative Verbrennen heiliger Bücher anderer Religionen nicht.
Christliches Sendungsbewusstsein mit dem Anspruch von Überlegenheit oder gar einziger Wahrheit ist nicht nur unangemessen, sondern kontraproduktiv. Die Schnittmengen für das ethisch Gemeinsame der Völkergemeinschaft und für »gemeinsame Sicherheit« sind auszuloten. Dafür können christliche Kirchen als vorpolitische Kraft wichtige Vermittlungsdienste leisten, wie sie dies in der Ost-West-Konfrontation hatten tun können.
Nur aus geistlicher Substanz erwächst öffentliche Relevanz. Geistige Enge und dogmatische Abgrenzung mindern öffentliche Akzeptanz. Wenn die verschiedenen christlichen Kirchen unter sich eher das Trennende als das Gemeinsame suchen oder sich gar gegenseitig die volle Anerkennung verweigern, sich nicht einmal zur eucharistischen Gastfreundschaft bereit finden, werden sie nicht nur an Überzeugungskraft, sondern an innerer Legitimation einbüßen.
Ökumene wäre an ihr (erreichbares) Ziel gelangt, wenn sich unter allen Christen ein »WIR-Gefühl« entwickeln würde und wenn Christen trotz aller Unterschiede zueinander und anderen gegenüber sagen könnten: Wir Christen!
Danach erst käme zur Geltung, was wir als Katholiken, Orthodoxe oder Protestanten sind.
Das wäre gewiss kein Relativismus, sondern gegenseitige Anerkenntnis aus dem versöhnenden Geiste Jesu Christi.
Die Autorität, Substanz und Legitimation aller christlichen Kirchen bleibt – bei allen historisch gewachsenen Unterschieden – zentral an das Lebensgeschick und den Lebensweg, an Auftrag und Verheißung des Jesus Christus gebunden.
II.
Was als winzige Abspaltung vom Judentum, inspiriert von einem charismatischen Rabbi aus der Provinz Galiläa mit den zwölf von ihm berufenen Jüngern und einigen tapferen Frauen begann, wurde zu einer kontinuierlich anwachsenden, die Sprach- und Kulturgrenzen überschreitenden Volksbewegung von unten, die von den römischen Machthabern über zwei Jahrhunderte aufs Blutigste verfolgt wurde, bis es im Jahre 312 durch Kaiser Konstantin zur Erhebung des Christentums zur Staatsreligion kam – und dies weniger aus theologischen als vielmehr aus machtpolitischen Gründen. Das Christentum wurde zur Reichs-Religion, zum Bindeglied des römischen Imperiums in seiner Sterbephase.
Bald standen Westrom gegen Ostrom, der Patriarch von Konstantinopel gegen den Papst in Rom. Das Schisma reicht bis heute. Durchgängiges Konfliktthema der Christentumsgeschichte blieb das Verhältnis von Menschlichkeit und Göttlichkeit Jesu, von staatlicher und geistlicher Autorität, Kaisertum und Papsttum, von sozialer Gestalt und sozialer Utopie, von realem »Reich der Welt« und erhofftem »Reich Gottes«. Genau diese nicht aufgelöste Spannung macht das Geheimnis des Erfolges Europas ebenso aus, wie es die Religions- und Expansionskriege erklären hilft.
Aufgeklärtes politisches Handeln versöhnt die Macher mit den Träumern, die kühlen Pragmatiker mit den glühenden Visionären, die Freiheit des Einzelnen mit den Verpflichtungen für die Gemeinschaft, das Realisierbare mit dem Wünschbaren – stets die Mittel-Zweck-Relationen austarierend, nicht die Priorität des je Aktuell-Konkreten gegen das Überzeitliche ausspielend. Die lang erkämpfte rechtliche Trennung von geistlicher und weltlicher Macht, der wohlweisliche Abschied von der Staatsreligion kennzeichnet das »aufgeklärte Europa«. Das Gegenüber der beiden Mandate erwies sich als eine alles in allem produktive Partnerschaft – solange der Staat sich nicht selber absolut setzte oder gar vergötzte (im 20. Jahrhundert in der Gestalt von Faschismus oder Bolschewismus) und insofern die Kirchen sich nicht von den Errungenschaften der Aufklärung trennten und nicht wieder in dogmatisch-fundamentalistisch-totalitäre Fallen laufen. Leszek Kolakowski hat die schwer erkämpfte, aber doch durchgängige Fähigkeit zur Selbstkritik als das bestimmende europäische Kennzeichen, als das Erfolgsgeheimnis Europas ausgemacht. So gehören z. B. das Bebauen und das Bewahren, das Herrschen über die Welt und das Schützen der Welt ebenso zusammen wie die nötige Autorität eines rechtlich verankerten Gewaltmonopols des Staates mit der Freiheit und Gewissensbindung des Einzelnen miteinander korrespondieren. So haben beispielsweise die Widerständler des 20. Juli 1944 ihr – spätes – Wagnis des Tyrannenmordes auch ethisch genau bedacht. Die Kirchenasylgemeinden stellen sich aus Barmherzigkeit in konkreten Fällen gegen geltende Abschiebegesetze. Johannes Paul II. hat im Januar 2003 vor dem Diplomatischen Korps davon gesprochen, dass Krieg immer eine Niederlage der Menschheit darstellt und hat mit deutlichen Worten vor dem 2003 drohenden Irak-Krieg gewarnt – wie maßgebliche Vertreter anderer Kirchen auch.
Ohne Zweifel ist das Christentum die bestimmende Hintergrundskultur der Welt geworden, die man weiterhin auch das griechisch-jüdisch-christlich geprägte Abendland nennen mag. Das traditionelle Europa reicht exakt so weit, wie die lateinische Messe einst gereicht hat. Bei den aktuellen EU-Erweiterungsdebatten um Länder außerhalb dieses Raumes wird das noch heute politisch brisant, ob gegenüber christlich-orthodoxen oder gar muslimisch geprägten Ländern.
Christlicher Glaube als persönliches Bekenntnis und Christentum als politisch-kulturelle Größe bleiben unterschieden und sind zu unterscheiden. Die Substanz des Christlichen gibt es nur gebrochen in verschiedenen christlichen Konfessionen und Kirchen, belastet und erneuert im Auf und Ab einer zweitausendjährigen Geschichte. Kirchengeschichte hat schon Goethe als einen »Mischmasch aus Irrtum und Gewalt« nicht unzutreffend, aber auch nicht hinreichend charakterisiert.
In der aktuellen Begegnung der christlich geprägten Kultur mit anderen Kulturen, Religionen und Weltbildern kann nicht mehr die Frage im Vordergrund stehen, wie man anderen christliches Traditionsgut nahebringt, sondern vielmehr, wie die Bürgerinnen und Bürger selbst sich dieses Traditionsgut individuell und kollektiv bewusst wieder aneignen – oder sich in ebenso freier Entscheidung davon verabschieden. Kulturelle Prägungen bleiben dennoch!
Der Dreiklang von Wissen, Verstehen und Teilhaben ist für den Glauben konstitutiv. Unverzichtbar ist hinreichende Kenntnis dieser Überlieferung. Ihr Verstehen schließt die kritische Würdigung der Wirkungsgeschichte ein. Die Teilhabe erfordert eine persönliche Entscheidung. Sie bleibt unter dem Vorbehalt des möglichen Irrtums. So wird die Geschichte weitergeschrieben und entfaltet ihre zivilisierende Kraft in der Gemeinschaft.
Christentum meint eine kulturelle Größe mit einem religiös bestimmten Überlieferungscorpus in vielfältigen Ausdrucksformen. Die Heiligen Schriften des Alten und Neuen Testaments verbinden die christlichen Konfessionen. Christlicher Glaube wird noch immer unter dem Dach der altchristlichen Bekenntnisse artikuliert, die zum Teil mit kaiserlicher Macht durchgesetzt und klerikal konserviert wurden. Ihren Anspruch, Symbol einer weltumspannenden Einheit zu sein, können sie faktisch schon lange nicht mehr einlösen, weil sie einem längst überwundenen, geozentrischen und dreistöckigen Weltbild von Himmel, Erde und Hölle verhaftet sind. Auch wenn sie für das universale Zeichen der Taufe immer noch als konstitutiv angesehen werden, sind sie für immer weniger Menschen ein adäquater Ausdruck ihres Glaubens und ihrer Versuche zu wacher Zeitgenossenschaft.
Christlicher Glaube und Christentum standen und stehen sowohl in einem Entsprechungs- wie in einem Spannungsverhältnis. Europa wird sich nicht zusammenfinden, wenn es sich dabei nicht mehr über seine Herkünfte, Grundlagen und Erfahrungen verständigen könnte. Es darf nicht in Vergessenheit geraten, dass es zu den essentiellen Grundeinsichten der europäischen Kulturgeschichte gehört, dass die Freiheit zum Glauben die Freiheit vom Glauben einschließt, also jede Nötigung ausschließt.
Wesentliche Elemente des Christlichen sind in Lebenswelten eingewandert, ohne dass sie noch unmittelbar wiedererkannt werden. In dem Maße, wie sie zum Allgemeingut wurden, haben sie ihren provokativ-sperrigen wie ihren befreienden Charakter verloren. Das Kalenderjahr wird bei allen Europäern – jedenfalls äußerlich – vom christlichen Festkalender bestimmt – verbunden mit allerlei heidnischem Brauchtum. Die großen Feste wie Weihnachten und Ostern sind weithin privatisiert, kommerzialisiert und dienen zuförderst einer spezifischen Stimmungspflege.
Öffentliche Rituale sind auch die Vereidigungen von Regierungen. In ihnen spiegeln sich besondere Erwartungen der Regierten an die Verlässlichkeit und das Verantwortungsbewusstsein der Regierenden wider. Sie thematisieren die Vertrauensfrage. Da bricht nicht zufällig immer wieder der Streit darüber auf, ob Ministerinnen und Minister ihre Verpflichtung mit der Formel schließen sollten: »So wahr mir Gott helfe.« Hinter dieser Auseinandersetzung verbirgt sich die Frage nach Identität und Integrität mitsamt der Gründe für die Weigerung, das Ritual in der überkommenen Form zu vollziehen. Manche suggerieren, dass es denen, die darauf verzichten, an letzter innerer Verbindlichkeit für ihre Amtsführung mangele.
Die Debatte um den Gottesbezug in der Europäischen Verfassung verdeutlichte den unterschiedlichen Weg, den europäische Nationalstaaten bei der Trennung von Staat und Kirche gegangen sind. Nicht wenige glaubensferne Philosophen oder Politiker plädieren gegen die Stimmen, die eine klerikale Vereinnahmung befürchten, für die »Chiffre Gott«, nämlich als Grenzziehung und Schutz vor einer Vergötzung politischer und ökonomischer Macht sowie als Markierung für das Festhalten an prinzipieller Unverfügbarkeit unserer grundlegenden Wertsetzungen. Das lässt sich ganz im Sinne einer aufgeklärten Vernunft verstehen, wie sie Immanuel Kant uns aufgegeben hat.
In Deutschland stehen – angesichts neuer Rahmenbedingungen in der Europäischen Union, aber auch durch konfessionelle Durchmischung und religiöse Entleerung – öffentliche Rolle und der Status der Kirchen sowie deren Präsenz in karitativ-diakonischen Einrichtungen, in Institutionen der Bildung und Erziehung sowie der Seelsorge in Militär und Polizei zur Debatte. Zugleich wächst die Sensibilität dafür, wie Kirchengebäude das Gesicht des öffentlichen Raumes prägen und welche symbolträchtige Bedeutung sie für das kulturelle Gedächtnis der europäischen Gesellschaften besitzen.
Direkte und indirekte »Wertevermittlung« wird in Konfliktzuspitzungen von den Kirchen erwartet, z. B. nach rechtsradikalen Gewaltübergriffen, in bezug auf die Solidarität mit den Armen in der Welt wie vor Ort oder bei Fragen nach Kriegsrechtfertigungen bzw. nach einem gerechten Frieden.
Die frühe Kirche, solange sie noch frei von staatlicher Anerkennung war, stellte sich auf Grund der Taufe radikal der Frage, ob Christen überhaupt Soldaten sein können, ob sie jemals einen Eid gegenüber einem Staat oder einem Herrscher ableisten dürfen. Der Kirchenvater Tertullian konstatierte im 2. Jahrhundert: »Vor allem muss man ja fragen, ob Christen überhaupt Soldaten werden dürfen ... Dürfen wir einen Fahneneid, der Menschen gilt, leisten, nachdem wir den Fahneneid geschworen haben, der Gott gilt (also das Glaubensbekenntnis)? Dürfen wir uns noch einem anderen Herren angeloben, nachdem wir uns Christus angelobt haben? ... Dürfen wir mit dem Schwert umgehen, während doch der Herr gesagt hat: ›Wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen.‹ ... Wird er sich vom Feldherren die Losung geben lassen, während er doch schon von Gott die Losung erfahren hat?«
Die Debatte lohnt, was von dieser prinzipiellen Haltung nach 1800 Jahren noch Gültigkeit beanspruchen kann.
An Versuchen, den damit gegebenen Konflikt zu entschärfen, hat es nicht gefehlt. Protestanten in Uniform wie Generalfeldmarschall von Moltke urteilten:
»Der ewige Friede ist ein Traum und nicht einmal ein schöner, und der Krieg ein Glied in Gottes Weltordnung. In ihm entfalten sich die edelsten Tugenden des Menschen, Mut und Entsagung, Pflicht, Treue und Opferwilligkeit mit Einsetzung des Lebens. Ohne den Krieg würde die Welt im Materialismus versumpfen.«
Staatliche Macht und Machthaber blieben immer in Versuchung, sich das Christentum dienstbar zu machen. Als verhängnisvoll erwies sich seine Abdrängung in die Sphäre von Innerlichkeit und als Privatsache. Die revolutionären Impulse des Christusglaubens ließen sich auf Dauer nicht aus der Welt schaffen. In allen Reformbewegungen der christlichen Kirchen haben sich die Ideale von Frieden, Gerechtigkeit, Menschenwürde und Selbsthingabe, von grenzenüberschreitender Nächstenliebe immer wieder neu Raum geschaffen. In den Kirchen fanden sich stets Herbergen für erwärmende Utopien.
Sicher stand für den Preußen Moltke die Überzeugung Pate, dass nur außerordentliche Anstrengungen zu außerordentlichen Leistungen befähigen. Dazu gehören Kraftanstrengung, Disziplin und Opferwille. Freilich: Kein Gemeinwesen kann bestehen ohne sogenannte Sekundärtugenden. Aber ohne Rückbindung an Grundwerte sind sie manipulier- und missbrauchbar.
III.
Das Christentum kann man als die Kultur verstehen, in der wir gemeinsam leben, während der christliche Glaube eine Haltung ist, aus der heraus Christen leben. Die Kultur finden wir vor. Jeder kann sich darin persönlich einfinden oder davon distanzieren. Dass dies ohne Sanktionen möglich ist, gehört zu der vom Christentum geprägten Kultur- und Lerngeschichte Europas. Es darf nicht verschwiegen werden, dass aggressive Intoleranz historisch so lange nicht zurückliegt und dass es durchaus wieder einen christlichen Fundamentalismus gibt, der sich in seiner Intoleranz mit geistiger Enge kaum von solchen Erscheinungen in anderen Religionen überbieten lässt.
Außer in spezifischer Traditionspflege, deren äußere Symbole und Verhaltensweisen beinahe alltäglich sind, wird das Christentum auch immer wieder durch Personen repräsentiert, die den christlichen Glauben nicht nur miteinander geteilt, sondern auch in aller Öffentlichkeit einen von Christus getragenen und geprägten Lebensweg gesucht haben. Offensichtlich braucht jede Kultur, jede Partei, jede Religionsgemeinschaft oder sonstige Gruppierung Leitfiguren. Es seien hier unter den christlich geprägten einige Namen von Deutschen genannt, deren Lebensweg in besonderer Weise so mit dem Christlichen verbunden ist, dass die Öffentlichkeit diese Verbundenheit wahrnimmt: der Theologe und Arzt Albert Schweitzer, der Philosoph und Physiker Carl Friedrich von Weizsäcker, der Begründer der Bodelschwinghschen Anstalten Friedrich von Bodelschwingh, die Widerständler gegen den Nazismus Sophie und Hans Scholl, Max Josef Metzger, Reinhold Schneider und Romano Guardini, Dompropst Lichtenberg, Dietrich Bonhoeffer und Martin Niemöller, auch die Präsidenten Gustav Heinenmann, Richard von Weizsäcker und Johannes Rau, die Theologin Dorothee Sölle, ostdeutsche Träger der friedlichen Revolution wie Christian Führer und Christof Ziemer sowie die spätere Sozialministerin in Brandenburg Regine Hildebrandt.
Auch wenn sie sich selbst dort sehen würden, sind in dieser Reihe nicht zu nennen: der im Talar den Arm zum Hitler-Gruß hebende Reichsbischof Ludolf Müller 1933 in Wittenberg oder all die Theologen, die ihre Staatsmänner und deren Kriegsgerassel nicht nur begrüßt, sondern deren Kriege aus nationaler bzw. nationalistischer Perspektive theologisch gerechtfertigt haben, wie Adolf von Harnack 1914 oder Immanuel Hirsch 1939, orthodoxe Bischöfe auf dem Balkan bis heute oder wie der Suggestiv-Prediger Billy Graham.
Ein maßgeblicher lutherischer Theologe, Paul Althaus, schrieb 1915:
»Auch der Krieg, so sinnwidrig er uns erscheinen mag, bildet ein Glied in der Kette der Geschehnisse, durch welche Gott seine heiligen Liebeszwecke der Menschheit zur Durchführung bringt und sie der ewigen Vollendung entgegenführt.«
Es bedurfte schon einigen Mutes, nicht als vaterlandslose Gesellen und Verräter gescholten zu werden, dass fünf Berliner Pfarrer 1917 erklärten: »Wir fühlen angesichts dieses fürchterlichen Krieges die Gewissenspflicht, im Namen des Christentums fortan mit aller Entschiedenheit dahin zu streben, dass der Krieg als Mittel der Auseinandersetzung unter den Völkern aus der Welt verschwindet.«
Besonders verführerisch wurde es für Kirchen, die sich als Volkskirchen innerhalb ihrer Nationen verstanden. So konnte Otto Dibelius, der nach dem Zweiten Weltkrieg zwölf Jahre lang Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland gewesen war, bereits 1926 schreiben: »Niemand kann an der Tatsache vorbeigehen, dass nach Gottes Schöpferwillen alles gesunde Menschenleben, sobald es in das Stadium der Kultur eingetreten ist, auf dem Volkstum beruht. Der Mensch, der sich von seinem Volkstum löst, verliert die innere Sicherheit, die Harmonie seines Lebens. Internationalität, die das eigene Volksleben überspringt, ist immer sittlich haltlos, äußerlich, oberflächlich.«
Eine solche nationalreligiöse Orientierung sollte sich in Deutschland rächen; eine solche Haltung rächt sich in jedem Land, in dem Christen sich dem Völkischen oder Nationalen unterwerfen. In der Regierungserklärung vom 23. März 1933 hatte Hitler – seine wahren Absichten verschleiernd – erklärt: »Der Kampf gegen eine materialistische Weltauffassung und für die Herstellung einer wirklichen Volksgemeinschaft dient ebenso sehr den Interessen der deutschen Nation wie denen unseres christlichen Glaubens.« Wohlgemerkt: »unseres christlichen Glaubens« ruft der Verfasser von »Mein Kampf« aus. Ließen sich alle nur täuschen und können sie sich mit Arglosigkeit freisprechen?
Für »Deutsche Christen« deckten sich die Interessen der Nation mit denen des christlichen Glaubens. Nur ein Teil der evangelischen Kirchen wandte sich seit 1934 der Bekennenden Kirche zu, ohne dass es auch dort zu einer prinzipiellen und öffentlichen Ablehnung des von Hitler angezettelten Raubkrieges und zum offenen Widerspruch gegen die Deportation und Vernichtung der Juden Europas gekommen wäre. Der Riss ging immer mitten durch die Kirchen hindurch. Der Tag von Potsdam im März 1934 symbolisierte den Schulterschluss zwischen Nazis, Bürgerlichen, Militärs und Kirchen. Er wurde ein »schwarzer Tag« unserer Christentumsgeschichte, der evangelischen wie der katholischen.
Früh und sehr konsequent hatte sich als einer der ganz wenigen der 28jährige Privatdozent Dietrich Bonhoeffer geäußert. »Die Kirche Christi lebt zugleich in allen Völkern und doch jenseits aller Grenzen völkischer, politischer, sozialer, rassischer Art, und die Brüder dieser Kirchen sind durch das Gebot des einen Herrn Christus, auf das sie hören, unzertrennlicher verbunden als alle Bande der Geschichte, des Blutes, der Klassen und der Sprachen Menschen binden können.«
Diese in einer Morgenandacht im finnischen Fanö 1934 vorgetragenen Gedanken gehören zu den Schlüsseltexten, die nach 1945 die Versöhnungs- und Friedensarbeit inspirierten.
Bonhoeffer wandte sich gegen jede nationalistische, rassistische oder militaristische Vereinnahmung des Christentums und spitzt in dieser Rede – den großen Krieg vorausahnend – sein theologisches Konzept so zu: »Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit. Der Friede muss gewagt werden.«
Nur eine sich einig werdende, ökumenisch – also weltweit – agierende Kirche kann das Wort des Friedens wirksam über der »rasenden Welt ausrufen« und »ihren Söhnen im Namen Christi die Waffen aus der Hand nehmen« – so Bonhoeffer.
Der christliche Glaube wird durch seine Zeugen ganz unmittelbar politisch, sowohl durch die Glaubenshaltung jedes einzelnen als auch durch ein inneres Einswerden von Kirchen, die sich gemeinsam an das Zeugnis des Neuen Testaments gebunden wissen, ihre eigenen Wurzeln ernst nehmend.