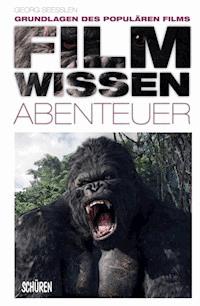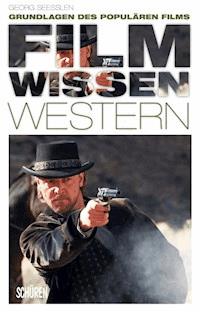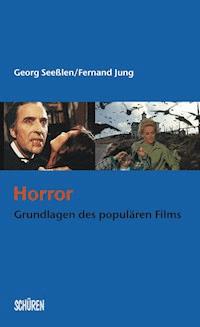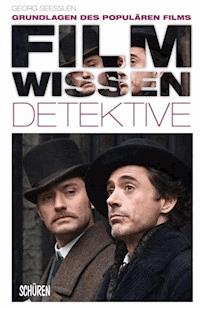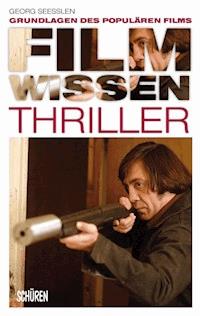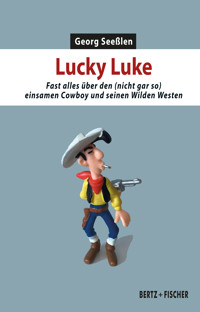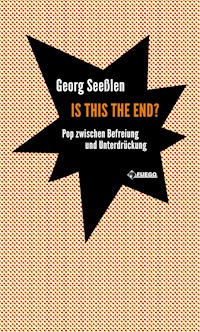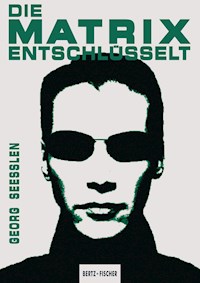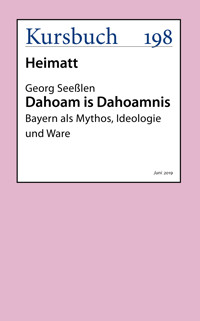
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kursbuch
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Georg Seeßlen entwirft in seinem Beitrag in Kursbuch 198 sieben Skizzen, in denen er der Fabrikation, also der künstlichen Produktion des Heimatkonzepts in Bayern nachspürt. Ob Politik, Volksmusik, Dirndl und Lederhose oder Volksfeste: Immer stellt Seeßlen ein karnevalisiertes Moment in der vermeintlichen Tradition fest und entlarvt Bayern in seiner sich selbst verstärkenden Gemachtheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 42
Ähnliche
Inhalt
Georg SeeßlenDahoam is DahoamnisBayern als Mythos, Ideologie und Ware
Der Autor
Impressum
Georg SeeßlenDahoam is DahoamnisBayern als Mythos, Ideologie und Ware
I
(Servus beinand.) Gewiss. Alles das, was die großen »Identitäten« schafft, das Volk, die Religion, die Geschichte, die Kultur, die Sitten und Gebräuche, die Traditionen und »Mentalitäten«, das ist zum größten Teil fiktional, in politischem und ökonomischem Interesse fabriziert, Teil symbolischer Ordnungen und Machtverhältnisse. Es hat so viele Wurzeln im Mythos wie in der Geschichte, ist zugleich Körper und Maschine, Original und Abbild, Propaganda und Überlebenskunst. Das Geflecht der fabrizierten Identitäten wird schließlich durch zwei Supermythen zusammengehalten, eine dunkle Yin-Yang-Situation: Nation (männlich-heroisch-maschinell) und Heimat (weiblich-idyllisch-organisch). Es ist allerdings zentriert um ein Tabu: Das Künstliche, das Fabrizierte, das Willkürliche, das Interesse und die Macht – das alles darf nicht ge- und benannt werden. Es soll gewachsen sein, was in Wahrheit fabriziert wurde. So steht den Aussagen »Keine Demokratie ohne Nation« und: »Keine Gesellschaft ohne Heimat« eine Antithese entgegen: »Die Nation ist niemals demokratisch« und: »Die Heimat ist nie sozial.« Es ist eben kompliziert.
Unglücklicherweise können über die Mythen der Identitäten nur Menschen nachdenken, die auf sie nicht mehr angewiesen sind. Nicht unbedingt die »Eliten«, die ohnehin in einer eigenen Welt leben, sondern am ehesten ein progressiver Teil der oberen Mittelschicht, der nur zu bewusst ist, wie wenig territoriales und historisches Herkommen wiegt im Verhältnis zur, nun ja, Klassenlage. Wer Nation und Heimat (von »Rasse«, Ethnie, Kultur oder Hautfarbe ganz zu schweigen) nicht mehr als bedeutende Indikatoren von Identität ansieht, hat entweder etwas verloren oder er oder sie haben sich von etwas befreit. Es kommt auf die Perspektive an. Oder auch auf die Biografie. Denn wird unterwegs etwas anderes verloren, die Gewissheit der Klassenzugehörigkeit etwa, die berufliche Perspektive, das verlässliche soziale Geflecht, dann kehrt, mal nostalgisch, mal neurotisch, mal auch durchaus »faschistisch«, die alte Mythologie zurück, um die Leerstellen zu besetzen. Richtig nachdenken über Heimat kann also nur, wer sie einerseits nicht mehr lebensnotwendig braucht, andererseits aber ein Bewusstsein von Verlust oder Überwindung entwickelt hat. Wie aber kann so jemand beurteilen, ja nur beobachten, was Nation oder Heimat für jemanden bedeutet, der sie dringend braucht? Die Ambiguität des Gegenstands überträgt sich auf die Beobachtung. Das darf man nicht vergessen.
(Jo, geh weida!) Für jede dieser Identitäten gibt es zwei grundsätzliche Erscheinungsformen (und vieles dazwischen): das Heilige und das Karnevalistische. Das eine ist ohne das andere beinahe nicht zu denken. Oder anders gesagt: Vor allem, zum Beispiel, dem das Karnevalistische zu fehlen scheint oder das nur in einer grotesk-sadistischen Form auftaucht, graut uns so sehr wie uns das, was ganz ohne Heiligkeit und Ernst daherkommt, zu wenig Bindung verspricht. Faschisierung lauert, erinnern wir uns an Adornos Beobachtungen, in dieser Dualität des Derben und des Heiligen, das nach Henri Lefebvre in allem »Populären« angelegt ist, aber zugleich ist es, solange alles gut geht, auch ein Aufheben und Aufschieben der Faschisierung. So mag man das Volksfest, und mehr noch seine mediale Inszenierung, zugleich als Antidot und Vorbereitung des Reichsparteitags empfinden. Den politischen Aschermittwoch als Antidot und Vorbereitung der Propagandarede. Den Lokalpatriotismus als Antidot und Aufhebung von Rassismus. Das Bad in der Menge als Antidot und Vorbereitung des Ornaments der Masse. Die Heimatlichkeit als Antidot und Latenz des Nationalismus. Und so weiter. Der Propaganda öffnet sich damit unter anderem das Instrumentarium einer Verheimatlichung der Nation und der Nationalisierung von Heimat. Und mehr noch: Machtpolitik realisiert sich unter bestimmten Bedingungen als Folklorisierung der Politik und Politisierung der Folklore. Bayern, zum Beispiel.
II
(San mia eppa mia?) Was Bayern anbelangt, scheint uns indes alles noch um einen erheblichen Anteil mehr nicht verschämt, kommerzpolitisiert und ohne Scheu vor Korruption und Bigotterie als anderswo. Identifikation und Ausverkauf sind dort sehr nahe beieinander. Heimat wird hier so unter Überdruck produziert, dass es oft unheimlich und »peinlich« wird. So entsteht der Mythos im Mythos, nämlich der vom »Echten« (der echten »Volksreligion« gegen die Bigotterie, der echten Volksmusik gegen die volkstümliche Industriemusik, der echten Trachten gegen die Pop-Dirndl und Lederhosen mit Smartphone- statt Hirschfänger-Taschen, des echten bayerischen Dialekts gegen das literarische und mediale Kunstbayerisch usw.), das man leicht vom Nachgemachten, Pop-Industriellen und Touristischen unterscheiden würde können. So als könnte man einen kulturellen Rohstoff rekonstruieren, aus dem die Fabrikation erst das erzeugte, was einem leicht unerträglich wird (und legitimiert nur als lukratives Maskenspiel »für die Fremden«). Das, was schon immer da war, oder jedenfalls lange bevor es eben diese Begriffe gab: Heimat und Nation. Und ihren Widerspruch. Weil dem aber jeder genauere Blick in die Geschichte widerspräche, der belegen könnte, dass »Heimat« keine Verwurzelung bedeutet, die über Besitz und Abhängigkeit hinausginge, sondern im Gegenteil kulturelles Instrument der Modernisierung, so wird auch dieser Blick getrübt. Populäre Geschichtsschreibung in Bayern wird ihrerseits ins Pathetische und ins Folklore-Karnevalistische hinein organisiert; kein Wunder also, dass der bayerische Staat kein Interesse an einer fundamentalen Historie hat, wie sich etwa im Jahr 2016 zeigte, als eine Neufassung von Max Spindlers grundlegendem Handbuch der bayerischen Geschichte