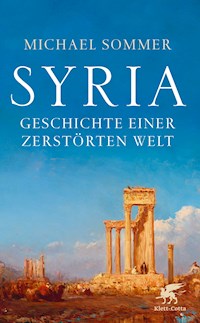Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Willkommen auf der dunklen Seite der römischen Geschichte! Hier erwartet Sie eine mal schrille, mal bedrohliche und immer wieder verstörend vertraute Lebenswelt. Es ist eine Welt des Drogenkonsums, perfider Mordanschläge, obskurer Kulte, mysteriöser Staatsaffären, brutaler Bandenkämpfe und bizarrer Obsessionen. In dieser Szene finden Sie keine sittenstrengen Senatoren und Matronen, sondern treffen auf skrupellose Politiker, in allen Künsten bewanderte Prostituierte, nervenstarke Geheimagenten, geniale Waffenkonstrukteure und kaltblütige Giftmischerinnen. Willkommen in – Dark Rome ! War Mark Aurel drogensüchtig? Angeblich konsumierte der Philosophenkaiser Opium. Hat Archimedes, der geniale Baumeister aus Syrakus, tatsächlich eine Superwaffe konstruiert? Und tagte gar eine Geheimloge in der unterirdischen Basilika, die Archäologen in Roms Unterwelt entdeckt haben? Diese und viele weitere Rätsel erwarten die Leserinnen und Leser von Dark Rome – einer ebenso wilden wie faktenreich und spannend erzählten Sittengeschichte der römischen Welt. So stößt, wer in den Abgründen des römischen Imperiums schürft, gelegentlich auf Bleitäfelchen: Am richtigen Ort vergraben und mit der richtigen Fluchformel versehen, konnte man mit schwarzer Magie versuchen, unliebsame Zeitgenossen in den Orkus zu schicken. Eilige wählten für solche Anlässe lieber ein Pilzgericht wie beispielsweise Agrippina, die Gattin des Kaisers Claudius, die ihren Gemahl mit seiner Lieblingsspeise zu einem Gott machte (böse Zungen behaupten, er habe es im Jenseits nur zu einer Karriere als Kürbis gebracht ...). In den Dunkelzonen des römischen Reiches begegnet man auch Politikern wie den Statthaltern Albinus und Florus in Ägypten, welche die Provinzbevölkerung nach Strich und Faden ausplünderten. Doch die beiden waren Waisenknaben im Vergleich mit dem notorischen Halsabschneider und Proprätor Verres, der Sizilien zu seiner Pfründe machte und dabei über Leichen ging. Was Mord aus politischen Motiven betrifft, so könnten selbst Despoten unserer Tage noch von den alten Römern lernen. Diese setzten bei Bedarf ihre Gegner – wie es etwa Sulla, Octavian und Marcus Antonius taten – einfach auf sogenannte Proskriptionslisten, so dass jeder die Vogelfreien straffrei töten und sich an ihrem Vermögen gütlich tun konnte. Kurzum: Dark Rome erweist sich auf unterschiedlichen Ebenen als Quelle der Erkenntnis, wobei es den Leserinnen und Lesern überlassen bleiben soll, die Kapitel über Geheimschriften, Spione, Falschspieler, dunkle Kulte und die Freuden der Venus aufzublättern...
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:9 Std. 17 min
Sprecher:Ähnliche
Michael Sommer
DARK ROME
Das geheime Leben der Römer
C.H.Beck
Zum Buch
War Mark Aurel drogensüchtig? Angeblich konsumierte der Philosophenkaiser Opium. Hat Archimedes, der geniale Baumeister aus Syrakus, tatsächlich eine Superwaffe konstruiert? Und tagte gar eine Geheimloge in der unterirdischen Basilika, die Archäologen in Roms Unterwelt entdeckt haben? Diese und viele weitere Rätsel erwarten die Leserinnen und Leser von Dark Rome – einer ebenso wilden wie faktenreich und spannend erzählten Sittengeschichte der römischen Welt. So stößt, wer in den Abgründen des römischen Imperiums schürft, gelegentlich auf Bleitäfelchen: Am richtigen Ort vergraben und mit der richtigen Fluchformel versehen, konnte man mit schwarzer Magie versuchen, unliebsame Zeitgenossen in den Orkus zu schicken. Eilige wählten für solche Anlässe lieber ein Pilzgericht wie beispielsweise Agrippina, die Gattin des Kaisers Claudius, die ihren Gemahl mit seiner Lieblingsspeise zu einem Gott machte (böse Zungen behaupten, er habe es im Jenseits nur zu einer Karriere als Kürbis gebracht …). In den Dunkelzonen des römischen Reiches begegnet man auch Politikern wie den Statthaltern Albinus und Florus in Ägypten, welche die Provinzbevölkerung nach Strich und Faden ausplünderten. Doch die beiden waren Waisenknaben im Vergleich mit dem notorischen Halsabschneider und Proprätor Verres, der Sizilien zu seiner Pfründe machte und dabei über Leichen ging. Was Mord aus politischen Motiven betrifft, so könnten selbst Despoten unserer Tage noch von den alten Römern lernen. Diese setzten bei Bedarf ihre Gegner – wie es etwa Sulla, Octavian und Marcus Antonius taten – einfach auf sogenannte Proskriptionslisten, so dass jeder die Vogelfreien straffrei töten und sich an ihrem Vermögen gütlich tun konnte.
Kurzum: Dark Rome erweist sich auf unterschiedlichen Ebenen als Quelle der Erkenntnis, wobei es den Leserinnen und Lesern überlassen bleiben soll, die Kapitel über Geheimschriften, Spione, Falschspieler, dunkle Kulte und die Freuden der Venus aufzublättern …
Über den Autor
Michael Sommer ist Professor für Alte Geschichte an der Universität Oldenburg. Er forscht zur Sozial- und Mentalitätsgeschichte des römischen Kaiserreichs und epochenübergreifend zur Geschichte der Levante. Bei C.H.Beck sind von ihm lieferbar: Wirtschaftsgeschichte der Antike (2013), Die Phönizier. Geschichte und Kultur (2008) und Schwarze Tage. Roms Kriege gegen Karthago (2022).
Inhalt
Mysterium Das nächste Fremde
I: Secretum – Von verschlossenen Türen und geheimen Orten
Es war kein Nachttopf da
Domus
Drängte die Riegel der Pforte
In den Eingangsschlünden des Orkus
II: Bettgeschichten – Von Kaisern und Kurtisanen
Eheliche Pflichten
Tausend Spiele kennt Venus
Kopfüber in die Wollust
Probos mores docili iuventae
Ich wäre lieber Phoebes Vater gewesen
Hochachtung und Treue
Frische Zeichen der Lust
Thymele hat einen fetten Arsch
Schön wie Dionysos
III: Nachrichten aus dem Dunkel – Von Geheimschriften und verbotenen Büchern
Geheime Geschichten
So ist er geteilten Herzens
Auf endloser Fahrt
Bücher auf dem Index
Enigma
IV: Im Dienste seiner Majestät – Von Spionen und Wunderwaffen
Punische Treue
Das Imperium schlägt zurück
Cursus Publicus
Augen und Ohren
Pestilens genus
Maschinen des Briareus
V: Verbotene Substanzen – Von Giftmischerinnen und Drogendealern
Paranoia
In Qualen sterben
Vestigia veneni
Lebe, als wärst du auf einem Berg
Dealer und Quacksalber
VI: «Priscilla soll zugrunde gehen» – Von schwarzer Magie und seltsamen Verwandlungen
Ich binde dich
Nicht aussagen noch plaudern
Ihr müsst sie der Gerechtigkeit zuführen
Mendacium et fabula
Apuleius ist ein Zauberer
Eine durchtriebene Meisterin der schwarzen Künste
Metamorphosen
Dieser Mann, ihr Senatoren
VII: Verschwiegene Gesellen – Von Verschwörungen und Geheimlogen
Welch ein Künstler
Dem erschöpften Staat aufhelfen
Wacht also auf!
Quousque tandem, Catilina?
Iden des März
Pythagoricus et magus
Keinen Menschen als Herrn
VIII: Angebote, die man nicht ablehnen kann – Von Korruption und organisiertem Verbrechen
Keine Schlechtigkeit, die er nicht begangen hätte
Gequält und unterdrückt
Die Macht des Geldes
Inter arma enim silent leges
Nika
IX: Schuld und Sühne – Von Falschspielern und Meuchelmördern
Tatort Palatin
Nicht mehr als 30 Jahre konnte ich leben
Was wollt ihr mehr?
Etwas Schmerz verkosten
X: Kulte im Verborgenen – Von Mysterien und geheimen Riten
Mit Zittern und Zagen
Keiner darf je sie verletzen
Werkstatt des Verderbens
Der, der alles zeugt
Wie eine Flut
Epilog
Anhang
Anmerkungen
I. Secretum Von verschlossenen Türen und geheimen Orten
II. Bettgeschichten Von Kaisern und Kurtisanen
III. Nachrichten aus dem Dunkel Von Geheimschriften und verbotenen Büchern
IV. Im Dienste seiner Majestät Von Spionen und Wunderwaffen
V. Verbotene Substanzen Von Giftmischerinnen und Drogendealern
VI. «Priscilla soll zugrunde gehen» Von schwarzer Magie und seltsamen Verwandlungen
VII. Verschwiegene GesellenVon Verschwörungen und Geheimlogen
VIII. Angebote, die man nicht ablehnen kann Von Korruption und organisiertem Verbrechen
IX. Schuld und Sühne Von Falschspielern und Meuchelmördern
X. Kulte im Verborgenen Von Mysterien und geheimen Riten
Zeittafel
Bibliographie
Zur Einführung
I. Secretum Von verschlossenen Türen und geheimen Orten
II. Bettgeschichten Von Kaisern und Kurtisanen
III. Nachrichten aus dem Dunkel Von Geheimschriften und verbotenen Büchern
IV. Im Dienste seiner Majestät Von Spionen und Wunderwaffen
V. Verbotene Substanzen Von Giftmischerinnen und Drogendealern
VI. «Priscilla soll zugrunde gehen» Von schwarzer Magie und seltsamen Verwandlungen
VII. Verschwiegene Gesellen Von Verschwörungen und Geheimlogen
VIII. Angebote, die man nicht ablehnen kann Von Korruption und organisiertem Verbrechen
IX. Schuld und Sühne Von Falschspielern und Meuchelmördern
X. Kulte im Verborgenen Von Mysterien und geheimen Riten
Epilog
Bildnachweis
Register
Mysterium Das nächste Fremde
Einer der sieben Hügel Roms ist der Aventin. Was in der Antike eine Armeleutegegend war, ist heute ein elegantes Wohnviertel. Prächtige Villen säumen ruhige Straßen. Die letzte Hausnummer an der Via Santa Sabina hat eine Kirche: Santa Maria del Priorato. Das klassizistische Gotteshaus, das noch Spuren des Rokoko ahnen lässt, ist weltweit das einzige Bauwerk, das nach Plänen Giovanni Battista Piranesis errichtet worden ist. Der Architekt und Kupferstecher, der sein Leben der klassischen Architektur seiner Wahlheimat Rom widmete, liegt dort auch begraben.
Die Kirche hat ihren Namen vom Priorat des souveränen Malteserordens, das sich gleich nebenan befindet. Der katholische Ritterorden, ein Relikt der Kreuzfahrerzeit, verwaltet von dem großen Komplex auf dem Aventin seine umfangreichen Liegenschaften in aller Welt. Eine Touristenattraktion ist weder Piranesis Kirche noch das Priorat, obwohl beide es durchaus verdient hätten, sondern das Tor, hinter dem das Grundstück des Priorats liegt, genauer gesagt: das Schlüsselloch. Durch den Buco della Serratura dell’Ordine di Malta, auch «Heiliges Schlüsselloch» genannt, kann man nicht etwa einen Blick auf das Grundstück der Malteser erhaschen. Auch vom möglicherweise verbotenen Tun der Ordensritter wird niemand etwas mitbekommen, der sich in die Schlange der Neugierigen einreiht. Nein: Das Schlüsselloch gibt den vielleicht schönsten Blick auf die Kuppel von St. Peter frei, die von dort immerhin anderthalb Kilometer Luftlinie entfernt liegt. Das Allerheiligste der katholischen Christenheit scheint direkt am Ende eines sorgsam gestutzten Laubengangs aus Lorbeerbäumen aufzuragen.
Buco della Serratura dell’Ordine di Malta: Wer durch das Heilige Schlüsselloch schaut, hat den Vatikan fest im Blick.
Durch Schlüssellöcher spioniert man nicht, so wie man auch nicht an Türen lauscht. Das lernt man schon als Kind. Trotzdem ist genau das der Zweck dieses Buches: einen Blick durch die Schlüssellöcher des alten Rom tun, um zu sehen, was dahintersteckt und vorgeht. Es sind die verbotenen Welten hinter den Portalen und Mauern, im Untergrund, im Geheimen, wofür die folgenden zehn Kapitel Begeisterung wecken wollen: jenes Rom also, das nicht gesehen und gehört werden wollte, das aber Spuren hinterlassen hat und das wir mit den Methoden der modernen Wissenschaft dem Dunkel entreißen können.
Die Reise durch das geheime Rom beginnt an der Schnittstelle zwischen privat und öffentlich, dort also, wo das jedermann Zugängliche aufhört und das anfängt, was den Blicken der Allgemeinheit verborgen ist (Kapitel I). Griechen und Römer waren überhaupt die Ersten, die diese Grenze sauber gezogen haben und damit, wenn nicht die Erfinder des Geheimen, so doch des Gegenteils: einer Öffentlichkeit, die allem, was sich im Verborgenen abspielt, mit einer gehörigen Portion Skepsis begegnet. Was das betrifft, waren die Römer noch um einiges konsequenter als die Griechen. Das zeigt sich daran, wie rabiat die Republik gegen die Mysterienkulte vorging, einen Import aus Griechenland, der sich seit dem 2. Jahrhundert v. Chr. wachsender Beliebtheit am Tiber erfreute, aber sofort den Argwohn der Behörden weckte (Kapitel X). Es zeigt sich auch an der Flut von Gesetzen, mit denen man Verbrechen Herr zu werden suchte, die im Geheimen geplant wurden (Kapitel IX).
Bei näherer Betrachtung erweist sich, dass die Grenze zwischen privat und öffentlich ebenso wie die zwischen heimlich und offensichtlich in Rom anders gezogen wurde als in der Moderne, und zwar zum Teil auf uns befremdende Weise. In Deutschland ist es selbstverständlich, ja es gilt geradezu als Eckpfeiler der Demokratie, dass der Bundestag und alle anderen Parlamente öffentlich tagen. In der römischen Republik war der Senat, wo Entscheidungen fielen, die für alle Bürger richtungweisend waren, ein unter striktem Ausschluss des Publikums beratender Herrenclub. Während der Senat also im Geheimen tagte, fanden die Römer – und Römerinnen – nichts dabei, Toilettensitzungen vor aller Augen abzuhalten, in trauter Runde in den öffentlichen Latrinen.
Aus unserer Sicht unverständlich mutet auch an, dass Menschen, die das Opfer von Straftaten wurden, auf eigene Faust ermitteln und so das Verborgene ans Licht der Öffentlichkeit zerren mussten. Eine Staatsanwaltschaft, die das heute für uns erledigt, gab es nämlich nicht, und dass Beamte in schweren Kriminalfällen Ermittlungen anstellen durften, hielt erst peu à peu Einzug in die römische Rechtspraxis. Vieles, was heute der Staat erledigt, war in antiken Gesellschaften Privatangelegenheit. Umgekehrt unternahm aber im römischen Imperium der Staat, vertreten durch das Militär, immer wieder den Versuch, die Produktion von Rüstungsgütern – heute fast überall Sache der Privatwirtschaft – zu einem staatlichen Monopol zu machen (Kapitel IV).
Geradezu verwirrend sind die Grenzverläufe beim Thema Sexualität (Kapitel II). Wer heute durch Pompeji spaziert, die luxuriöse Villa von Oplontis auf sich wirken lässt oder einen Rundgang durch das Nationalmuseum in Neapel unternimmt, stolpert förmlich über aufreizend offenherzige Bilder, die Paare in allen möglichen und unmöglichen Stellungen beim Sex zeigen. Die römischen Dichter Catull und Ovid waren ebenso Meister des Schlüpfrigen wie die zahl- und namenlosen Graffitischreiber der Vesuvstädte. Zugleich aber verdunkelten die Römer schamhaft ihr Schlafzimmer, wenn Mann und Frau sich der schönsten Nebensache der Welt zuwandten. Römische Eheleute, der Oberschicht zumal, breiteten den Mantel des Schweigens über ihr Liebesleben, junge Mädchen waren sexuell völlig unerfahren, wenn sie mit vierzehn den Bund fürs Leben schlossen.
Nicht anders als moderne Gesellschaften litten die Römer unter Kriminalität, für die sich unter dem Deckmantel des Heimlichen Handlungsräume eröffneten (Kapitel V und IX). Giftmischer, Serienmörder, Betrüger, Brandstifter, Geldfälscher, Falschmünzer, Erpresser, Räuberbanden – sie alle trieben ihr Unwesen im Untergrund. Die Gesellschaft reagierte, indem sie das Gesetz gegen das Recht des Stärkeren setzte, doch war der Staat, in dessen Händen heute das Gewaltmonopol und damit die Durchsetzung von Recht und Gesetz liegt, sozusagen auf Lücke gebaut, wenn es auch in der Kaiserzeit und besonders in der Spätantike die Tendenz dazu gab, dass staatliches Handeln in immer mehr Bereiche vordrang. Sicherheitsorgane, vor allem eine Polizei, fehlten fast ganz, und das Militär, das auch für die innere Sicherheit zuständig war, war in der Fläche mit dieser Aufgabe überfordert – ganz abgesehen davon, dass es nicht selten Soldaten waren, die Zivilisten auch mit krimineller Energie drangsalierten.
Dass es dennoch nicht drunter und drüber ging, lag daran, dass in der römischen Gesellschaft Bindekräfte am Wirken waren, die in vielen Bereichen das Fehlen eines staatlichen Gewaltmonopols aufwogen. Familie, Patronage und Klientelwesen, die Großzügigkeit von privaten Wohltätern, die Lebensmittel und Kleider an die breiten Massen verteilten und Großveranstaltungen wie Gladiatorenspiele ausrichteten, schließlich die christliche Kirche und ihre Organisation gaben Halt und füllten das Vakuum, das an der Stelle klaffte, wo sich in der Moderne der Staat um alles Mögliche kümmert: Sicherheit, Daseinsvorsorge, Infrastruktur. Noch heute gibt es das in Staaten, die schwach sind oder mit konkurrierenden Ordnungssystemen wie Stämmen und Clans ringen, in Zentral- und Vorderasien, in Afrika, auf dem Balkan und selbst in Süditalien, wo Großfamilien dort Sicherheit geben, wo der Staat versagt. Mafiös muten tatsächlich auch viele Strukturen der römischen Gesellschaft an, nur dass sie eben nicht mit dem Gewaltmonopol des Staates konkurrierten – wie die organisierte Kriminalität heute –, sondern stattdessen seine Stelle dort einnahmen, wo er keine Aufgaben für sich sah (Kapitel VIII).
Trotzdem war der Staat auch im antiken Rom hinreichend stark, dass er sich gegen Versuche zur Wehr setzte, ihn durch Korruption zu unterwandern. Schon die Republik schuf sich gesetzliche Waffen gegen Amtsmissbrauch von Magistraten, vor allem da, wo sie ihre Macht in den Provinzen schamlos nutzten, um sich zu bereichern. Der römischen Führungsschicht glückte es in der von Catilina ausgelösten Krise, die Republik gegen den Versuch eines Einzelnen zu schützen, die Macht gewaltsam an sich zu reißen. 63 v. Chr. verteidigte Cicero fast im Alleingang die Republik gegen die klandestine Verschwörung eines irrlichternden Aristokraten. 44 v. Chr. versuchten irrlichternde Aristokraten in einer klandestinen Verschwörung, die Republik den Klauen des De-facto-Monarchen Caesar wieder zu entwinden. Nichts illustriert besser die politischen Verwerfungen als die Ironie, dass die Verteidiger der Republik knapp 20 Jahre nach Ciceros Sieg über Catilina selbst in den Untergrund abtauchen mussten (Kapitel VII).
Die sich häufenden politischen Verschwörungen am Ende der Republik und in der römischen Kaiserzeit sind geradezu eine Signatur der Epoche. Sie sind Symptom des Kontrollverlusts, den die senatorische Elite im Lauf weniger Jahrzehnte durchlitt. Aus den Herren der Republik, die ihre Politik Fürsten und ganzen Völkern diktiert hatten, waren seit den Tagen des Augustus bloße Statisten geworden, aus deren Reihen die Kaiser ihr höheres Verwaltungspersonal rekrutierten. Und in der Umgebung von Herrschern wie Caligula oder Domitian zu leben, konnte lebensgefährlich sein. Ehe man es sich versah, landete man auf einer Todesliste oder erhielt von einem freundlichen Zenturio den Befehl zugestellt, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Um Kontrolle zurückzuerlangen, griffen die Opfer zum einzigen Mittel, das ihnen geblieben war: Sie verschworen sich im Geheimen, schmiedeten Mordpläne und brauten Gifttränke, um den Tyrannen ins Jenseits zu befördern. Oft gelang das, doch manchmal flogen die Verschwörer auch auf.
Kontrollverlust erlebten aber nicht nur die hohen Herren im Senat, sondern immer wieder auch die ganz einfachen Leute. In einer Wirklichkeit ohne wissenschaftliches Weltbild und ohne fürsorglichen Staat wussten sie sich oft nicht anders zu helfen als dadurch, dass sie ihre Zuflucht zu höheren Mächten suchten. Weil die Götter meist weit weg und unerreichbar schienen, waren die Ansprechpartner nicht selten Wesen wie Dämonen oder Totengeister, das Mittel der Wahl magische Praktiken: man schrieb Fluchtäfelchen, sagte Zaubersprüche auf oder braute magische Tränke (Kapitel VI). Erlösung und damit ein gewisses Maß an Kontrolle verhießen aber auch die Mysterienreligionen, deren Anhänger einen Initiationsritus durchlaufen mussten, um den Status von Eingeweihten zu erlangen (Kapitel X). Was hinter den Mauern von Heiligtümern wie dem Demetertempel von Eleusis vorging, blieb der Allgemeinheit verborgen. Die antike Religion hatte damit die Grenze zur Gemeinschaftsbildung überschritten, ein Weg, den das Christentum, zeitweise aus der Illegalität heraus, konsequent weiterbeschritt.
Ein arkaner Bereich, ein Mysterium, ist heute der Teil der Weltgeschichte, der einmal das «klassische Altertum» genannt wurde. Die Antike, ihre Geschichte und Kultur sind aus den Lehrplänen weitgehend verdrängt worden, und wer auf der Schule nicht eine der alten Sprachen lernt, hat kaum noch die Chance, mit der Welt von Griechen und Römern mehr als nur oberflächlich in Berührung zu kommen. Das ist schade, denn mit dem antiken Mittelmeerraum gerät nicht nur eine in vielerlei Hinsicht einzigartige Doppelzivilisation aus dem Blickfeld, die jahrhundertelang der Referenzpunkt schlechthin für Denken und Wahrnehmung der Gebildeten war, sondern auch der historisch und kulturell kleinste Nenner, auf den sich ein sonst in jeder Hinsicht vielfältiges Europa vermutlich bis heute noch verständigen kann.
Der Klassische Philologe Uvo Hölscher hat die Antike in einem berühmt gewordenen Wort als das «nächste Fremde» bezeichnet: Fremd, weil sich eben die Wirklichkeit, in der Griechen und Römer lebten, fundamental von unserer heutigen Welt unterscheidet, aber doch eben auch relativ nah, weil sie, anders als die Vergangenheit Indiens, Chinas, Persiens oder gar Altamerikas oder des subsaharischen Afrika mit unserer Gegenwart durch eine zweitausendjährige intensive Rezeptionsgeschichte verbunden und außerdem durch das Erlernen zweier uns nicht sehr ferner Sprachen recht leicht zu erschließen ist.
Dass erst aus dem Wissen um dieses nächste Fremde vieles von unserer eigenen Wirklichkeit verständlich wird, hat vor gut 50 Jahren der Althistoriker Christian Meier in einem «Was soll uns heute noch die Alte Geschichte?» betitelten Aufsatz herausgearbeitet. In der Antike begegneten wir uns selbst überall in einer «anderen Möglichkeit», will sagen: Über das Bekannte stolpern wir in Griechenland und Rom immer wieder in variierten, teilweise embryonalen, teilweise auch völlig verfremdet scheinenden Formen. Ohne die Möglichkeit, diesen fundamental anderen, aber eben mit unserer Wirklichkeit noch eng verflochtenen Standpunkt einnehmen und die Moderne gewissermaßen aus der Distanz betrachten zu können, hätten wir keine Möglichkeit wahrzunehmen, was das Besondere an unserer eigenen Epoche ist. Meier formuliert es so: Wer nur die Neuzeit kenne, der stehe «auf einem Bein in der Geschichte».
Meiers Frage nach dem Sinn der Antike in der heutigen Zeit stellt sich immer wieder. Damals war es der Geist von 1968, der nicht nur den Muff von 1000 Jahren auskehren, sondern auch mit vermeintlich überkommenen Bildungsidealen aufräumen wollte. Heute gibt es keinen klassischen Kanon mehr, der gegen ökonomistisches Nützlichkeitsdenken von rechts und gegen den das gesamte geschichtliche Erbe Europas unter Rassismusverdacht stellenden identitätspolitischen Furor von links zu verteidigen wäre. Ein Klassizismus, der die Antike auf Lehr- und Spielplänen verankern will, weil sie vorbildhaft für unsere Gegenwart wäre, ist heute auch kaum noch zu vermitteln. Aber Meiers Kernaussage, dass die Gegenwart nicht versteht, wer sie nicht vom anderen Ende des historischen Kontinuums her denken kann, hat nichts von ihrer Aktualität verloren. Die griechisch-römische Antike ist ein Laboratorium, wo mit dem historisch Möglichen auf sensationell kreative Weise herumexperimentiert worden ist.
Die folgenden Kapitel möchten einiges von dieser Experimentierfreude an moderne Leser weitergeben. Das Schlüsselloch soll den Blick freigeben auf die geheimnisvollen, untergründigen, verborgenen Seiten der Antike. Wie das in der Lochkamera gebündelte Licht eine Projektion auf die Mattscheibe wirft, so entsteht durch die Schlüssellochperspektive ein Abbild der Epoche, in dem das Nahe und das Fremde prägnante Konturen erhält. Und wie in Wahrheit nicht der Tempel von Eleusis eingemauert ist, sondern die Menschheit draußen durch die Beschränktheit ihres Wissens, so sind auch wir in den Mauern unserer Erfahrungen, Routinen und Denkmuster gefangen, wenn wir uns nicht trauen, einen Schritt aus unserer Welt herauszutun. Lassen Sie sich also einweihen in das Mysterium der römischen Antike!
I
Secretum
Von verschlossenen Türen und geheimen Orten
Secretum ist das lateinische Wort für «Geheimnis». Das Substantiv ist das neutrale Partizip Perfekt passiv des Verbs secernere, was so viel bedeutet wie: «absondern», «ausscheiden», «trennen». Das deutsche Wort Sekret hat hier seine Wurzeln. Secretum ist etwas, das abgesondert, abgeteilt ist. Doch wovon? Es kann Abgeschiedenheit oder Einsamkeit bedeuten, dann bezieht es sich auf Orte, die entfernt von belebten Räumen liegen, oder es kann Heimlichkeit oder Geheimnis bedeuten, dann heißt secretum, dass etwas der Sichtbarkeit entzogen ist. Secretum war für die Römer all das, was sich im Geheimen, hinter Schloss und Riegel, in den Häusern oder Köpfen abspielte. Um secreta zu bewahren, musste oft erheblicher Aufwand getrieben werden: Man vertraute auf geheime Boten, Geheimschriften, zu Verschwiegenheit verpflichtete Freigelassene und Sklaven, deren Stillschweigen man vielleicht noch nachhalf, indem man ihnen die Zunge herausschnitt. Secreta waren aber auch Orte, die weit weg lagen vom Alltag der Menschen: verlorene Orte, lost places, an denen sich allenfalls die Geister der Toten ein Stelldichein gaben.
Es war kein Nachttopf da
Ein Buch, das sich mit dem Geheimen in der römischen Welt beschäftigt, muss zuerst dort ansetzen: bei der Frage, wo das Öffentliche aufhört und das anfängt, was ihr entzogen ist und oft auch vor ihr verborgen bleiben soll. Der Öffentlichkeit entzogen ist das Private, und auch unser Wort «privat» kommt aus dem Lateinischen. Das Adjektiv privatus ist fast bedeutungsgleich mit secretus. Es bedeutet ebenfalls «abgesondert», aber nicht allgemein, sondern spezifisch, im Sinne von: abgeteilt von der Öffentlichkeit, zur Privatsphäre gehörend.
Die Trennung zwischen öffentlichem und privatem Raum ist weniger selbstverständlich, als man glauben möchte. Noch im alten Ägypten und Vorderasien war sie nahezu unbekannt gewesen. Verwandtschaft regelte, wer wo wohnte: Familien, Clans und Stämme hausten zusammen, ganze Stadtviertel waren Gemeinschaftseigentum von Großfamilien, deren Angehörige in den Häusern ein- und ausgingen. Rückzugsmöglichkeiten, gar eine Privatsphäre, die vor der weitläufigen Verwandtschaft verborgen geblieben wäre, gab es kaum. Die Schattenseite der solidarischen Familienbande war permanente soziale Kontrolle.
Im Umkehrschluss gab es auch keine Öffentlichkeit. Alles war sozusagen privat, die abstrakte Idee eines Gemeinwesens, gar eines Staates, war den altorientalischen Gesellschaften fremd. Selbst die großen Institutionen, deren Gebäude weithin sichtbar über der Stadt aufragten und von denen aus später ganze Reiche beherrscht wurden – Paläste und Tempel –, waren Privatsache: des Stadtherrn oder Königs und seines respektiven Familienanhangs oder eben eines Gottes.
Deshalb kam es einer Revolution gleich, als um 700 v. Chr. die Griechen begannen, Bereiche in ihren Städten zu schaffen, die allen gehörten. Straßen, Theater, Tempel, öffentliche Gebäude waren für die Gesamtheit da, für die Stadtgemeinde, die Polis, die nicht etwa das Eigentum eines Königs oder Gottes war, sondern sich als Summe ihrer Bürger verstand. Der Begriff des Bürgers, der eben nicht Untertan, sondern als Souverän Träger und Teilhaber der Gemeinschaft war, war ein radikal innovativer Gedanke. Das Bürgerrecht hatte vermutlich von allen politischen Neuerungen der klassischen Antike die durchschlagendste und nachhaltigste Wirkung. Unsere Demokratie wäre ohne dieses fundamentale Konzept überhaupt nicht zu denken.
Der Bürger braucht Platz, wo er sein Bürgerrecht ausüben kann. Dieser Platz war bei den Griechen die Agora, der Marktplatz. Dort verkauften nicht nur Bauern ihre Waren, gingen Stadtbewohner ihren Besorgungen nach, wurden Gerichtsverhandlungen abgehalten und Geschäfte abgeschlossen. Auf der Agora standen auch die Amtsgebäude der Magistrate, wurden Feste gefeiert, in denen die Polis im Jahresrhythmus ihre Identität zelebrierte. Vor allem fanden dort, jedenfalls in der Frühphase der Stadtentwicklung, die Volksversammlungen statt. Dort trafen sich die Bürger in ihrer Rolle als Souverän, um über Gesetze, Amtsträger, Krieg und Frieden – kurz: das Schicksal ihrer Gemeinschaft – zu entscheiden.
Weil die Polis und ihre Bürger ein und dasselbe waren, haftete jedweder Politik im antiken Griechenland ein entschieden totalitärer Zug an. Richter, Ratsmitglieder und viele Beamte wurden per Losverfahren bestimmt, Feste durch Beiträge der Bürger ausgerichtet, die Bewaffnung der schwerbewaffneten Milizsoldaten, der Hopliten, durch sie selbst beschafft, selbst Kriegsschiffe durch Privatleute finanziert und ausgerüstet. Entziehen konnte sich kein Bürger den Pflichten, die ihm die Gemeinschaft auferlegte. Dennoch gab es einen Rückzugsraum, wenn auch nur einen bedingten: Im Haus, griechisch Oikos, war der Bürger Familienmitglied. Die Rollen aller Haushaltsmitglieder wandelten sich, sobald sich hinter ihnen die Haustür schloss.
Wie um die Privatheit des von ihm besetzten Raumes zu markieren, schloss sich das griechische Haus gegenüber der Außenwelt fast hermetisch ab. Die Räume der ein- oder zweigeschossigen Bauten gruppierten sich um einen Innenhof, der von der Straße aus nur durch einen schmalen Eingang zugänglich war. Fast fenster- und schmucklos, machten die Häuser nach außen einen abweisenden Eindruck. Die Römer übernahmen von den Griechen nicht nur in modifizierter Form diesen Wohnhaustypus, sondern auch die Agora, die bei ihnen «Forum» hieß, und das Konzept von öffentlichem und privatem Raum. Transmissionsriemen dafür waren die seit dem 8. Jahrhundert wie Pilze aus dem Boden wachsenden griechischen Siedlungen in Süditalien. Dort, auf sozusagen jungfräulichem Boden, probierten die Griechen vieles Neue zum ersten Mal aus: Einer der ältesten griechischen Marktplätze etwa befand sich in Selinus auf Sizilien, Denker wie der aus dem sizilischen Akragas stammende Empedokles und Parmenides aus Elea in Kampanien waren im 6. und frühen 5. Jahrhundert v. Chr. Wegbereiter der griechischen Philosophie. Vieles von dem Neuen strahlte ins Mutterland zurück, manches aber auch nach Norden aus, Richtung Rom. Kampanien war die Landschaft, wo sich Griechisches und Italisches besonders intensiv und zukunftsweisend durchmischte. Noch vor den Römern wohnten die Schönen und Reichen zu Füßen des Vesuvs, in Pompeji, in Häusern, die griechischem Wohngeschmack und Stilempfinden sehr nahekamen.
In Rom war das Forum, das in einer Senke zwischen den Hügeln Kapitol, Palatin und Esquilin lag, der öffentliche Raum par excellence. Dort fand alles buchstäblich coram publico statt: Die Volksversammlungen auf dem Comitium, die Gerichtsverhandlungen unter freiem Himmel, später in den eigens dafür errichteten Basiliken, Amtshandlungen von Magistraten und Kulthandlungen von Priestern. Nichts war verborgen. Gleich nebenan tagte der Senat in einem festen Gebäude, der Kurie. Auf harten Bänken nahmen die hohen Herren mit ihren purpurgesäumten Togen Platz, fein säuberlich nach Rang gegliedert, und ergriffen, ebenfalls dem Dienstalter nach, das Wort. Bei ihren Sitzungen blieben die Senatoren unter sich: Getagt wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Kurie glich einem Club: Members only.
Zweck der Übung war selbstverständlich, dass geheim blieb, was die 300 Senatoren während ihrer oft stundenlangen Sitzungen miteinander diskutierten. Kontroversen blieben im inneren Kreis und wurden, so wollten es die Spielregeln der republikanischen Politik, nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen. An sie wandte man sich erst, sobald ein Beschluss gefasst war. Die Vertraulichkeit der Senatssitzungen war ein Grundpfeiler des politischen Systems. Der senatorische Amtsadel trat als homogene Gruppe mit hoher Binnensolidarität auf, obwohl man durchaus geteilter Meinung sein konnte. Dissens in der Kurie war in Ordnung, solange von ihm nichts nach draußen drang. Senatoren, die gegen diese goldene Regel verstießen, wie die Brüder Tiberius und Gaius Gracchus 133 und 123 v. Chr., stellten sich außerhalb des Konsenses und wurden von ihren Standesgenossen geächtet.
Eine andere Art von Sitzung, die im Alltag der Moderne eher auf einem stillen Örtchen stattfand, brachte man übrigens in Rom in aller Öffentlichkeit hinter sich. Nur die wirklich Reichen hatten wassergespülte Toiletten in ihren Privathäusern. Wer in einer Insula, einem Mietshaus, wohnte, benutzte einen Kübel, der im Erdgeschoss stand und in die öffentliche Kanalisation entleert wurde. In Pompeji künden Graffiti vom Ärger vieler Hausbesitzer über Fäkalien, die von Passanten an ihrer Hauswand hinterlassen wurden: CACATOR SIG VALEAS/VT TV HOC LOCVM TRASEA, schrieb ein in Orthographie und Grammatik nicht ganz sattelfester Unbekannter: «Scheißer, möge es dir gut gehen, wenn du an diesem Ort vorübergehst.» Die Gäste einer Herberge hinterließen folgende Botschaft an der Zimmerwand: MIXIMVS IN LECTO FATEOR, PECCAVIMVS. HOSPES SI DICES QVARE, NVLLA MATELLA FVIT – «Wir haben ins Bett gepisst, ich gebe es zu, wir haben gesündigt. Wirt, wenn du fragst warum, es war kein Nachttopf da.»
Öffentliche Latrinen befanden sich an vielen Stellen in Rom und anderen Städten. Sie boten bis zu 80 Menschen Platz, aber keinerlei Privacy. Wie bei den berüchtigten «Zwillingsklos» der Olympiade von Sotschi gab es keine Trennwände, Geschlechtertrennung war ebenfalls nicht vorgesehen. Dafür bot sich Gelegenheit zum zwanglosen Plausch. Die Bedürfnisanstalten wurden privat betrieben und finanzierten sich durch Eintrittsgelder und den Verkauf der Jauche als Dünger – den der Kaiser Vespasian mit seinem berühmten Ausspruch «Geld stinkt nicht», non olet, schamlos besteuerte. Immerhin gab es den Luxus von Holz- oder Marmorsitzen, und in vielen – längst nicht allen – Latrinen wurden die Fäkalien durch Frischwasser aus den Aquädukten oder Brauchwasser aus den Thermen in den nächsten Abwasserkanal gespült. Dass sich die Benutzer nach getaner Arbeit mit dem gemeinschaftlich benutzten Xylospongium, einem Holzstab mit daran befestigtem Schwamm, den Allerwertesten abwischten und den Schwamm anschließend lediglich in Wasser spülten, findet sich als unbewiesene Behauptung in der älteren Literatur. Vermutlich war das Xylospongium einfach eine Toilettenbürste.
Domus
Wenn das Forum öffentlicher und die Kurie eine Art halböffentlicher Raum war, dann sollte man meinen, das römische Haus sei – wie das griechische – der Ort schlechthin für das private Leben gewesen. Das stimmt aber nur zum Teil. Die Grenze zwischen privatem und einem weiteren halböffentlichen Raum verlief mitten durch die Domus, das Wohnhaus wohlhabender Römer. Dass es sich so verhielt, hing mit einer weiteren Besonderheit der römischen Gesellschaft zusammen: Anders als die griechische Polis gliederten den Bürgerverband der römischen Republik Beziehungen zwischen Personen, die in keinem Gesetz festgeschrieben und für Fremde kaum sichtbar waren, Nahverhältnisse zwischen oben und unten einer- und Beziehungen zwischen Gleichen andererseits (S. 199).
Einfache Bürger verband mit Höhergestellten ein Verhältnis vertikaler Solidarität, das die Römer Klientel, clientela, nannten. Teil der Patronage, die Angehörige der Elite über den Rest des Volkes übten, war die Vertretung vor Gericht, patrocinium. Dafür gehörte es zur Pflicht der Klienten, ihren Patronen regelmäßig die Aufwartung zu machen. Die allmorgendliche «Begrüßung», salutatio, der Klienten durch den Patron fand in dessen Privathaus statt. Der Hausherr empfing die Schar im Tablinum, das an den zentralen Innenhof angrenzte, über den jedes römische Haus verfügte, und im rückwärtigen Teil der Domus lag: das Atrium. Normalerweise war das Tablinum, wo sich der schwere, oft aus Marmor gefertigte Schreibtisch des Hausherrn befand, durch einen Vorhang vom Atrium abgetrennt, der beiseite gezogen wurde, sobald sich die Klienten im Innenhof versammelten.
Ins Atrium gelangten die Besucher durch die fauces, einen Flur, der den Innenhof mit der Eingangstür verband. Wörtlich bedeutet fauces «Rachen», und tatsächlich verschluckte der lange, schmale Korridor die Eintretenden wie eine Speiseröhre. Wer hindurchgelangt war, der befand sich gewissermaßen im sozialen Verdauungstrakt des Hauses, aber nicht in den Privatgemächern der Familie. Speise- (Triclinia) und Schlafzimmer (Cubicula) lagen zu beiden Seiten des Atriums, hinter dem Tablinum befand sich der Garten, der später noch von Säulenhallen und weiteren Räumen eingerahmt war. Große Häuser besaßen auch im Obergeschoss private Räumlichkeiten. Dort war die Familie unter sich.
Privat und öffentlich mischten sich in der Domus nicht nur beim Morgenempfang der Klienten. Ins Tablinum lud der Hausherr auch seine politischen Weggefährten, amici. Amicus war eigentlich ein «Freund», doch Freundschaft erstreckte sich vom privaten weit in den öffentlichen Bereich hinein. Freunde verbanden Interessen, sie waren Alliierte im hochkompetitiven Geschäft der römischen Politik. Wer ein Amt anstrebte oder sonst etwas erreichen wollte, der versammelte zunächst seine Freunde um den großen Schreibtisch im Tablinum. Nach getaner Arbeit zog man sich zum gemeinsamen Essen ins Triclinium zurück. So manche politische Intrige dürfte hinter den Mauern einer römischen Domus ausgeheckt, so mancher Coup im Senat in der Verschwiegenheit eines häuslichen Tablinum vorbereitet worden sein.
Die meisten Städte im römischen Imperium waren wie ein Rom im Kleinen. Das galt vor allem für die westlichen Provinzen, in denen es vor der Eroberung durch die Römer keine urbane Tradition gegeben hatte. Ob in Lyon, in Trier, London oder Sofia: Wer zur einheimischen Oberschicht gehörte, wollte wohnen wie ein Senator in Rom. Anders lagen die Dinge weiter östlich: in Griechenland und Kleinasien, im Nahen Osten und in Ägypten gab es eine weit zurückreichende, tief verwurzelte Stadtkultur, die von Italien allenfalls Impulse empfing, im Wesentlichen aber auf ihrer Eigenheit beharrte.
Wieviel Raum für Eigenheiten das Imperium bot, zeigt sich in der Stadt Dura-Europos am Euphrat, in Mesopotamien, ganz am Ostrand der römischen Welt. Dura-Europos wurde um 300 v. Chr. von dem Seleukidenherrscher Seleukos I. Nikator gegründet. Rund 200 Jahre später, Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr., eroberten die von Osten vordrängenden Parther die Stadt. Und schließlich, 166 n. Chr., wurde Dura-Europos römisch, um wiederum knappe hundert Jahre später, 256 n. Chr., durch die Perser erobert und endgültig zerstört zu werden. Nach der Gründung durch Seleukos sah Dura-Europos so aus wie alle griechischen Städte der Epoche: in der Mitte eine Agora, viel öffentlicher Raum, ein rechtwinkliges Straßenraster wie heute in Manhattan, dazwischen, blockweise, die Wohnbebauung. Die gleichen, standardisierten Hofhäuser hätten auch in Milet oder Halikarnassos stehen können.
Vom Tag der parthischen Machtübernahme an änderte sich dieses Schema langsam, aber sicher: Zwar blieb das Schachbrett der Blöcke bestehen, doch füllte sich der öffentliche Raum allmählich mit sich eng aneinander schmiegenden Wohnbauten. Der klare Planungsvorgaben voraussetzende einheitliche Charakter der Blöcke ging mit der Zeit verloren: Häuser wurden geteilt oder per Wanddurchbruch zusammengelegt, abgerissen oder in neuer Gestalt errichtet. Ein Papyrus aus Dura-Europos informiert uns über die vier Brüder Nikanor, Antiochos, Seleukos und Demetrios, die 88/89 n. Chr. ein zweistöckiges Hofhaus von ihrem Vater erbten und per Los je ein Viertel des Hauses zugeteilt bekamen. Jeder Bruder erhielt einen Raum im Erdgeschoss und die darüberliegenden Zimmer.[1]
Umbaumaßnahmen waren die unausweichliche Folge, um die Baulichkeiten den neuen Bedürfnissen anzupassen. Die Großfamilie lebte fortan in einem Haus mit mehreren Eingängen von der Straße her. Jede Teilfamilie hatte ihre eigenen Räumlichkeiten, aber in einem Haus, das als Einheit erhalten blieb. Verschiedene Teile der Großfamilie hatten Kontrolle über unterschiedliche Zugänge zum Haus. Solchen Wohnstrukturen, in denen ein völlig anderes Verständnis von «privat» und «öffentlich» als das aus Hellas und Rom bekannte herrschte, begegnen Archäologen nicht nur in Dura-Europos, sondern überall im Nahen Osten, aus ganz unterschiedlichen Epochen. Durch die römische Machtübernahme am Euphrat änderte sich daran nichts.
Fundamental wandelte sich hingegen das Gesicht der Stadt. In den 190er Jahren n. Chr. bezog eine Kohorte der römischen Armee in der wichtigen Grenzfestung Dura-Europos Garnison. Die Soldaten – alles in allem 1000 Mann – kamen nicht von sehr weit her: aus Palmyra, der Stadt in der Oase mitten in der Syrischen Wüste. Sie waren gleichwohl ein Fremdkörper. Die gesamte Nordhälfte von Dura-Europos wurde Kaserne und zum militärischen Sicherheitsbereich erklärt. Nicht nur Privathäuser waren auf einmal unerreichbar, auch Tempel verschwanden hinter einer hohen Mauer und konnten nur mit Sondergenehmigung betreten werden. Dura-Europos war für alle sichtbar Garnisonsstadt geworden.
Der Ausbau zur Garnisonsstadt war das sichtbarste Indiz dafür, wer die neuen Herren vor Ort waren: Wer entscheidet, wo und wie gebaut werden kann, besitzt, mit einem Wort des Soziologen Heinrich Popitz, «datensetzende Macht». Sie ist für ihn die subtilste aller Machtformen, weil sie bestimmt, wie Menschen ihre Umgebung wahrnehmen, wohin sie gehen können und welche Wege ihnen versperrt sind, oft, ohne dass sie merken, welcher Macht sie da ausgesetzt sind. Architektur ist auch ein wichtiges Mittel, um Dinge und Handeln Blicken zu entziehen, um «abzusondern» und so Privatheit, ja Geheimhaltung, herzustellen.
Drängte die Riegel der Pforte
Um Fremde draußen zu halten, das Private vor den Blicken Neugieriger und die Habseligkeiten vor dem Zugriff Krimineller zu schützen, reicht es nicht aus, Steine aufeinander zu schichten und Mauern zu bauen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, braucht Tür und Tor, dazu Aufbewahrungsmöglichkeiten für Bares und Geheimes. Sie schützen aber nur dann vor Unbefugten, wenn nicht jeder herankommt. Schlösser, die sich nur mit dem passenden Schlüssel öffnen lassen, sind das Mittel der Wahl, wenn man den Zugang zu etwas begrenzen möchte.
Im Griechenland Homers war es bereits selbstverständlich, dass Wertgegenstände hinter Schloss und Riegel gelagert wurden. Als sich Penelope, die Gattin des reisenden Helden Odysseus, während dessen zwanzigjähriger Abwesenheit von Ithaka mit einer wachsenden Schar von Freiern konfrontiert sieht, deren Geduld rapide schwindet, verfällt sie auf den Gedanken, die Männer einen Wettkampf im Bogenschießen austragen zu lassen. Wohlwissend, dass nur Odysseus in der Lage ist, seinen Bogen überhaupt zu spannen, lobt sie sich selbst als Preis für jenen aus, dem es gelänge, zwölf Axtringe mit einem einzigen Pfeil aus diesem Bogen zu durchschießen.
Die Waffe lagert in der Schatzkammer des Palastes, zwischen all dem, was Odysseus auf seinen Beute- und Kriegszügen an Wertvollem angehäuft hatte. Um hineinzugelangen, muss Penelope erst die Tür aufschließen: «Fasste mit zarter Hand den schöngebogenen Schlüssel,/zierlich von Erz gegossen, mit elfenbeinernem Griffe,/eilete dann, und ging, von ihren Mägden begleitet,/zu dem innern Gemach, wo die Schätze des Königes lagen,/Erzes und Goldes die Meng’, und künstlichgeschmiedetes Eisens.» Selbst das Aufschließen der Tür ist Homer etliche Verse wert: «Löste sie schnell vom Ringe den künstlichen Knoten des Riemens,/steckte die Schlüssel hinein, und drängte die Riegel der Pforte,/scharf hinblickend, zurück: da krachten laut, wie ein Pflugstier/brüllt auf blumiger Au, so krachten die prächtigen Flügel,/von dem Schlüssel geöffnet, und breiteten sich auseinander.»[2]
Schloss und Schlüssel sind Hightechutensilien: klare Indizien, dass man auch auf der Insel Ithaka nicht hinterm Mond lebt, sondern Anschluss gefunden hat an die Zivilisation mit ihren Segnungen. Der Schlüssel ist aus Eisen, nicht aus Holz, und mit einem Elfenbeingriff verziert. Das ist ein untrügliches Zeichen, dass Penelope hier nicht mit einem simplen Werkzeug, sondern mit einem Statussymbol hantiert, das seinen Wert nicht nur daraus bezieht, dass es den Weg zu Schätzen freigibt.
Der Mechanismus, den Homer beschreibt, war primitiv, aber im antiken Griechenland weit verbreitet: Er bestand aus einem Holzriegel, der an der Innenseite der Tür angebracht war. Durch einen Riemen oder eine Schnur wurde er von außen in die Schließstellung gezogen und dann verknotet. Wollte man die Tür wieder öffnen, so stieß man den Riegel mit einem langen, hakenförmigen Gegenstand, dem Schlüssel, zurück: Die Tür sprang auf. Der Mechanismus bot relativ wenig Sicherheit, weil er sich mit jedem beliebigen Haken öffnen ließ; wohl deshalb vertraute Penelope zusätzlich auf einen komplizierten Knoten, den nur sie zu öffnen verstand.
Doch schon im alten Mesopotamien und Ägypten waren effektivere Schlösser bekannt: Man konstruierte ein System aus Sperrstiften, die der Schwerkraft folgend von oben in den Riegel einfielen, ihn arretierten und nur mit einem präzise angepassten Schlüssel so nach oben verschoben werden konnten, dass sich der Riegel bewegen ließ. Anfangs waren Schlösser und Schlüssel aus Holz, später immer mehr Bauteile aus dem widerstandsfähigeren Eisen. Außerdem wurden die Stiftkonstruktionen immer komplizierter und die Schlüssel variantenreicher, so dass sich der Mechanismus nicht mehr so leicht überlisten ließ.
In römischer Zeit waren Schlösser, anders als zur Zeit Homers, längst allgegenwärtig. Dennoch gab man sich in der Öffentlichkeit gern als Besitzer von Wertsachen zu erkennen, die eingeschlossen werden mussten. Reiche Römer trugen ihre Schlüssel gern an Ringen, was neben der öffentlichen Zurschaustellung von Wohlstand den unabweisbaren Vorteil hatte, dass man sie nur schwer verlieren konnte. Das Oberhaupt einer Familie von Rang trug als Zeichen seiner Autorität einen goldenen Schlüssel am goldenen Ring. Später wurde das Tragen von Ringen mit daran befestigten Schlüsseln auch unter Frauen Mode.
Mit Herstellung und Verkauf von Schlössern ließ sich gutes Geld verdienen. Der Händler Caratullius aus Metz ist auf seinem Grabstein mit einer Tunika und einem Mantel bekleidet dargestellt – und mit zwei Ketten samt Vorhängeschlössern sowie einem Schloss unter seinem rechten Arm und einem Schlüssel in seiner linken Hand. Als wären diese Symbole nicht klar genug, weist auch die Inschrift Caratullius, der seinem Namen nach keltischer Herkunft ist, als negotiator artis clostrariae aus, heute würde man sagen: als Spezialisten für Sicherheitstechnik.[3]
Auf Nummer sicher: Caratullius war mit dem Handel von Schlössern wohlhabend geworden. Seine Grabstele befindet sich in Metz.
Überall in der römischen Welt haben Archäologen Vorrichtungen gefunden, mit denen die Menschen sich selbst und ihren Besitz schützten: Die Türen von Privathäusern waren mit Schlössern gesichert, die Bewohner, vor allem Frauen, verwahrten ihre Habseligkeiten in verschließbaren Kästchen, Ketten mit Vorhängeschlössern verhinderten, dass Gegenstände weggetragen oder Sklaven entlaufen konnten. Schlafzimmertüren in Pompeji und Herculaneum wurden mit einfachen Riegeln verschlossen. Selbst in Militärlagern traute man einander offenbar so wenig über den Weg, dass man alles, was nicht niet- und nagelfest war, gut verschlossen aufbewahrte – darunter vermutlich auch geheime Dokumente, die neugierigen Blicken und dem Zugriff Unbefugter entzogen sein sollten. Das Militär besaß sogar eigene Werkstätten für die Produktion von Schlössern und Schlüsseln.
Die Technik wurde in römischer Zeit immer raffinierter und sicherer, die Funktionsweise von Schlössern komplizierter und vielfältiger. Federn sorgten nun statt der Gravitation dafür, dass die Sperrstifte den Riegel arretierten. Gelöst werden konnten sie nur durch erhebliche Kraft, wie sie allein mit einem Metallschlüssel ausgeübt werden konnte. Die Anordnung der Stifte wurde so modifiziert, dass sie ausschließlich mit einem bestimmten Schlüssel zu öffnen waren. Der Bart, der jedem Schlüssel Einzigartigkeit verleiht, trat seinen Siegeszug an. Anders als bei modernen Schlössern führte man den Schlüssel zunächst schräg ins Schloss ein und drehte ihn dann, so dass er rechtwinklig stand und der Bart in die Öffnungen des Riegels griff, um mit einer Schiebebewegung die Sperrstifte zu verdrängen. Noch anspruchsvoller war eine neuartige Mechanik, bei der die Stifte wie bei modernen Schlössern per Drehung des Schlüssels bewegt wurden.