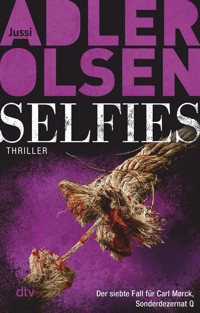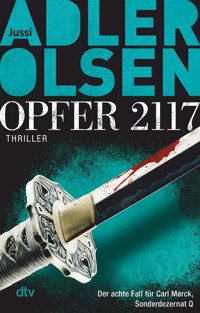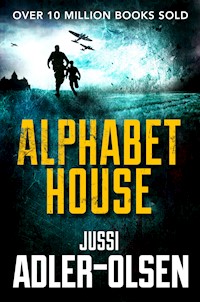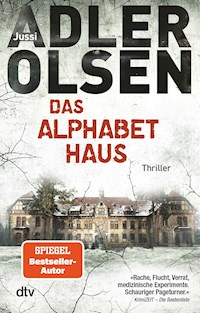
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Der schaurigste Kriegsschauplatz ist die Seele 1944. Die jungen britischen Piloten James und Bryan, unzertrennliche Freunde seit ihrer Kindheit, stürzen über deutschem Territorium ab. Schwerverletzt und unter falscher Identität gelangen sie in eine Nervenheilanstalt im Schwarzwald. Ihre einzige Chance zu überleben besteht darin, psychisch krank zu spielen. Noch wissen die beiden Männer nicht, dass erst hier, im »Alphabethaus«, die wahre Hölle auf sie wartet. Jahrzehnte später kehrt mit Gewalt zurück, was längst vergangen und vergessen schien. Und es fordert unerbittlich neue Opfer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 742
Ähnliche
Über das Buch
»Als Bryan das Rote Kreuz auf den Dächern sah, atmete er tief durch. Trotz der vielen Sandsäcke, trotz der vergitterten Fenster im ersten und zweiten Stock und trotz etlicher Wachen mit Hunden wirkte die Anlage tatsächlich wie ein ganz normales Krankenhaus. ›Aber lass dich nicht täuschen‹, dachte Bryan, als man ihn zu den Gebäuden brachte. Wer ihn in diesem Moment anlächelte, konnte im nächsten Augenblick schon sein Henker sein …«
1944. Nach einem Flugzeugabsturz über deutschem Territorium retten sich die beiden britischen Soldaten Bryan und James in einen Lazarettzug, der verletzte deutsche Soldaten von der Ostfront nach Hause bringt. Unter falscher Identität landen die Piloten als Patienten im »Alphabethaus«, einem Krankenhaus in der Nähe von Freiburg im Breisgau. Bryans und James‘ einzige Chance, dort zu überleben, besteht darin, sich selbst als psychisch krank auszugeben. Doch können sie das, ohne Schaden zu nehmen an Leib und Seele? Und: Sind sie die einzigen Simulanten? Jahrzehnte später werfen entsetzliche Ereignisse der Vergangenheit noch einmal ihre Schatten auf die Überlebenden …
TEIL 1
1
DAS WETTER WAR alles andere als gut.
Kalt und windig, geringe Sichtweite.
Für einen englischen Januartag war es ungewöhnlich rau.
Die amerikanischen Soldaten hatten schon eine Weile auf den Landebahnen gesessen, als sich der hochgewachsene Engländer der Gruppe näherte. Er war noch nicht ganz wach.
Hinter der vordersten Gruppe richtete sich eine Gestalt auf und winkte ihm zu. Der Engländer winkte zurück und gähnte laut. Nach so langer Zeit mit nächtlichen Angriffsflügen fiel es ihm schwer, sich wieder auf den normalen Tag-Nacht-Rhythmus einzustellen.
Und es würde ein langer Tag werden.
Weiter entfernt rollten die Maschinen langsam zum südlichen Ende der Startbahnen. Also würde es in der Luft bald wieder voll sein.
Die Vorstellung weckte gemischte Gefühle in ihm.
Der Auftrag zu dieser Mission war vom Büro des Generalleutnants Lewis H. Brereton in Sunning Hill Park gekommen. Er hatte den Oberbefehlshaber der Royal Air Force, Luftmarschall Harris, um britische Unterstützung gebeten. Die britischen Moskitos hatten bei den Nachtangriffen auf Berlin im November das streng gehütete Geheimnis der Deutschen – die Anlagen für die V-1-Raketen in Zempin – enthüllt, und das hatte die Amerikaner nachhaltig beeindruckt.
Die Mannschaften auszuwählen überließ man Oberstleutnant Hadley-Jones, der die praktische Arbeit seinem Mitarbeiter, Wing Commander John Wood, anvertraute.
Er hatte die Aufgabe, zwölf britische Crews zusammenzustellen. Acht für Beobachtungsflüge und vier Mannschaften mit besonderen Observationszielen zur Unterstützung, die unter dem Kommando der 8. und der 9. US-Luftflotte fliegen sollten.
Für diese Aufgabe wurden doppelsitzige P-51-D-Mustang-Jagdflugzeuge mit sogenannten Meddo-Geräten und hochempfindlichen optischen Instrumenten ausgerüstet.
Vor gerade mal zwei Wochen hatte man James Teasdale und Bryan Young als erste Crew ausgewählt, die dieses Material unter sogenannten »normalen Verhältnissen« erproben sollte.
Sie konnten also davon ausgehen, schon bald wieder Kampfeinsätze fliegen zu müssen.
Der Angriff war für den 11. Januar 1944 geplant. Das Ziel der Bombergeschwader waren die Flugzeugfabriken in Aschersleben, Braunschweig, Magdeburg und Halberstadt.
Beide hatten dagegen protestiert, dass man ihnen den Weihnachtsurlaub kappte. Beide waren noch kampfmüde.
»Vierzehn Tage, um sich in diese Teufelsmaschine zu vertiefen.« Bryan seufzte. »Mit diesen ganzen Apparaturen kenne ich mich doch überhaupt nicht aus! Warum bemannt Uncle Sam seinen Mist nicht selbst?«
John Wood hatte sich über die Akten gebeugt und ihnen den Rücken zugekehrt. »Weil sie euch haben wollen.«
»Das ist doch kein Argument!«
»Ihr werdet die Erwartungen der Amerikaner erfüllen und da lebendig wieder rauskommen.«
»Und das garantieren Sie uns?«
»Ja.«
»Sag schon was, James!« Bryan wandte sich dem Freund zu.
James griff nach seinem Halstuch und zuckte die Achseln. Bryan ließ sich schwer auf einen Stuhl fallen.
Es war hoffnungslos.
Die Operation war insgesamt auf gut sechs Stunden angelegt. Eskortiert von P-51-Langstreckenjägern sollte die gesammelte Streitkraft von ungefähr sechshundertfünfzig viermotorigen Bombern der 8. US-Luftflotte die deutschen Flugzeugfabriken bombardieren.
Während des Angriffs sollte James’ und Bryans Maschine die Formation verlassen.
Hartnäckigen Gerüchten zufolge war in den letzten Monaten bei Lauenstein südlich von Dresden ein deutlich erhöhter Zustrom von Bauarbeitern, Ingenieuren und hoch spezialisierten Technikern sowie von polnischen und sowjetischen Zwangsarbeitern registriert worden.
Der Nachrichtendienst hatte lediglich herausgefunden, dass in der Gegend gebaut wurde. Es war jedoch völlig unklar, worum es sich handelte. Eine Fabrik für die Produktion synthetischer Brennstoffe, so vermutete man. Wenn das stimmte, wäre das eine Katastrophe, denn es könnte den Deutschen bei der Entwicklung und Umsetzung neuer V-Raketen-Projekte Auftrieb geben.
Bryans und James’ Aufgabe bestand darin, die Gegend und das Eisenbahnnetz bei Dresden abzufotografieren und zu kartographieren, und zwar so gründlich, dass damit die Informationen des Nachrichtendienstes aktualisiert werden könnten. Nach vollbrachter Mission sollten sie sich wieder dem Fluggeschwader auf dem Weg zurück nach England anschließen.
Unter den Amerikanern, die an dem Angriff teilnehmen sollten, waren viele erfahrene Luftkrieger. Trotz Frostes und trotz der bevorstehenden Mission lagen sie lässig ausgestreckt direkt auf der gefrorenen Erde, die jemand eine Landebahn genannt hatte. Die meisten plauderten entspannt vor sich hin, fast so, als wollten sie demnächst zu einem Ball aufbrechen. Hier und da saß aber doch einer mit verschränkten und auf die Knie gestützten Armen da und starrte stumpf vor sich hin. Das waren die Neuen und Unerfahrenen, die noch nicht gelernt hatten, ihre Träume zu vergessen und die Ängste zu bannen.
Der Engländer schritt zwischen den Sitzenden hindurch auf seinen Partner zu. Der lag, die Arme unter dem Kopf verschränkt, ebenfalls ausgestreckt auf der Erde.
Bryan schreckte zusammen, als er einen leichten Tritt in die Seite spürte.
Schneeflocken fielen ihnen aufs Gesicht, legten sich auf Nase und Augenbrauen. Der Himmel über ihnen verdunkelte sich. Dieser Tagesangriff würde sich nicht sonderlich von den Nachtangriffen unterscheiden.
Der Sitz vibrierte leicht unter Bryan.
Der Luftraum ringsum war gesättigt von Radarreflexen der Flugzeuge im Konvoi. Jedes einzelne Echo war sehr deutlich wahrzunehmen.
Die Apparate waren so präzise, dass die Piloten während des Trainings mehrfach gescherzt hatten, sie könnten genauso gut die Fenster zumalen und allein nach den Instrumenten fliegen.
Genau das forderte ihnen dieser Flug im Prinzip ab. Die Sicht war James zufolge »so klar wie eine Symphonie von Béla Bartók«. Die Scheibenwischer und die in die Schneemassen eindringende Nase des Flugzeugs waren alles, was sie sahen.
Die beiden waren sich einig gewesen, dass es Wahnsinn war, so kurzfristig den Dienst und die Maschine zu wechseln. Aber was Johns Beweggründe betraf, da waren sie unterschiedlicher Meinung. John behauptete, sie seien ausgewählt worden, weil sie die Besten seien, und James nahm das für bare Münze.
Bryan dagegen war sich sicher, dass John Wood sie ausgewählt hatte, weil sich James im aktiven Dienst niemals widersetzte und weil man bei dieser Operation wahrhaftig keine Zeit für Komplikationen hatte. Mit anderen Worten: Ja, er gab James die Schuld daran, dass man sie ausgewählt hatte.
Bryans Vorwürfe ärgerten James. Als hätten sie keine anderen Sorgen. Die Tour war lang, die Ausrüstung neu, das Wetter miserabel. Wenn sie sich erst vom Hauptgeschwader getrennt hatten, würde sie niemand mehr unterstützen. Waren die Vermutungen des Nachrichtendienstes korrekt, dass sich dort kriegswichtige Fabriken im Aufbau befanden, würde das Zielgebiet extrem scharf bewacht werden. Fotos davon nach England zu bringen, würde alles andere als leicht werden.
Aber irgendjemand musste es ja tun. So sehr konnte sich dieser Flug doch nicht von den Angriffen auf Berlin unterscheiden.
Und die hatten sie schließlich auch überlebt.
Schweigend saß Bryan hinter James und konzentrierte sich mit der üblichen Sorgfalt auf seine Aufgaben.
Zwischen Bryans Karten und Messinstrumenten hing das Foto eines Mädchens in der Uniform des ATS. Madge Donat himmelte den gut aussehenden Bryan an, und auch er hielt ihr schon seit geraumer Zeit die Treue.
Wie nach der Taktvorgabe eines energischen Dirigenten bei der Ouvertüre eröffnete die deutsche Flak das Feuer auf die zuerst ankommenden Maschinen. Bryan hatte das Sperrfeuer Sekunden vorher geahnt und James ein Zeichen gegeben, den Kurs des Geschwaders zu verlassen. Von dem Moment an waren sie fürs Erste in der Gewalt des Teufels.
»Wenn du willst, dass wir hier noch weiter runtergehen, dann schrammen wir der Maschine den Arsch ab«, grunzte James zwanzig Minuten später.
»Und wenn wir auf zweihundert Fuß hängen bleiben, siehst du auf den Fotos nichts«, kam es von hinten zurück.
Bryan hatte Recht. Über dem Zielgebiet schneite es und Windböen wirbelten den Schnee auf. Man musste schon dicht genug heranfliegen, dann gab es immer wieder Löcher, in denen sich fotografieren ließ.
Seit sie dem Sperrfeuer über Magdeburg ausgewichen waren, hatte sich niemand mehr für sie interessiert. Vermutlich hatte man ihre Existenz noch nicht mal bemerkt. James würde alles dafür tun, dass es dabei blieb.
James schrie durch den Lärm nach hinten zu Bryan, er habe deutsche Jagdflugzeuge gesehen, die raketenartige Dinger abfeuerten. Ein Aufblitzen, gefolgt von einer heftigen Explosion.
»Die deutsche Luftwaffe taugt doch nicht mal zum Tontaubenschießen«, hatte sich am gestrigen Abend ein amerikanischer Pilot in breitem Kentucky-Akzent lustig gemacht. Das Lachen war ihm heute vermutlich vergangen.
»Und jetzt nach hundertachtunddreißig Grad Süd!« Bryan beobachtete das Schneemeer unter sich. »Da unten ist die Hauptstraße von Heidenau. Siehst du die Kreuzung? Gut, dann lass uns der Abzweigung in Richtung Höhenzug folgen.«
Sie flogen jetzt nur noch knapp zweihundert Stundenkilometer, und der gesamte Rumpf dröhnte unheilschwanger.
»James, hier musst du im Zickzack über die Straße fliegen. Aber pass auf! Ein paar von den Hängen nach Süden zu können ziemlich steil sein. Kannst du etwas sehen? Das Gebiet zwischen hier und Geising kommt mir verdächtig vor.«
»Ich sehe so gut wie gar nichts, nur dass die Straße recht breit zu sein scheint. Wozu braucht man in einer so gottverlassenen Gegend eine so breite Straße?«
»Hab ich mich auch gefragt. Kannst du jetzt südwärts drehen? Guck mal, die Bäume da. Ganz schön dicht, das Dickicht, oder?«
»Meinst du, das sind Tarnnetze?«
»Kann schon sein.« Wenn es hier Fabriken gab, mussten sie in die Hänge hineingebaut sein. Bryan hatte da seine Zweifel. Wurde eine solche Anlage erst einmal entdeckt, würden die Erdwälle bei intensivem Präzisionsbombardement niemals ausreichend Sicherheit bieten. »Das ist eine Finte, James! Nichts hier in der Nähe deutet auf irgendwelche neuen Fabrikanlagen hin.«
Für diesen Fall lautete der Befehl, sie sollten nordwärts an der Eisenbahnstrecke auf Heidenau zufliegen, nach Westen in Richtung Freital abdrehen und der Eisenbahnstrecke in Richtung Chemnitz folgen. Erst an der Eisenbahnstrecke nach Waldheim sollten sie Kurs auf Nord und dann Nordost nehmen. Die Russen hatten darum gebeten, das gesamte Schienennetz gründlich abzufotografieren. Bei Leningrad machten die russischen Truppen mächtig Druck, sie drohten, die gesamte deutsche Front aufzurollen. Ihrer Ansicht nach liefen bei Dresden die wichtigsten Versorgungslinien der Deutschen zusammen. Erst wenn dieser Eisenbahnknotenpunkt lahmgelegt wäre, würde den deutschen Divisionen an der Ostfront der Nachschub ausgehen. Die Frage war nur, wie man das am effizientesten anstellte. Bryan blickte auf den Bahnkörper unter sich.
Die Gleisanlagen waren mit Schnee bedeckt. Viel würde man auf seinen Fotos nicht erkennen können.
Ohne jede Vorwarnung krachte es gerade mal einen halben Meter hinter Bryans Sitz. Ehe Bryan sich umdrehen konnte, beschleunigte James bereits und zog die Maschine fast senkrecht hoch. Bryan befestigte den Karabinerhaken am Sitz und spürte, wie unter ihm die lauwarme Luft aus der Kabine gesaugt wurde.
Das ausgefranste Loch im Rumpf war etwa faustgroß, das Austrittsloch in der Decke tellergroß. Es war nur ein einzelnes Projektil eines kleinkalibrigen Flakgeschosses gewesen.
Sie hatten also doch etwas übersehen.
Der Motor heulte bei dem steilen Aufstieg so ohrenbetäubend, dass sie nicht mal hören konnten, ob sie noch weiter beschossen wurden.
»Ist das da hinten ernst?«, schrie James durch den Fluglärm und nickte, als er die Antwort hörte. »Dann geht’s jetzt also los!« Im selben Moment vollführte er mit der Maschine einen Looping, legte sie leicht auf die Seite und ließ sie dann im Sturzflug fallen. Wenige Sekunden später begannen die Maschinenkanonen der Mustang zu ticken. Direkt auf sie gerichtetes Mündungsfeuer wies ihnen den Weg.
Inmitten des todbringenden Feuerhagels musste sich etwas befinden, von dem die Deutschen nur sehr ungern wollten, dass andere davon erfuhren.
Während das Flakpersonal am Boden versuchte, sie ins Visier zu nehmen, ließ James das Flugzeug unruhig von einer Seite zur anderen schwenken. Die Kanonen waren nicht zu sehen, aber das Geräusch war unmissverständlich: Flakzwilling 40.
Kurz über dem Boden richtete James die Maschine ruckartig auf. Sie hatten nur diese eine Chance. Das Gebiet war etwa zwei bis drei Kilometer breit. Es erforderte jetzt mehr Glück als Verstand, wenn sie hier noch brauchbare Bilder machen wollten.
Die Landschaft rauschte unter ihnen hinweg. Graue Felder und weiße Wirbel wechselten sich mit Baumgipfeln und Gebäuden ab. Das Gebiet, über das sie hinwegdonnerten, war von hohen Zäunen umgeben. Aus dem Inneren der Wachtürme schickte man ihnen eine Maschinengewehrsalve nach der anderen entgegen. In diesen Lagern hielten sie die Zwangsarbeiter gefangen. Leuchtspurgeschosse aus einem Walddickicht unter ihnen ließen James instinktiv weiter die Flughöhe reduzieren und direkt auf die Baumwipfel zufliegen. Mehrere ihrer eigenen Maschinengewehrsalven trafen tief zwischen die Stämme, woraufhin es dort still wurde.
Dann streifte James fast die Wipfel der Fichten, als er das Flugzeug direkt über eine ausgedehnte gräuliche Fläche aus Tarnnetzen, Mauern, Eisenbahnwaggons und Haufen von Gütern gleiten ließ. Bryan hatte jede Menge zu fotografieren. Wenige Sekunden später zogen sie wieder aufwärts und drehten ab.
»Okay?«
Bryan nickte, klopfte James auf die Schulter und betete, die Kanonen unter ihnen mochten ihre einzigen Widersacher sein.
Aber das waren sie nicht.
»James! Die Motorhaube! Siehst du das?« Natürlich sah er es. Eine Ecke der Haube ragte in die Luft. Ob der Sturzflug, ein Treffer oder die Druckwellen das Teil losgerissen hatten, spielte keine Rolle. Es war nicht gut.
»Geh runter mit der Geschwindigkeit, James. Und ist dir klar, was das bedeutet? Wir werden das Bombergeschwader nicht mehr erreichen.«
»Sag einfach, was du für richtig hältst.«
»Wir folgen der Eisenbahn. Wenn die ihre Jagdflugzeuge auf uns hetzen, werden sie denken, wir hauen direkt nach Westen ab. Ich behalte den Luftraum um uns herum im Auge, okay?«
Der Rückflug würde ewig dauern.
Allmählich wurde die Landschaft unter ihnen flacher. An einem klaren Tag hätten sie den Horizont ringsum sehen können. Aber ohne das Unwetter würde man sie eben auch kilometerweit hören können.
»Wie zum Teufel willst du uns denn bloß heil nach Hause bringen, James?«, fragte Bryan leise.
Ein Blick auf die Karte war überflüssig. Ihre Chancen waren minimal.
»Behalt du nur deinen Schirm im Auge, mehr kannst du nicht tun«, kam es von vorn. »Ich glaube, die Klappe hält noch, solange wir nicht deutlich schneller fliegen müssen.«
»Also auf kürzestem Weg zurück.«
»Nördlich von Chemnitz! Danke, Bryan, ja.«
»Wir sind verrückt!«
»Nein. Nicht wir.«
Die Bahnstrecke unter ihnen war keine Nebenstrecke. Früher oder später würde ein Munitionszug oder ein Truppentransport auftauchen. Mit der kleinen, leicht einzustellenden Doppelkanone oder diesen 20-Millimeter-Flak-Vieling 38-Flugabwehrkanonen wären sie im Handumdrehen erledigt. Und dann waren da auch noch die Messerschmitts. Man würde sie für leichte Beute halten. Nahkampf und Abschuss. Länger würde der Kampfbericht nicht ausfallen.
Bryan wollte James gerade vorschlagen, selbst die Maschine zu Boden zu bringen, bevor es der Feind tun würde. Seine Philosophie war so einfach wie pragmatisch: Lieber in Gefangenschaft als tot.
Er legte James die Hand auf den Oberarm und rüttelte ihn leicht.
»Die haben uns im Visier, James«, sagte er. Kommentarlos drückte James die Maschine nach unten.
»Naundorf voraus. Du musst nördlich daran vorbei …« Bryan sah den Schatten des Feindes über sich. »James! Direkt über uns!« James riss den Flieger mit einem gewaltigen Ruck weg von der Erde.
Bei der Beschleunigung ächzte und vibrierte die ganze Maschine. Durch das Loch hinter Bryan wurde bei dem jähen Aufstieg die Luft aus der Kabine gesaugt. James’ Bordkanonen dröhnten, noch bevor Bryan ihr Ziel ausmachen konnte. Eine unbarmherzige Salve in den Bauch stoppte die angreifende Messerschmitt sofort: Die Explosion war tödlich.
Der Pilot würde nicht einmal mehr merken, wie ihm geschah.
Es krachte ein paarmal, ohne dass Bryan erkennen konnte, wo. Dann lagen sie urplötzlich gerade in der Luft. Bryan starrte auf James’ Hinterkopf, als wartete er auf eine Reaktion. Von vorn hörte man ein Brausen, das Dreieck der Motorhaube hatte sich losgerissen und die Frontscheibe zerschmettert. James wackelte leicht mit dem Kopf, gab aber keinen Laut von sich.
Dann kippte er vornüber, das Gesicht zur Seite gedreht.
Das Motorengeräusch wurde lauter. Der Rumpf der Maschine schlug mit solcher Wucht durch sämtliche Luftschichten hindurch abwärts, dass es in allen Fugen ächzte. Bryan riss an seinem Gurt und warf sich über James, packte den Steuerknüppel und zog ihn gewaltsam in Richtung des reglosen Körpers.
Blut strömte über James’ Wange. Das Metallteil hatte ihn an der Schläfe getroffen und den größten Teil seines Ohrläppchens abgetrennt.
Da riss sich krachend ein weiteres Teil der Motorhaube los und trudelte über die linke Tragfläche. Ein unheilverkündendes Knarren veranlasste Bryan, für sie beide eine Entscheidung zu treffen. Er löste James’ Sicherheitsgurt.
Im selben Moment wurde ein Teil des Cockpits explosionsartig losgerissen und Bryan aus dem Sitz geschleudert. Er packte James unter den Armen und zerrte ihn mit sich hinaus in den eisigen Wind auf die Tragfläche. Da sackte auch schon die Maschine unter ihnen weg. Bryan konnte seinen Kameraden nicht mehr halten, spürte aber noch den Zug von James’ Reißleine. James hing sekundenlang schlaff im Wind. Dann öffnete sich sein Fallschirm.
Bryans Finger waren eisig, als er die eigene Reißleine zog. Er hörte den Knall des Fallschirms über sich und gleichzeitig am Boden knatternde Schüsse. Verräterische Lichtpunkte drangen schwach durch das Schneetreiben.
Die Maschine kippte zur Seite und stürzte weit hinter ihnen ab. Die Suche nach den beiden Piloten würde nicht leicht werden. Jetzt aber musste Bryan erst einmal aufpassen, dass er James und seinen Fallschirm nicht aus den Augen verlor.
Der Aufprall war unerwartet brutal. Der Boden war steinhart gefroren, die Ackerfurchen waren wie aus Beton gegossen. Während Bryan noch ächzend und stöhnend dort lag, füllte der Wind den losgelösten Fallschirm aufs Neue und trieb ihn über das Feld. Bryans Fliegeroverall war zerrissen, er selbst hatte den Sprung jedoch einigermaßen überstanden.
Dann wurde Bryan Zeuge von James’ extrem unsanfter Landung. Es sah aus, als würde dessen gesamte untere Körperhälfte zerschellen.
Allen Regeln zum Trotz ließ Bryan seinen Fallschirm davonfliegen und humpelte über die Ackerfurchen zu James. Ein paar Zaunpfähle markierten eine alte Koppel. Pferde waren keine da, die waren sicher alle längst geschlachtet. James’ Fallschirm hatte sich zwischen Holz und Rinde einer der Latten verhakt.
Bryan sah sich um. Es herrschte vollkommene Stille. Windböen wirbelten den Schnee auf. Bryan packte die tanzende Fallschirmseide und zog sich an Nähten, Bindungen und Schnüren vorbei bis zu seinem Freund, der reglos dalag.
Erst bei der dritten Berührung kippte James auf die Seite. Widerstrebend gab der Reißverschluss nach. Bryans eiskalte Fingerspitzen gruben sich unter die groben Kleidungsstücke. Die Wärme, auf die er dabei stieß, tat fast weh.
Bryan hielt die Luft an, bis er endlich James’ schwachen Puls fühlte.
Als der Wind sich schließlich legte, hatte es auch aufgehört zu schneien. Noch immer war alles ganz still.
Bryan schleifte den schwach atmenden James zum nächstgelegenen Dickicht. Die Baumwipfel waren nackt, die Stürme hatten die Bäume leergefegt, und Äste, Blätter und Zweige lagen nun in Haufen am Boden und boten den beiden Piloten etwas Schutz.
»Hier liegt so viel Feuerholz herum, da können keine Siedlungen in der Nähe sein«, murmelte er halblaut vor sich hin. Die Angst um James versuchte er gar nicht erst hochkommen zu lassen.
»Was hast du gesagt?« James ließ sich willenlos durch den Schnee schleppen, bis Bryan auf die Knie fiel und vorsichtig James’ Kopf auf seinen Schoß zog.
»James! Was ist passiert?«
»Ist – ist was passiert?« Noch hatte er die Augen nicht ganz geöffnet. Sein Blick war nach oben auf Bryan gerichtet und flackerte unkontrolliert. Dann drehte James den Kopf und blickte über die schwarz-weiße Landschaft. »Wo sind wir?«
»Abgestürzt, James. Bist du schwer verletzt?«
»Keine Ahnung.«
»Kannst du deine Beine spüren?«
»Die sind verflucht kalt.«
»Kannst du sie fühlen, James?«
»Verdammt, ja! Ich sag doch, die sind scheißkalt. An was für einen gottverlassenen Ort hast du mich eigentlich verschleppt?«
2
MAN KONNTE MEILENWEIT sehen. Und gesehen werden.
Auf einem Acker, so groß, dass die Ernte für ein ganzes Dorf reichen könnte, lagen die Reste von James’ Fallschirm. Deutliche, dunkle Schleifspuren führten von dort geradewegs zu dem Dickicht, in dem sie sich versteckt hielten.
Das alles machte Bryan aber erst Sorgen, seit er wusste, dass James keine schlimmeren Verletzungen davongetragen hatte. Die Blutung am Ohr hatte der Frost längst gestoppt, und Gesicht und Hals waren aufgrund der bitteren Kälte nur schwach geschwollen.
Sie hatten noch mal Glück gehabt.
Doch damit schien nun Schluss zu sein.
Der Frost kroch ihnen bis ins Mark. Es war so kalt, dass ihre Mundwinkel einrissen. Wenn sie nicht erfrieren wollten, mussten sie einen Unterschlupf finden.
James horchte auf Flugzeuge. Aus der Luft würden die Spuren auf dem Feld überdeutlich den Verlauf des Geschehens bezeugen. Kam ein Flugzeug, würden auch die feldgrauen Spürhunde schnell auftauchen.
»Ich glaube, wenn wir die Fallschirme hergeholt haben, sollten wir zu der Senke dort drüben laufen.« James deutete nach Norden auf ein paar dunkelgraue Felder und sah dann wieder zurück. »Wie weit ist es wohl bis zum nächsten Dorf, wenn wir nach Süden gehen?«
»Wenn wir da sind, wo ich glaube, gehen wir direkt auf Naundorf zu. Das müssen knapp zwei Kilometer sein. Aber ich bin nicht sicher.«
»Die Eisenbahn liegt also südlich von uns?«
»Ja. Aber ich bin nicht sicher.« Bryan sah sich noch einmal um. Keine topographischen Besonderheiten. »Ich finde, wir machen es so, wie du vorgeschlagen hast.«
Ein gutes Stück weiter boten ihnen die Schneewehen entlang einer Windschutzhecke ein wenig Deckung. Die Männer folgten dem Gebüsch bis zur ersten Öffnung im Schnee. James atmete schwer. Im vergeblichen Versuch, die Körperwärme zu halten, presste er die verschränkten Arme eng an den Körper. Bryan schleuderte den Fallschirm durch die Vertiefung in den Graben.
Er wollte James gerade etwas fragen, da hielten beide intuitiv inne und lauschten konzentriert auf einen Ton, der näher kam. Das Flugzeug tauchte ein Stück hinter ihnen auf, und während es im Tiefflug über das Dickicht strich, das sie vor Kurzem verlassen hatten, wippte es leicht mit den Flügeln. Beide Männer warfen sich sofort flach auf den Boden. Dann schwenkte der Flieger über das Feld südlich hinter den Bäumen. Eine Weile wurde das Brummen der Maschine immer dunkler, als würde sie wegfliegen und verschwinden. James hob das Gesicht gerade so weit aus dem Schnee, dass er noch Luft holen konnte.
Ein zunehmender Pfeifton ließ beide den Kopf nach hinten drehen. Die Wolken über den Bäumen bildeten kleine dunkle Felder, und in einem davon tauchte die Maschine wieder auf. Diesmal nahm sie direkten Kurs auf sie.
James warf sich über Bryan, sodass der tief in den Schnee gedrückt wurde.
»Ich frier mir den Arsch ab«, stöhnte Bryan unter ihm. Das Gesicht im Schnee begraben, versuchte er trotzdem zu grinsen. James blickte auf seinen Rücken, sah das zerrissene Hinterteil des Fliegeroveralls und dicke Placken Schnee, die durch die Körperwärme langsam schmolzen und über Hüften und Lenden rutschten.
»Lass uns hoffen, dass dir das noch eine ganze Weile so geht. Wenn der da oben uns gesehen hat, dann wird uns beiden bald ein bisschen heiß.«
In dem Moment dröhnte die Maschine über sie hinweg und verschwand.
»Was für eine war das? Konntest du das sehen?«, fragte Bryan und versuchte, sich den Schnee abzuklopfen.
»Eine Junkers vielleicht. Wirkte ziemlich klapprig. Glaubst du, der hat uns gesehen?«
»Dann würden wir jetzt nicht mehr frieren. Aber unsere Spuren hat er sicher gesehen.«
Bryan packte James’ Hand und ließ sich hochziehen.
Beiden war allzu bewusst, dass sie das hier nur mit sehr viel Glück überleben konnten.
Lange liefen sie wortlos und ohne anzuhalten. Ihre Bewegungen waren steif und ungelenk. Wann immer sie mit den Stiefeln an die gefrorenen Schollen stießen, zuckten sie vor Schmerz zusammen. James war leichenblass.
Weit hinter ihnen war wieder ein schwaches Brummen zu hören. Sie warfen sich einen Blick zu. Eine ganz andere Art Geräusch kam von vorn, etwas, das eher wie ein Zug klang.
»Hast du nicht gesagt, die Eisenbahnstrecke läge nördlich von uns?«, stöhnte James und rieb die eiskalten Hände am Brustkorb.
»Verdammt noch mal, James! Ich hab doch gesagt, dass ich nicht sicher bin!«
»Du bist mir vielleicht ein Navigator!«
»Hätte ich lieber erst die Karte studieren sollen, bevor ich dich aus der Yankee-Büchse rausgeholt habe, oder was?«
James antwortete nicht, sondern legte Bryan eine Hand auf die Schulter und deutete zum Grund der grauen Senke, die sich nach beiden Seiten hin erstreckte und von wo das unverkennbare Geräusch des Dampfkessels einer Lokomotive kam. »Vielleicht hast du jetzt ein besseres Gefühl dafür, wo genau wir sind?«
Bryan nickte kurz, und gleich entspannte sich James. Die Frage war nur – was nutzte ihnen das? Hinter einem Gebüsch gingen sie in die Hocke. Die Schienenstränge waren in der weißen Landschaft nur zu erahnen. Das Terrain hinüber bis zur Bahnstrecke war vielleicht sechs-, siebenhundert Meter breit, ziemlich offen und bot keinerlei Schutz.
Sie waren also die ganze Zeit nördlich der Eisenbahnstrecke gewesen.
»Alles in Ordnung?« Vorsichtig zupfte Bryan an James’ Lederkragen, sodass der ihm das Gesicht zuwenden musste. Durch die extreme Blässe traten die Konturen des Schädels umso deutlicher hervor. Er zuckte die Achseln und sah wieder zu den Schienen.
Langsam senkte sich die winterliche Abenddämmerung über die Landschaft. Die Schatten in der Talsenke begannen sich zu bewegen. Ein großartiger und erschreckender Anblick zugleich. Schier endlos war die Reihe der Waggons, die wie ein Lindwurm durch die Landschaft glitt und die Front mit dem Vaterland verband.
In Wellen trug der Wind das Geräusch der gewaltigen Güterzüge zu ihnen. Gepanzerte Lokomotiven, Güterwaggons mit zahllosen Kanonen, Maschinenkanonennester in Sandsackburgen und graubraune verschlossene Mannschaftswagen, aus denen kein Licht drang. Als der erste Güterzug vorbei war, kündigten die Geräusche schon den nächsten an.
Zwischen den einzelnen Transporten vergingen nur wenige Minuten. Tausende von menschlichen Schicksalen mussten sie bereits passiert haben: die völlig erschöpften Verwundeten nach Westen, die furchtsamen und stillen Reserven nach Osten. Jeden Tag nur einige wenige Bomben auf diese Strecke, und die Russen bekämen eine Verschnaufpause und hätten im Hexenkessel der Ostfront leichteres Spiel.
Bryans Arme zuckten. James hielt warnend den Finger vor den Mund. Er lauschte. Jetzt konnte es auch Bryan hören. Die Geräusche hinter ihnen kamen von zwei Seiten.
»Hunde?«
Bryan nickte.
»Aber nur in der einen Truppe, oder?« James setzte sich aufrecht hin und lauschte. »Die zweite Truppe ist motorisiert. Das war dieses Brummen, das wir vorhin schon gehört haben. Die müssen da, wo wir über den Graben gesprungen sind, von den Motorrädern abgestiegen sein.«
»Kannst du sie sehen?«
»Nein, aber das kann nicht mehr lange dauern.«
»Was machen wir jetzt?«
»Was sollen wir schon machen, verdammt?« James ging wieder in die Hocke. »Den Spuren, die wir hinterlassen haben, kann selbst ein Blinder folgen.«
»Also ergeben wir uns?«
»Wissen wir denn, was die mit abgeschossenen Piloten anstellen?«
»Das ist keine Antwort auf meine Frage. Ergeben wir uns?«
»Wir müssen auf jeden Fall ein Stück raus ins Freie, damit die uns sehen können.«
Als Bryan James in Richtung der Talsenke folgte, spürte er den beißenden Wind. Nach einigen schnellen Schritten befanden sie sich auf offenem Gelände, wo sie mit erhobenen Händen ihren Verfolgern zugewandt stehen blieben.
Zunächst geschah gar nichts. Die Rufe verstummten. Die Bewegungen vor ihnen stoppten. James flüsterte leise, die Soldaten seien vielleicht hinter ihnen vorbeigegangen, und ließ die Arme etwas sinken.
Im selben Moment wurde das Feuer auf sie eröffnet.
Doch die schlechte Sicht war ihre Rettung. Blitzschnell hatten sich die beiden auf den Boden fallen lassen. Sie starrten sich ungläubig an: Sie waren beide unverletzt.
Sofort setzte sich Bryan robbend in Richtung Bahngleise in Bewegung. Immer wieder sah er über die Schulter zurück zu James, der auf Knien und Ellbogen hinter ihm herkroch. Die Wunde am Ohr war wieder aufgeplatzt, sie hinterließ kleine rote Flecken auf dem verharschten Schnee.
Mehrere kurze Maschinengewehrsalven zerfetzten die Luft über ihnen. Dann hörten sie wieder die Rufe der Soldaten.
»Jetzt lassen sie die Hunde los«, stöhnte James und packte Bryans Fuß. »Kannst du losspurten?«
»Und wohin?« Bryan wurde heiß und kalt. Sein Magen krampfte sich zusammen.
»Rüber zu den Schienen. Da kommt gerade kein Zug.« Bryan hob den Kopf und ließ den Blick an der langen, verräterisch offenen Strecke entlangwandern. Und was dann?
Als eine längere Maschinengewehrsalve verstummte, rappelte James sich auf und packte Bryan. Die Böschung war halsbrecherisch steil, vor allem mit völlig tauben Füßen, die in steifen Stiefeln steckten. Die Projektile flogen dicht über ihre Köpfe.
Auf einem Stück zweihundert Meter weiter unten sah sich Bryan kurz um. James rannte mit gespreizten Fingern und in den Nacken gelegtem Kopf hinter ihm her. Er sah aus, als wären alle seine Gelenke eingefroren. Hinter ihm rutschten die Soldaten das erste steile Stück der Böschung auf dem Rücken hinunter. Währenddessen wurde nicht geschossen. Als das Feuer wieder einsetzte, zielten ihre Verfolger völlig wahllos, aber immer an ihnen vorbei. Waren diese Schweine etwa müde? Oder wollten sie den Hunden die restliche Arbeit überlassen?
Jedenfalls ließen sie sie jetzt von der Leine, und die aufs Töten abgerichteten Hunde schossen lautlos und ohne zu zögern los.
Als Bryan den Rand der Böschung erreichte, blickte er sich im fahlen Licht der Dämmerung um.
Da sich von beiden Seiten Züge näherten, konnten sie sich nicht jenseits der Eisenbahnstrecke im Gebüsch verstecken. Bryan zuckte zusammen, als es in unmittelbarer Nähe laut krachte. James hatte im Laufen seinen Enfield-Revolver gezogen und den Hund niedergestreckt, bevor der ihn angreifen konnte.
Blutdürstig verfolgten die drei anderen Hunde weiter die Fährte der beiden Männer.
Schusssalven wirbelten den Schnee zwischen ihnen und um sie herum auf. Früher oder später würden sie getroffen werden.
James schoss noch einmal. Bryan ertastete die Klappe der Revolvertasche und packte den Schaft. Dann blieb er kurz stehen. James rannte an ihm vorbei, Bryan zielte.
Der Hund, den James gerade verletzt hatte, ließ sich von Bryans Manöver ablenken. Als der Schuss fiel, überschlug sich das Tier mehrfach, dann blieb es liegen. Die anderen beiden Köter griffen Bryan sofort an. Bryan ging zu Boden, und es gelang ihm lediglich, einen der beiden anzuschießen.
Dem Schäferhund an seinem linken Arm schlug er den Revolverschaft so heftig auf den Hinterkopf, dass das Tier leblos zur Seite fiel. Bryan sprang sofort wieder auf und hinderte den dritten Hund im letzten Moment mit einem gezielten Schuss daran, sich in seinen Arm zu verbeißen. Doch als das Tier zu Boden fiel, rutschte Bryan aus und verlor den Revolver. Sofort eröffneten die Soldaten wieder das Feuer. Jetzt riskierten sie ja nicht länger, ihre Hunde zu treffen.
James war etwa fünfzig Meter entfernt. Die Lederjacke schlotterte um seine Schultern, sein Körper zitterte bei jedem Schritt.
Im Osten, wenige hundert Meter weiter in der Senke, tauchte eine weitere Patrouille auf. Zwar konnten die sie nicht richtig sehen, aber ihr Erscheinen ließ James und Bryan keine andere Möglichkeit, als direkt auf die Bahngleise und die beiden Güterzüge zuzuspurten, die ihnen schon bald den Weg abschneiden würden.
Bryan rannte, so schnell er konnte, bis er kaum noch Luft bekam. Er musste James erreichen. Wenn sie, was nun unausweichlich schien, getroffen würden, wollte er wenigstens in seiner Nähe sterben.
Der erste Zug, der sie erreichte, kam von Osten.
Unbeteiligt beobachtete die Mannschaft auf der Lokomotive die sich nähernden Patrouillen. Die braunen, mit dem Zeichen des Roten Kreuzes versehenen Holzwaggons krochen durch die nackte weiße Landschaft an den beiden Engländern vorbei. Kein einziges Gesicht zeigte sich in den wenigen Fenstern der Waggons.
Auf dem hinteren, nach Osten führenden Schienenstrang zogen zwei zusammengekoppelte, gepanzerte Lokomotiven eine Reihe feldgrauer Waggons. Schon bald verdeckte der Lazarettzug nach und nach den gepanzerten Zug. Die Soldaten auf den Dächern der letzten Waggons des hinteren Zuges hatten sie bereits entdeckt und sich in Bewegung gesetzt, beschossen sie aber nicht, aus Angst, den Lazarettzug zu treffen.
Bryan machte einen großen Schritt und setzte den Fuß direkt in James’ Spur. James lief schwer atmend vor Bryan her. Bryan bremste ab und sah zurück.
In dem Moment, als James den Lazarettzug erreichte, beschleunigte er seine Schritte mit letzter Kraft und streckte die Hand nach dem nächstbesten Geländer aus. Aber er hatte das Metallgeländer so tief unten zu fassen bekommen, dass er unmöglich den Fuß auf das unterste Trittbrett schwingen konnte. Seine verschwitzte Handfläche war sofort angefroren. Nur knapp bevor er das Gleichgewicht verlor, erreichte Bryan ihn und stieß ihn so kräftig nach vorn, dass James zum nächsten Trittbrett flog. Bryan hatte ein anderes Geländer des Zuges inzwischen mit einer Hand gepackt und rannte nebenher. Er stolperte, seine Enfield flog in hohem Bogen ins Gleis, und nur mit größter Anstrengung gelang es Bryan, nicht unter die Räder zu geraten. Auch seine Hand war am Metallgeländer angefroren, doch er zwang sich, loszulassen, machte ein paar rasche Schritte und enterte dann den Wagen davor. Der Schmerz in seiner Hand war unbeschreiblich. Aber sie hatten es geschafft.
Schräg hinter ihnen tauchte die Vorhut der ersten Patrouille mit blaugefrorenen Gesichtern auf, zu müde, um in dem Schneegestöber das Gleichgewicht zu halten. Als einer der Soldaten nach dem Geländer des Zuges greifen wollte, stolperte er über die Schwellen, überschlug sich, fiel und blieb regungslos liegen.
Mittlerweile hatten die Züge einander komplett passiert, und der Lazarettzug beschleunigte wieder.
Erst da gaben die Verfolger auf.
3
IN EINER SANFTEN Kurve neigte sich der Zug einem Hügel zu und gab kurz die Aussicht in Fahrtrichtung frei. Die Silhouetten kahler Bäume auf dem Hügelkamm im Süden schienen zu tanzen.
James war allmählich wieder zu Atem gekommen. Er strich seinem Freund über den Rücken. »Setz dich hin, Bryan. Du bekommst sonst eine Lungenentzündung!«
Sie klapperten beide vor Kälte mit den Zähnen.
»Hier draußen können wir nicht bleiben.« Bryan kauerte auf der eisigen Unterlage. »Entweder wir erfrieren hier draußen oder die knallen uns ab, wenn wir durch den nächsten Bahnhof fahren. Wir müssen so schnell wie möglich abspringen.«
Bryan starrte vor sich hin. Er lauschte dem immer schneller werdenden Rattern des Zuges.
»Was für eine verdammte Scheiße, das alles«, fügte er dann noch leise hinzu.
»Bist du verletzt?« James war heiser. Er sah Bryan nicht an. »Kannst du aufstehen?«
»Ich glaube nicht, dass es mich schlimmer erwischt hat als dich.«
»Dann ist es doch immerhin ein Segen, dass wir auf einem Lazarettzug gelandet sind. Die Pflegeplätze befinden sich gleich hinter der nächsten Tür«, scherzte James.
Keiner von beiden lachte. James hob die Hand und rüttelte mit den Fingerspitzen am Türgriff. Die Tür war abgeschlossen.
Bryan zuckte die Achseln. Das war doch der helle Wahnsinn. »Wer weiß, was sich dahinter verbirgt? Die werden doch sofort auf uns schießen!«
James wusste, was er meinte. Das Rote Kreuz, das auf deutsches Gerät gemalt war, war schon längst als Finte bekannt. Das Zeichen der Barmherzigkeit war zu oft missbraucht worden, und darum waren auch Transporte mit dieser Kennzeichnung nicht mehr sicher vor feindlichen Bomberpiloten. Das wussten sie nur zu gut.
Aber wenn das nun tatsächlich ein Lazarettzug war? Es war doch kein Wunder, dass die Deutschen Hass gegen die Piloten der Alliierten hegten. Ihm ging es mit den Männern der Luftwaffe ja nicht anders. Sie alle hatten zu viel auf dem Gewissen, als dass sie noch mit Barmherzigkeit rechnen konnten. Sie alle, die sie an diesem wahnsinnigen Krieg teilnahmen.
James sah ihn an und Bryan nickte. Wehmut lag in seinem Blick. Bisher hatten sie bei allem verdammt viel Glück gehabt. Damit schien nun Schluss zu sein.
Der Zug ruckelte, als er über einen Bahnübergang fuhr. Im Halbdunkel sahen sie fünfzig Meter entfernt an der Straße neben dem Bahnwärterhäuschen eine ältere Frau stehen.
James streckte vorsichtig den Kopf vor und sah nach vorn. Nichts in der ruhigen, von Raureif überzogenen Landschaft verriet, was nach der nächsten oder der übernächsten Kurve kommen würde.
Aus dem Wageninnern drangen Geräusche. Die Nachtwache machte sich zur Ablösung bereit. Hinter ihnen auf der kleinen Plattform zwischen den zwei Waggons klackte der Riegel im Schloss.
Bryan tippte James auf die Schulter und zog sich selbst hinter die Tür zurück. Dabei machte er James ein Zeichen, ihm zu folgen.
In der nächsten Sekunde bewegte sich der Türgriff. Ein sehr junger Mann steckte den Kopf heraus, holte tief Luft und seufzte. Als der Sanitäter auf die Plattform trat, wandte er ihnen den Rücken zu. Der Mann war offenkundig nur zum Pinkeln herausgekommen.
Als er sich wieder umdrehte, versetzte James ihm einen Schlag ins Gesicht, der ihn taumelnd vom Zug kippen ließ.
Bryan sah James entsetzt an. Wie oft schon hatten sie mit dem Flugzeug anderen den Tod gebracht – aber noch nie aus dieser Nähe. James lehnte sich gegen die ruckelnde Waggonwand. »Was hätte ich denn tun sollen, Bryan! Er oder wir!«
Bryan seufzte. »Wie sollen wir uns jetzt noch ergeben, James?«
Es wäre eine perfekte Gelegenheit gewesen. Der junge Sanitäter war allein und unbewaffnet gewesen. Aber jetzt war es für Reue zu spät. Die Schwellen sausten unter ihnen hinweg, der Zug schien immer noch mehr Fahrt aufzunehmen.
Einen Absprung bei dieser Geschwindigkeit würden sie wohl kaum überleben.
James wandte den Kopf und horchte an der Tür. Dahinter war es ganz still. Aus Schaden klug, wischte er seine Hand sorgfältig an der Hose ab, bevor er nach dem Türgriff fasste. Er legte den Zeigefinger auf die Lippen, zog vorsichtig die Tür einen Spaltbreit auf und steckte den Kopf hinein.
Dann gab er Bryan ein Zeichen, ihm zu folgen.
Im Wageninnern war es dunkel. Eine Trennwand markierte den Übergang zu einem größeren Raum. Von dort drangen Laute und ein wenig Licht zu ihnen. Unter der Decke hingen prall gefüllte Regale mit Tiegeln, Flaschen, Tuben und Pappschachteln in allen Größen. In der Ecke stand ein Schemel. Es war die Kammer der Nachtwache, des jungen Sanitäters, den sie gerade ins Jenseits befördert hatten.
Vorsichtig zog James den Reißverschluss seines Fliegeroveralls auf und bedeutete Bryan, dasselbe zu tun.
Dann standen sie in Hemd und langen Unterhosen in dem Kabuff und warfen alle Bestandteile ihrer Uniformen aus dem Zug.
Wenn man sie in diesem Aufzug entdeckte, so hofften sie, würde man zumindest nicht sofort auf sie schießen.
Als sie hinter die Trennwand traten, blieben sie abrupt stehen. Auf engstem Raum zusammengepfercht lagen Dutzende Soldaten in schmalen Stahlbetten oder auf grau gestreiften Matratzen auf dem Fußboden. Dazwischen verlief ein schmaler Streifen nackter Bodenplanken. Es gab nur diesen Gang. Die Gesichter der Männer waren ausdruckslos. Niemand reagierte auf die Neuankömmlinge. Viele trugen noch ihre Uniformen. Demnach war nicht ein einziger Landser dazwischen.
Der Mief aus Urin und Exkrementen, vermischt mit dem schwachen, süßlichen Geruch von Kampfer und Chloroform, war erstickend. Viele dieser schwer verletzten Männer lallten vor sich hin, aber keiner hatte die Kraft, laut zu klagen. Ungewaschene, dünne Laken waren alles, was sie vor der Kälte schützte.
Beim langsamen Vorbeigehen nickte James denen zu, bei denen er einen Hauch Lebens zu ahnen meinte. Einer hob seinen Arm ein klein wenig an, als Bryan an ihm vorbeiging, und er versuchte zurückzulächeln. Ein Fuß stak hervor, James wäre beinahe darüber gestolpert. Erschrocken hielt er sich die Hand vor den Mund, als er hinunter zu dem Verwundeten sah. Die Augen des Mannes waren tot. Der Offizier, dessen Hand ein Päckchen Gaze umklammerte, lag vermutlich schon seit Stunden tot auf dem Fußboden. Die Matratze war voll von getrocknetem Blut.
Die Gazebinde aber war sauber.
Blitzschnell entwand James dem Toten das Verbandsmaterial und hielt sich die Gaze an sein lädiertes Ohr, die Wunde hatte wieder zu bluten begonnen. In dem Moment hörten sie von dort, wo sie hergekommen waren, ein Rumpeln und Klirren.
»Komm!«, flüsterte James.
»Können wir nicht einfach hierbleiben?«, flüsterte Bryan zurück.
»Bryan, hast du keine Augen im Kopf?«
»Was meinst du?«
»Alle Offiziere hier im Wagen tragen das Zeichen der SS. Alle! Was glaubst du denn, was passiert, wenn wir nicht von Sanitätern, sondern von SS-Leuten entdeckt werden?« Er lächelte betrübt. Dann machte er ein ernstes Gesicht und sah Bryan eindringlich an. »Ich verspreche dir, dass ich uns hier raushole, Bryan. Aber überlass die nächsten Schritte mir.«
Bryan schwieg.
»Einverstanden?«, fragte James beharrlich nach.
»Einverstanden!« Bryan versuchte, ihn anzulächeln.
Neben seinen Füßen klirrten in einem Eimer verchromte Instrumente. Sie schwammen in einer unbestimmbaren dunklen Soße.
Alles deutete darauf hin, dass die Söhne Deutschlands, die mit diesem Transport auf deutschen Boden zurückkehrten, schon bald in selbigem begraben werden würden.
Wenn dies ein gewöhnlicher Lazarettzug war, dann musste an der Ostfront die Hölle los sein.
Im nächsten Wagen leuchteten Glühbirnen über den beiden Reihen mit den Betten, die eng nebeneinander an den Wänden standen.
James blieb an einem der Betten stehen und kippte das Krankenblatt zu sich. Dann nickte er dem apathisch daliegenden Patienten zu und ging weiter zum nächsten Bett. Er warf einen Blick auf das nächste Krankenblatt und erstarrte. Bryan trat leise zu ihm.
»Was steht da?«, flüsterte er.
»Da steht ›Schwarz, Siegfried Anton. Geboren 10.10.1907, Hauptsturmführer‹.«
James ließ das Krankenblatt fallen und sah Bryan an. »Das sind alles SS-Offiziere, Bryan. Auch in diesem Wagen.«
Einer der nächsten Patienten war offenkundig schon seit Stunden tot. Ein findiger Pfleger hatte den verletzten nackten Oberarm des Mannes an einem Stahlgalgen festgebunden, wohl um dem Ruckeln des Zuges entgegenzuwirken. James’ Blick fiel in dessen tätowierte Achselhöhle, und er griff intuitiv nach Bryans Arm.
Als sie in den nächsten Wagen kamen, spürten sie gleich, dass dort etwas anders war. Die Geräusche waren gedämpfter. Der Türgriff war aus Messing. Die Tür öffnete sich geräuschlos.
Hier gab es keinen abgetrennten Raum. Einige wenige Lämpchen warfen ihr gelbliches Licht auf zehn parallel aufgestellte Betten. Sie standen so dicht, dass sich die Krankenpfleger wohl nur mit Mühe dazwischenzwängen konnten. Hinter den Kopfenden klirrten die Glasflaschen mit den lebenserhaltenden Infusionen schwach gegen die Stahlgalgen. Sonst war es ganz still. Aber aus dem nächsten Wagen konnten sie deutlich Stimmen hören.
James zwängte sich zwischen die beiden ersten Betten und beugte sich über den nächstliegenden Patienten, dessen Brustkorb sich fast unmerklich hob und senkte. Darauf drehte er sich um und legte das Ohr auf die Herzgegend des nächsten Patienten.
»Was zum Teufel machst du da, James!«, protestierte Bryan so leise er konnte.
»Los, wir müssen einen finden, der es hinter sich hat, aber beeil dich!«, sagte James, ohne ihn anzusehen, während er an Bryan vorbeiging.
»Willst du etwa, dass wir uns in die Betten legen?« Entsetzen sprach aus Bryans Stimme.
Der Blick, den James ihm zuwarf, war eindeutig. »Hast du vielleicht eine bessere Idee?«
»James, die bringen uns um! Wenn nicht für den Pfleger, dann für das hier!«
»Halt die Klappe, Bryan. Die bringen uns so oder so um, wenn sie uns entdecken.« Hastig richtete er den Leib auf dem nächsten Lager auf und zog dem Mann das Hemd über den Kopf. Dann ließ er ihn wieder zurückfallen, sodass die Arme des Mannes schlapp über die Bettkante hingen.
»Hilf mir!«, sagte er im Befehlston, während er dem Toten die Kanüle aus dem Arm zog und die Klebestreifen abriss. Der faulige Gestank ließ Bryan nach Luft schnappen.
Dann schob James Bryan den Oberkörper des Toten so weit entgegen, dass Bryan danach greifen musste. Die Haut des Toten war übel zugerichtet und kühl, aber nicht kalt. Bryan hielt die Luft an, um den Brechreiz zu unterdrücken, und als sich James mit aller Kraft an den Haken des nächsten Fensters zu schaffen machte, sah er weg.
Durch das halb offene Fenster strömte eiskalte Luft in den Wagen. Bryan wurde schwindlig.
James drehte den toten Körper etwas, hob den linken Arm, warf einen Blick in die Achselhöhle und dann auf das Gesicht des Toten. Er war kaum älter als sie.
Mit vereinten Kräften gelang es ihnen, den Toten aus dem Fenster zu schieben. Als Bryan sah, wie der Körper das dünne Eis des Entwässerungskanals neben den Gleisen durchbrach, wurde ihm bewusst, was gerade geschehen war.
Jetzt gab es kein Zurück mehr. Sie hatten ihre Unschuld vollends verloren.
Rasch wandte sich James dem Verletzten im Nachbarbett zu, nahm dessen Arm und griff nach dem Puls. Dann wiederholte er die Prozedur und kippte den Mann vornüber.
Wortlos nahm Bryan den Körper entgegen und zog die Decke auf den Fußboden. Auch dieser Mann trug keinen Verband. Er war etwas kleiner und kompakter als der andere.
»Aber der ist ja gar nicht tot«, flüsterte Bryan und zog den warmen Körper an sich, während James den Arm nach hinten bog und in die Achselhöhle starrte.
»Blutgruppe A positiv. Merk dir das, Bryan!« Zwei schwache Zeichen in der Achselhöhle zeigten die Arbeit des Tätowierers.
»Was soll das heißen, James?«
»Dass du ihm mehr ähnelst als ich und dass du deshalb von nun an die Blutgruppe A positiv hast. Ich übrigens auch. Allen SS-Soldaten wird ihre Blutgruppe auf die Innenseite des linken Oberarms tätowiert, und den meisten auf der rechten Seite das SS-Zeichen.«
Bryan richtete sich auf. »Du bist verrückt! Die entdecken uns doch sofort!«
James reagierte nicht. Er studierte die Krankenblätter an den beiden Betten. »Du heißt jetzt Arno von der Leyen und bist Oberführer. Ich bin Gerhart Peuckert. Merk dir das!«
Bryan starrte James ungläubig an.
»Oberführer! Ja, du hast richtig gehört!« James’ Gesicht war ernst. »Und ich bin Standartenführer! Wir haben es weit gebracht, Bryan!«
Sekunden, nachdem sie sich auch ihrer Unterwäsche entledigt und sie auf demselben Weg entsorgt hatten wie die beiden Soldaten, konnten sie hören, dass sie ein Haus und also vermutlich einen Bahnübergang passierten.
»Nimm die ab«, sagte James und deutete auf Bryans »Hundemarke«, die nun vier Jahre um seinen Hals gehangen hatte.
Bryan zögerte. Da riss ihm James die Erkennungsmarke mit einem Ruck ab und warf sie zusammen mit seiner eigenen aus dem Fenster, das er dann schloss.
»Und was ist mit Jills Halstuch?« Bryan deutete auf das Tuch mit dem gestickten Herzen, das James noch immer um den Hals trug. James reagierte nicht, sondern zog sich das Krankenhemd des Toten über den Kopf.
Ohne eine Miene zu verziehen, legte sich James auf das schmutzige Bett. Er atmete schwer und starrte sekundenlang an die Decke, um sich zu sammeln. Dann flüsterte er, ohne den Kopf zu drehen: »Okay. Wir müssen jetzt so hier liegen, kapiert? Niemand weiß, wer wir sind. Und denk in Gottes Namen dran, die Klappe zu halten. Kein Wort, egal was passiert. Ein einziger Fehler, und mit uns beiden ist es aus.«
»Das musst du mir nicht sagen!« Bryan sah mit Abscheu auf das fleckige Laken, ehe er sich hinlegte. Feucht war es auch noch. »Sag mir lieber, wie du dir das vorgestellt hast! Die Krankenpfleger führen wir nicht hinters Licht, James!«
»Solange du den Mund hältst und den Bewusstlosen spielst, sehen die gar nichts. In diesem Zug sind sicher mehr als tausend Verwundete!«
»Aber die hier drinnen kommen mir irgendwie anders vor …«
Im Wagen vor ihrem knallte es metallisch, und sie schwiegen und schlossen die Augen. Schritte näherten sich und gingen an ihnen vorbei zum nächsten Wagen. Bryan blinzelte und sah einen Uniformierten verschwinden.
»Was ist mit den Kanülen?«, fragte er leise.
James sah über die Schulter. Der Schlauch hing schlaff neben dem Bett.
»Die stecke ich mir auf keinen Fall in den Arm.« Als Bryan James’ Gesichtsausdruck sah, lief es ihm eiskalt über den Rücken.
Wortlos stand James auf und packte Bryans Unterarm. Bryan riss die Augen auf. »Das tust du nicht!«, flüsterte er erschrocken. »Wir wissen doch gar nicht, was ihnen fehlte! Wir werden davon krank!« Als er James nach Luft schnappen hörte, wusste er, dass seine Einwände überflüssig waren. Ungläubig starrte Bryan auf die Kanüle, die bereits tief in seiner Armbeuge steckte. James legte sich wieder ins Nachbarbett.
»Keine Angst, Bryan. Daran sterben wir nicht.«
»Woher willst du das wissen? Die hatten doch gar keine äußeren Verletzungen. Die können die ekelhaftesten Krankheiten gehabt haben.«
»Willst du dich lieber hinrichten lassen?« James sah auf seinen Arm und packte die Kanüle fester. Er drehte den Kopf zur Seite, und als er die Kanüle an irgendeiner Stelle in die Ader presste, wurde ihm schwarz vor Augen.
Im selben Moment ging die Tür des Wagens hinter ihnen auf.
Bryans Herz klopfte verräterisch, als sich Schritte und Stimmen mischten. Er verstand kein Wort. Was hätte er darum gegeben, wenn er auch nur einen Bruchteil von dem verstanden hätte, was um ihn herum gesprochen wurde.
Er musste an unbeschwerte Zeiten in Cambridge denken. James war damals ganz in seinem Deutschstudium aufgegangen, das Studentenleben hatte ihn nie sonderlich interessiert. Das kam James jetzt zugute, denn er würde verstehen, was gesprochen wurde.
In seiner Ohnmacht öffnete Bryan die Augen einen winzigen Spalt. Ein paar Betten weiter beugten sich mehrere Personen über einen Patienten und dessen Krankenblatt.
Dann zog eine Krankenschwester dem Liegenden das Laken über den Kopf und die anderen gingen weiter. Kalter Schweiß bildete sich an Bryans Haaransatz und lief ihm langsam über die Stirn.
Eine vollbusige ältere Frau, offenbar eine Vorgesetzte, ging voraus und warf abschätzende Blicke auf die Betten, an deren metallenen Fußenden sie leicht rüttelte. Als sie James’ Ohr sah, blieb sie stehen und zwängte sich zwischen Bryans und James’ Bett.
Sie murmelte etwas und beugte sich so tief über James, als wollte sie ihn verschlingen.
Beim Aufrichten drehte sie sich um und warf einen Blick auf Bryan, der die Augen in Windeseile wieder schloss. Herr im Himmel, lass sie weitergehen, dachte er und gelobte sich, nie mehr so unvorsichtig zu sein.
Am Quietschen ihrer Schuhsohlen konnte er hören, dass sie sich entfernte. Er blinzelte vorsichtig rüber zu James. Der lag noch ganz ruhig auf der Seite. Er hatte Bryan das Gesicht zugewandt, aber seine Augen waren fest geschlossen.
Vielleicht hatte James ja Recht, und das Krankenpersonal konnte sich nicht an die einzelnen Patienten erinnern.
Die Oberschwester hatte jedenfalls nichts bemerkt.
Aber was, wenn es zu einer genaueren Untersuchung kam? Wenn sie gewaschen wurden? Oder wenn sie mal pinkeln mussten? Bryan wagte den Gedanken gar nicht zu Ende zu denken, denn er spürte längst einen mörderisch zunehmenden Druck im Unterleib.
Nachdem die Oberschwester einen Blick auf das letzte Bett im Waggon geworfen hatte, klatschte sie laut in die Hände und gab irgendeine Anweisung. Binnen Sekunden herrschte vollkommene Stille.
Bryan wartete ein paar Minuten ab, dann öffnete er wieder vorsichtig die Augen. James lag noch immer auf der Seite und sah ihn fragend an.
Bryan blickte sich um. »Sie sind weg«, flüsterte er. »Was war da los?«
»Mit uns warten sie noch. Andere haben es nötiger als wir.«
»Verstehst du, was die sagen?«
»Ja.« James griff nach seinem Ohr und sah an sich herunter. Die Wunden an seinem Körper und der Hand waren nicht weiter auffällig. »Wie sehen deine Verwundungen aus?«
»Weiß nicht.«
»Dann find’s raus!«
»Ich kann doch jetzt nicht das Hemd ausziehen!«
»Versuch’s! Du musst das Blut entfernen, falls da welches ist. Sonst werden die misstrauisch.«
Bryan blinzelte zur Kanüle. Er sah den Gang hinunter, holte tief Luft und zog dann das Hemd schräg über den Kopf, sodass es lose über dem Arm hing, in dem die Kanüle steckte.
»Wie sieht’s aus?«
»Nicht besonders gut.« Arme und Schultern mussten eigentlich gründlich gereinigt werden. Die Verletzungen waren nur oberflächlich, aber eine Schnittwunde reichte von der Schulter bis zum Rücken.
»Wasch dich mit deiner Hand, Bryan. Nimm Spucke und leck die Hand ab. Aber beeil dich!«
James richtete sich ein bisschen auf. Als das Hemd die Wunde an Bryans Schulter wieder bedeckte, nickte er kaum merklich. Seine Lippen bemühten sich, ein Lächeln anzudeuten, aber seine Augen sprachen eine andere Sprache. »Wir müssen uns tätowieren, Bryan«, sagte er. »So schnell wie möglich.«
»Wir müssen – was?«
»Uns tätowieren. Pass auf. Man sticht mit einer Nadel Farbstoff unter die Haut. Dazu können wir die Kanüle benutzen.«
Bryan wurde übel. »Und was ist mit dem Farbstoff?«
»Da müssen wir wohl den Dreck unter unseren Fingernägeln nehmen.«
Ein Blick auf ihre Hände zeigte, dass es in diesem Fall nicht zu Engpässen kommen würde. »Bekommen wir davon nicht Wundstarrkrampf?«
»Wovon?«
»Von dem Dreck?«
»Vergiss es, Bryan. Das ist nun wirklich nicht unser größtes Problem. Und jetzt überleg mal, was wir uns tätowieren müssen.«
Die Worte versetzten Bryan einen Schock. Daran hatte er noch überhaupt nicht gedacht. »Welche Blutgruppe hast du, James?«
»Null Rhesus negativ. Und du?«
»B Rhesus positiv«, antwortete Bryan leise.
»Verdammte Scheiße«, kam es müde von James. »Aber wenn wir nicht A+ tätowieren, merken die früher oder später, dass etwas nicht stimmt. Das steht doch in der Krankenakte, oder?«
»Aber das falsche Blut ist auch verdammt gefährlich!«
»Ja, schon.« James seufzte. »Du kannst machen, was du willst, Bryan. Aber ich tätowiere mir A+.«
Der enorme Druck in seinem Unterleib lenkte Bryan ab. Er konnte die Probleme kaum noch auseinanderhalten. »Ich muss pinkeln«, sagte er.
»Dann tu’s doch! Kein Grund, hier irgendwas zurückzuhalten.«
»Ins Bett?«
»Ja! Himmel, Bryan, natürlich ins Bett! Wohin denn sonst?«
Vom Waggon hinter ihrem war Unruhe zu hören. Beide Männer erstarrten und schlossen die Augen. Bryan lag in einer höchst unbequemen Position, mit dem einen Arm unter sich und dem anderen schräg über der Bettdecke. Auch wenn er gewollt hätte: So war es ihm unmöglich, Wasser zu lassen.
Bryan meinte, nach Tonfall und Klang ihrer Stimmen mindestens vier Krankenschwestern zu zählen. Vermutlich machten immer zwei Schwestern ein Bett. Er wagte es nicht, den Kopf zu drehen.
Weit hinten schlug das eine Paar Schwestern bei dem Toten die Seitensicherung des Bettes herunter. Sie würden ihn sicher wegbringen.
Die beiden Schwestern in seiner Nähe arbeiteten zügig und murmelten leise vor sich hin. Offenbar hatten sie dem Patienten das Hemd über den Kopf gezogen. Bryan öffnete seine Augen einen winzigen Spalt. Die Schwestern beugten sich über den Patienten und wuschen ihm zielstrebig und ohne zu zögern Beine und Unterleib.
Die Krankenschwestern hinten im Wagen hatten bereits das Laken um den Soldaten gelegt und waren gerade dabei, ihn auf den Rücken zu drehen. Als sie ihn in die Mitte des Lakens zogen, gab er plötzlich einen Laut von sich, der alle vier Schwestern jäh in ihrem Tun innehalten ließ. Eine lange Wunde von der Schulter bis zum Hinterkopf hatte zu bluten begonnen. Ohne der Wunde die geringste Aufmerksamkeit zu schenken, zog die kleinste der Schwestern die Nadel aus dem Kragen ihrer Schwesterntracht und stach dem Mann damit fest in die Seite. Bryan konnte nicht hören, ob er stöhnte. Was bezweckten die Schwestern damit? Wollten sie die Reaktionsfähigkeit des Patienten testen? Und wie auch immer sie seinen Zustand einschätzen mochten, sie fuhren fort, ihn einzupacken.
Es war ihm ein Rätsel, wie er und James es hinbekommen sollten, so ruhig zu bleiben, dass niemand Verdacht schöpfte. Bryan betrachtete die ausdruckslosen Gesichter der Krankenschwestern. Was, wenn sie dasselbe Spiel auch mit ihm machten? Würde er unbeweglich liegen bleiben können? Bryan bezweifelte es.
Er hatte Angst.
Als sie James übersprangen und direkt auf Bryan zusteuerten, zuckte er zusammen. Mit einem Ruck zogen sie ihm die Decke weg. Ein Griff, und er war auf den Rücken gerollt.
Die Frauen waren jung. Die Peinlichkeit wuchs ins Unermessliche, als sie ihm das Hemd hochzogen, seine Beine spreizten und ihn mit festen Bewegungen am After und unter dem Hodensack abwischten.
Das Wasser war eiskalt. Bryan zitterte und konzentrierte sich, so gut es ging, darauf, ruhig zu bleiben. Wenn sie jetzt nur keinen Verdacht schöpften. Dann war schon viel gewonnen. Halt die Arme an den Körper gepresst, dachte er, als sie ihn wieder herumrollten.
Eine der Frauen zog seine Pobacken auseinander und schlug danach auf das Laken. Die Schwestern wechselten ein paar Worte. Vielleicht wunderten sie sich, dass das Laken nicht nasser war. Eine Schwester beugte sich über ihn, und in der nächsten Sekunde spürte Bryan einen Schlag auf die Wange. Er hatte kapiert, dass er sich entspannen musste. Deshalb traf der Schlag zwar Wangenknochen und Augenbraue hart, aber er verzog keine Miene.
Dann würde er wohl auch die Nadel aushalten.
Er war mit seinen Gedanken ganz weit weg von dem Albtraum in diesem Zug, als er spürte, wie die Nadel ihm tatsächlich in die Seite gestochen wurde.
Ihm wurde kalt. Aber kein Muskel zuckte.
Ein zweiter Stich würde schwerer auszuhalten sein.
Dann begann der Zug zu schwanken. Eine enorme Erschütterung ging durch den ganzen Wagen, sodass die Betten knarrten. Vom Ende des Wagens war ein Poltern zu hören. Die beiden Frauen, die gerade an James’ Bett getreten waren, schrien auf und rannten zum anderen Ende. Der tote Soldat war auf den Boden geknallt. Bryan ließ die Hand vorsichtig zu der wunden Stelle an der Lende gleiten, wo die Schwester die Nadel eingestochen hatte.
James nebenan hatten sie das Hemd schon halb über den Kopf gezogen. Im Dunkeln lag er vollkommen still mit seinem kreidebleichen Gesicht und sah Bryan aus weit aufgerissenen Augen an.
Tonlos bewegte Bryan die Lippen und versuchte, James zu signalisieren, dass er nichts zu befürchten habe. Aber James war in seiner Angst nicht zu erreichen.
Verräterische Schweißperlen hatten sich gebildet und liefen über sein Gesicht. Die Schwestern hatten große Mühe mit dem Toten, denn der Zug ruckelte enorm. Für den Moment waren sie abgelenkt und James schnappte nach Luft.
Da durchfuhren den Wagen zwei mächtige Stöße und Bryan rutschte bis an die Bettkante vor. James zog die Beine an und klammerte sich an das Laken.
Der Zug bewegte sich nur ruckweise weiter. Bryan schob einen Arm hinüber zu James, um ihn zu beruhigen. Aber James bekam nichts mehr mit. Tief in seiner Kehle formte sich ein Schrei. Bryan, der das kommen sah, griff nach der Metallschale, die die Krankenschwestern auf der Bettkante vor James’ halb nacktem Körper zurückgelassen hatten.
Das Wasser platschte an die Wand, als Bryan ihm die Schale hart an die Schläfe schlug. Bei dem Geräusch richteten sich die Krankenschwestern auf und sahen zu ihnen hinüber, konnten aber nur noch Bryan sehen, dessen Oberkörper schlaff über die Bettkante bis fast auf den Boden hing. Auf dem Fußboden lag umgekippt die Schale.
Soweit Bryan das mitbekam, schöpften die Krankenschwestern keinerlei Verdacht, als sie James fertig machten. Leise murmelnd gingen sie ihrer Arbeit nach, keine von ihnen registrierte die fehlende Tätowierung.
Nachdem sie gegangen waren, schaute Bryan James lange an. Das verletzte Ohr und die blauen Flecken hatten das sonst so harmonische Gesicht verändert und ließen es viel älter aussehen.
Bryan seufzte.
Wenn er sich nicht irrte, befanden sie sich im fünften oder sechsten Waggon dieses endlos langen Zuges. Wenn die Umstände es erforderten, dass sie am nächsten Tag bei Tageslicht vom Zug abspringen müssten, würden also vielleicht vierzig Wagen an ihnen vorbeifahren. Da würden sie wohl kaum ungesehen davonkommen. Und wo sollten sie auch hin, Hunderte Kilometer hinter den feindlichen Linien!
Das Schlimmste war jedoch, dass sie sich nun nicht mehr zu erkennen geben konnten. Sie hätten drei Menschenleben auf dem Gewissen, würde man behaupten. Ohne korrekte Uniform würde man sie zumindest als Spione betrachten und sie vor ihrer Hinrichtung foltern, um alles, was sie wussten, aus ihnen herauszupressen.
Trotz all der Leiden, deren Zeuge Bryan im Krieg bereits geworden war, fand er, es habe sie ungebührlich hart getroffen. Er wollte noch nicht sterben. Es gab noch so viel, für das es sich zu leben lohnte. Der Gedanke an seine Familie ließ ihm ganz warm ums Herz werden und löste Wehmut und Verzweiflung in ihm aus.
Für einen Moment entspannte sich Bryans Körper – und seine Blase konnte sich endlich entleeren.
Allmählich ratterte der Zug wieder in seinem gewohnten Rhythmus. Das Licht der bleichen Wintersonne fand seinen Weg in den Wagen, wenn auch gedämpft durch die mattierten Scheiben. Stimmen kündigten neue Untersuchungen an.
Ein hochgewachsener Mann im Kittel, gefolgt von Krankenschwestern und Pflegern, steuerte zielstrebig auf das erste Bett zu und schlug energisch das Krankenblatt auf. Dann notierte er etwas, riss das Papier ab und reichte es der Krankenschwester.
Keiner der Patienten wurde untersucht. Der hochgewachsene Militärarzt lehnte sich kurz über die Fußenden, wechselte ein paar Worte mit dem Personal, erteilte die eine oder andere Anweisung und ging schnell weiter zum nächsten. Beim Bett, in dem Bryan lag, sah er respektvoll auf die Karte, flüsterte der Oberschwester ein paar Worte zu und schüttelte dann den Kopf.
Anschließend deutete er auf James’ Kopfende, worauf ein junges Mädchen herbeisprang und es höher stellte. Bryan gab sich alle Mühe, flach zu atmen und sich weit weg zu phantasieren. Horchten sie sein Herz ab, würden sie merken, wie es galoppierte.