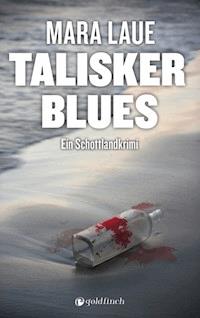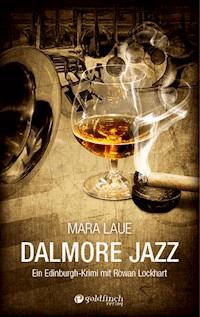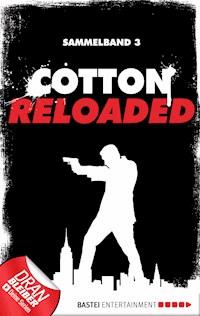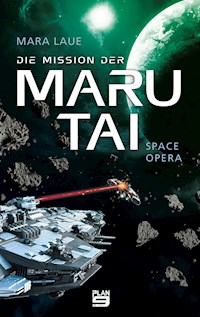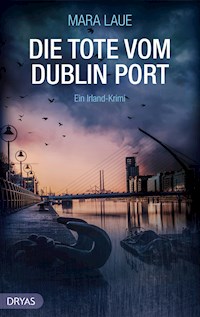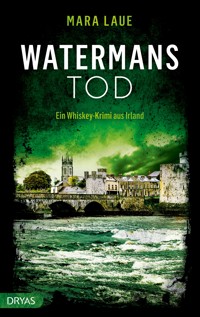3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Kara MacLeod hatte geglaubt, die Visionen los zu sein, in denen sie in jedem Spiegel einen Fremden erblickte, der ihr seltsam ähnlich sieht. Jahre später kehren sie zurück und mit ihnen äußerst lebendige erotische Träume. Gleichzeitig beginnt sie sich zu verändern und entwickelt einen Hunger nach Sex, der so gar nicht zu ihr passt. Als der Mann aus dem Spiegel leibhaftig vor Kara steht und ihr eröffnet, dass sie kein Mensch ist, ist der Irrsinn perfekt. Denn die Tatsache, dass sie zu den Rhu’u-Dämonen gehört, macht sie zu einer Miterbin eines uralten Kristalls, an den die Rhu’u mit ihrem Blut gebunden sind. Doch nicht nur Dämonenjäger wollen verhindern, dass diese Macht durch Kara wieder aufersteht. Sie wäre auch eine gefährliche Bedrohung für die Zehn Mächtigen Fürsten der Unterwelt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mara Laue
Das Blut
der Rhu’u
Fantasy
Impressum
Neuauflage
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Kathrin Peschel, nach Motiven, 2023
Korrektorat: Bärenklau Exklusiv
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Alle in diesem Roman dargestellten Personen und Handlungen sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Ereignissen oder Namensgleichheit mit real existierenden Menschen wären rein zufällig.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Das Blut der Rhu’u
1
2
3
4
5
6
7
8
Epilog
Anmerkung der Autorin
Stammbaum der Rhu’u
Das Buch
Kara MacLeod hatte geglaubt, die Visionen los zu sein, in denen sie in jedem Spiegel einen Fremden erblickte, der ihr seltsam ähnlich sieht. Jahre später kehren sie zurück und mit ihnen äußerst lebendige erotische Träume. Gleichzeitig beginnt sie sich zu verändern und entwickelt einen Hunger nach Sex, der so gar nicht zu ihr passt. Als der Mann aus dem Spiegel leibhaftig vor Kara steht und ihr eröffnet, dass sie kein Mensch ist, ist der Irrsinn perfekt. Denn die Tatsache, dass sie zu den Rhu’u-Dämonen gehört, macht sie zu einer Miterbin eines uralten Kristalls, an den die Rhu’u mit ihrem Blut gebunden sind. Doch nicht nur Dämonenjäger wollen verhindern, dass diese Macht durch Kara wieder aufersteht. Sie wäre auch eine gefährliche Bedrohung für die Zehn Mächtigen Fürsten der Unterwelt …
***
Das Blut der Rhu’u
von Mara Laue
1
Kara fühlte den weichen Samt auf ihrer Haut und darunter die Kälte des Altars. Die harte Steinplatte drückte unangenehm durch den Stoff. Sie fröstelte, obwohl die im weiten Kreis um den Altar herum aufgestellten neun Kerzen eine für ihre geringe Zahl ungewöhnliche Hitze verbreiteten. Vier schwarze Kerzen, vier rote und eine weiße. Sie hörte das leise Knistern von Weihrauch, der außerhalb ihres Gesichtsfeldes verbrannt wurde. Sein Duft ließ sie schwindelig werden. Gleichzeitig versetzte er sie in angenehme Erregung.
Zwei Männer und zwei Frauen standen um den Altar herum, rothaarig, grünäugig und vollkommen nackt. Kara wurde sich bewusst, dass sie ebenfalls nackt war. Was tat sie hier? Sie versuchte aufzustehen, doch kein Muskel gehorchte ihrem Befehl. Der ältere der beiden Männer beugte sich zu ihr herab und strich ihr über das Gesicht. Die Berührung weckte ihre Lust.
»Es ist alles in Ordnung, Carana. In wenigen Minuten bist du endlich du selbst.«
Seine Stimme klang einschmeichelnd, verführerisch, wie die Verheißung des Paradieses. Er streckte die Hände aus und hielt sie so, dass sie über Karas Körper schwebten. Die anderen taten dasselbe, ehe sie begannen, gemessen im Kreis um den Altar zu schreiten. Dabei murmelten sie erst leise, dann zunehmend lauter dieselben Worte einer Sprache, die Kara noch nie gehört hatte: »Zitágunee, Rhu’Carana! Zitágunee!« Bis der ganze Raum davon widerhallte.
Eine unsichtbare Kraft strömte von den acht Händen aus, verwob sich mit dem Singsang und drang in Karas Körper ein. Ließ sie unkontrolliert zucken, als würden Stromstöße durch ihren Körper gejagt. Das Echo des Chants vervielfältige sich in ihrer Seele, schwoll zu einem unerträglichen Crescendo an, bis die Seele brach, zersplitterte und …
*
Kara fuhr keuchend aus dem Schlaf hoch und brauchte eine Weile, um zu begreifen, dass es nur ein Traum gewesen war. »Nur« wurde dem Grauen dieses Albtraums allerdings kaum gerecht. Sie spürte immer noch die Angst, das Entsetzen, ihre Hilflosigkeit, weil sie sich nicht gegen das hatte wehren können, was mit ihr geschehen war. Das Szenario, in dem sie sich im Traum befunden hatte, erinnerte sie an eine Szene aus einem Horrorfilm und trug nicht dazu bei, dass sie sich besser fühlte. Dafür kribbelte die Lust immer noch in ihr, die sie trotz ihrer Angst empfunden hatte.
Ein Blick auf die Uhr zeigte ihr, dass es kurz nach drei Uhr morgens war. Sie atmete tief durch und bemerkte, dass sie vollkommen nass geschwitzt war. Sie ging ins Badezimmer. Ihr Spiegelbild sah schrecklich aus und zeigte eine blasse Haut, dunkle Ringe unter den Augen und einen gequälten Ausdruck im Gesicht. Sie warf ihr Nachthemd in den Wäschekorb, duschte und zog anschließend ein frisches Hemd über. Ein erneuter Blick in den Spiegel zeigte ihr, dass sich die Sorgenfalten auf ihrer Stirn vertieft hatten.
Kein Wunder: Seit ihrem achtundzwanzigsten Geburtstag vor fünf Wochen häuften sich die Albträume. Als wären sie Vorboten einer Gefahr, die unaufhaltsam auf sie zukam. Es fehlte nur noch, dass die Visionen sie wieder heimsuchen würden, die sie für immer los zu sein gehofft hatte. Deshalb klammerte sie sich an die Hoffnung, dass die Ursache in ihrer vor drei Monaten erfolgten Trennung von ihrem Freund Ben lag.
Er hatte sie Hals über Kopf wegen einer dunkelhäutigen exotischen Schönheit sitzengelassen, »die wenigstens weiß, wie man einen Mann im Bett glücklich macht«. Seine offensichtliche Verachtung steckte immer noch wie ein Stachel in ihr und ließ sie sich minderwertig fühlen. Seine gehässige Bemerkung, dass er von einer Frau, deren Körper bei jeder Bewegung »Sex« buchstabierte, mehr erwartet hatte, gab ihr nachträglich das Gefühl, dass er sie nur als Lustobjekt betrachtet hatte.
Vielleicht war Bens Anschuldigung, sie sei eine verklemmte Puritanerin, der Grund dafür, dass die Träume immer intensiver in Bereiche vorgedrungen waren, in die Kara sich im realen Leben nie gewagt hätte. In einem dieser Träume hatte sie sich auf einer Party gesehen, gekleidet in ein gewagtes Nichts, das kaum das Nötigste verbarg. Männer hatten sie umschwärmt wie die Motten das Licht. Das Ganze endete in einer Orgie mit ihr als Mittelpunkt, die sie in vollen Zügen genoss.
Später waren die Albträume gekommen. Zunächst nur schemenhafte Bilder, die kurz aufblitzten und wieder verschwanden. Aber sie wurden mit jedem Mal deutlicher und endeten entweder mit der schwarzen Messe, von der sie vorhin abermals geträumt hatte, oder damit, dass ein paar Männer sie in eine Höhle jagten und ihr bei lebendigem Leib das Herz aus dem Körper schneiden wollten. Zum Glück wachte sie immer auf, bevor der erste Dolch in ihren Körper eindrang. Die Todesangst aus dem Traum hielt jedoch im Wachzustand immer noch eine Zeit lang an.
Sie verscheuchte die düsteren Gedanken, flocht ihr feuchtes Haar zu einem Zopf, krabbelte wieder ins Bett, umarmte die Bettrolle und wünschte sich, nicht allein zu sein. Vielleicht sollte sie Urlaub machen. Oder einen Arzt aufsuchen und sich ein Schlafmittel verschreiben lassen. Oder sich eine Katze anschaffen. Am besten zwei.
Während sie langsam wieder in den Schlaf hinüberglitt, hatte sie das Gefühl, aus weiter Ferne wie von einem Magneten angezogen zu werden; glaubte sie, eine Stimme zu hören, die nach ihr rief. Aber das war wohl nur eine aus ihrer Übermüdung resultierende Halluzination.
*
»Sie sehen gar nicht gut aus, Kara.«
Dr. Mortimer, der sechzigjährige Kurator des National Museum of Scotland, blickte sie über den Rand seiner silbergefassten Brille besorgt an, als Kara sich zum fünften Mal in nur einer Stunde ihren Kaffeebecher randvoll nachfüllte und zum unzähligsten Mal ein Gähnen unterdrückte. Sie fand, dass Mortimer ihr schmeichelte, denn ihr Spiegelbild hatte ihr heute Morgen gezeigt, dass sie furchtbar aussah; wie ein Junkie auf Entzug.
Die Albträume hatten ihr letzte Nacht keine Ruhe gegönnt. Kaum war sie wieder eingeschlafen, war sie hochgeschreckt, weil sie eine Berührung gespürt hatte, eine Hand, die sie sanft berührte, ihr Haar zurückstrich und ihr Nachthemd über die Schulter nach unten schob. Als sie schreiend und um sich schlagend hochgefahren war, befand sich natürlich niemand in ihrem Schlafzimmer. Aber ihr Nachthemd war aufgeknöpft und hing genau dort, wo sie gespürt hatte, dass die Hand es hingeschoben hatte.
Sie hatte mit einem Brotmesser in der Hand ihre Wohnung durchsucht, nur um festzustellen, dass sie allein war. Dennoch hatte sie den Rest der Nacht hellwach verbracht. Darauf hatte der Wecker nicht die geringste Rücksicht genommen. Er klingelte wie gewohnt um sieben Uhr. Mit dem vorhersehbaren Ergebnis, dass sie unausgeschlafen war und Mühe hatte, sich zu konzentrieren. Und obendrein wäre sie auch noch beinahe zu spät zur Arbeit gekommen.
»Ich habe nur schlecht geschlafen, Sir.«
Mortimer verzog das Gesicht. »Sie sollen doch nicht immer ›Sir‹ zu mir sagen, Kara. Da komme ich mir jedes Mal vor wie ein Drill-Sergeant.«
Sie lächelte. »Und wenn ich Sie James nenne, komme ich mir so respektlos vor. Sie sind immerhin mein Boss.«
Mortimer hatte sie unter seine Fittiche genommen, seit sie nach dem Studium vor fünf Jahren als Ethnologin im Museum angefangen hatte. Sie arbeitete in der Abteilung des Scottish Life Archives, in dem neben dem Sammeln von alten Fotos, Bildern, Tagebüchern, sonstigen Schriftstücken und Landkarten, die die schottische Geschichte dokumentierten, auch Forschungen über lokale Bräuche betrieben wurden. Das kam ihr sehr gelegen, denn sie wollte promovieren und hatte sich dafür das Thema »Schottische Volksbräuche und Aberglauben aus vorchristlicher Zeit bis ins 21. Jahrhundert« ausgesucht. Das Thema war spannend und arbeitsintensiv genug, um sie von dem Gedanken an Ben oder andere Männer abzulenken. Wenn sie danach zu Bett ging, war sie meistens müde genug, um sofort einzuschlafen.
Mortimer lächelte. »Wenn die Ursache für die Schlaflosigkeit ein netter Mann ist, hat die definitiv ihre Berechtigung.« Er zwinkerte verschwörerisch.
Kara schüttelte den Kopf. »Leider nicht.«
»Dann arbeiten Sie entschieden zu viel.« Er klopfte ihr auf die Schulter. »Darüber wollte ich ohnehin mit Ihnen sprechen. Ich habe nichts dagegen, wenn Sie einen Teil Ihrer Recherchen für Ihre Dissertation während der Arbeitszeit erledigen. Sie sitzen hier doch an der Quelle und müssen nicht noch nach der Arbeit hierbleiben oder die Arbeit mit nach Hause nehmen. Auf diese Weise haben Sie abends etwas mehr Zeit für sich.«
Mehr Zeit für sich war das Letzte, was sie wollte. Diese Zeit hätte unweigerlich zum Grübeln über die Trennung von Ben und seine Vorwürfe über ihre mangelnden Qualitäten als Liebhaberin geführt. Sie fühlte sich auch ohne die Erinnerung an diese Verletzung schlecht genug. »Danke, Sir. Das ist ein sehr großzügiges Angebot, aber …«
»Kein Aber, junge Dame.« Er drohte ihr scherzhaft mit dem Finger. »Glauben Sie, ich merke nicht, dass Sie sich vergraben, weil Sie Liebeskummer haben?«
»Liebeskummer würde ich das nicht nennen.« Sie fühlte ihre Wangen heiß werden.
»Aber als ich in Ihrem Alter war, nannte man das so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das nicht geändert hat.« Er tätschelte ihr erneut die Schulter. »Eine Trennung ist eine Trennung, und die ist immer schmerzhaft. Heute genauso wie in meinen jüngeren Jahren.«
Kara hatte Mortimer ihr Herz ausgeschüttet, als er sie am Tag nach Bens Flucht aus ihrem Leben völlig verheult in ihrem Büro vorgefunden hatte. Mortimer hatte sie in die Arme genommen und getröstet. Wie ein Vater, den sie nie kennengelernt hatte, weil er gestorben war, als Kara erst wenige Monate alt gewesen war; ein Fischer, den die See geholt hatte. Sie kannte ihn nur von Fotos, einen gut aussehenden Mann mit roten Haaren – Karas einzige Ähnlichkeit mit ihm – und einem charmanten Lächeln.
Mortimer sah sie nachdenklich an. »Wissen Sie was? Sie kommen heute zu uns zum Abendessen. Linda wird sich freuen. Mein Neffe Jarod ist wieder in der Stadt und will uns besuchen. Ich kann dem Jungen doch nicht zumuten, den ganzen Abend nur mit seinem schrulligen alten Onkel und seiner zugegeben liebenswerten, aber nicht minder alten Tante zu verbringen.«
Sie musste lachen. Sein Humor tat ihr gut. Trotzdem hatte sie keine Lust. Mortimer hatte schon öfter von seinem Neffen erzählt, der bei der Polizei arbeitete und wohl ein tüchtiger Ermittler war. Er hatte voller Stolz berichtet, dass Jarod im Rahmen eines Fortbildungsprogramms zum FBI nach Langley geschickt worden war. Jarod war für die Mortimers der Sohn, den sie sich immer gewünscht, jedoch nie gehabt hatten, da Linda keine Kinder bekommen konnte. Kara war für sie inzwischen wie eine Tochter. Nicht nur deshalb war Mortimers Manöver, sie mit seinem Neffen zu verkuppeln, mehr als durchsichtig.
Er hatte es vor zwei Jahren schon einmal versucht. Kara erinnerte sich an Jarod Kane als einen ruhigen Mann, durchaus attraktiv, der aber etwas ausstrahlte, das sie verunsicherte. Deshalb hatte sie jede Einladung der Mortimers abgelehnt, wenn sie wusste, dass auch Jarod kommen würde.
Mortimer nahm ihre Hand in seine beiden und drückte sie fest. »Bitte, Kara, sagen Sie Ja.«
Angesichts seines beinahe flehenden Lächelns brachte sie es nicht über sich, die Einladung abzulehnen. »Sie sind sehr überzeugend, wenn Sie wollen, Sir. Ich werde also kommen.«
Er strahlte. »Prima! Und da das Private nun geklärt ist, können wir dienstlich werden. Wenn ich mich recht erinnere, stammen Sie aus Lochinver.«
»Ja. Aber sagten Sie nicht, wir wollten wieder dienstlich werden?«
»Werde ich doch. Ein Bekannter aus Ullapool hat mir eine alte Chronik aus der Gegend geschickt. Er hat sie aus dem Nachlass einer alten Familie, deren letzter Spross vor ein paar Wochen kinderlos gestorben ist. Vielleicht kannten sie ihn: Angus Muir.«
»Mr Muir ist tot?« Die Nachricht betrübte sie. Der alte Mann war der Geschichtenerzähler des Dorfes gewesen. Seine Familie lebte in Lochinver, seit das Dorf vor Jahrhunderten gegründet worden war. Es gab nichts, was er nicht über den Ort, die Gegend und nahezu jeden wusste, der im Umkreis von zwanzig Meilen lebte. Kara hatte ihn wie viele andere Kinder auch oft besucht, um seinen Geschichten zuzuhören. Er war das lebende Gedächtnis des Dorfes gewesen.
Mortimer legte tröstend die Hand auf ihre Schulter. »Mein Bekannter schreibt, dass er gerne Geschichten erzählt hat. Einen Teil davon hat er aufgeschrieben. Wahrscheinlich wollte er nicht, dass sein Wissen verloren geht, und hat deshalb wohl schon seit Jahren alles in dieser Chronik notiert, an das er sich erinnern konnte. Mein Bekannter erwähnte ebenfalls, dass es auch noch alte Fotos, Tagebücher und Briefe von ihm gibt, die gegenwärtig bei der Gemeindeverwaltung in Ullapool lagern. Ich möchte, dass Sie hinfahren und versuchen, sie für uns abzustauben.« Er lächelte. »Ich denke mir, dass die Leute einer einheimischen Highlanderin gegenüber aufgeschlossener sind als gegenüber einem großstädtischen Lowlander wie mir. Außerdem könnte es dort auch etwas Interessantes für Ihre Arbeit geben. Zumindest, wenn man den Geschichten von Mr Muir glauben kann. Haben Sie schon mal von einem Ort namens Demon’s Leap gehört? Er schreibt in seiner Chronik, dass dort früher heidnische Rituale stattfanden.«
Kara fühlte ein kaltes Gewicht im Magen, das ihr den Atem nahm. Schwindel erfasste sie, die Umgebung verschwamm vor ihren Augen, Bilder strömten auf sie ein. Eine Höhle, eine Decke auf dem Boden, Kerzen, die nackten, ineinander verschlungenen Leiber zweier Menschen, Lust, Hunger, Männer mit Waffen, ein Messer …
»Kara!«
Dr. Mortimers erschrockener Ruf riss sie in die Wirklichkeit zurück. »Mein Gott, Sie sind ja kreidebleich. Ich glaube, Sie sind ernsthaft krank.«
Sie schüttelte benommen den Kopf. »Das war wohl nur ein Schwindelanfall.« Sie strich sich über die Stirn und fühlte die Schweißperlen, die sich dort gebildet hatten. »Ich sagte doch, dass ich die letzten Nächte schlecht geschlafen habe. Wie, sagten Sie, heißt der Ort?«
»Demon’s Leap. Aber das ist jetzt vollkommen unwichtig. Sie gehen sofort nach Hause und legen sich schlafen. Anordnung vom Chef!«, wehrte er ihren beginnenden Protest ab. »Und wenn es nicht besser wird, sollten Sie unbedingt einen Arzt aufsuchen. Nun gehen Sie.«
Da er keinen Widerspruch duldete, machte sich Kara ergeben auf den Heimweg. Es beunruhigte sie zutiefst, dass diese Träume oder Visionen sie nun auch schon im wachen Zustand heimsuchten. Die Angst wuchs, dass sie den Verstand verlieren könnte und sich wie damals als Kind einbildete, im Spiegel einen Jungen zu sehen statt ihres eigenen Gesichts. Ein Arztbesuch war in Anbetracht dessen keine schlechte Idee. Aber vielleicht half tatsächlich auch eine Mütze voll Schlaf.
Sie hatte es zum Glück nicht weit bis nach Hause. 8 Richmond Place war nur eine halbe Meile vom Museum entfernt, weshalb sie meistens zu Fuß ging. Die Sommerluft tat ihr gut, und der Sonnenschein vertrieb ihre düsteren Gedanken. Zu Hause angekommen, nahm sie die Post aus dem Briefkasten und legte sie ins Arbeitszimmer. Sie schaltete die Klingel aus, stellte das Telefon ab, ließ die Jalousien herunter und ging ins Bad, wo sie sich das Gesicht mit heißem Wasser wusch. Das half ihr meistens, schnell einzuschlafen.
Als sie anschließend in den Spiegel sah, blickte ein rothaariger Mann sie daraus an.
*
Cameron zuckte zusammen, als er einen schrillen Schrei aus dem Haupthaus hörte. Vor Schreck fiel ihm der Schraubenschlüssel aus der Hand. Er richtete sich so hastig auf, dass er mit dem Kopf gegen die Kante der Kühlerhaube stieß. Er verzog das Gesicht und rieb sich die schmerzende Stelle, ehe er den Schraubenschlüssel aus den Eingeweiden des alten Ford Transits hervorangelte.
Jemand schlug ihm auf die Schulter. »Beeil dich, Cameron! Vielleicht darfst du diesmal endlich auf deine erste Jagd gehen.«
Jack McCall packte ihn am Arm und zog ihn mit sich, so schnell, dass Cameron sich beinahe zum zweiten Mal den Kopf gestoßen hätte. Er warf den Schraubenschlüssel in die Werkzeugbox neben dem Wagen und folgte Jack zum Versammlungsraum, der früher mal eine Kapelle gewesen war. Die »Gemeinschaft des Lichts« hatte, lange bevor Cameron ihr beigetreten war, ein altes, nicht mehr benutztes Kloster am Ufer des Loch Shiel gekauft, etwa eine Meile von Glenfinnan entfernt, und bewirtschaftete es zunächst mit einer Schafzucht, inzwischen ist es ein Öko-Hof. Noch immer wies das Schild an der A830 unverändert den Weg zum Kloster St. George the Pure.
Die nächste größere Stadt, Fort William, war knapp zwanzig Meilen entfernt. Die relative Abgeschiedenheit war der Gemeinschaft nur recht, denn unter dem Deckmantel einer sich weitgehend selbst versorgenden Gruppe von Aussteigern, die das einfache Leben auf dem Land dem in den Städten vorzog, verbarg sich eine Organisation von Dämonenjägern, die seit dem Mittelalter existierte und gnadenlos Jagd auf jedes Wesen machte, das sie als Dämon identifizierte.
Cameron gehörte erst seit fünfzehn Jahren zu ihnen und hatte bisher noch an keiner Jagd teilgenommen. Das lag weniger daran, dass jeder Neuling sich erst in der Gemeinschaft bewähren musste, sondern hauptsächlich daran, dass ihre bevorzugte Beute selten geworden war. Nach allem, was Patrick Buchanan, das Oberhaupt der Gemeinschaft, ihm erzählt hatte, war die letzte »Höllenbrut« vor vierundzwanzig Jahren erlegt worden. Zumindest hatte sie angeblich zu jenem besonderen Zweig von Dämonen gehört, deretwegen die Gemeinschaft im Jahr 1295 überhaupt ins Leben gerufen worden war. Auch darüber hatte man Cameron noch nicht allzu viel erzählt und ihm auch nicht gestattet, die entsprechenden Ereignisse in der Chronik nachzulesen, die Patrick hütete wie seinen Augapfel und auf der er buchstäblich schlief; sie lag in seinem Bettkasten. Nicht nur diese Verschlossenheit hatte Cameron zu dem Schluss kommen lassen, dass die Gemeinschaft ein Geheimnis hütete, das ihre Oberhäupter selbst vor den eigenen Mitgliedern verbargen.
Im Moment interessierte ihn jedoch mehr, was Megan, die Seherin, in der Vision entdeckt hatte, die sie den »Dämonenschrei« hatte ausstoßen lassen. Megan gehörte wie Patrick zu den Ältesten der Gemeinschaft. Da sie gegenwärtig die einzige Seherin war, versetzte sie sich jeden Tag mehrere Stunden lang in Trance und suchte mit ihren besonderen Sinnen nach der typischen Aura, die nur Dämonen umgab. Hatte sie eine aufgespürt, wurde zur Jagd geblasen und ein Team losgeschickt, das die Kreatur erledigte – sofern sie sich auf schottischem Boden aufhielt. Megans Gabe reichte nicht allzu weit über die Grenze hinaus.
Cameron betrat mit Jack die Kapelle, in der sich schon fast die gesamte Gemeinschaft versammelt hatte. Eine Dämonenfindung sprach sich mit Windeseile herum. Jeder war neugierig zu erfahren, wo Megan diesmal eine Höllenkreatur ausgemacht hatte und wen Patrick als Jagdgruppe zusammenstellen würde. Cameron setzte sich neben Jack auf einen noch unbesetzten Platz in der fünften Bankreihe und wartete.
Patrick und Megan kamen fast gleichzeitig mit den letzten Gemeindemitgliedern, die nicht unabkömmlich waren. Patrick, ein weißhaariger Mann Mitte sechzig, blickte in die Runde.
»Meine Freunde, unsere Geduld wurde belohnt. Megan hat endlich wieder einen Dämon aufgespürt.« Er nickte Megan zu.
Auch sie war bereits in den Sechzigern, eine zerbrechlich wirkende kleine Frau, die aber eine machtvolle Ausstrahlung besaß. Cameron beugte sich gespannt vor.
»Edinburgh«, verkündete Megan in einem Tonfall, als würde sie einen lange vermissten Verwandten begrüßen. »Und«, fügte sie mit einem strahlenden Lächeln hinzu, »es ist eine der Neun!«
Während Cameron wie alle anderen jubelte, musste er sich ein Lachen verbeißen. Megan wurde offenbar alt, sodass ihre Gabe nachließ. Oder es lag daran, dass sie seit vierundzwanzig Jahren keinen der Neun mehr gespürt und deshalb vergessen hatte, wie sich deren typische Ausstrahlung anfühlte. »Die Neun«, das war der Dämonenclan der Rhu’u. Die Gemeinschaft des Lichts war ihrer Legende nach von einem Engel dazu berufen worden, ihr ganzes Leben der Aufgabe zu widmen, diesen schlimmsten aller Dämonenclans auszurotten und seine Mitglieder so lange zu jagen, bis auch der Letzte von ihnen unwiederbringlich tot war. Das war der Preis gewesen, den Gott durch seinen Engel dafür verlangt hatte, dass er die ersten vierzehn Mitglieder der Gemeinschaft davor bewahrt hatte, von den Engländern abgeschlachtet zu werden, als ihr König Edward I. »Longshanks« in Schottland eingefallen war, um es zu erobern.
Die Rhu’u waren so mächtig, dass es immer nur neun von ihnen gab. Manchmal weniger, aber niemals mehr. Was Cameron an Megans Behauptung zum Lachen reizte, war die Tatsache, dass die Rhu’u sich nicht erst, seit die Gemeinschaft des Lichts vor vierundzwanzig Jahren beinahe ihr letztes neugeborenes Mitglied ermordet hatte, so gut tarnten, dass es höchst unwahrscheinlich war, dass der Dämon, den Megan ausgemacht hatte, einer von ihnen sein konnte. Erst recht passte Edinburgh nicht in das Raster, das die Gemeinschaft seit Jahrhunderten über die Orte erstellte, an denen Rhu’u-Sichtungen bestätigt waren. Sie bevorzugten kleine, manchmal sogar abgeschiedene Orte, in denen jeder jeden kannte und alle Nachbarn im Brustton der Überzeugung jeden Eid schworen, dass der Nachbar und die Nachbarin Mac-Irgendwas nichts als nette Menschen waren, die mit ihnen sonntags sogar in die Kirche gingen.
Cameron bezweifelte, dass bei dieser perfekten profanen und magischen Tarnung irgendein Rhu’u so unvorsichtig sein könnte, sie aufzugeben oder auch nur zu vernachlässigen. Schließlich wussten die Rhu’u, dass die Gemeinschaft hinter ihnen her war, die in der Vergangenheit schon so manches ihrer Mitglieder getötet hatte.
Nachdem sich der Jubel gelegt hatte, ergriff Megan wieder das Wort. »Es ist eine Frau, rothaarig und grünäugig wie sie alle.«
Zumindest das passte, denn diese Merkmale waren typisch für die Rhu’u. Da aber viele Schotten rothaarig waren, lag es nahe, dass sich ein Dämon, der sich in diesem Land als Mensch tarnte, dieses Aussehen nach außen zeigte.
»Eine genaue Adresse kann ich euch natürlich nicht geben«, fuhr Megan fort, »aber die Dolche werden euch zu ihr führen.«
Cameron hatte noch nie einen dieser Dolche gesehen, die der Engel damals den Gründervätern der Gemeinschaft gegeben hatte. Neun geweihte Dolche, von Gott mit der Macht ausgestattet, jeden Rhu’u-Dämon aufzuspüren und für immer zu vernichten. In der Vergangenheit hatten die Dolche schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie sehr gut funktionierten. Besonders in Verbindung mit der Tatsache, dass die Gemeinschaft des Lichts jedes ihrer Mitglieder – Männer wie Frauen – auch zu Soldaten ausbildete, die in ihrer Kampfkraft keinem Angehörigen einer Eliteeinheit der Welt nachstanden.
Megan trat zurück und überließ Patrick wieder das Feld. »Jack, Liz, Janet, Seymour und Andrew«, er nickte den Auserwählten zu, »ihr macht euch in einer Stunde auf den Weg.« Er blickte Cameron an und lächelte entschuldigend. »Tut mir leid, Cameron, aber du hast noch nie gejagt. Und bei einem Rhu’u dürfen wir kein Risiko eingehen. Deshalb schicke ich unsere erfahrensten Jäger. Aber ich verspreche dir, dass du mit auf die nächste Jagd nach einem normalen Dämon gehen wirst.«
»Kein Problem«, versicherte Cameron. »Der Erfolg ist das Einzige, was zählt, nicht wer ihn ermöglicht hat. Ich mache noch schnell den Ford fertig. Die neue Lichtmaschine dürfte den alten Kasten problemlos bis nach Edinburgh bringen.« Er nickte den Auserwählten zu. »Ich wünsche euch viel Glück und vor allem Erfolg. Und lasst euch bloß nicht erwischen.«
Schließlich sah es für jeden Menschen, der zufällig Zeuge der Hinrichtung eines Rhu’u-Dämons wurde, so aus, als würde ein Mensch ermordet, denn das war ihre natürliche, angeborene Gestalt. Und ihr Blut war ebenso rot wie das jedes Menschen.
Cameron verließ die Kapelle und ging zurück auf den Hof, um die Reparatur am Wagen abzuschließen. Es machte ihm wirklich nichts aus, dass er nicht für die Jagd auserwählt worden war. Denn die Vernichtung von Dämonen war nicht der Grund gewesen, warum er sich der Gemeinschaft des Lichts angeschlossen hatte.
*
Kara fuhr zurück und starrte das Spiegelbild an. Kniff die Augen zusammen und riss sie wieder auf. Das Bild des Mannes darin blieb. Sie presste die Hand vor den Mund, um das Wimmern zu ersticken, das in ihr aufstieg, und fühlte sich den Tränen nahe. Alles begann wieder wie damals. Nur dass sie statt des Jungen jetzt einen erwachsenen Mann im Spiegel sah.
Dass das ein Zeichen war, dass sie verrückt wurde, erkannte sie daran, dass er ihr so ähnlich sah, als trüge er tatsächlich ihr Gesicht, nur eine ins Männliche verschobene Version davon. Aber er hatte die gleichen Augen wie sie, von genau derselben Form und Farbe, die gleichen roten Haare, nur dass er sie kurz trug, die gleichen geschwungenen Lippen und die gleiche Nase. Lediglich die Kinnpartie war etwas kantiger. Wenn sie den Rest des Bildes mit den Händen abdeckte und nur die Augenpartie frei ließ, waren ihre und seine exakt deckungsgleich.
Genau wie damals. Deshalb hatte sie lange gebraucht, bis ihr aufgefallen war, dass das Spiegelbild nicht dieselben Bewegungen machte wie sie. Anfangs hatte sie das nicht als bedrohlich empfunden, hatte sogar versucht, mit dem Jungen zu sprechen. Aber er hatte sie nicht hören können. Dafür hatte ihre Mutter sie gehört und sie gefragt, mit wem sie denn redete. Erst als Kara begriffen hatte, dass ihre Mutter den Jungen nicht sehen konnte und erschrocken reagierte, war ihr bewusst geworden, dass das, was sie sah, nicht natürlich war.
Die Angst war jedoch erst gekommen, als ihre Mutter mit ihr zu einem Arzt nach Inverness gefahren war, den sie Psychiater nannte. Dass sie eine so weite Reise von fast hundert Meilen gemacht hatten, nur um einen Arzt aufzusuchen – da musste Kara wirklich schlimm krank sein, obwohl sie sich nicht krank fühlte. Und dass sie eine ganze Woche in einer Klinik hatte bleiben müssen – »zur Beobachtung« –, hatte ihr noch mehr Angst gemacht. Zwar hatte sie auch in den Spiegeln der Klinik den Jungen gesehen, aber der Doktor und alle Schwestern hatten ihr immer wieder gesagt, dass sie sich das nur einbildete, weil sie sich einsam fühlte. Ein Einzelkind, ohne Vater, mit einer traurigen Mutter, die sich nach dem Tod ihres Mannes ebenfalls einsam fühlte, dazu die lebhafte Fantasie eines Kindes – sie hatte sich einfach jemanden in den Spiegel geträumt, der gar nicht da war. Sie solle sich mit schönen Dingen ablenken, hatte der Doktor ihr und der Mutter geraten und Kara ein Medikament verschrieben. Das hatte sie müde gemacht, lustlos, appetitlos, aber sie hatte den Jungen im Spiegel nicht mehr gesehen.
Jetzt war er wieder da, erwachsen wie sie, aber derselbe. Und obwohl sie sich einsam fühlte, war sie sich verdammt sicher, dass das nicht der Grund für diese Vision war. Dass das auch damals nicht der Grund für ihre Vision von ihm gewesen war.
»Wer bist du?«, fragte sie ihn.
Sie sah, wie sich seine Lippen bewegten, aber sie hörte kein Wort. Stattdessen verspürte sie wieder wie in der letzten Nacht das Gefühl, dass etwas in der Ferne sie anzog, nach ihr rief. War er das? Er streckte im selben Moment die Hand nach ihr aus wie sie nach ihm und drückte sie auf seiner Seite gegen den Spiegel. Kara zögerte, aber dann legte sie ihre Hand ebenfalls auf den Spiegel, wo seine lag. Ein Stromstoß fuhr durch ihren Körper, nicht so stark, dass es schmerzte, aber er genügte, ihr die Haare am ganzen Körper zu Berge stehen zu lassen.
Gleich darauf spürte sie die Hand des Mannes, fühlte sie warm und lebendig auf ihrer Handfläche. Gleichzeitig überfiel sie ein so heftiges Verlangen nach Sex, wie sie sich nicht erinnern konnte, jemals empfunden zu haben. Sie riss die Hand zurück. Das Spiegelbild verschwand. Das Verlangen nach Sex blieb und steigerte sich zu einem regelrechten Hunger, dass Kara ins Schlafzimmer rannte, sich die Kleidung vom Leib riss und über die Bettrolle herfiel. Sie presste sie mit einer Hand an sich, während sie sich mit der anderen Hand streichelte, ihre Brüste massierte, die Klitoris rieb und sich mit geschlossenen Augen vorstellte, die Hand, die sie streichelte, gehöre zu einem Mann, der sie liebte.
Nach einer Weile bekam sie tatsächlich das Gefühl, dass ein Mann bei ihr wäre, glaubte, seinen Atem auf ihrer Haut zu spüren, seine Küsse und seine Berührungen zu fühlen. Sie beging nicht den Fehler, die Augen zu öffnen und sich der Realität zu stellen. Stattdessen gab sie sich der Fantasie hin, glaubte schließlich, ein hartes Glied in sich eindringen zu spüren, und erlebte Sekunden später einen herrlichen Orgasmus, der sie glücklich machte und genug entspannte, dass sie, als sie sich danach ins Bett kuschelte, ohne zuvor die Augen zu öffnen, überraschend schnell einschlief.
*
Cal MacLeod starrte auf die Meerenge, die den Beauly Firth vom Moray Firth trennte, den er durch das Fenster seines Hauses 42 Kessock Road am Rand von Inverness sehen konnte. Der Sommer zeigte sich von seiner besten Seite, obwohl der Herbst schon vor der Tür stand. Die Sonne warf ihr strahlendes Licht auf das Wasser und ließ dessen gekräuselte Wellen glitzern wie Diamanten. Der Anblick konnte jedoch nicht seine düstere Stimmung vertreiben oder seine Besorgnis dämpfen.
Er verspürte eine Unruhe, die er nur allzu gut kannte. Sie sagte ihm, dass sich Gefahr zusammenbraute. Dieses Gefühl hatte ihn kurz nach Cayelus achtundzwanzigstem Geburtstag beschlichen und war seitdem täglich stärker geworden. Nicht nur bei ihm.
Cayelu spürte es auch; sogar stärker als Cal. Cayelu war mittlerweile so nervös, dass er kaum noch schlief, und entsprechend reizbar.
Cassilya fühlte es ebenfalls, auch wenn es auf sie eine weniger starke Wirkung hatte. Was sie und Cayelu jedoch nicht daran hinderte, sich in bester geschwisterlicher Manier bei jeder Gelegenheit zu streiten. Das wiederum ging Cayuba auf die Nerven, die es sich nicht nehmen ließ, ihren Neffen und ihre Nichte mit spitzen Bemerkungen zusätzlich zu reizen und ihren Bruder Cal aufzufordern, er solle die beiden gefälligst zur Ordnung rufen; schließlich waren sie seine Kinder. Die Laune im Haus war auf dem Nullpunkt. Cal wünschte sich beinahe, dass die Gefahr sich endlich zeigen würde, damit man sie beseitigen konnte und danach wieder Normalität einkehrte.
Er tastete mit seinen magischen Sinnen die Schutzzauber ab, die er um das Haus gelegt hatte. Sie waren intakt und ungebrochen stark. In dieses Haus konnte niemand eindringen, der seinen Bewohnern schaden wollte, seien es profane Einbrecher oder die mordlüsternen Mitglieder der Gemeinschaft des Lichts. Die hatte Cals große Liebe Mirjana ermordet, Cayelus Mutter, und hatte dasselbe mit Cassilyas Mutter getan, nur weil aus Cals One-Night-Stand mit ihr ein Kind entstanden war.
Er hatte schon so manches Mal mit dem Gedanken gespielt, den Spieß umzudrehen und jeden aus der Gemeinschaft des Lichts zu vernichten, der auf der Erde lebte. Die Macht dazu besaß er. Ein wohlplatzierter Todeszauber, und sie würden sterben wie die Fliegen, ohne je zu erfahren, was sie getötet hatte. Er tat es nicht. Menschen zu töten lag nicht in der Natur seiner Art.
Cal war ein Inkubus, einer der Dämonen, die sich vom Sex ernährten. Als Gegenleistung für die Nahrung schenkten sie den Menschen unbeschreibliche sexuelle Freude, aber sie brachten sie nicht um. Außerdem würde die Vernichtung der Gemeinschaft nichts bringen, weil der eigentliche Feind im Hintergrund sofort neue Schergen rekrutieren würde, um Cals Familie zu jagen. Wodurch sie vom Regen in die Traufe kämen. Die Gemeinschaft des Lichts war eine vertraute Größe, die sie einschätzen konnten. Ein neuer Feind dagegen könnte tödlich sein.
Ein erschrockener Schrei, dem unmittelbar ein zweiter folgte, ließ ihn zusammenfahren. Oben klappte eine Tür.
»Dad!« Cayelu kam die Treppe heruntergestürmt. Cassilya folgte ihm auf dem Fuß. »Dad, ich hab sie wieder gesehen.«
»Ich habe sie auch gesehen.« Cassilya nickte heftig zur Bestätigung.
Cal musste nicht fragen, wer »sie« war. Cayelus primäre magische Fähigkeit – außer denen, die ihrer gesamten Art angeboren waren – lag auf dem Gebiet der Spiegelmagie. Spiegelnde Oberflächen offenbarten ihm Dinge, die selbst Cal verborgen blieben. Schon als Kind hatte Cayelu manchmal im Spiegel ein Mädchen gesehen, das, wie er sagte, sein Ebenbild war, und in dem Zusammenhang das Gefühl gehabt, dass sie seine »fehlende Hälfte« wäre. Irgendwann, Cayelu musste ungefähr acht gewesen sein, hatten die Visionen aufgehört, als er begonnen hatte, seine magischen Kräfte zu entwickeln. Außerdem war zu dem Zeitpunkt bereits Cassie da gewesen, und sein »Job« als großer Bruder hatte ihn das Spiegelmädchen vergessen lassen.
Dass die Vision jetzt wieder auftauchte, noch dazu im Kielwasser einer drohenden Gefahr, war nicht nur ungewöhnlich, sondern ließ Cals innere Alarmsirenen Sturm klingeln. Und dass Cassie sie ebenfalls gesehen hatte, bedeutete ohne jeden Zweifel, dass das Mädchen aus dem Spiegel nicht aus Cayelus Geist und Magie geboren worden war, sondern dass sie real existierte.
Cal forderte die beiden mit einer Handbewegung auf, Platz zu nehmen, und setzte sich in seinen Lieblingssessel am Fenster. »Beschreibe mir, was du gesehen und gefühlt hast«, bat er seinen Sohn, »und zwar jedes Detail.«
»Ich bin ins Bad gegangen, um mir die Hände zu waschen. Als ich aufgesehen und in den Spiegel geblickt habe, war sie da. Ihr Gesicht war nass und sie war sehr erschrocken. Sie hat mich auch gesehen, Dad. Und, verdammt, sie sieht immer noch so aus wie ich. Nur ist sie natürlich kein Kind mehr, sondern erwachsen. Eine Schönheit. Und«, er sah Cal in die Augen, »sie ist mein fehlender Teil. Ich habe es deutlich gespürt, als ich ihre Hand berührt habe.«
»Du hast ihre Hand berührt?«
Cayelu nickte. »Ich habe meine Hand gegen den Spiegel gelegt und sie hat dasselbe getan. Ich schwöre dir, Dad, wir haben einander real berührt. Und wir sind dadurch verbunden worden. Wie wenn …« Er suchte nach einem passenden Vergleich. »Wie wenn man das Wasser aus zwei Schalen in einer einzigen vereint.« Er blickte Cal anklagend an. »Verdammt, Dad, warum hast du mir nie gesagt, dass ich eine Zwillingsschwester habe? Und warum lebt sie nicht bei uns? Warum hast du mich all die Jahre in dem Glauben gelassen, dieses elende Gefühl der Unvollständigkeit läge daran, dass ich zur Hälfte ein Mensch bin? Dabei war von Anfang an sie der Teil, der mir fehlt.«
Cal hatte das Gefühl, dass ihm der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Was Cayelu beschrieben hatte, war so eindeutig das Band des Blutes, dass das nur den einen Schluss zuließ, den sein Sohn gerade gezogen hatte: Cayelu hatte eine Zwillingsschwester. »Das habe ich nicht gewusst.« Cal schüttelte den Kopf. »Auf mein Wort, das habe ich nicht gewusst.«
Er erinnerte sich noch gut an die ersten Wochen nach Cayelus Geburt. Mirjana war sehr traurig und verzweifelt und oft in Tränen aufgelöst gewesen. Er hatte das dem »Baby-Blues« zugeschrieben, der Wochenbettdepression. Doch bei Mirjana war sie heftiger gewesen als bei anderen Frauen und hatte bis zu ihrem Tod nicht aufgehört. Sie hatte Cayelu bei jeder sich bietenden Gelegenheit im Arm gehalten oder ihn, wenn er in seinem Bettchen schlief, stundenlang beobachtet und still geweint. Später hatte Cal dieses Verhalten dahingehend interpretiert, dass sie zu dem Zeitpunkt wohl schon ihren bevorstehenden Tod ahnte.
Doch offensichtlich gab es dafür eine ganz andere Erklärung. Mirjana hatte Zwillinge geboren, Cal aber nur ein Kind gegeben. Und auch in der Geburtsurkunde war nur Cayelu – Kyle – eingetragen worden. Wie hatte sie ihm seine Tochter verheimlichen können? Und wo hatte sie all die Jahre gelebt? Wo war sie jetzt?
Cal stand auf. »Gehen wir der Sache auf den Grund. Cayelu, ich möchte mit dir eine Retrospektion durchführen. Eine Rückschau zum Tag deiner Geburt.«
Cayelu stand sofort auf. »Unbedingt. Ich muss wissen, warum Mutter mich von meiner Schwester getrennt und dir nie ein Wort über sie gesagt hat.«
»Ich komme mit.«
»Nein, Cassie. Das machen Cayelu und ich allein. Du versuchst inzwischen herauszufinden, wo eure Schwester wohnt. Wir müssen sie schnellstens zu uns holen, denn ich fürchte …« Er winkte ab. »Zuerst die Retrospektion.«
Er ging mit Cayelu in einen Raum im Keller, der hinter einer Wand verborgen war und nur durch eine Geheimtür betreten werden konnte. Dieser geheime Raum war nicht für die Blicke Außenstehender geeignet, denn er verriet die MacLeods auf den ersten Blick als Anhänger eines magischen Kultes.
In der Mitte des Raums stand ein steinerner Altar, umgeben von einem mit roter Farbe auf den Boden gemalten Pentagramm, in dessen Spitzen jeweils eine rote Kerze stand. An einer Wand befand sich ein Regal mit magischen Gerätschaften. An den Wänden war der Fußboden etwa drei Fuß breit mit weichen Teppichen belegt, auf denen einige Decken, Isomatten, Meditations- und Sitzkissen lagen.
Cal holte eine Kristallkugel aus dem Regal, während Cayelu sich bequem auf einem der Kissen niederließ. Er nahm die Kugel entgegen und versetzte sich in Trance. Cal zündete ein stimulierendes Räucherwerk an und setzte sich anschließend seinem Sohn gegenüber. Als erfahrenem Magier gelang es Cayelu sofort, den erforderlichen Zustand zu erreichen und sich auf die geistige Reise durch die Zeit vorzubereiten. Er starrte in die Kugel.
»Cayelu«, sagte Cal und ließ seine Stimme so tief wie möglich klingen, da diese Tonlage die Trance verstärkte. »Kehre zurück zum Tag deiner Geburt. Sommersonnenwende 1984. Direkt zu dem Moment, nachdem dem du geboren wurdest. Was siehst du dort?«
Cayelus Blick nahm einen abwesenden Ausdruck an. Cal sah, dass in der Kristallkugel die Nebel der Zeit zu wirbeln begannen und sich schließlich klärten. Alles Weitere war nur noch für seinen Sohn sichtbar.
Der begann, wie ein Baby zu wimmern. Gleich darauf sprach er mit der weichen Stimme einer Frau.
»Sie haben ein wunderschönes Baby, Mrs MacLeod. Einen Sohn. Und es ist alles an ihm dran, was er haben muss. Herzlichen Glückwunsch! Haben Sie schon einen Namen für ihn?«
»Kyle«, antwortete Cayelu mit einer anderen Frauenstimme, die Cal nur zu gut kannte. Sie rief ein schmerzhaftes Echo in ihm wach. Cayelu schrie mit der Stimme seiner Mutter schmerzhaft auf.
»Oh, Nummer zwei hat es aber eilig, auf die Welt zu kommen«, sagte die erste Frau. »Keine Sorge, dieses Mal geht es leichter. Sie haben es bald überstanden, Mrs MacLeod.«
Cal konnte nicht verhindern, dass ihm das Herz bis zum Hals schlug. »Geh vorwärts in der Zeit«, wies er seinen Sohn atemlos an, »bis zur«, er schluckte, »zweiten Geburt.«
Cayelu wimmerte erneut wie ein neugeborenes Baby. Dann: »Ein Mädchen diesmal! Sie haben gesunde Zwillinge bekommen. Und wie soll Ihre kleine Prinzessin heißen?«
»Kara«, antwortete Mirjana. »Oh, geben Sie sie mir, Doktor! Beide! Ich will sie wenigstens einmal beide im Arm halten.«
»Aber Mrs MacLeod«, tadelte die Ärztin sanft. »Sie werden Ihre beiden Schätzchen noch oft im Arm halten.«
»Nein.« Mirjana begann zu weinen. »Doktor, Sie müssen etwas für mich tun. Die Frau, die vorhin eine Totgeburt hatte. Sie heißt auch MacLeod, nicht wahr?«
»Ja.«
Das war in der Gegend von Lochinver, wo Cal damals gewohnt hatte, ein verbreiteter Name. Wegen dieses Namens, der in Lochinver nicht auffiel, war er dorthin gezogen, und hatte ihn bis heute beibehalten. Immerhin war der Name jahrhundertealte Familientradition. Auch die Ärztin, in deren Praxis Mirjana entbunden hatte, hieß MacLeod, wie er sich erinnerte.
»Geben Sie ihr meine Kara. Bitte.«
»Das kann ich nicht tun«, protestierte Dr. MacLeod. »Auf keinen Fall. Liebe Mrs MacLeod – Mirjana, Sie schaffen das schon mit den Zwillingen. Ihr Mann ist der beste Fischer im Ort, und er liebt Sie über alles. Er wird auch zwei Kinder lieben.«
Mirjana weinte. »Ich weiß. Aber darum geht es nicht. Meine Kinder sind in großer Gefahr. Es gibt Menschen, die meinen Mann und seine Kinder töten wollen. Was glauben Sie denn, warum wir hier in der Abgeschiedenheit leben? Sie werden meine Kinder töten! Aber niemand außer Ihnen weiß, dass ich Zwillinge habe. Wenn Sie Kara der anderen Frau geben, wird wenigstens sie in Sicherheit sein und leben. Bitte!«
Cals Herz zog sich schmerzhaft zusammen, als er die Mutter seiner Kinder um deren Leben flehen hörte. Ihre Sorge war nur zu berechtigt gewesen. Ein halbes Jahr nach der Geburt war Mirjana von der Gemeinschaft des Lichts ermordet worden.
»Komm zurück, Cayelu.«
Den Rest der Geschichte, wie Mirjana es geschafft hatte, die Ärztin doch noch zu überreden, Kara jener anderen Mrs MacLeod zu geben, konnte er später herausfinden. Sie mussten erst einmal Kara finden und in Sicherheit bringen. Jetzt war Cal vollkommen klar, welcher Art die drohende Gefahr war. Bei Inkubi und Sukkubi erhielt bei einer Zwillingsgeburt nur der Erstgeborene magische Fähigkeiten; der Nachgeborene ging leer aus. Mirjana hatte das gewusst, weil Cal es ihr oft genug als Teil der Antwort auf ihre Frage erklärt hatte, wie es die Seher der Gemeinschaft des Lichts fertigbrachten, ausgerechnet die Mitglieder der Familie Rhu’u aufzuspüren. Die Seher waren in der Lage, die Ausstrahlung der angeborenen Magie über Meilen hinweg zu spüren, wenn sie nicht magisch abgeschirmt wurde.
Mirjana war ein Mensch gewesen und Magie ihr suspekt. Sie hatte Cals Versicherung, dass er ihr gemeinsames Kind ausreichend abschirmen würde, zwar geglaubt, aber sie hatte nicht darauf vertrauen können, dass das klappte. Deshalb hatte sie den aus ihrer Sicht einzigen Ausweg gewählt, um wenigstens eins ihrer Kinder in Sicherheit zu wissen, und das magielose Zweitgeborene weggegeben. Darüber war ihr das Herz gebrochen.
Sie musste das von Anfang an geplant haben. Zumindest von dem Moment an, als sie erfahren hatte, dass sie Zwillinge bekommen würde. Cal hatte anhand ihrer veränderten Aura schon wenige Minuten nach der Zeugung gemerkt, dass sie schwanger geworden war, und hatte mit seiner Magie herausfinden wollen, ob das Kind, das sie erwartete, ein Junge oder ein Mädchen werden würde. Mirjana hatte es ihm verboten, weil sie sich überraschen lassen wollte. Cal hatte ihren Wunsch zwar nicht verstanden, ihn aber respektiert und sich an das Wort gehalten, das sie ihm abgetrotzt hatte, niemals heimlich zu versuchen, das Geschlecht des Kindes herauszufinden. Damit ihm das auch nicht aus Versehen passierte, hatte er seine magische Wahrnehmung ihr gegenüber in den folgenden Monaten permanent abgeschirmt. Mirjana musste bei der ersten Ultraschalluntersuchung bei Dr. MacLeod erfahren haben, dass sie Zwillinge erwartete, und hatte wohl in dem Moment den Entschluss gefasst, das unmagische Zweitgeborene wegzugeben, damit es in Sicherheit wäre.
Weder sie noch Cal hatten ahnen können, wie das menschliche Blut in ihren Kindern sich auf deren magische Fähigkeiten auswirkte. Cayelu hatte sich, abgesehen davon, dass er wie ein menschliches Kind dreizehn Jahre gebraucht hatte, um geschlechtsreif zu werden, statt wie ein reinblütiger Inkubus bereits eine Stunde nach der Geburt ein erwachsener Mann zu sein, ganz normal entwickelt. Auch seine magischen Kräfte hatten die normale dämonische Entwicklung durchgemacht. Doch nach achtundzwanzig Jahren setzte ein abschließender Reifungsprozess ein, im Zuge dessen diese Kräfte ihre endgültige Ausprägung erfuhren und vollständig entfaltet wurden. Bei Cayelu hatte dieser Prozess bereits begonnen, wodurch wahrscheinlich die Vision von seiner Zwillingsschwester im Spiegel initiiert worden war.
Und bei ihr, bei Kara, hatte dieser Prozess offenbar die magischen Kräfte geweckt, die sie gar nicht gehabt hätte, wenn sie nicht zur Hälfte Mensch gewesen wäre. Der Reifungsprozess hatte angefangen, sie zu befreien. Da sie aber nicht in der Lage war, deren Ausstrahlung abzuschirmen, war sie mit Sicherheit auf dem Radar der Seher der Gemeinschaft des Lichts aufgetaucht. Weil sie Cals Tochter war, spürte er die Gefahr, die ihr drohte, ebenfalls. Wenn er sie nicht vor dem Hinrichtungskommando der Gemeinschaft fand, würde er sie nie kennenlernen.
»Carana«, sagte Cayelu. »Ihr wahrer Name ist Carana.« Er blickte Cal an. »Sie erwacht gerade, nicht wahr? Das ist es, was ich fühle. Was wir fühlen.«
Cal nickte. »Und wenn wir sie spüren können …«
»Dann können die Seher von der Gemeinschaft des Lichts das auch«, ergänzte Cayelu und ballte die Faust. »Wie ich diese verfluchte Brut hasse! Verdammt, Dad, warum vernichten wir sie nicht endlich?« Seine Augen glühten für einen Moment rot vor Wut, ehe er sich wieder im Griff hatte.
»Weil wir dann nicht besser wären als sie. Wir Rhu’u haben Seelen, mein Junge. Im Gegensatz zu den meisten anderen Dämonen. Deshalb ist es überaus wichtig, für welchen Pfad wir uns entscheiden. Töten ist nur in Notwehr eine Option.«
»Ich weiß.« Cayelu stand mit einer geschmeidigen Bewegung auf. »Ich helfe Cassie, unsere Schwester zu finden. Als ihr Zwilling wird mir das bestimmt leichter fallen als ihr. Und dann bringe ich sie nach Hause. Hier wird sie in Sicherheit sein. Wenigstens für einige Zeit.«
*
Als Kara erwachte, stellte sie fest, dass es sechs Uhr abends war. Sie hatte fast neun Stunden lang geschlafen und zur Abwechslung keinen Albtraum gehabt. Dafür erinnerte sie sich an einen lebhaften Traum, in dem sie mit einem attraktiven Unbekannten Sex gehabt hatte. Sie stellte fest, dass sie immer noch – oder schon wieder – die Bettrolle umarmt hielt. Das wurde langsam zur Gewohnheit. Vielleicht sollte sie sich tatsächlich in eine Affäre stürzen, um Ben zu vergessen. Aber von Beziehungen hatte sie die Nase voll, und auch eine Affäre war eine Art von Beziehung. Stattdessen wurde Sex ohne Beziehung, der nur der Lust diente, wie sie ihn in ihrem Traum ausgelebt hatte, zu einer echten Option. Fast schon zu einem Bedürfnis.
Dabei passte das gar nicht zu ihr. Sie brauchte immer eine gefühlsmäßige Bindung zu ihrem Partner. Zwar hatte sie grundsätzlich nichts gegen einen One-Night-Stand, aber der Mann musste ihr schon sehr sympathisch sein und sie das Gefühl haben, dass eine Beziehung mit ihm möglich wäre, selbst wenn nur für kurze Zeit. Ohne jegliche Zuneigung mit einem Fremden ins Bett zu gehen, war absolut nicht ihr Ding.
Sie stand auf, duschte und zog sich an, um zum Abendessen zu den Mortimers zu gehen. Dazu hatte sie zwar keine Lust, aber sie hatte es versprochen. Und vielleicht lenkte der Besuch sie von der Sorge um ihren Geisteszustand ab. Wenn sie ehrlich war, fühlte sie intuitiv, dass das Erlebnis vorhin mit dem Mann im Spiegel keine Illusion gewesen war, obwohl sie es sich nicht erklären konnte. Seit sie sich mit ihren Forschungen über alte Volksbräuche und die »Magie« der heidnischen Rituale beschäftigte, war sie zu der Überzeugung gekommen, dass es tatsächlich mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gab, als der normale menschliche Verstand sich erträumen konnte. Deshalb nahm sie schließlich ihren ganzen Mut zusammen und stellte sich vor den Badezimmerspiegel, halb fürchtend, halb hoffend, dass er wieder darin erschien. Doch sie sah nur ihr eigenes Spiegelbild. Sie legte die Hand gegen den Spiegel.
»Bist du da?«
Sie kam sich lächerlich vor. Bis sie eine Männerstimme aus dem Spiegel rufen hörte. »Carana!« Hastig riss sie die Hand zurück und flüchtete aus dem Badezimmer. Was hatte das nur zu bedeuten?
Sie verließ die Wohnung und ging zu Fuß zu den Mortimers, die 15 Lutton Place gegenüber der St. Peter’s Church wohnten, nur eine gute halbe Meile entfernt. Die frische Luft tat ihr wieder gut; allerdings beschlich sie ein ungutes Gefühl, je länger sie auf der Straße war. Mehrmals verspürte sie den Impuls, sich umzudrehen und sich zu vergewissern, dass niemand sie verfolgte, denn das Gefühl, dass sie von unsichtbaren Augen beobachtet wurde, verstärkte sich mit jedem Schritt. Lange bevor sie das Haus der Mortimers erreichte, musste sie sich zusammenreißen, dass sie nicht wie von Furien gehetzt anfing zu laufen.
Deshalb war sie mehr als froh, als sie nach etwa einer Viertelstunde endlich bei den Mortimers ankam und an der Tür klingelte.
Dr. Mortimer öffnete nur Sekunden später. »Kara, wie schön, dass Sie gekommen sind. Kommen Sie rein! Das Essen ist gleich fertig.«
In der Tür zur Küche erschien Linda Mortimer, eine schlanke Frau Anfang sechzig, die sehr viel jünger wirkte. Sie lächelte Kara zu. »Hallo Kara. Schön, dass Sie uns mal wieder besuchen.«
»Guten Abend, Mrs Mortimer.«
»Was möchten Sie trinken? Tee? Oder Wein?« Sie wartete Karas Antwort nicht ab. »James, kümmerst du dich um Kara?«
»Natürlich, meine Liebe.« Er machte eine einladende Handbewegung zum Wohnzimmer hin und ließ Kara vorangehen.
Als sie das Wohnzimmer betrat, stand der Mann auf, der auf der Couch gesessen hatte und in die Betrachtung eines Fotos vertieft gewesen war. Es stellte Mortimers verstorbene Schwester Alice und ihren Mann Donald dar, Jarod Kanes Eltern. Jarod sah noch genauso aus, wie Kara den Mittdreißiger in Erinnerung hatte. Er trug lediglich sein dunkles Haar etwas länger. Allerdings hatte sie vergessen, wie intensiv blau seine Augen waren. Die sich bei ihrem Anblick erstaunt weiteten, ehe er sie verengte und die Stirn runzelte, bevor er sie so intensiv anstarrte, als wäre sie ein gefährliches Raubtier.
Mortimer fiel das auch auf. »Jarod, du schaust Kara so finster an, als wäre sie eine von den Verbrechern, die du jagst. Sei ein braver Junge und sag ihr guten Tag.«
»Guten Tag, Ms MacLeod.«
»Guten Abend, Mr Kane.«
Mortimer schob Kara zu einem Sessel und forderte sie mit einer Handbewegung auf, Platz zu nehmen. »Ach, Kinder, ihr tut ja so, als wärt ihr euch noch nie begegnet. Ich erinnere mich genau, dass ihr euch beim letzten Mal geduzt habt. Also seid bitte nicht so förmlich.«
Kara hatte nichts gegen Förmlichkeit. Gegenüber Jarod Kane bevorzugte sie so viel Distanz wie möglich. Die Art, wie er sie immer noch ansah, hatte etwas Bedrohliches. Gleichzeitig verspürte sie das Bedürfnis, ihn ins Schlafzimmer zu zerren und ihm die Kleider vom Leib zu reißen. Und diese Regung lag nicht nur daran, dass er mit seiner sportlichen Figur, dem ebenmäßigen Gesicht und seinen auffallenden Augen zum Anbeißen gut aussah. Was war nur mit ihr los, verdammt?
»Jarod hat mir, bevor Sie kamen, von seiner Arbeit beim FBI erzählt«, riss Mortimers Stimme sie aus ihren Gedanken.
»Fortbildung, Onkel«, verbesserte Jarod. »Zum Thema FACS – Facial Action Coding System. Gefühlserkennung durch die Interpretation der Mikroreaktionen des Gesichts.« Er blickte Kara eindringlich an.
Sie fühlte, wie ihr das Blut aus den Wangen wich, und schluckte.
»Blässe, zuckende Augenlider, flache Atmung, geweitete Pupillen – du hast Angst, Kara.«
Sie konnte gerade noch verhindern, dass sie aufsprang und wie ein gehetztes Tier aus der Wohnung rannte.
»Jarod, bitte«, rügte Mortimer. »Kara hat doch keinen Grund, Angst zu haben.« Er legte ihr die Hand auf den Arm und streichelte ihn beruhigend.
»Sieht man mir das so deutlich an?«, fragte sie. Ein Dementi hätte zumindest Jarod ihr nicht geglaubt.
Er nickte. »Selbst ohne Ausbildung in FACS. Ich hoffe, dass nicht ich der Grund für deine Angst bin.« Er lächelte. Es ließ ihn noch sympathischer aussehen. Allerdings erreichte das Lächeln nicht seine Augen.
»Ich schlafe schlecht in letzter Zeit. Und obendrein hatte ich auf dem Weg hierher das Gefühl, verfolgt zu werden. Aber das habe ich mir wahrscheinlich nur eingebildet.« Sie zwang sich zu einem Lächeln. »Stimmt es, dass FACS beinahe so ist wie Gedankenlesen?«
Jarod lächelte; ein echtes Lächeln diesmal. »Leider – oder zum Glück – nicht wirklich. Aber es kommt einem manchmal so vor.« Er wurde ernst. »Wurdest du in letzter Zeit von irgendwem bedroht? Hattest du mit wem Ärger?«
»Jarod, bitte.« Mortimer schüttelte den Kopf. »Wir wissen, dass du bei der Polizei bist, auch ohne dass du das durch ein Verhör unter Beweis stellst.«
Jarod grinste; es wirkte verlegen. »Berufskrankheit, Onkel James. Aber falls du einen begründeten Verdacht hast, dass dich jemand stalkt, Kara, dann scheue dich bitte nicht, sofort zu mir zu kommen. Ich gehöre immerhin dem CID an. Stalking fällt in mein Ressort.