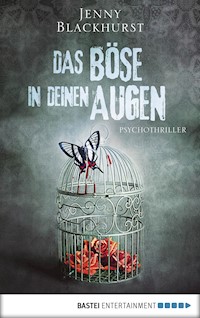
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Niemand hat Angst vor einem kleinen Mädchen, oder doch?
Als die Kinderpsychologin Imogen Reid den Fall der elfjährigen Ellie Atkinson übernimmt, weigert sie sich, den seltsamen Gerüchten um das Mädchen zu glauben. Ellie sei gefährlich, so heißt es. Wenn sie wütend wird, passieren schreckliche Dinge. Imogen hingegen sieht nur ein zutiefst verstörtes Kind, das seine Familie bei einem Brand verloren hat und ihre Hilfe benötigt. Doch je näher sie Ellie kommt, desto merkwürdiger erscheint ihr das Mädchen. Dann erleidet auch Imogen einen schrecklichen Verlust - und sie fürchtet, dass es ein Fehler war, Ellie zu vertrauen ...
Jenny Blackhurst schreibt Psychologische Spannung mit Gänsehauteffekt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 519
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
Epilog
Danksagung
Jenny Blackhurst
DAS BÖSEIN DEINENAUGEN
PSYCHOTHRILLER
Aus dem Englischen vonSabine Schilasky
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:Copyright © 2017 by Jenny BlackhurstTitel der englischen Originalausgabe: »The Foster Child«Originalverlag: Headline Publishing Group, London
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Anita Hirtreiter, MünchenTitelillustration: © Jitka Saniova/Trevillion Images;© Christina Mitchell/Trevillion Images;© Olga Nikonova/shutterstock; © CureLala/shutterstockUmschlaggestaltung: Manuela Städele-Monverde
eBook-Erstellung: Olders DTP.company, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-5649-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Mum und Dad –ihr hättet nicht mehr für mich
Prolog
»Imogen? Sind Sie das?«, fragt mich jemand ganz außer Atem. Die panische Stimme am anderen Ende der Leitung erkenne ich sofort.
»Sarah, beruhigen Sie sich«, sage ich. »Was ist los?«
»Es ist wegen Ellie.« Ich höre, dass ihre Stimme zittert. »Sie ist mittags aus der Schule weg, und ich weiß nicht, wo sie ist.«
Ich seufze. Das ist doch schon längst nicht mehr mein Problem.
»Ich bin nicht mehr die zuständige Fallbearbeiterin für Ellie, Sarah. Ich wurde abgezogen. Ihr Schulschwänzen fällt wirklich nicht mehr in meinen Zuständigkeitsbereich.«
»Sie verstehen das nicht.« Sarahs Stimme wird dringlicher. »Es ist nicht Ellie, um die ich mir Sorgen mache. Sondern Lily!«
Unwillkürlich wandert meine Hand zu meinem Bauch, bevor mir wieder bewusst wird, dass ich das Baby verloren habe.
»Was ist mit Lily, Sarah?«
Sarah Jefferson schluchzt auf. »Sie wird vermisst. Ellie hat das Baby mitgenommen.«
Kapitel 1
Ellie
Ellie liegt auf einem Bett, das nicht ihres ist, in einem Zimmer, das niemandem gehört, und lauscht der Familie von jemand anderem, die unten fernsieht. Mit dem Daumen reibt sie an dem scharfkantigen Reibrad des Feuerzeugs in ihrer Hand. Orangefarbene Flammen springen auf und verschwinden wieder, wenn Ellie loslässt.
Ratsch, Flamme.
Ratsch, Flamme.
Ratsch, Flamme.
Sie streicht mit den Fingerspitzen oben durch die Flamme und stellt verwundert fest, dass es nicht wehtut. Sie probiert es noch einmal, lässt die Finger ein klein wenig länger in der Flamme. Diesmal fühlt es sich heiß an, tut aber nicht weh. Sie schiebt ihren Finger ins Blaue der Flamme und hält ihn dort, bis Schmerz hindurchfährt, der sich jedoch nicht schlimm anfühlt. Er ist herrlich. Hat ihre Familie das gefühlt? Diesen Schmerz, diese Erleichterung? Sie wiederholt es, hält die Flamme nun über ihren Handballen, ganz ruhig, und wartet auf den Schmerz. Als er kommt, ist er intensiver, und erschrocken lässt sie den Anzünder los. Ihr Herz rast, trotzdem tut sie es wieder … ratsch, Flamme.
In dem Moment, in dem die verbrannte Haut zu riechen beginnt, geht die Tür auf. Ihre Pflegeschwester Mary steht da, die große Augen bekommt und deren Mund aufklafft wie der einer Comic-Figur, als sie sieht, was Ellie tut.
»Ellie! Was machst du denn?« Mary packt grob ihre Hand und reißt sie weg von der Flamme. »Bist du irre? Du verletzt dich doch.«
Plötzlich brennt ihre Haut vor Schmerz, und Ellie sieht hinunter zu den Blasen, die sich dort bilden.
»Ich … ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe bloß gespielt. Es hat nicht mal wehgetan.« Eher desinteressiert betrachtet sie ihre Handfläche. »Jetzt aber schon.«
Mary legt sanft eine Hand auf Ellies Arm.
»Komm, ich verarzte das. Wir tragen Salbe auf und machen einen Verband darum, und Mum sagen wir, dass du dich geschnitten hast, als du mir beim Kochen helfen wolltest.«
Ellie starrt die blasige Haut an, stellt sich vor, wie sich die Blasen ihren Arm hinauf ausbreiten, ihre Schultern und ihren Hals bedecken.
Mary schüttelt den Kopf, als könnte sie nicht glauben, was sie sieht. »Ich behalte das im Auge und wechsle den Verband täglich. Und falls es aussieht, als würde es schlimmer werden, müssen wir uns vielleicht eine andere Geschichte ausdenken.« Sie sieht Ellie freundlich an. »Warum tust du dir so etwas an? Glaubst du, deine Mum würde sich freuen, wenn sie sieht, dass du dich verletzt?«
»Aber meine Mum kann ja gar nichts sehen! Meine Mum ist tot.«
Ellie fühlt sich innerlich völlig kaputt, wie eine Orange, die von innen nach außen vergammelt; die Schale ist noch gut, das Innere aber giftig. Sie ist nicht wie Mary, wie überhaupt keiner hier. Einige von ihnen erkennen es – das merkt sie den Dorfbewohnern an, wenn sie ihnen auf der Straße begegnet und diese die Seite wechseln, ihre Kinder ein bisschen fester an die Hand nehmen, ohne genau zu wissen, warum. Ellie hingegen tut es. Sie weiß, was die anderen in ihr sehen können.
»Aber sie passt auf dich auf, das weißt du doch, nicht wahr?«, sagt Mary. »Vom Himmel aus beobachtet deine Mum alles, was du machst. Und sie möchte, dass du glücklich bist, dass du auf dich achtest. Sie möchte, dass du groß wirst und eine eigene Familie gründest. Das hätte sie gewollt, wenn sie hier wäre, und sie will es immer noch. Du musst versuchen, dich einzuleben, Ellie. Ich weiß, dass es schwer ist und dass wir nicht deine Familie sind, aber du musst es wirklich versuchen.«
»Und wenn ich es nicht versuchen will, Mary? Was ist, wenn ich gar nicht Teil deiner Familie sein will?«
»Mir ist klar, wie schwer es für dich sein muss. Ich habe hier schon eine Menge Kinder kommen und gehen sehen, eine Menge wütende Kinder, die keine Zuneigung kennen. Aber du bist anders, Ellie. Du weißt, wie es ist, geliebt zu werden und ein Zuhause zu haben, wo man sich sicher und geborgen fühlt. Es mag jetzt nicht danach aussehen, doch eines Tages wirst du das wieder haben. Du musst immer daran denken, dass nichts von alledem deine Schuld ist. Du hast dir nichts vorzuwerfen, Ellie, egal, was andere sagen mögen.«
Ellie nickt, obwohl ihr Bauchgefühl ihr sagt, dass Mary unrecht hat. Sie mag älter sein und glauben, alles zu wissen, aber sie kennt Ellie überhaupt nicht. Niemand kennt sie.
Kapitel 2
Imogen
Ein Baldachin aus Baumkronen überspannt die Straße in das Dorf Gaunt und sprenkelt den Asphalt mit Sonnenlichtflecken, die durch das Laub dringen, sodass ich blinzeln muss. Es fühlt sich an, als würden wir durch einen wunderschön gesäumten Tunnel auf das letzte Ziel zufahren, das wir jemals erreichen werden. Das Ende der Straße.
Thomas Wolfe sagte, man kann nicht zurück, und vielleicht hätte ich das bedenken sollen, ehe ich meinen Lebenslauf losschickte und eine Reihe von Ereignissen in Gang setzte, die mich nach über fünfzehn Jahren in meinen Heimatort zurückführen. Vielleicht war es dumm von mir.
Gaunt erstreckt sich so karg und abweisend vor uns, wie der Name nahelegt: ausgehöhlt, ausgemergelt. Die ganze Gemeinde mutet wie ein Raum in einem Spiegelkabinett an, wo jeder Winkel schief und verzerrt ist, sodass es egal ist, aus welcher Warte man hinsieht, weil es immer falsch wirkt. Häuser mit grauen Fassaden stehen einsam und verlassen. Einwohnerzahl: rückläufig.
Für Außenstehende könnte Gaunt wie ein einstmals prächtiger Ort anmuten, könnte der eine oder andere Prunkbau oder eine auffällige Skulptur als Indiz gelten, dass irgendwann mal jemand Großes mit dieser seltsamen Gemeinde vorhatte – Pläne, die längst aufgegeben wurden. Sogar als Kind faszinierte mich mein Dorf ebenso sehr, wie es mich abschreckte. Dieselbe Anziehung, die Bauunternehmer und Bauträger hergelockt hatte, und dasselbe unerklärliche Unbehagen, das sie wieder vertrieb – stets mit Geschichten von unbrauchbarem Land und unhaltbaren Planungsvorschriften … denn wer will schon zugeben, dass er eine Baugelegenheit wegen eines unguten Gefühls sausen ließ? Manche haben dabei sehr viel Geld verloren.
Ich kann mich kaum mehr an damals erinnern. Zu lange habe ich sicher im mondänen Dunst der Großstadt gelebt, gezielt mein Leben hier vergessen, sodass ich mir kaum die Vergangenheit ins Gedächtnis rufen kann; nicht einmal, wenn ich die Augen fest schließe und mich so angestrengt erinnere, dass ich davon Kopfschmerzen bekomme.
Trotz des strahlenden Sonnenscheins ist die Luft beißend kalt. Ein frischer Tag für einen Neuanfang, hatte Dan heute Morgen gesagt. Ein gutes Omen. Ein Zeichen, dass wir das Richtige tun.
»Ich glaube nicht an so was«, hatte ich schmunzelnd erwidert. Mein Gesichtsausdruck musste mich jedoch verraten haben, denn mein Mann legte sanft eine Hand auf meinen Ellbogen und sagte: »Es wird super. Wie Ferien auf dem Lande. Wir beide werden endlich mal Zeit für uns haben.« Er sprach nicht aus, woran er zweifellos dachte – eine eigene Familie –, und dafür war ich ihm dankbar.
»Ferien? Ich dachte, Autoren haben nie frei. Und ich habe ganz sicher keine. In vier Tagen fange ich in meinem neuen Job an.«
»Du weißt, was ich meine. Ferien von alldem hier«, hatte er gesagt und zum Fenster gezeigt, hinter dem es von Menschen wimmelte, die geschäftig hin und her eilten, ohne von ihren Smartphones aufzublicken. Ein Mann in einem Ding, das man nur als Patchwork-Cape bezeichnen konnte, verteilte leere Umschläge, von denen ich aus Erfahrung wusste, dass sie Good Vibrations enthalten sollten, und Autofahrer rammten die Handballen auf ihre Hupen, sowie der Wagen vor ihnen unter 35 fuhr. »Von Menschenmassen. Und dem ganzen Druck. Aus der Tretmühle raus. Es ist genau das, was wir nach dem Mist, den du durchgemacht hast, brauchen.« Der Mist, den ich durchgemacht habe. Als könnte man das, was in London geschehen war, schlicht als unglückliche Umstände abtun.
Die ersten Häuser tauchten auf; umgebaute Scheunen und Neubauten, die aus dem Boden schossen, wo ich früher nichts als Felder kannte, seit sich das Baugewerbe wieder erholte. Allem Anschein nach wollte jemand Gaunt eine zweite Chance geben. Dan stupst mich an und zeigt hin.
»Siehst du das? Wenn wir das Haus deiner Mum verkaufen, könnten wir uns etwas wie das kaufen. Oder bauen.«
Ich grinse. »Was verstehst du denn schon von Hausbau? Abgesehen von dem in deinen Fantasiewelten. Häuser bauen sich nicht ganz so leicht, wie sie sich erdichten lassen.«
»Und das von jemandem, der noch nie versucht hat, ein Wüstenschloss aus der Perspektive eines Orcs zu beschreiben.« Dan setzt eine übertrieben beleidigte Miene auf, ehe er mein Grinsen erwidert. »Okay, vielleicht bleiben wir erst mal beim Kaufen. Irgendwas Helles. Und groß soll es sein.«
»Mit einem Swimmingpool und unseren eingemeißelten Initialen im Marmorboden des Eingangsbereichs.« Ich lache. »Ich fürchte, dir ist nicht ganz klar, wie viel das Haus wert ist. Auf jeden Fall nicht genug, dass meine Mutter jemals darüber nachgedacht hatte, es zu verkaufen.« Das Wort »Mutter« versetzt mir einen Stich. Sie ist nicht mehr da, Imogen.
Kein grauer Nebel wirbelt vor uns auf, als wir uns dem Dorf nähern. Keine uralte Frau warnt uns mit arthritischem Finger, nicht weiterzufahren. Kein kohlschwarzer Rabe hockt auf dem Schild mit der Aufschrift »Willkommen in Gaunt« und krächzt leise »Nimmermehr«. Und dennoch spüre ich eine eisige Furcht gleich Fingern, die sich um meine Kehle schlingen, sodass ich kurzzeitig um Luft ringe. Das Ortsschild ist verwittert und verrostet und die Schrift derart verblichen, dass man sich alles andere als »willkommen« fühlt. Während ich hinschaue, scheint es sich zu schwärzen, als würde dunkler Schimmel auf der Fläche erblühen. Plötzlich habe ich ein Engegefühl in der Brust, und die Straße verschwimmt vor meinen Augen. Ich greife nach Dans Arm.
»Fahr da nicht lang.«
Meine Stimme ist ein kaum verständliches Raunen. Dan sieht zu mir. Sorge überschattet seine Züge, und er verlangsamt, bis der Wagen nur noch im Schneckentempo fährt.
Ich blicke zu dem Schild. Es ist immer noch alles andere als einladend, jetzt jedoch frei von Schwarzschimmel, und ich merke, dass ich vor Scham rot werde. Was ist nur in mich gefahren?
Da vorne ist Gaunt. Der Ort beobachtet mich, wartet auf mich.
»Ja, mir geht es gut«, schwindle ich. »Ich dachte bloß, dass wir uns vorher in der High Street was zu essen besorgen könnten. Was ist, wenn wir noch keinen Strom im Haus haben?«
Dan nickt kurz, doch die steile Falte zwischen seinen Brauen glättet sich nicht. Neuerdings ist er dauernd um mich besorgt.
»Gute Idee«, stimmt er zu, schaut sich über die Schulter um und blinkt nach rechts. »Darauf hätte ich auch von allein kommen sollen. Ich weiß ja nicht, wie du darüber denkst, aber ich bezweifle, dass das Angebot in deinem kleinen Ort sonderlich vielseitig und reichhaltig ist.«
»Es ist nicht mein …«, beginne ich und breche achselzuckend ab. Wenigstens wird das Pochen in meiner Brust weniger. »Es gibt einen Fish & Chips-Laden … oder gab es früher zumindest.«
Dan fährt an der Abzweigung zu unserem Haus vorbei und direkt zur High Street, die nicht einmal eine Meile entfernt ist. Ich erinnere mich, wie ich früher mit Pammy die lange schmale Landstraße dorthin zu Fuß gegangen bin, wie wir ältere Jungs überredeten, uns Alkohol zu kaufen, mit dem Versprechen, ihnen etwas abzugeben. Wir versuchten, einen Aushilfsjob in dem Schnellrestaurant zu bekommen, hatten aber keine Chance gegen Mädchen wie Michelle Hoffman oder Theresa Johnson. Ich frage mich, was die heute machen, und hoffe insgeheim ein wenig gehässig, dass sie immer noch in dem Eckladen jobben.
»Ich finde es klasse, dass wir von allem das Beste haben«, bricht Dan das grüblerische Schweigen, in das wir beide verfallen waren. »Eine wunderschöne Landschaft um uns herum und passable Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Ich kann immer noch morgens los und Frühstück besorgen …«
»Immer noch?« Ich lache bei der Vorstellung, wie mein Mann gut gelaunt Kaffee und frische Brötchen beim Bäcker holt. »Wann hast du das je gemacht? Ich muss zugeben, dass ich mir einen Hausmann anders vorgestellt hatte. Mir schwebte da eher eine Haushaltshilfe vor, kein Spätpubertierender, der Netflix guckt und den Kühlschrank leer isst.«
»Das ist gemein. Ich bin kein Hausmann, sondern Künstler.«
»Tja, Mr. Bestseller, während ich all die Kinder gebäre, auf die du so wild bist, darf ich doch wohl wenigstens erwarten, dass du morgens Kaffee und frische Brötchen holst.«
Dan strahlt, und sofort bereue ich meine Unbedachtheit. Ich darf nicht vergessen, dass jede Bemerkung zu diesem Thema ihn nur in seinem Wunsch befeuert, so bald wie möglich eine Familie zu gründen. Er ahnt nicht, wie schmerzhaft sich mein Bauch bei dem Wort »Baby« verkrampft. Ich sehe zum Seitenfenster hinaus und hoffe, damit diese Unterhaltung zu beenden.
Der Samstagnachmittag in der High Street ähnelt London in den frühen Morgenstunden. Ich blicke durch die Windschutzscheibe nach vorn zu ein paar Mädchen, die sich auf dem Gehweg gegenüberstehen. Die eine hat langes dunkles Haar, das ihr ins Gesicht hängt und es verdeckt. Sie sieht wie versteinert aus, während die andere, hübsch, blond und viel zu aufreizend gekleidet, sich näher zu ihr beugt. Vielleicht soll das ein Spiel sein oder so, obwohl mir diese Szene komisch vorkommt. Ich will schon etwas sagen, als wir an ihnen vorbeifahren und die Blonde einige unsichere Schritte rückwärts auf die Straße zu macht.
»Pass auf«, warne ich Dan. »Sie sieht –«
Ich schreie auf, als das Mädchen vor uns auf die Straße stolpert. Dann höre ich das Kreischen der Bremsen und einen dumpfen Knall.
Kapitel 3
Ellie
Der Tag zieht sich hin, bis er sich so lang anfühlt wie die gesamten Sommerferien. Obwohl die Schule vor sechs Wochen wieder angefangen hat, werden sie erst jetzt zu den Geschäften mit Schuluniformen geschleift, um Mary einige neue Blusen zu besorgen. Sie schien praktisch über Nacht Brüste bekommen zu haben, denkt Ellie, und garantiert würde sie ihre alten, ausgeleierten Blusen mit Grauschleier bekommen. Mary hat miese Laune, seit sie das mit dem Baby erfahren hat, und außer mit Ellie spricht sie mit so gut wie keinem.
Sarah meckert in dem gefühlt tausendsten Laden über die Preise. Sie hat nur ein begrenztes Budget zur Verfügung, aber trotzdem ganz klare Vorstellungen, was sie alles kaufen möchte, und will weder von der einen noch von der anderen abweichen, egal wie sehr sich die arme junge Verkäuferin bemüht, ihr zu erklären, dass sie schon der günstigste Anbieter in der Stadt seien. Sie würden meilenweit in eine andere Stadt fahren müssen, denn Gaunt hat kein Geschäft mit Schuluniformen, geschweige denn mehrere, unter denen man wählen kann. Ellie tritt mit der Schuhspitze gegen einen der Kleiderständer, und Mary wirft ihr einen mitleidigen Blick zu, als sie hereinkommt. Naomi Harper. Als wäre der Tag nicht schon schlimm genug. Naomis Mutter begrüßt Sarah wie eine alte Freundin, dabei hat Ellie die beiden bisher kaum mehr als ein »Hallo« wechseln gesehen. Die zwei Frauen verfallen in einen Wechselgesang von »So ein Zufall, dass wir uns hier treffen« und »Wie geht es euch?«. Naomis Mum sieht ihre Tochter schwärmerisch an und verkündet, diese sei »in den letzten Wochen praktisch in die Höhe geschossen«. Sie ahnt ja nicht, denkt Ellie boshaft, dass ganz gleich ist, wie lang die Röcke sind, die sie kauft, ihr kleiner Schatz sowieso den Bund umkrempelt, sobald die Mutter vom Schultor verschwunden ist. Mary, die vier Jahre älter ist und daher kaum weiß, wer Naomi Harper überhaupt ist, sieht Ellie fragend an, bekommt aber nur ein gleichgültiges Schulterzucken als Antwort.
»Gott, ich hätte nicht gedacht, dass ich deine hässliche Visage auch noch am Wochenende sehen muss«, faucht Naomi mit einer Boshaftigkeit, wie man sie von einer Zwölfjährigen nicht vermuten würde. Ellie malt sich aus, wie ein Pfeil aus dem Nichts angeflogen kommt, Naomis linkes Auge durchbohrt und Eiter und Blut aus der zerstörten Höhle treten, sagt aber nichts.
»Sprichst du eigentlich nie?« Naomi ist sichtlich verärgert, weil eine Reaktion von Ellie ausbleibt. Wie ein Kind, das in einem Wespennest stochert und beleidigt ist, weil nichts rausgeflogen kommt. »Na los, Smellie-Ellie, sag was.«
Ellie fühlt, wie sie die Hände zu Fäusten ballt, sieht, wie ihre Fingerknöchel weiß werden. Sie weiß, dass sie nicht stinkt und es bloß ein dämlicher Reim auf einen blöden Namen ist. Warum reimt Naomi sich nicht mit etwas Ekligem?
»Geh weg«, murmelt sie. Ihr ist schmerzlich bewusst, dass es das Dümmste ist, was sie sagen könnte. Mary sieht sich wieder die Accessoires an, und sosehr Ellie sich auch bemüht, ihre Pflegeschwester telepathisch auf sich aufmerksam zu machen, gelingt es ihr nicht, Mary dazu zu bringen, dass sie sich umdreht und Naomi die Faust ins Gesicht schmettert. Also betet Ellie, dass Sarah sich umdreht und sagt, dieser Laden sei viel zu billig für sie. Sie sehnt sich danach, das selbstgefällige Grinsen aus Naomis Gesicht und dem ihrer fiesen Mutter verschwinden zu sehen. Doch nichts von alledem geschieht. Was hingegen passiert, ist, dass Naomi Harper blitzschnell und ohne Vorwarnung mit ausgestrecktem Arm vorschnellt, eine Reihe Turnschuhe aus dem Regal neben Ellie schleudert und wieder zurückspringt, bevor jemand etwas mitbekommt.
»Ellie!«, ruft Sarah aus und kommt herüber, um die Bescherung aufzuräumen. Ihr Gesicht ist dunkelrot angelaufen. »Warum hast du das gemacht?«
Es ist zwecklos zu widersprechen. Sarah hört ihr so oder so nicht zu, und Naomi wirft ihrer Mutter einen Blick zu, von dem ganz leicht zu erraten ist, was er bedeuten soll: Habe ich es dir nicht sagt? Einzig Mary sieht skeptisch von Ellie zu ihrer Mitschülerin. Sie scheint als Einzige zu erkennen, was hier vor sich geht.
»Darf ich draußen warten?«, fragt Ellie, denn sie merkt, dass sie wütend wird, und weiß, was passiert, wenn sie die Beherrschung verliert. Sosehr sie Naomi in diesem Moment auch hasst, kann sie die Situation nur weiterhin unter Kontrolle behalten, wenn sie sich zurückzieht.
»Ich komme mit dir«, bietet Mary an, und Ellie atmet auf. Mary ist für sie eine Beschützerin, eine Vertraute. Ihre Erleichterung ist indes nur von kurzer Dauer, denn Sarah schüttelt den Kopf. »Du musst noch die Bluse anprobieren, Mary. Ellie ist alt genug, um fünf Minuten alleine draußen zu warten.«
Natürlich ist sie alt genug, und wäre es damit getan, könnte alles gut sein. Wenn Naomi drinnen geblieben wäre. Doch Minuten später steht sie draußen neben Ellie und flüstert ihr giftige Worte ins Ohr.
»Jeder in der Schule will wissen, wieso du so komisch bist, weißt du das?«, zischt sie. Sie steht so dicht neben Ellie, dass diese ihren warmen Atem auf der Wange fühlt. Ellie sagt nichts. Zwar ist ihr klar, dass ihr Schweigen das andere Mädchen erst recht aufstachelt, doch sie fürchtet, ihre Stimme könnte sie verraten.
»Aber ich weiß es«, sagt Naomi sachlich. Sie tritt einen Schritt zurück, vermutlich ahnend, dass ihre nächsten Worte kein Stochern im Wespennest sein werden, sondern eher dem entsprächen, selbiges mit beiden Händen zu packen und auseinanderzureißen. »Willst du wissen, was ich weiß?«
»Nein«, antwortet Ellie. Ihr Herz schlägt immer schneller, und ihre Oberarme beginnen zu kribbeln. Sie weiß, dass etwas passieren wird, und sie kann es nicht aufhalten. Alles, was sie tun kann, ist beobachten, eine zufällige Zeugin dessen werden, was hier entsteht. »Halt den Mund.«
»Hast du gerade gesagt, ich soll den Mund halten?«, fragt Naomi ungläubig. Sie hat ja keinen Schimmer. Noch nicht.
»Hör einfach auf. Geh wieder rein«, drängt Ellie sie, während sie spürt, wie die Wut in ihr anschwillt, ähnlich einem kleinen Wollknäuel, das aufgewickelt und immer größer und fester wird.
»Glaubst du, du kannst mir Angst machen? Sehe ich etwa ängstlich aus?«
Ellie starrt sie an, und ihre dunklen Augen werden hart vor Zorn. Solltest du aber sein, Naomi Harper. Solltest du aber sein.
»Was machst du?«, fragt Naomi, immer noch arrogant, immer noch mit der Haltung von jemandem, der eine Antwort erwartet, nun allerdings auch mit einem Hauch von etwas anderem, einer leisen Unsicherheit, vielleicht sogar Angst. »Gott, du bist so schräg.« Sie macht einen Schritt vorwärts und streckt eine Hand aus, um Ellie gegen die Schulter zu stoßen.
»Geh weg«, befiehlt Ellie, lauter diesmal, und Naomis Hand sinkt nach unten, ohne sie zu berühren. Ellie hat die Hände an ihren Seiten zu Fäusten geballt und kneift die Augen fest zu. Reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen.
»Was soll das?«, fragt Naomi und tritt einen Schritt zurück. »Was murmelst du da? Lass das. Hör auf damit!« Sie geht noch einen Schritt zurück und stolpert, weil ihr Fuß unglücklich aufsetzt.
Ellies Worte sind nun lauter, die Augen noch fest geschlossen. Immer wieder wiederholt sie dieselben Worte. »Geh weg, geh weg, geh weg.«
Naomi bemerkt kaum, wie ihre Ferse auf die Gehwegkante trifft, doch ihr Herz erkennt den scheußlichen Moment, in dem sie das Gleichgewicht verliert und in den Verkehr kippt. Obwohl hinter ihr eine Hupe schrillt, Bremsen quietschen und Leute schreien, kann Naomi Harper nichts hören als die wiederholten Worte …
»Geh weg, geh weg, geh weg.«
Kapitel 4
Imogen
Die Vollbremsung schleudert mich nach vorn, und ich nehme die Hände von meinen Augen. Mir graut vor dem Anblick, das Mädchen zerquetscht und schwer verletzt auf der Straße liegen zu sehen. Stattdessen sehe ich, wie es sich benommen aufsetzt, und vor unserer Stoßstange ist der Wagen, den Dan gerammt hat, als er dem Kind auswich. Ich stürze mich buchstäblich raus und zu dem Mädchen. Als ich mich neben es knie, kommen zwei Frauen aus einem Laden in der Nähe gerannt, dicht gefolgt von einem Mädchen im Teenager-Alter. Die erste Frau stößt einen gellenden Schrei aus, der die Luft förmlich durchschneidet.
»Naomi! Kind!« Die Frau wirft sich auf die Straße und zieht das benommene Mädchen an ihre Brust. »Ruft einen Krankenwagen! Was ist passiert, mein Schätzchen?«
Naomi, die starr vor Schock ist, sieht nun abwechselnd zu dem Mädchen auf dem Gehweg und dem Wagen. Furcht und Verwunderung spiegeln sich in ihren Augen.
»Sie ist vor unser Auto gefal …«, beginne ich zu erklären, weil ich dringend jedwede Schuld von uns weisen will, doch die Frau sieht mich nicht mal an.
»War sie das?« Naomis Mutter zeigt mit dem Finger auf das Mädchen, das auf dem Gehweg steht, und Naomi nickt. Die Frau richtet sich auf und stürmt mit wutverzerrtem Gesicht auf das Mädchen zu. »Was hast du mit ihr gemacht?«
Die andere Frau und das junge Mädchen stellen sich schützend vor sie, und die Frau – die Mutter? – klingt ernstlich besorgt.
»Ellie, was ist passiert? Was hast du mit Naomi gemacht?«
Ellie bleibt stumm, starrt immer noch Naomi an. Ist das Wut in ihrem Blick? Oder Angst?
»Du hättest sie umbringen können!«, kreischt Naomis Mutter. »Sie hat versucht, sie umzubringen!«
»Jetzt warten Sie mal«, mische ich mich ein, strecke eine Hand vor und versuche, die Lage zu beruhigen, ehe sie außer Kontrolle gerät. Was bildet diese Frau sich ein, ein unter Schock stehendes Mädchen anzuschreien? »Ich verstehe, dass Sie in Sorge um Ihre Tochter sind, aber es besteht kein Grund, wilde Anschuldigungen zu äußern.«
»Verzeihung, wer sind Sie?« Naomis Mutter funkelt mich wütend an, und mir wird sofort klar, dass ich die Frau nicht ausstehen kann.
»Offensichtlich die Einzige, die gesehen hat, was wirklich passiert ist. Dieses Mädchen, Ellie, nicht wahr?« Ich drehe mich zu Ellie um, die immer noch kein Wort gesagt hat. Ellies Mutter nickt. »Ellie war nicht mal in Naomis Nähe, als sie gestürzt ist. Ich denke, Sie sollten sich beruhigen.«
»Mich beruhigen? Haben Sie Kinder?« Sie wartet meine Antwort nicht ab. »Denn falls Sie welche hätten, würden Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn eines von denen vor ein Auto gestoßen wird.«
»Sie wurde nicht …«
»Was ist hier los?« Dan erscheint neben mir und legt schützend eine Hand auf meine Schulter. »Geht es ihr gut? Geht es dir gut?« Er ist noch blass vor Schreck, als er Naomi ansieht. Sie ist inzwischen aufgestanden und an den Straßenrand getreten.
Ich verschränke die Arme vor der Brust. Cool bleiben, Imogen. Nicht die Fassung verlieren. Er sorgt sich schon genug.
»Wir haben sie nicht angefahren, Dan. Ihr geht es gut.« Ich achte darauf, ruhig und leise zu sprechen, Beherrschtheit auszustrahlen. »Und mir auch. Ist alles okay? Bist du verletzt? Ich denke, jemand ruft schon einen Krankenwagen. Sollen wir die Polizei holen? Wir möchten nicht, dass man uns Fahrerflucht vorwirft.« Ich verstumme abrupt, als mir bewusst wird, dass ich wirr plappere. Mein eigener Schock setzt ein. Für einen Augenblick dachte ich tatsächlich, wir würden sie anfahren. Ich dachte, wir würden sie töten.
Dan zieht mich in seine Arme, und ich genieße das tröstende Gefühl seiner harten Brust. »Die habe ich schon verständigt«, sagt er. »Auch wenn es allen gut zu gehen scheint.«
»Es geht nicht allen gut«, faucht Naomis Mutter, die eindeutig nicht gewillt ist, ihre Wut zu zügeln. »Meine Tochter …«
Ihre Worte verklingen, als ein Kranken- und ein Streifenwagen neben uns halten und die Männer aussteigen. »Oh, Gott sei Dank. Endlich!«
»Uns wurde gemeldet, dass ein Mädchen angefahren wurde«, sagt der Sanitäter, der die beiden Mädchen ansieht. »Wir hatten geraten, nichts zu unternehmen, bis wir eintreffen.«
»Der Wagen hat sie nicht angefahren«, entgegne ich im selben Moment, in dem Dan sagt: »Sie war schon wieder auf den Beinen.«
Der Polizist sieht Dan an. »Sind Sie gefahren?« Dan nickt. Der Polizist zückt einen Block und einen Stift. »Gut, erzählen Sie mir, was passiert ist.«
»Was passiert ist?« Naomis Mutter baut sich vor dem Polizisten auf. »Ich werde Ihnen erzählen, was passiert ist. Sie!« Sie streckt den Finger zu dem Mädchen aus, das noch immer völlig verstört ist. »Sie hat versucht, meine Tochter umzubringen! Sie hat sie gestoßen …«
»Augenblick mal«, unterbreche ich und fühle, wie ich vor Zorn erröte. »Ellie war nicht mal in ihrer Nähe, als sie gestürzt ist. Wir haben die beiden gesehen. Sie standen nur da, mindestens einen Schritt voneinander entfernt. Und Ihre Tochter ist rückwärtsgegangen und auf die Straße gestolpert.«
»Sie hat recht«, sagt das ältere Mädchen, das neben dem kleinen Mädchen steht. »Ich habe es von drinnen gesehen, Mum. Ellie hat sie nicht angefasst.« Sie geht noch näher zu Ellie, legt einen Arm um sie, und diese schmiegt sich an ihre Schulter, als wäre sie ihre Mutter.
»Entspricht das dem, was Sie gesehen haben?« Der Polizist sieht wieder Dan an.
»Ja, ich bin mir ziemlich sicher.« Er blickt zu mir, als warte er auf meine Bestätigung. »Ja. Ich meine, es ging ziemlich schnell, aber ich habe definitiv niemanden gesehen, der jemanden gestoßen hat.«
Naomis Mutter ist regelrecht empört über seine Worte. »Wollen Sie behaupten, dass meine Tochter einfach auf die Straße gefallen ist? Sie ist zwölf Jahre alt und hat keine Probleme, sich aufrecht zu halten. Sag es ihnen, Naomi. Sag denen, was du mir gesagt hast.«
»Ich …« Naomi blickt völlig verängstigt drein. »Ich, sie … ich bin gefallen«, endet sie matt. Daraufhin entgleisen ihrer Mutter die Gesichtszüge. Ich schäme mich, weil ich innerlich triumphiere, als sich ihre Wangen röten.
»Du hast gesagt …«
»Ich habe mich geirrt. Es war ein Unfall, okay?« Flackert da Angst in ihren Zügen auf? Falls ja, scheint es außer mir niemand zu bemerken.
»Tja.« Ihre Mutter bläst einen Schwall Luft aus. »Wie ich sehe, wird hier nichts unternommen. Komm mit, Naomi.« Sie ergreift den Arm ihrer Tochter, doch der Sanitäter hält eine Hand in die Höhe, um sie zu stoppen.
»Bedaure, aber da wir jetzt hier sind, müssen wir uns Ihre Tochter einmal genauer ansehen.«
»Sie haben doch gehört, sie ist gefallen! Das Auto hat sie nicht mal berührt!«
»Trotzdem sollten wir uns vergewissern«, sagt er entschuldigend. »Ich würde meinen Job nicht richtig machen, wenn ich es nicht täte.«
»Und ich muss von allen hier Aussagen aufnehmen«, ergänzt der Polizist. »Das sollte schnell gehen – natürlich vorausgesetzt, dass Sie nicht doch einen versuchten Totschlag anzeigen wollen.«
Ich genieße es, wie Naomis Mutter aufs Neue rot wird. Geschieht ihr recht. »Nein, es klingt nicht so, als wäre das nötig.«
Ich kann nicht recht entscheiden, was wirklich zwischen den beiden Mädchen war. Die Beschuldigte, Ellie, hat mit keinem Wort versucht, sich zu verteidigen – wahrscheinlich eingeschüchtert von Naomis anmaßender Mutter. Zum ersten Mal sehe ich sie mir genau an. Sie ist bleich, und ihre Augen starren ins Leere, was allerdings nach der Verbalattacke von einer Erwachsenen eben nicht weiter verwunderlich ist. Ich versuche, Augenkontakt zu ihr herzustellen, ihr einen tröstenden Blick zuzuwerfen, doch sie schaut nicht einmal in meine Richtung.
»Dürfen wir im Wagen warten?«, frage ich den Polizisten, weil ich unbedingt ein paar Minuten weg von dieser beklemmenden Szene will. Er nickt.
»Wenn es für Sie okay ist, zu fahren, können Sie hier drüben halten«, sagt er zu Dan und zeigt auf den Straßenrand. »Falls nicht, können wir den Sanitäter bitten, Sie sich gleich mal anzusehen.«
»Nein, mir geht es gut. Wir fahren links ran und warten.«
Dan und ich gehen zum Wagen und inspizieren die Kühlerhaube. Der andere Fahrer ist ausgestiegen und spricht mit der Polizei. Ich frage mich, was er sagt, ob er auch die Mädchen auf dem Gehweg gesehen hatte. Der Schaden an unserem Wagen sieht nicht so schlimm aus, wie sich der Rums angehört hatte, und der Motor startet problemlos. Dans Hände zittern ein wenig am Lenkrad, und ich bedecke seine Hand mit meiner.
»Mann, das war vielleicht ein Schock«, sagt er und legt seine warme Hand auf meinen Schenkel, was sehr wohltuend ist. Selbst nach zehn gemeinsamen Jahren gibt mir seine Berührung neue Kraft und innerliche Stärke, ich sauge Ruhe aus seinem Körper in meinen. Diese Wirkung hat er von jeher auf mich. Als wir frisch zusammen waren, lag ich oft mit dem Kopf auf seiner Brust und inhalierte seinen warmen, tröstlichen Atem. »Was für eine Ankunft. Alles okay mit dir?«
Ich nicke gedankenverloren. »Ein ziemlicher Schock, ja«, murmle ich. Ich sehe zu den Mädchen, die noch bei dem Polizisten und dem Sanitäter stehen. Die eine Mutter war so schnell bereit gewesen, einem Mädchen einen Mordversuch zu unterstellen, die andere tat nichts, um ihr Kind zu verteidigen.
An was für einen Ort habe ich uns da bloß zurückgebracht?
Kapitel 5
Imogen
Der einzige Fish & Chips-Laden in der High Street sticht heraus wie eine Nonne in einem Nachtclub. Mit seiner Chromfassade und den LED-beleuchteten Lettern »Oh My Cod« sowie der silbernen Silhouette eines, soweit ich es erkennen kann, zwinkernden Fisches, wirkt er nicht mal annähernd wie der Laden, an den ich mich vom letzten Besuch hier erinnerte. Damals war die weiße Farbe draußen zu einem schmutzigen Grau verwittert, war von dem Holzschild abgeblättert, und die verblichenen blauen Buchstaben erklärten beinahe mürrisch »Chip Shop«. Ich frage mich, wer für die Modernisierung verantwortlich war – gewiss nicht Roy, der untersetzte Besitzer mit den wabbeligen Wangen, den ich in meiner Jugend kannte. Ich lächle, als ich mir den angewiderten Ausdruck auf seinem verdrossenen Gesicht beim Anblick des zwinkernden Fisches vorstelle, der an seiner gewollt unmodernen Ladenfront angebracht wurde.
Doch zu meiner Verwunderung steht Roy hinter dem Tresen und sieht keinen Tag älter aus. Als wäre er schon als Fünfzigjähriger auf die Welt gekommen und weigerte sich seither stoisch, zu altern.
»Schlimme Geschichte das eben.« Ich zucke zusammen, als die Stimme von einer der vier blanken silbernen Sitznischen hinter mir ertönt. Ich drehe mich um und sehe eine Frau, die ich nicht von früher wiedererkenne. Sie ist so grau, dass sie fast vollständig mit der trendigen Wandfarbe von Farrow & Ball hinter sich verschmilzt. Ihr Haar, ihr Gesicht und ihre Kleidung scheinen vollständig farblos. Ich ringe mir ein Lächeln ab, um meine Überraschung zu verbergen.
»Hätte viel schlimmer ausgehen können«, sagt Dan in seinem jovialsten Ton, ehe ich reagieren kann. Er drückt kurz meine Hand, und ich frage mich, ob er merkt, dass ich immer noch ein bisschen zittre. »Das Mädchen ist noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen und hat nur aufgeschürfte Knie. Und meinem Wagen fehlt außer einer Delle in der Kühlerhaube nichts.«
»Ja, das war eine beachtliche Notbremsung, die Sie da hingelegt haben, mein Guter«, tönt es von Roy hinter der Glastheke. Seine Stimme hat einen freundlichen Klang, den ich nicht entsinne, jemals als junges Mädchen gehört zu haben. Andererseits erinnere ich mich insgesamt nicht an überbordende Freundlichkeit von irgendwem hier – ausgenommen von Pammy und ihren Eltern.
»Ende gut, alles gut«, murmle ich, um das Thema zu wechseln. Die graue Frau jedoch ignoriert den Wink.
»Diese Harper hatte Glück, dass Sie das waren. Viele hier hätten nicht so schnell reagiert und gebremst. Na ja« – da ist ein Anflug von Härte in ihren Augen –, »bei Mädchen in dem Alter rechnet man ja auch nicht damit, dass die sich gegenseitig auf die Straße schubsen, oder?«
Dan wirft mir einen Seitenblick zu, und ich weiß, dass er mich stumm anfleht, mich nicht ködern zu lassen. Nicht die Krallen ausfahren, Immy. Das ist nicht dein Problem …
»Sie hat sie nicht geschubst.« Ich höre meinen Mann leise ausatmen. Er hatte gewusst, dass ich nicht widerstehen könnte. »Wir haben es gesehen, nicht wahr, Dan?«
Dan nickt. »Ja, sie hat sie nicht geschubst.«
»Ach, na, da irren Sie sich.« Die Frau grinst verschlagen. »Das Mädchen muss einen nicht anfassen, um das zu schaffen. Ich habe direkt hier gesessen und gesehen, was sie gemacht hat.«
Ich runzle die Stirn. »Was meinen Sie? Wollen Sie behaupten, sie hat das Mädchen geschubst, ohne es anzufassen? Das ist doch verrückt.« Ich sehe wieder zu Roy und rechne damit, dass er lacht oder die Augen angesichts der alten Frau verdreht, vielleicht sogar den Finger neben seiner Schläfe kreisen lässt, um uns zu bedeuten, dass sie nicht alle Tassen im Schrank hat. Stattdessen steht er stocksteif da, meidet meinen Blick und wendet immer wieder ein Fischstück auf der Warmhalteplatte. Ich spreche ihn direkt an, sodass er mich unmöglich ignorieren kann. »Wer ist das Mädchen? Sie heißt Ellie, nicht wahr? Wer ist sie?«
»Das war Ellie Atkinson«, antwortet die Frau kichernd. »Sie ist ein Pflegekind.«
»Ach, und das macht sie automatisch …« Ich verstumme, als Dan an meinem Arm zieht. Die Tür geht auf, und herein kommen Ellie und die Frau, von der ich nun weiß, dass sie ihre Pflegemutter ist. Das ältere Mädchen, das Ellie eben beschützend zur Seite gestanden hatte, trottet hinter ihnen her.
Die alte Frau bricht die Stille mit einem Kichern, und Dan räuspert sich.
»Zwei kleine Portionen Fisch und eine große Portion Pommes frites, bitte«, sagt er zu Roy, der nickt, als hätte es die letzten Minuten nie gegeben.
»Der Fisch dauert fünf Minuten«, murmelt Roy, und wir setzen uns auf der anderen Seite des Ladens hin, so weit weg wie möglich von der unheimlichen Alten. Ellies Pflegemutter bestellt ihr Essen und kommt zu uns.
»Ich möchte mich nur bedanken, dass Sie der furchtbaren Frau Paroli geboten haben.« Sie sieht müde, fast niedergeschlagen aus. Ihr mausgraues Haar ist zu einem unordentlichen Pferdeschwanz gerafft, und einzelne Strähnen stehen in einem komischen Winkel von ihrem Kopf ab, als wäre sie es gewesen, die beinahe von unserem Wagen angefahren wurde. »Und natürlich dafür, dass Sie ihre Tochter nicht angefahren haben«, ergänzt sie mit einiger Verzögerung.
»Machen Sie sich deshalb keine Gedanken.« Ich lächle und hoffe, dass es fürsorgliches Mitgefühl signalisiert, keinen Irrsinn. Wussten sie, was die Leute über Ellie reden? Das Mädchen muss einen nicht anfassen, um das zu schaffen. »Mit dir ist hoffentlich alles okay?«
Ich richte die Frage an Ellie, die mit gesenktem Kopf dasteht und etwas auf dem Boden fixiert. Auf meine Ansprache hin rührt sie sich nicht. Ihre Pflegeschwester knufft sie leicht, und als Ellie immer noch keinen Mucks macht, sagt sie: »Ihr geht es gut, danke.«
Dan schnaubt, und ich bedenke ihn mit einem verärgerten Blick. Die graue Frau in der Ecke rückt aus ihrer Sitznische, wobei sie uns beobachtet.
»Mrs. Evans.« Ellie blickt auf, spricht die Frau von hinten mit tiefer, klarer Stimme an. Es ist das erste Mal, dass ich sie reden höre, und es klingt nicht natürlich.
Die Frau zögert, fast als wolle sie sich nicht mal zu dem Mädchen umdrehen. Schließlich schaut sie sich doch um. »Ja?«
»Sie sollten wirklich keine Lügen erzählen. Früher hätte man Ihnen die Zunge rausgeschnitten.«
Kapitel 6
Sie gehen die Straße entlang, wobei sie wenige Schritte Abstand zueinander wahren, die ebenso gut Meilen sein könnten. Sie sieht zu der Hand der Frau auf, die einfach an deren Seite baumelt, und Imogen sehnt sich danach, hinzugreifen und ihre eigene hineinzuschieben. Sie sieht viele andere Kinder, die das tun, Händchen mit ihren Mums halten, als wäre es das Natürlichste auf der Welt, den Arm auszustrecken und sich mit der Person zu verbinden, die man liebt. Und Imogen liebt ihre Mutter, obwohl diese sich nicht dazu bringen kann, die Liebe ihrer Tochter zu erwidern.
Mutter – sie hasst »Mummy«, weil sich das nach einem heulenden kleinen Baby anhört – sieht nach unten, und es ist, als wisse sie genau, was Imogen denkt, denn sie reißt ihre Hand hoch und schiebt sie tief in ihre Manteltasche. Und damit ist ihre Chance dahin.
»Jetzt beweg dich schon«, schimpft Carla Tandy und wendet ihren Kopf von ihrem einzigen Kind ab. »Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit.«
Kapitel 7
Imogen
Ich blicke hinauf zu dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, und von einem Moment auf den anderen ist es, als würden die letzten zwanzig Jahre meines Lebens wegschmelzen, als hätte es sie nie gegeben. Walisischer Stein umgibt die schwere Holztür, und Efeu schlängelt sich nach oben. Das Geräusch ebendieser Tür, die hinter meinem fünfzehnjährigen Ich zuknallt, ist immer noch wie ein Peitschenhieb, ein Schuss, der in meinen Ohren hallt. So deutlich, dass ich vor Angst zusammenfahre, als die Kofferraumklappe zufällt. Innerhalb von Sekunden ist Dan bei mir. Wahrscheinlich denkt er, ich wäre immer noch von dem Vorfall in der Stadt erschüttert. Was ich auch bin. Der Gedanke an die Frau, wie sie die arme Ellie anschrie, und der starre Gesichtsausdruck des Mädchens, als hätte es keine Ahnung, was eben geschehen war. Aber das ist es nicht, was mich unfähig macht, den Schlüssel in die Vordertür eines Hauses zu stecken, das ich als Teenager hinter mir ließ.
»Lass dir Zeit«, murmelt Dan. »Ich weiß, dass das schwer für dich sein muss.«
Offensichtlich begreift er mehr, als ich ihm zugetraut habe. Ich traue meinem Mann nie viel zu.
»Mir geht es gut.« Ich schüttle den Kopf, um die Erinnerungen zu vertreiben. »Komm, gehen wir rein.«
Nach einigen Anläufen bekommen wir die verzogene Haustür auf und fallen praktisch ins Haus, weil wir so fest drücken. Ich mache mich gefasst, von Erinnerungen überrollt zu werden, die mit der Kraft eines Güterzugs über mich hereinbrechen. Aber die Diele ist so anders als die in meinem Gedächtnis, dass ich mich für einen Moment frage, ob wir im falschen Haus sind. Der muffig riechende Teppich meiner Großmutter mit den rotgoldenen Wirbeln ist herausgerissen worden und durch polierten Holzboden ersetzt, ein beige und dunkelblau gestreifter Läufer führt die Treppe hinauf, und die Wände sind in einem frischen Hellgelb gestrichen, nicht mehr schmutzig graubraun wie früher. Es fühlt sich wie ein neues Haus an, das sich von außen so gut als das verkleidete, an das ich mich erinnerte. Aber nein. Es mag renoviert sein, doch der Grundriss ist noch derselbe. Die neue Farbe kann die kleinen Setzrisse nicht verstecken, die ich mit den Fingern nachmalte, wenn ich auf der Treppe hockte und wartete, dass meine Mutter nach Hause kam. Manchmal saß ich dort so lange, dass die Risse zu Schatten wurden, die mich zu sich hineinzureißen drohten. Manchmal wünschte ich mir, sie würden es.
»Nett hier«, bemerkt Dan, als er unsere beiden Taschen über die Schwelle hievt. »Hattest du nicht gesagt, dass es ziemlich runtergekommen ist?«
»Sie muss renoviert haben«, antworte ich. Mit sie ist meine Mutter gemeint. Einerseits bin ich froh, dass es kein bisschen so aussieht, wie ich es in Erinnerung habe, andererseits ärgert mich, dass sie sich erst die Mühe machte, alles anständig herzurichten, nachdem ich gegangen war. All die Jahre hatten wir mit abblätternder Farbe und Schimmelflecken gelebt, während sie sich wie eine Art Geist durchs Haus bewegte und vorgab, nicht zu sehen, wie unser Zuhause immer mehr verfiel und damit auch unser Leben.
»Na, das erspart uns die Arbeit«, sagt Dan grinsend und will die Wohnzimmertür öffnen. Mir geht das zu schnell. Ich will nicht wie eine Hysterikerin wirken, aber ich hatte gehofft, dies alles ein bisschen langsamer angehen zu lassen. Hätte ich ihm auch bloß winzige Bruchstücke meiner Vergangenheit anvertraut, könnte er meine Zurückhaltung vielleicht besser verstehen. So muss ich notgedrungen tun, als würde ich den großen Haufen Post auf dem Holzboden durchsehen, um den Moment aufzuschieben, in dem ich die Diele verlasse. Es sieht aus, als wären es Rechnungen, Rechnungen und noch mehr Rechnungen. Mum hatte genug hinterlassen, um die Kosten für ihre Beerdigung zu decken – eine Beerdigung, die ich organisierte, zu der ich aber nicht ging. Ich empfinde einen Anflug von etwas, das Scham sein könnte angesichts meines endgültigen »Leck mich« an die Frau, der ich nie wichtig genug war, dass sie mich zu bleiben gebeten hätte.
»Hier ist etwas an uns adressiert«, sage ich leise, doch Dan ist bereits durchs Wohnzimmer in die Küche gegangen, und ich höre, wie er Schränke öffnet und schließt und dabei hin und wieder Dinge sagt wie »Wozu soll das denn sein?«. Bedenkt man, dass er in den letzten fünf Jahren kaum je in unserer Küche war, würde mich nicht wundern, wenn er den Ofen entdeckt hätte.
Der an uns adressierte Umschlag ist knallpink, was ein Schreiben von einem Anwalt oder dem Finanzamt unwahrscheinlich macht. Ich reiße ihn auf und muss lächeln, als ich laut lese, von wem er ist.
Hey, Großstädter. Ich habe Euch ein Carepaket unter den Kohlenschuppen im Garten gestellt (das schwarze Ding aus Blech, für den Fall, dass Du es nach all den Jahren in der großen weiten Welt vergessen hast). Komm mich so bald wie möglich besuchen. Bring Wein mit. Ich hoffe, dies hier ist nicht zu schräg für Dich.
Pam xx
»Das ist aber nett von ihr.« Dan taucht wieder an meiner Schulter auf. »Ein Jammer, dass sie keinen Schlüssel hatte und hier ein bisschen putzen konnte. Die Staubschicht auf allem ist ganz schön hoch.«
»Dann hast du ja etwas zu tun, während du wartest, dass deine Muse uns einholt.« Ich grinse und küsse ihn auf die Nasenspitze. »Macht es dir etwas aus, wenn ich mich allein umsehe? Es ist ein bisschen viel, wieder hier zu sein, und Mum ist nicht mehr da.«
»Natürlich nicht.« Dan nickt nach draußen. »Ich hole mal die restlichen Sachen aus dem Wagen.«
Die nächste Stunde wandere ich in der fernen Erinnerung umher, dass dies mein Elternhaus ist. So vieles hat sich verändert, und gerade wenn ich denke, dass es doch nicht so schwierig würde, sehe ich irgendeine Kleinigkeit, wie die Uhr vom Kaminsims im Wohnzimmer, der längst nicht mehr da ist, aber die Uhr steht jetzt auf einem Holzregal – ein verborgenes Relikt, das darauf wartet, mich in die Vergangenheit zurückzuversetzen. Meine Kehle schnürt sich zusammen, als ich sie entdecke, als ich mich an die Stunden erinnere, die ich auf diese Uhr gestarrt und gewartet habe, dass meine Mutter zurückkam, gleichermaßen furchtsam und aufgeregt. Wie ich mich fragte, ob heute der Tag wäre, an dem sie ein Gespräch anfängt oder uns Fish & Chips mitbringt. Dabei wusste ich, dass er es nicht sein würde. Ich nehme die Uhr auf und drehe sie in meinen Händen. Ein Leben lang Kummer hat sich in diesem Uhrglas gespiegelt. Die Zeiger stehen still, und mir kommt der bizarre Gedanke, dass sie in exakt dem Augenblick stehenblieb, in dem meine Mutter starb. Sei nicht albern, sage ich mir, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass die Uhr wusste, ihre Arbeit wäre getan und sie müsste die Stunden bis zur Rückkehr meiner Mutter nicht mehr zählen. Sie kam nie wieder zurück.
Ich stelle die Uhr hin und blinzle mehrmals, um die Tränen zu bremsen, die mich zu überkommen drohen. Weinen hat noch nie irgendein Problem gelöst, Imogen. Einer der wenigen Ratschläge, die sie mir je gegeben hat. Und selbst bei dem lag sie falsch. An dem Tag, an dem ich ging, wartete ich, bis ich sicher in der schäbigen Studentenbude war, die ich zu einem Spottpreis ergattern konnte, um in lautes Schluchzen auszubrechen, bis ich beinahe keine Luft mehr bekam. Und beim Aufwachen am nächsten Morgen, mit geschwollenen, geröteten Augen und einem Schädel, als hätte ich einen Viertelliter Wodka getrunken, fühlte ich mich verblüffend gereinigt. Ich nahm mir vor, nie wieder eine Träne wegen einer Frau zu vergießen, die es in den ganzen Jahren kein einziges Mal schaffte, mir zu sagen, dass sie mich liebt.
Kapitel 8
Das letzte Sonnenlicht ist fort und der Garten in eine finstere Palette von Violett- und Grautönen getaucht, aber dennoch weigert der Himmel sich, der Dunkelheit nachzugeben. Sarah hockt schon länger mit angewinkelten Beinen auf dem Gartenstuhl und scrollt ganz vertieft auf ihrem Handy durch Facebook, sodass sie kaum bemerkt, wie sich die Schatten um sie herumlegen und die Wärme des Tages verebbt, um dem kühlen Zwielicht zu weichen, bis ihr eine sanfte Brise über die nackten Arme streicht und sie verwundert aufblicken lässt.
»Oh verdammt«, murmelt sie. »Wie spät ist es?« Sie sieht wieder zu ihrem Telefon. Zehn nach sechs. Die Mädchen und Billy hätten schon kommen müssen, um etwas zu essen. Sarah wundert, dass sie nicht längst angequakt kamen – Kinder haben dauernd Hunger, wie sie gelernt hat. Nun, mit Ausnahme von Ellie, versteht sich. Aber Ellie tanzt in den meisten Fällen aus der Reihe.
Apropos Kinder – wo sind sie? Sie haben in dem halb verfallenen Spielhaus am Ende des Gartens gespielt, vor – wann war das? – einer halben Stunde, vierzig Minuten? Viel länger kann das nicht her sein, obwohl sie sich viel zu lange mit Marks Cousine, Tina, wegen eines Artikels gestritten hat, in dem es hieß, dass es egoistisch von Frauen sei, mit über vierzig noch Babys zu wollen. Und Tina hat den auf ihre Pinnwand gestellt! Dämliche Kuh. Sie hätte wissen müssen, dass Sarah ihn sehen würde, und kam trotzdem noch mit »Sorry, Süße, wusste nicht, dass dich das aufregt xx«, als Sarah ihr sagte, wie verletzend das war. Die blöde Kuh hatte genau gewusst, was sie tat. Jedenfalls hat Sarah die Kinder da zwar nicht gesehen, aber gehört. Doch nun ist es vollkommen still im Garten.
»Mary? Billy? Ellie?«
Nichts. Sarah blickt seitlich neben das Spielhaus, aber die Kinder sind nirgends. Sie ruft ins Haus, aus dem ihr nichts als Stille entgegenkommt. Wo sind sie?
Bemüht, nicht panisch zu werden, eilt Sarah zurück in den Garten und sieht sich hektisch um. Es ist ein kleiner Garten: ein Baum, das Spielhaus am Zaun und dahinter dieser kleine Flecken Brachl …
Das Brachland! Warum hat sie da nicht als Erstes nachgesehen? Die Kinder schleichen sich dauernd durch die Lücke im Zaun, obwohl Sarah sie normalerweise hören kann, wenn sie lachend und rufend durch das dichte Gestrüpp staksen. Heute ist es allerdings mucksmäuschenstill.
»Mary?«, ruft Sarah, als sie sich den zerbrochenen Zaunlatten nähert. »Billy? Ellie?«
Es ist eng, doch Sarah ist keine massige Frau und schafft es, sich hindurchzuquetschen. Ihr T-Shirt verfängt sich in den groben Splittern, ihr Haar in den Zweigen der ungepflegten Hecke am Zaun.
Das Brachland ist ein kleines verwildertes Grundstück, das Sarahs und Marks mit den beiden benachbarten verbindet. Es ist ein Durcheinander von wuchernder Hecke und Brennnesseln, und keiner ist ganz sicher, wem es gehört – wenn überhaupt jemandem. Daher ist es schon verwaist und ungepflegt, solange die Jeffersons in der Accacia Avenue wohnen. Ihnen ist es ein Dorn im Auge, für die Kinder ein Abenteuerspielplatz.
Sie sieht sie sofort. Mary, Billy und Ellie knien im Dreieck auf dem einzigen freien Fleck, den das Grundstück hergibt. Alle drei haben die Augen fest zugekniffen, und Mary und Billy schwanken leicht vor und zurück. Ellie sitzt wie versteinert da; einzig ihre Lippen bewegen sich rasend schnell, während sie leise vor sich hin murmelt.
Sarah spürt, wie sich die Härchen auf ihren Armen aufstellen, als sie ein kalter Schauer durchfährt. Sie hat die Kinder gefunden, sie sehen unversehrt aus – also warum bekommt sie dann eine Gänsehaut?
»Kinder?« Sarah geht näher heran. Die drei können sie unmöglich nicht hören, und dennoch regt sich keines von ihnen auf ihre Stimme hin. Sie drängt sich durch die Dornen und Sträucher auf die kleine Lichtung und tritt hinter Ellie.
»Kinder!« Nun schreit sie förmlich und streckt eine Hand nach Ellies Schulter aus. Doch ehe Sarah sie berührt, erstarren Ellies Lippen, und alle drei Kinder reißen gleichzeitig die Augen auf. Später würde Sarah sich dabei ertappen, wie sie es Mark schilderte, als seien die drei aus einem Zauberbann befreit worden.
»Mum«, sagt Mary mit großen Augen, »was ist los? Was machst du hier?«
»Ich hatte vom Garten aus nach euch gerufen, und keiner hat geantwortet. Was tut ihr hier? Was zum Teufel geht hier vor?«
»Wir spielen nur, Mrs. Jefferson.« Ellie schaut zu ihr auf, fixiert Sarahs Gesicht mit ihren dunklen Augen. Sie wirkt als Einzige von den dreien weder verwirrt noch desorientiert. Billys Augen hingegen wandern zwischen Ellie und dem verwilderten Grundstück hin und her, als versuche er zu begreifen, wie er hier gelandet sein mag.
»Billy?«
»Wir spielen nur, Mrs. Jefferson.«
»Und warum hat mich keiner von euch rufen gehört? Ich habe gleich da drüben gestanden.«
Ellies Blick weicht nicht von Sarahs Augen. Sie wirkt alles andere als schuldbewusst, eher trotzig.
»Oh Mann, ehrlich«, bricht Mary patzig das Schweigen. »Ist das denn wichtig? Du hast uns ja jetzt gefunden. Kommt mit, ihr zwei.«
Ellie und Billy stehen auf und folgen Mary von der Lichtung und durch die Lücke im Zaun, was ihnen erheblich leichter gelingt als Sarah.
Erst als sie wieder im Haus sind und Sarah allein im Bad ist, macht sie ihrem bis dahin unterdrückten Entsetzen in einem tiefen Schluchzen Luft.
Kapitel 9
Imogen
Ich starre ins Feuer und beobachte die Flammen, wie sie knackend und knisternd wachsen und dann wieder sterben. Lächelnd blicke ich zu Dan auf, als er mir einen Becher heiße Schokolade mit einem Berg Schlagsahne drauf reicht. »Danke.«
»Dem Himmel sei Dank für Pammy und ihr Carepaket«, bemerkt Dan. Wir hatten das Willkommensgeschenk meiner alten besten Freundin hinten im Garten gefunden, und mich amüsierte, was sie uns hingestellt hatte: Wein, Haferkekse, Krabbenchips, Trinkschokolade und Schlagsahne neben einem Beutel Kaminholz und einem Bündel Kleinholz, das mit »Anmachholz«, beschriftet war, sowie eine Packung Kaminanzünder.
»Man sollte meinen, wir wären Idioten aus der Großstadt«, hatte Dan gescherzt, aber insgeheim war er eindeutig froh, dass ihm jemand die Arbeit abgenommen hatte. Und ich freue mich schon darauf, ihm morgen den Holzschuppen zu zeigen und wo die Axt ist.
Ich hatte mich wie eine Blinde durchs Haus bewegt, Wände und Möbel berührt und versucht, irgendwelche Gefühle hervorzulocken. Doch so vieles hat sich verändert – ich habe mich verändert. Ich fühle mich nicht mehr wie das einsame, unglückliche Mädchen, das in dem Kinderzimmer kniete und einen Gott, an den es nicht glaubte, anflehte, dass eine Mutter, die es kaum kannte, die Tür öffnen und es in die Arme schließen würde. Die Tür zum Zimmer meiner Mutter zu öffnen, in dem wir die Nacht verbringen würden, war am befremdlichsten. Als Kind war mir nicht erlaubt gewesen, es zu betreten, und wenngleich mich das nicht abhielt, erinnerte ich mich nur vage, wie es drinnen aussah. Beim Übertreten der Schwelle fröstelte ich, denn ich stellte mir vor, wie wütend meine Mutter wäre, sollte sie mich hier erwischen. Sei nicht albern, Imogen. Du bist kein Kind mehr. Trotzdem hatte ich gezögert und es nicht einmal fertiggebracht, die Tür zu meinem alten Kinderzimmer zu öffnen.
»Du bist sehr still«, bemerkt Dan und streicht mir eine Locke aus dem Gesicht hinters Ohr. »Denkst du immer noch an das von vorhin, oder ist es etwas anderes?«
»Nur an vorhin«, lüge ich. Darüber lässt sich leichter reden als über meine Unfähigkeit, die Tür des Teenagers Imogen Tandy zu öffnen, aus Angst, ich könnte Pforten aufstoßen, die ich nicht wieder schließen kann. »Ehrlich gesagt geht es mir immer noch durch den Kopf. Wie sie zu diesem Mädchen waren. Ich meine, sah sie aus wie ein Typ Mädchen, das jemanden auf die Straße stoßen würde?« Doch schon während ich es ausspreche, wird mir klar, dass niemand vorhersehen kann, wer »der Typ« Mensch ist, der Gewalt gegen andere ausübt. Du am allerwenigsten, höhnt eine kleine Stimme in meinem Kopf. Deine Erfolgsbilanz auf dem Gebiet ist ja wohl kaum glorreich, oder?
»In dem Fish & Chips-Laden war sie ziemlich unheimlich«, erwidert Dan. »Ich meine, wie viele Kinder kennst du, die drohen würden, jemandem die Zunge herauszuschneiden? Und woher wusste sie, dass die Frau über sie geredet hatte? Sie waren nicht mal in der Nähe des Restaurants gewesen, als sie das sagte.«
Ich winke ab. »Sie hat nicht gedroht, ihr die Zunge herauszuschneiden, sondern bloß etwas nachgeplappert, was sie in der Schule gehört hatte oder in ihrem früheren Zuhause. Und ich hatte den Eindruck, dass Mrs. Evans nicht zum ersten Mal ihre lächerlichen Theorien verbreitete. Das Mädchen könnte eine andere Gelegenheit gemeint haben. Ihrer Pflegemutter war das reichlich unangenehm, oder?«
Ich weiß nicht, was der Frau unangenehmer gewesen war: Ellies Worte oder Dans Prusten, als er sie hörte.
»Ja, war es. Das war mal ein geniales Timing, was? Wahrscheinlich hätte ich nicht lachen sollen. Aber zumindest entkrampfte es die Situation ein bisschen.«
»Sie war überhaupt nicht in der Nähe des Mädchens«, überlege ich laut und ignoriere Dans Grinsen. Er braucht wahrlich keine Ermutigung, um aus jeder Situation einen Witz zu machen. »Du hast es doch gesehen, oder? Sie standen mindestens einen halben Meter voneinander entfernt. Wir hätten es gesehen, wenn sie die andere geschubst hätte.«
»Eigentlich habe ich nichts gesehen«, gesteht Dan und wirkt für einen Moment verlegen. »Ich hatte die beiden ehrlich gesagt gar nicht bemerkt. Sie waren auf dem Gehweg, und ich hatte mitgeschnitten, dass sie da waren, aber nicht, was sie gemacht haben.«
»Aber du hast dem Polizisten gesagt –«
»Weiß ich.« Dan verzieht das Gesicht. »Sei nicht sauer auf mich. Ich habe lediglich dem zugestimmt, was du gesagt hattest. Diese Frau war so furchtbar, und ich wollte dir Rückendeckung geben. Als er meine Aussage aufnahm, habe ich gesagt, dass ich die Mädchen gesehen hatte, aber nicht, dass eines das andere schubste. Was stimmt«, sagt er rasch, als ich schon etwas entgegnen will. »Ich habe nicht gesehen, dass irgendwer irgendwen geschubst hat. Aber ich könnte auch nicht schwören, dass sie die andere nicht geschubst hat. Ich habe nicht darauf geachtet.«
Ich rufe mir die Sekunden vor der Notbremsung ins Gedächtnis. Zu dem Zeitpunkt war ich mir so sicher, dass ich gesehen hatte, wie die beiden mehrere Schritte voneinander entfernt standen; aber das war, als Dan mir zustimmte, als er sagte, er hätte dasselbe gesehen. Kann ich wirklich schwören, dass ich keine Sekunde weggesehen hatte? Würde ich unter Eid aussagen, dass Naomi gestürzt war? Ich versuche, den Moment im Geiste wie einen Film ablaufen zu lassen, kann mich jedoch nicht zwingen, das Geschehen zu visualisieren.
»Vergiss es, Im. Ernsthaft, keiner wurde verletzt, und es sieht nicht so aus, als würde die Irre Anzeige gegen das Kind erstatten. Also lassen wir uns davon nicht unseren ersten Abend verderben.«
Das ist so wunderbar typisch Dan. Wir hätten heute beinahe ein Kind überfahren, aber davon lassen wir uns nicht den Abend verderben, oder? Er hat recht. Er hat immer recht. Was soll es bringen, darüber nachzugrübeln? Niemand wurde verletzt. Beide Mütter haben heute ihre Kinder nach Hause gebracht, und das ist der bestmögliche Ausgang, den wir uns hätten wünschen können. Aber warum ist mir dann trotzdem so unwohl bei dieser Geschichte?
Kapitel 10
Die Schulversammlung wäre die ideale Gelegenheit. Sobald sie sich entschlossen hat, es zu tun, das Wort »Schummeln« aus ihrem Kopf verbannt und sich gesagt hat, dadurch hätte Yasmin am ehesten Chancen, den Test zu bestehen, ist es recht simpel. Sogar viel einfacher, als Florence einen gern glauben machen will. Der Haken bei den Anti-Schummel-Maßnahmen der Direktorin ist der, dass keiner damit rechnet, jemand würde allen Ernstes versuchen, bei den Abschlussprüfungen zu mogeln. Deshalb überlegt auch niemand sonderlich angestrengt, wie es zu verhindern wäre. Sie wollen, dass man es für unmöglich hält, sich von verschlossenen Schubladen und versiegelten Unterlagen abschrecken lässt. Tatsächlich haben drei Lehrer Schlüssel zu dem Aktenschrank, und jeder von denen würde einem seinen Schlüsselbund mit ebenjenem Schlüssel daran leihen, ohne im Traum zu denken, dass man diesen einen abnehmen könnte, um ihn später in der Woche zu benutzen. Und selbst wenn sie bemerkten, dass er fehlte, würden sie zunächst glauben, er wäre vom Ring gerutscht. Die Lehrer an ihrer Schule stehlen, lügen oder betrügen nicht. Das Problem mit Florence ist, dass sie es vorziehen würde, zu denken, ihre Lehrer wären unfähig genug, um einen Schlüssel zu verlieren, anstatt gerissen genug, um einen zu stehlen.





























