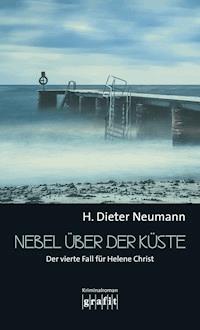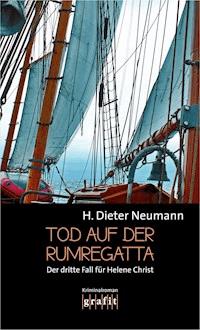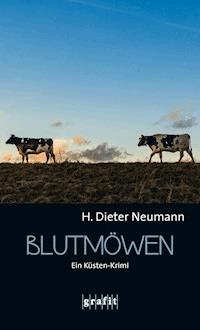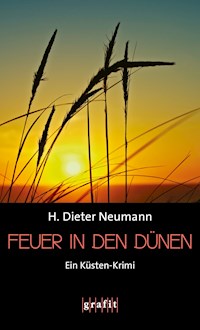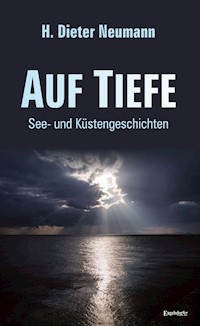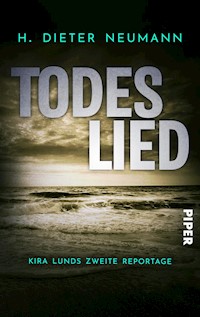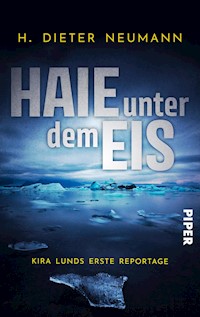5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Johannes Clasen ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Ein Thriller, der unter die Haut geht! „Das Erbe der Wölfin“ von H. Dieter Neumann jetzt als eBook bei dotbooks. Mitten in der Nacht wird München von einem Anschlag erschüttert. Das Ziel: eine kurdische Schneiderei. Die Täter: Rechtsradikale oder Islamisten? Terrorismus-Experte Clemens Venske verdächtigt die Grauen Wölfe. Da wird ein Mitglied dieser pantürkischen Nationalistenorganisation ermordet, das Venske kurz zuvor brisante Informationen versprochen hat. Haben die Grauen Wölfe den Verräter beseitigt? Und wo sind die Dokumente, die das Opfer dem Verfassungsschutz übergeben wollte? Die Ermittlungen führen Venske nach Ostanatolien … „DAS ERBE DER WÖLFIN stellt definitiv eine Bereicherung für den deutschen Krimimarkt dar.“ Stefan Schweizer, literaturkritik.de Jetzt als eBook kaufen und genießen: „Das Erbe der Wölfin“ von H. Dieter Neumann. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Ähnliche
Über dieses Buch:
Mitten in der Nacht wird München von einem Anschlag erschüttert. Das Ziel: eine kurdische Schneiderei. Die Täter: Rechtsradikale oder Islamisten? Terrorismus-Experte Clemens Venske verdächtigt die Grauen Wölfe. Da wird ein Mitglied dieser pantürkischen Nationalistenorganisation ermordet, das Venske kurz zuvor brisante Informationen versprochen hat. Haben die Grauen Wölfe den Verräter beseitigt? Und wo sind die Dokumente, die das Opfer dem Verfassungsschutz übergeben wollte? Die Ermittlungen führen Venske nach Ostanatolien …
»Das Erbe der Wölfin stellt definitiv eine Bereicherung für den deutschen Krimimarkt dar.« Stefan Schweizer, literaturkritik.de
Über den Autor:
H. Dieter Neumann, Jahrgang 1949, wurde nach dem Abitur zunächst Offizier in der Luftwaffe der Bundeswehr. Später kündigte er sein Dienstverhältnis, um Finanzwirtschaft zu studieren. Er arbeitete als Vertriebsleiter und Geschäftsführer in der Versicherungsbranche, bis er seine Leidenschaft für das Schreiben von Kriminalromanen, Thrillern und Sachbüchern entdeckte. H. Dieter Neumann ist ein passionierter Segler. Er lebt mit seiner Frau in Flensburg.
Der Autor im Internet: www.hdieterneumann.de
Bei dotbooks erscheint von H. Dieter Neumann außerdem:
Die Narben der Hölle
***
Überarbeitete eBook-Neuausgabe November 2016
Copyright © der Originalausgabe 2013 Verlag Jürgen Wagner Südwestbuch, SWB-Verlag Stuttgart
Copyright © der überarbeiteten Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/sufi
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-823-6
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Das Erbe der Wölfin an: [email protected]
Gerne informieren wir Sie über unsere aktuellen Neuerscheinungen und attraktive Preisaktionen – melden Sie sich einfach für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
H. Dieter Neumann
Das Erbe der Wölfin
Thriller
dotbooks.
Für Julia und Ilka
»Ich schwöre bei Allah, dem Koran, dem Vaterland, bei meiner Flagge: Meine Märtyrer, meine Frontkämpfer sollen sicher sein.
Wir, die idealistische türkische Jugend, werden unseren Kampf gegen Kommunismus, Kapitalismus, Faschismus und jegliche Art von Imperialismus fortführen.
Unser Kampf geht bis zum letzten Mann, bis zum letzten Atemzug, bis zum letzten Tropfen Blut.
Unser Kampf geht weiter, bis die nationalistische Türkei, bis das Reich Turan erreicht ist.
Wir, die idealistische türkische Jugend, werden niemals aufgeben, nicht wanken, wir werden siegen, siegen, siegen!
Möge Allah die Türken schützen und sie erhöhen!«
»Ülkücü-Eid«, NRW-Verfassungsschutzbericht 2007, Seite 61
***
»(…) Die Türken nennen ihre Jäger Akıncı, das bedeutet Renner. Sie sind wie Regengüsse, die aus Wolken stürzen (…) Den Wolkenbrüchen gleich, verweilen die Jäger oder türkischen Renner nur kurz. Sobald sie etwas erreichen, ergreifen und rauben sie es. Sie morden und richten solche Verheerungen an, dass an den Stellen viele Jahre kein Hahn mehr kräht. Die türkischen Jäger sind Freiwillige, und sie nehmen an den Feldzügen freiwillig und zu ihrem eigenen Nutzen teil.«
Aus: Memoiren eines Janitscharen oder Türkische Chronik. Eingeleitet und übersetzt von Renate Lachmann. Slawische Geschichtsschreiber Bd. VIII, Graz 1975, S. 163f.
***
»Ein Idealist (Türkisch: Ülkücü) ist in der Regel kein Mann des Denkens, sondern immer ein Mann der Tat (…) Alle Denkweisen, Handlungen und Meinungen, die von Handlungs- und Denkweise der Idealisten abweichen, sind ungültig.«
Necdet Sevinç: Ülkücüye Notlar. Istanbul 1976, S. 28
Prolog
Sie musste auf den Hocker steigen und sich auf die Zehen stellen, um hinaussehen zu können. In der Ferne türmte sich ein Gebirgsmassiv auf, dessen Spitzen hoch in den Himmel ragten. So weit sie blicken konnte, zog sich die Bergkette am Horizont entlang. Auf den Gipfeln lag an einigen Stellen noch Schnee, weiter unten waren die Hänge völlig kahl. Grau schimmerte der Fels durch die hitzeflirrende Luft – kein Grün bedeckte die scharfen Grate.
Ihr Guckloch war kaum dreißig Zentimeter breit und nur halb so hoch. Es war ganz oben in die Außenwand eingelassen, und sie stieß immer mit ihrem Kopf an die raue Decke, wenn sie durch den flachen, unverglasten Schlitz schaute. Inzwischen waren ihr schon viele ihrer tiefschwarzen Haare ausgefallen.
Das Mauerloch war ihre einzige Verbindung zur Welt da draußen. Sooft die Schmerzen in ihren geschwollenen Füßen es zuließen, stand sie in dieser unbequemen Haltung davor und sog gierig die Luft ein. Der Sichtwinkel war flach, da die Außenmauer unter ihr fast einen Meter dick war. Der immer gleiche Bildausschnitt, den sie einsehen konnte, hatte daher keinen Vordergrund. Das Bild begann erst in einiger Entfernung, dort, wo ein weitgespanntes silbriges Blätterdach von Olivenbäumen das gleißende Sonnenlicht wie ein Spiegel zu reflektieren schien. Dahinter ragten schon die Berge auf, und über allem wölbte sich der wolkenlose Himmel.
Ein wahrhaft grandioses Panorama.
Für sie inzwischen nur noch ein trostloses Standbild. Sie betrachtete es schon zu lange. Nie veränderte es sich. Sie hätte es jederzeit detailgenau aus dem Gedächtnis malen können.
Allein die Dunkelheit veränderte das Bild, schuf täglich ein zweites. Bereits eine halbe Stunde nach Einbruch der Dämmerung herrschte eine so vollkommene Finsternis, dass sie unter den Bergspitzen nichts mehr erkennen konnte. Niemals hatte sie ein Licht entdeckt, keine Feuerstelle irgendwo in der Weite, auch nicht die Scheinwerfer eines Fahrzeuges. Eine Straße schien es in ihrem Blickfeld nicht zu geben, ebenso keine anderen Häuser.
Dafür aber bot das nächtliche Firmament, übersät mit unzählbar vielen strahlenden Sternen, einen überirdischen Anblick. Wie eine in millionenfachem Funkeln leuchtende Kuppel hob sich der Nachthimmel vom Dunkel darunter ab, und die schwarzen Gipfel der schroffen Gebirgskette ragten scharfkantig in das Lichtermeer hinein. Manche Himmelskörper erschienen zum Greifen nah, und auf einigen von ihnen pulsierte das Licht, als wären sie atmende Organismen.
Dieses Bild könnte sie nicht einmal abmalen, das wusste sie. Oft versank sie vollkommen darin und vergaß darüber sogar minutenlang die zermürbende Angst, die sie nie verließ, die in Wellenbewegungen unausgesetzt gegen sie anbrandete.
Ihr Gefängnis musste weit entfernt von jeder Siedlung liegen, so viel war ihr schnell klar geworden. Es war ein offenbar sehr altes, massives Steinhaus, in dessen Obergeschoss man sie eingesperrt hatte. Die Wände bestanden aus unverputzten, roh behauenen Feldsteinen. Sie hielten viel von der Tageshitze draußen und sorgten dafür, dass der Raum in den Nächten nicht zu stark auskühlte.
Bis auf das Motorengeräusch eines Autos, das einmal täglich um die Mittagszeit vorfuhr, war es meistens still. Hin und wieder, auch nachts, hörte sie die Stimmen von Männern, die sich einige Meter unterhalb des Mauerlochs unterhielten. Sie verstand zwar nichts, stellte aber fest, dass es immer höchstens drei oder vier Personen waren. Ihre Bewacher – stumm waren sie also nicht, auch wenn sie nie etwas sagten, wenn sie in ihrer Zelle waren. Bärtige Schweiger.
In den Nächten drangen manchmal die Töne einer fremdartigen Instrumentalmusik aus dem Inneren des Hauses zu ihr herauf. Gegen Morgen aber wurde es still. Vollkommene Stille, in der nur noch die tosende Brandung aus Angst in ihren Ohren dröhnte. In den seltenen Pausen zwischen den Brechern drangen manchmal ein paar ferne Vogelstimmen fast unhörbar an ihr Ohr. Nur mühsam konnte sie dann ihre Tränen zurückhalten.
Heute hörte sie nichts. Sie saß auf der Kante des Bettes aus rostigen Metallrohren und sah sich um. Dieses Bett mit der harten Matratze und den beiden Decken darauf war – neben dem Hocker und einem hölzernen Regal – das einzige Möbel in ihrem Verlies. Wenigstens war der Raum frei von Ungeziefer, nur ein paar Geckos, harmlose kleine Gesellen, kamen manchmal durch den Schlitz und huschten an den Wänden entlang. In einer Ecke des Raumes war eine Toilettenschüssel aufgestellt. Sie hatte ein Abflussrohr, das im Boden verschwand, aber keine Spülung. Ein gefüllter Wasserkanister stand daneben, und es gab auch eine langstielige Bürste und Papier in ausreichender Menge. Dafür sorgte eine Frau, deren Gesicht stets mit einem übergroßen Kopftuch so verhüllt war, dass nur ihre Nase und die dunklen Augen zu sehen waren. Sie erschien jeden Morgen zusammen mit einem der Wächter, kehrte den Fußboden und hatte einmal sogar frische Decken und ein neues Laken auf die Matratze gelegt.
Der Wächter blieb immer im Raum, bis die Frau mit ihrer Arbeit fertig war. Nie sprach sie dabei. Auch die Männer, die das Essen brachten, hatten in all den Tagen nie geredet. Der einzige, der bisher mit ihr gesprochen hatte, war ›Eron‹, ein gut aussehender Mann Mitte zwanzig. Insgeheim hatte sie ihm diesen Namen eines türkischstämmigen deutschen Schauspielers gegeben, dem er ähnlich sah.
Doch dieser Mann war kein Schauspieler. Sie konnte nur ahnen, welches Höllenfeuer in ihm brannte. Äußerlich strahlte er nichts als Kälte aus, aber in seinen Augen loderte es. Versengende Glut und klirrendes Eis gleichermaßen. Eisfeuer.
Niemals würde sie vergessen, wann sie ihm schon einmal begegnet war. Die Bilder jener Nacht hatten sich für immer in ihr Gedächtnis gebrannt.
Auf keinen Fall aber durfte sie es wagen, ihn nochmals darauf ansprechen. Bei seinem ersten Besuch hier in ihrer Zelle hatte sie diesen Fehler gemacht. Und dann seinen Blick gesehen.
Mittlerweile war er schon vier- oder fünfmal hier gewesen und hatte in akzentfreiem Deutsch mit ihr gesprochen. Anfangs war er immer beherrscht gewesen, fast höflich. Dennoch stellten sich alle Härchen bei ihr auf, und ein Schaudern überlief sie, wenn er sie mit seinen unergründlichen Augen musterte. Abschätzig, fast gelangweilt.
Sie hatte nicht den geringsten Zweifel, dass dieser Mann keinen Atemzug lang zögern würde, mit ihr genau das tun, was er ihr androhte. Wozu er fähig war, brauchte sie sich nicht lange zu fragen. Sie hatte es schon einmal mit eigenen Augen gesehen.
Panik überkam sie, und ihre Kehle wurde schlagartig trocken, als sie an das letzte Gespräch mit ihm dachte. Spätestens da war ihr klar geworden: Ihre Lage war hoffnungslos.
Mit zitternden Händen holte sie sich eine Flasche Mineralwasser aus der Plastikkiste, die von ihren Bewachern immer wieder aufgefüllt wurde, und trank einen Schluck. Dann schaute sie hinüber zu dem Mauerdurchbruch auf der anderen Seite des Raumes. Selbst um die Mittagszeit drang durch dieses Loch nur wenig Helligkeit in ihr Verlies. Doch jetzt ging die Sonne unter, und es fiel kaum noch Tageslicht herein. Bald würde wieder völlige Dunkelheit herrschen. Elektrisches Licht, eine Petroleumlampe oder Kerzen gab es nicht.
Ihre wievielte Nacht hier mochte das sein? Sie wusste zwar nicht genau, wie lange sie ohnmächtig gewesen war, nachdem man sie hierher gebracht hatte. Seit sie aber wieder zu sich gekommen war, hatte sie fünf Nächte gezählt.
Gab es überhaupt noch Hoffnung, hier wieder lebend herauszukommen?
Der Hubschrauber. Ganz in der Nähe hatte er vor ein paar Stunden lärmend seine Kreise gezogen. Suchte man sie endlich?
»Mach dir nichts vor«, murmelte sie mit ihrer krächzenden Stimme, die sie inzwischen selbst kaum noch wiedererkannte, »kein Mensch weiß, wo du bist. Und deine Zeit läuft ab. Hör auf, dir Illusionen zu machen.«
Sie kletterte auf den Hocker und blickte mit feuchten Augen hinüber zu dem Bergmassiv, das sich nur noch schwach gegen den Himmel abhob.
Wann nur hatte dieser Albtraum begonnen?
Das Unheil hatte sich in der glücklichsten Zeit ihres Lebens angeschlichen, erinnerte sie sich verzweifelt, tückisch langsam und unbemerkt von allen, die es bald darauf überfiel.
Mit der Dunkelheit kam der Nachtwind und blies den unheimlichen Gesang von den eisigen Berggipfeln herab durch das Tal. Das schaurige Heulen war ihr inzwischen vertraut, hatte aber nichts von seinem Schrecken verloren.
Wie gelähmt stand sie da und lauschte. Todesgesang, dachte sie.
Sie singen mir mein Todeslied.
***
Auch den Bewohnern des Dorfes auf der anderen Seite des Gebirges fuhren die uralten Klänge – keinem Menschenlaut vergleichbar – ins Mark und ließen sie schaudernd erstarren. Als hätten sie, aus entfernten, längst versunkenen Welten kommend, einen weiten Weg zurückgelegt, wehten die Töne erst verhalten und wie tastend, dann rasch lauter werdend durch die Stille heran.
Bald klang das Heulen wie eine nie verstummende Klage aus vergangener Zeit machtvoll von den schroffen Hängen herab, vielstimmig und stetig wechselnd in Tonlage und Lautstärke. Sie lähmten alle Betriebsamkeit und ließen die Menschen innehalten. Für kurze Zeit erstarben alle ihre Gespräche, und schweigend blickten sie durch die Finsternis zu den Bergen hinauf.
Die Schafe und Ziegen ließen von den Halmen auf ihren kargen Weiden ab, standen angstvoll still und hörten auf das Lied ihrer alten Feinde. Die Kinder flüchteten sich in die Häuser zu ihren Müttern, die aus schmalen Fensterhöhlen grimmig in die Nacht hinausblickten. Die Alten, für die diese Klänge ein wohlbekannter, stetig wiederkehrender Teil ihres langen Lebens waren, lauschten ihnen versonnen und mit nie nachlassender Ehrfurcht.
Der fast achtzigjährige Muhsin Coşkun, der gerade ein Feuer in dem Eisenofen auf seinem Hinterhof entfachte, legte den rostigen Schürhaken zur Seite, stand mühsam auf und hob seinen Blick zu den fernen Gipfeln. Für ihn, der schon in diesem abgelegenen Tal zwischen den Ausläufern des Mercan-Gebirges geboren war und es kaum je verlassen hatte, waren Wölfe weit mehr als nur wilde Tiere, die seine Herden bedrohten. Für ihn war der Wolf über alle Zeiten hinweg das geblieben, was er in der jahrtausendealten Mythologie der Turkvölker immer gewesen war: Ihr Urahne und ihr heiligstes Tier.
Wenn er dem Wolf zuhörte, wie er in den Nächten auf seine ganz eigene Weise mit den höchsten Mächten Verbindung aufnahm, dann sah der alte Bauer ihn vor seinem inneren Auge, sah, wie das Tier dabei seinen Kopf mit den unergründlichen Augen hinauf zum Tengri hob.
Muhsin war, wie alle seine Nachbarn, ein tiefgläubiger Muslim, der strikt nach dem Koran und den Regeln der Sunna lebte, doch war er auch verwurzelt in den vielen uralten Legenden, die bis heute von Generation zu Generation forterzählt wurden.
Hier in den entlegenen Tälern des ostanatolischen Hochlandes kannten viele Menschen noch die Stammesmythen und Heldensagen ihrer frühen Vorfahren. Die meisten davon stammten aus vorislamischer Zeit und hatten sich, stets nur mündlich weitergegeben, in Hunderten von Jahren immer wieder verändert, waren an den nächtlichen Feuern auf den Weiden und in den Lehmhütten der vergessenen Dörfer mit neuen Details ausgeschmückt und mit islamischen Elementen versehen worden.
Mochte auch jeder hier diese Sagen kennen – immer wenn Muhsin Gelegenheit fand, eine davon zu erzählen, war ihm die Aufmerksamkeit der Dorfbewohner sicher, bei den Kindern ebenso wie bei den Greisen. Ob geheimnisvoller Schöpfungsmythos, sentimentales Liebesdrama oder blutiges Schlachtenepos – Muhsin kannte für jeden Tag, für jede Stimmung eine passende Geschichte.
Nach einigen Minuten des Lauschens nahm er den Schürhaken wieder auf und fachte das Feuer kräftig an. Dann legte er noch etwas Holz nach und hielt seine kalten Hände über den Ofen. Er spürte eine schwache Bewegung hinter sich und wandte sich um. Dort stand seine siebenjährige Urenkelin und blickte scheu auf das prasselnde Feuer, das aus der offenen Klappe leuchtete. Muhsin strich ihr mit seiner erwärmten Hand über den Kopf und fragte: »Musst du noch nicht schlafen gehen, Kind?«
»Nein, Dede, Mutter hat mir erlaubt, noch mit dir am Feuer zu sitzen«, antwortete das kleine Mädchen und sah den alten Mann mit ihren dunklen Augen an. »Willst du mir eine Geschichte erzählen?«
Der Urgroßvater zog sie neben sich auf eine Holzbank gegenüber dem wärmenden Ofen. Dann drehte er sich, von dem Mädchen aufmerksam beobachtet, eine Zigarette und steckte sie an. Er nahm einen tiefen Zug und fragte: »Welche Geschichte möchtest du denn hören?«
»Die Sage von der heiligen Wölfin Asena«, rief das Kind sofort und drückte aufgeregt mit seinen kleinen Fingern die rissige Hand des Urgroßvaters. »Willst du sie mir erzählen, Dede?«
In der Dunkelheit, nur schwach vom Licht des flackernden Feuers im Ofen erleuchtet, huschte ein feines Lächeln über das zerfurchte Gesicht. Heißgeliebte Worte, geheimnisvolle alte Geschichte – wie gern erzählte er sie! Wie sehr konnte er sich mit Haut und Haar in die ferne Zeit stürzen, wie wohl war ihm, wenn er – die Stimme gekonnt modulierend – die fabelhaften Gestalten zu neuem Leben erwecken durfte.
Er freute sich unbändig, dass seine Urenkelin gerade die älteste aller Legenden, die tragischste und türkischste von allen, zu ihrer Lieblingsgeschichte erkoren hatte. Und er hielt sich nicht wenig darauf zugute, dass dies wohl vor allem seiner im ganzen Tal gerühmten Erzählkunst zu danken war.
Leidenschaftlich erzählte er von Tengri, dem Gott der alten Türken, der in allerhöchster Not Asena, die heilige Wölfin des Himmels, gesandt hatte, um sein geliebtes Volk vor dem Untergang zu retten, beschrieb das Schlachtengetümmel eines urzeitlichen Krieges, ließ seine Vorfahren darin heldenhaft kämpfen und vielstimmig die dennoch unvermeidliche Niederlage beklagen, die ihnen durch Hinterlist und Heimtücke zugefügt wurde.
»Schließlich haben die Feinde gesiegt, und unser Volk wäre für immer vom Angesicht der Erde verschwunden, wenn …«
»Sie haben aber den kleinen Jungen übersehen, der noch lebte!«, rief das Mädchen aufgeregt, das diese Sage auswendig kannte.
»Genau«, sagte der Urgroßvater. »Und was haben sie gemacht, als sie ihn doch noch fanden?«
»Die bösen Soldaten haben ihm die Hände und die Füße abgehackt und ihn in einen Sumpf geworfen!«
»Ja, das taten sie«, bestätigte Muhsin und erzählte dann von der Wölfin, die, vom Tengri gesandt, dem Jungen die Wunden leckte und ihn mit Fleisch ernährte. Er wurde wieder gesund, und als er herangewachsen war, vereinigte er sich mit der Wölfin und schwängerte sie.
Hier angelangt, warf der alte Mann einen kurzen prüfenden Blick auf seine Urenkelin, um sich zu wappnen, falls zu dieser Stelle eine Nachfrage erfolgen sollte. Mit Erleichterung stellte er fest, dass für das Kind dieser Zeitpunkt noch nicht gekommen war. Rasch fuhr er fort: »Doch der König des feindlichen Volkes erfuhr, dass der Junge überlebt hatte, und sandte seine Soldaten erneut aus, um auch den Letzten unseres Volkes zu töten. Die Wölfin aber floh mit dem Jungen in die Berge, wo Tengri eine riesige Höhle für sie geschaffen hatte.«
Er zündete sich eine neue Zigarette an und schloss die Augen. Dann beschrieb er die weite fruchtbare Ebene mit reicher Vegetation, die sich hinter der Höhle befand, von allen Seiten uneinnehmbar von Bergen umschlossen, die klaren Bäche und die wohlriechende gute Erde, auf der man Feldfrüchte aller Art anbauen konnte.
»Dort fand die Wölfin Zuflucht und brachte zehn Jungen zur Welt. Sie wuchsen heran und nahmen sich Frauen von draußen. Die Kinder und die Kinder der Kinder vermehrten sich. Einige Generationen später kamen sie aus der Höhle und zogen nach Süden, bis sie auch hierher in das Land kamen, das nun das unsere ist.«
Das Mädchen saß einen Augenblick in Gedanken versunken da, stand dann auf, dankte dem Urgroßvater artig und wandte sich zum Gehen.
»Einen Moment, mein Kind«, hielt der alte Mann sie zurück, »weißt du noch, was unsere Vorfahren in der Höhle aufgehängt hatten?«
»Das weiß ich doch, Dede: Eine große Fahne mit einem Wolfskopf darauf!«
»Und warum haben die alten Türken das gemacht?«
»Damit sie niemals vergessen, dass sie von der Wölfin abstammen!«, rief ihm das Kind triumphierend zu, als es schon zum Haus lief.
Muhsin blieb auf der Bank sitzen und starrte versonnen lächelnd ins Feuer.
1
Technik und Taktik, beides in Perfektion. Und Präzision. Nur dann klappte es.
Man musste die Finger leicht spreizen, so dass die Luft unter ihnen nicht komprimiert wurde. Wenn man mit der geschlossenen Hand zuschlug, baute sich darunter ein Luftpolster auf, mit dem man die Fliege förmlich zur Seite wegkatapultierte. Natürlich durften die Finger auch nicht zu weit gespreizt werden – dann konnte das Tier im letzten Moment durch eine der Lücken nach oben entkommen. Es kam darauf an, dass zwar die Luft, nicht aber das Opfer entweichen konnte. Und dann musste man die Hand zunächst langsam über der Fliege in Stellung bringen – nicht zu nah, um sie nicht nervös zu machen – und sie dort reglos in der Luft verharren lassen.
Geduld, das Wichtigste war Geduld. Solange die Fliege sich nicht bewegte, war sie auf der Hut, nahmen die Facettenaugen auch noch das kleinste Zittern in ihrem Umkreis wahr, das musste man wissen. Ein Zuschlagen wäre dann unsinnig gewesen. Nein, der tödliche Schlag musste in dem Moment erfolgen, wenn sie sich in Sicherheit wähnte, wenn sie begann, ihre kleinen Vorderbeinchen aneinander zu reiben oder ihren flinken Marsch über die grüne Schreibunterlage wieder aufzunehmen.
Jetzt! »Nummer drei«, grunzte Clemens Venske befriedigt und wischte sich die sterblichen Überreste seines Opfers mit einem Papiertaschentuch von der Handfläche. Zwei flogen noch im Zimmer herum. Doch es war früh am Tag; auch die würden an diesem Vormittag noch dran glauben müssen.
Fliegenpatschen fand Venske unsportlich, außerdem brauchte er solche Waffen nicht. Wozu hatte die Natur ihn schließlich mit diesen riesigen Händen ausgestattet? Sie waren bei der Insektenjagd effektiver als jedes künstliche Hilfsmittel. Ebenso wie die viel zu großen Füße hatten sie ihn schon in der Kindheit zur Zielscheibe ständiger Verspottung gemacht, aber manchmal waren sie durchaus nützlich.
Außerdem tötete er die Fliegen nur, wenn sie ihn belästigten. Doch statt einfach weiter im Büro herumzufliegen und sich ihres Lebens zu erfreuen, summten die Viecher um seine abstehenden Ohren herum oder krabbelten über seine Finger. Vor allem hatten sie den unerklärlichen Drang, sich auf seinem zugemüllten Schreibtisch niederzulassen. Warum sie sich dermaßen für die Akten, die Mappen und den Papierberg vor ihm interessierten, würde für immer das Geheimnis der Fliegen bleiben. Auf jeden Fall reichte Venskes Begeisterung für seinen Schreibtisch nicht annähernd an die seiner kleinen Opfer heran.
Es klopfte. Ohne eine Antwort abzuwarten, trat Karl-Friedrich von Gössler durch die Tür, wie immer in einen tadellosen dunklen Anzug mit Weste gekleidet. Trotz der morgendlichen Hitze hatte der fast sechzigjährige Herr den Kragen seines blütenweißen Hemdes hoch geschlossen und die dezente Krawatte korrekt zu einem Windsorknoten wie aus dem Bilderbuch gebunden. Das dünne eisgraue Haar war straff an den langen Schädel des Abteilungsdirektors gekämmt.
»Was machen Sie denn hier drin, Herr Venske?«, fragte er. »Auf dem Flur hat es sich angehört, als hätten Sie geschossen.«
»Ich habe eine Fliege erlegt«, gab Venske grinsend zurück, »ausnahmsweise ohne Schusswaffengebrauch.«
Mit einem indignierten Stirnrunzeln setzte sich von Gössler auf den Besucherstuhl gegenüber Venskes Schreibtisch und sagte: »Eine Fliege … aha. Ich hoffe, dass das nicht der einzige Erfolg unserer Behörde an diesem sonnigen Tag bleiben wird.«
Arschloch, dachte Venske. Mit zuckersüßer Stimme erwiderte er: »Ich nehme an, Sie kommen gerade von der Morgenlage beim Innenminister.«
»In der Tat, Herr Venske, in der Tat!« Mit einer eleganten Bewegung tupfte von Gössler sich mit seinem seidenen Taschentuch ein paar Schweißtropfen von der hohen Stirn. »Der Herr Minister ist … beunruhigt, wenn ich das einmal so ausdrücken darf.«
»Ist er das?«, fragte Venske unbeeindruckt und lehnte sich in seinem Schreibtischsessel zurück.
»Es interessiert Sie wohl nicht, worüber man sich im Kabinett Sorgen macht, Venske«.
Gleichmütig blickte der Angesprochene seinen Chef an und schwieg. Als dem die Pause zu lang wurde, sagte er forsch: »Erkenntnisse! Darum geht es dem Herrn Minister. Seit Monaten tragen Sie mir nur Hinweise und Verdachtsmomente vor, ein paar Namen, ein paar nebensächliche Ermittlungsergebnisse.«
Venske setzte sich auf und schob seinen mächtigen Kopf mit dem blassen, von einer wilden Haarpracht umwallten Gesicht über die Schreibtischplatte. Dann sagte er leise: »Herr von Gössler! Darf ich daran erinnern, dass Sie es waren, der den Abbruch der Beschattung in Neuperlach angeordnet hat? Wir standen kurz davor, über den obskuren Moscheeverein dort ein paar hochinteressante ›Erkenntnisse‹ zu gewinnen.«
»Das behaupten Sie!«
»Das weiß ich! Und ich weiß auch, dass wir zu handfesten Erkenntnissen gekommen wären, wenn ich unseren V-Mann nicht hätte abziehen müssen.«
»Ihr V-Mann, Venske! Fast zwei Jahre hat der Kerl uns nur Geld gekostet; sein Einsatz hat Unsummen verschlungen. Und was hat er uns gebracht? Gar nichts hat er uns gebracht, Ihr … Protegé.«
»Jetzt reicht´s mir aber«, gab Venske noch leiser zurück. »Der Mann war von mir ausgebildet, das stimmt. Aber mein ›Protegé‹? Machen Sie sich doch nicht lächerlich.«
Von Gösslers Charakterkopf hatte sich gerötet. Heftig tupfte er mit dem edlen Tuch auf seiner schweißglänzenden Stirn herum. »Jedenfalls war er einfach zu teuer«, lenkte er vorsichtig ein. Er liebte es zwar, sich als Vertrauter des Innenministers aufzuspielen. Niemals aber hatte er es bisher auf eine ernsthafte Konfrontation mit seinem Stellvertreter, diesem sonderbaren Kobold mit den grotesk überdimensionierten Extremitäten ankommen lassen, den man hinter seinem Rücken nur ›Rumpelstilzchen‹ nannte. Er schien seine Grenzen genau zu kennen, wusste allzu gut, dass die gesamte Abteilung Ausländerterrorismus und -extremismus des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz mit Venskes Fähigkeiten stand und fiel. Von Gössler war zwar der Chef, aber viel mehr Politiker als Geheimdienstmann. Nie war es ihm gelungen herauszufinden, wie das fein gesponnene Netzwerk seines Stellvertreters funktionierte, das sowohl Verbindungen zu wichtigen Leuten anderer Dienste im In- und Ausland als auch beste Kontakte zum BND umfasste.
»Wie weit sind Sie denn mit dem Halbjahresbericht?«, wechselte der Abteilungsdirektor das Thema. Und den Tonfall.
Venske machte eine vage Handbewegung über seinen vollgepackten Schreibtisch und sagte: »Da sitze ich noch mindestens zwei Wochen dran, wenn Klausner nicht bald wieder gesund wird. Und das kann ich mir eigentlich gar nicht leisten. Wir haben da eine neue Spur im Umfeld der türkischen ›Idealistenvereine‹, wie die Brüder sich nennen, die uns ganz schnell handfeste … Erkenntnisse bringen könnte. Aber da muss ich mich selbst reinhängen, sonst geht das schief.«
»Hm. In der Tat: So lange können Sie für die operative Arbeit nicht ausfallen! Und diese neue Spur …«
»Ist wirklich brandheiß«, ergänzte Venske und blickte seinem Chef treuherzig in die Augen.
»Bemerkenswert, wirklich! Das wäre ja endlich einmal etwas Erfreuliches, wenn ich dem Herrn Minister einen solchen Fortschritt melden könnte.«
Eifrig sagte Venske: »Die aktuellen Zahlen für den Bericht habe ich jetzt alle beisammen. Die Statistiker haben gut gearbeitet. Aber Sie wissen ja, Herr von Gössler, nicht jeder tut sich mit dem Formulieren so leicht wie Sie.«
»Na ja«, zierte sich der Abteilungsdirektor, »ein jeder hat seine Stärken auf unterschiedlichen Feldern, nicht wahr? Lassen Sie mich doch mal schauen.« Damit langte er nach der Mappe.
Venske reichte sie ihm und verkündete: »Eigentlich geht es nur noch darum, alles in … äh … gefälliges Deutsch zu bringen.«
»Nun, daran soll es wahrlich nicht scheitern«, erklärte von Gössler hoch motiviert. »Das Werk ist bei mir in guten Händen. Und wenn Klausner wiederkommt, kann er mir bei den weniger wichtigen Kapiteln ja noch zuarbeiten.« Damit erhob sich der elegante Herr und ging zur Tür. Dort wandte er sich noch einmal um und sagte mit verschwörerischem Unterton: »Hauptsache, Sie kommen rasch voran mit Ihrer vielversprechenden Spur, lieber Herr Venske. Nächsten Mittwoch findet die ›Große Lage‹ beim Herrn Ministerpräsidenten statt – da wäre es gut, wenn ich ihm Ihre neuen Erkenntnisse schon vortragen könnte.«
Als ob du meinen Namen in dem erlauchten Kreis überhaupt erwähnen würdest … Venske musste grinsen. »Prima, und ich mach mich dann gleich mit Volldampf an die Arbeit«, sagte er beflissen. »Vielleicht gibt es tatsächlich schon bald handfeste … äh …« Sollte er es doch selbst sagen.
»Erkenntnisse!«, tönte es erwartungsgemäß von der Tür, bevor sie geschlossen wurde.
Venske stand auf und wanderte lächelnd ans Fenster. Die Vormittagssonne strahlte freundlich aus einem weißblauen bayerischen Himmel. Schöner Tag. Erst mal Schonfrist für die Fliegen.
Ein kurzer Kontrollblick auf seine Armbanduhr: Dreißig Sekunden – höchstens – schätzte er, dann würde das fleischige Gesicht des ›Hubernazi‹ um die Tür gucken. Das ganze Amt nannte seinen engsten Mitarbeiter so – natürlich mit Ausnahme von Gösslers. Der Spitzname setzte sich aus dem Nachnamen des Mannes – Huber – und einer sehr bajuwarischen Verballhornung seines Vornamens Ignaz zusammen.
Der Hubernazi vom Verfassungsschutz – in einer Behörde, die sich mit der Beobachtung und Verfolgung von Extremisten jeglicher Couleur beschäftigte, entbehrte dieser Spitzname nicht einer gewissen boshaften Ironie, die Venske unwiderstehlich fand. Natürlich wusste er auch um seinen eigenen Spitznamen, den er allerdings nur selten selbst zu hören bekam. Niemand aus seiner Umgebung verdarb es sich gern mit ihm.
»Hast du´s geschafft?«
Nur zwanzig Sekunden, stellte Venske befriedigt fest, als er die Stimme des Hubernazi hörte, der sofort wissen wollte: »Sag schon, hat er denn angebissen?«
»Wie ein hungriger Hecht im Frühjahr«, antwortete Venske und setzte sich wieder an seinen Tisch.
Huber nahm ihm gegenüber Platz und warf eine Mikrokassette auf den gewaltigen Papierberg. »Dann mal los. Aufnahmezeit heute Morgen, sechs Uhr und zwei Minuten.«
»Nachverfolgbar?«
»No, Sir, Prepaid-Handy. Immerhin: Ein Funkmast im Osten Münchens.«
»Hm. Anschluss bei uns?«
»Hauptanschluss. Dann hat er gezielt nach einem Gesprächspartner für das Aussteigerprogramm gefragt und wurde weiterverbunden.«
»Wer hatte Dienst?«
»Lisa. Sie hat gleich diese Kopie für dich gemacht.«
»Sehr gut«, sagte Venske, nahm die Kassette und legte sie in sein Diktiergerät ein. Gespannt lauschten die beiden Männer dem Dialog. Schon nach wenigen Sätzen waren sie wie elektrisiert.
»Ich habe etwas zu bieten, eine Liste und auch anderes Material.«
»Wollen Sie mir sagen, wer Sie sind?«
»Natürlich nicht am Telefon. Aber ich will mich mit jemandem von euch treffen. Ich will aussteigen. Und ich habe etwas in der Hand.«
»Woraus wollen Sie denn aussteigen?«, hakte Lisa nach.
»Ich sage nur ein Wort: Akıncı«
Venske runzelte die Stirn und starrte Huber an. »Was hat der gesagt – Akıncı? Originell, jedenfalls als aktueller Name.«
»Bisher kennen wir hier keine Gruppe, die sich so nennt … Aber dir sagt der Name doch etwas, oder?«
»Erklär ich dir später. Still, hör zu!«
Die junge männliche Stimme sagte gerade: »… und ich war an keiner Straftat beteiligt, bin nur Mitglied.«
Lisa versuchte es noch einmal: »Welche Straftat meinen Sie?«
Pause. Dann: »Die planen da etwas. Ich kann am Telefon nicht darüber reden. Aber ich habe alle Informationen. Wenn ich straffrei bleibe, erhaltet ihr von mir das Material.«
»Wir helfen Ihnen auf jeden Fall, darauf können Sie sich verlassen, aber …«
Plötzlich war im Hintergrund ein Poltern zu hören, und die nächsten Worte kamen hastig: »Ich muss Schluss machen. Ich rufe um Punkt zwölf Uhr und zehn Minuten wieder unter dieser Nummer an. Dann will ich mit eurem Chef sprechen, oder jedenfalls mit einem, der etwas zu sagen hat.«
Damit brach die Verbindung ab. Venske blickte auf seine Uhr. Noch dreieinhalb Stunden. Er schloss die Augen und sagte: »So, Ignaz, das ist jetzt mal richtig wichtig.«
»Schon klar«, gab Huber leicht pikiert zurück. »Bin doch net deppert.«
Clemens Venske lächelte mild. »Ich werde sofort Çelik in Ankara anrufen. Vielleicht hat er ja schon einmal etwas von dieser Gruppe gehört.«
Levent Çelik war leitender Beamter im türkischen Inlandsgeheimdienst MIT und dessen Verbindungsmann zum deutschen Verfassungsschutz. Einige Jahre schon arbeitete Venske eng mit ihm zusammen und schätzte den ausgewiesenen Kenner weltweit agierender terroristischer Organisationen sehr. Vor allem sein umfangreiches Wissen über die extremistische türkische Nationalistenszene hatte sich in vielen Fällen als nützlich erwiesen.
»Tu das«, sagte Huber. »Ich bereite inzwischen alles für den zweiten Anruf des Mannes vor.«
Venske nickte. Er wusste, dass er dem Hubernazi keine weiteren Anweisungen geben musste.
»Akıncı«, murmelte er leise. Kopfschüttelnd griff er zum Hörer des abhörsicheren Telefons und tippte die Nummer ein.
Er kannte sie auswendig.
2
Ungeduldig trommelte Karen Terhoven mit ihren Fingern aufs Lenkrad. Seit zwanzig Minuten stand sie nun schon im Stau auf der A 99, kurz vor der Ausfahrt Haar. Von dort waren es eigentlich nur noch fünf Minuten bis zum Klinikum München Ost. Die Fahrt von dem kleinen Ort Aying im Südosten Münchens, wo sie wohnte, bis zu ihrem Arbeitsplatz dauerte gewöhnlich kaum länger als eine halbe Stunde.
Heute nicht, stellte sie nüchtern fest.
Nun unterbrach auch noch Bayern 3 sein Musikprogramm für eine ›aktuelle Verkehrsmeldung‹, und der Moderator eröffnete seiner Hörerin in bester Laune, dass sie wegen eines Verkehrsunfalls hier stand.
Die aufgeräumte Stimmung des Radiomannes ging Karen auf die Nerven. Ungeduldig blickte sie in den Spiegel und strich sich eine Strähne ihres dichten schwarzen Haares aus der Stirn. Ihr Blick fiel auf das kleine Bild in dem Kleberahmen am Armaturenbrett. »Grins nicht so!«, knurrte sie das Gesicht auf dem Foto an und musste schmunzeln. Johannes, der um diese Zeit sicher gerade ihr Haus verließ, würde mit der S-Bahn bereits mitten in der Stadt sein, wenn sie gerade erst am Stadtrand ankäme.
Johannes. Dieser groß gewachsene Mann war vor drei Jahren als verängstigter, schwer traumatisierter Patient in ihr Leben getreten. Unsicher, verletzlich und verzweifelt mit seiner Amnesie hadernd. Und Karen hatte, als er sie in der Klinik in Freiburg zum ersten Mal ansah, sofort gewusst, dass künftig nichts mehr so sein würde wie zuvor.
Dabei war er äußerlich gar nicht ihr Typ, musste sie sich eingestehen. ›Edler Ritter in schimmernder Rüstung‹ – Männer, die bei ihr diese kitschige Assoziation weckten, hatte sie früher nur mit Missachtung gestraft. Aber in jenem Augenblick hatte sie etwas gespürt, was sie damals noch nicht in Worte kleiden konnte, ein Band, eine Verbindung zu diesem verstörten Menschen, die ihr als Psychoanalytikerin anfangs mehr als unheimlich war.
Es hatte seine Zeit gedauert, bis sie bereit war, ihre Rolle als vermeintlich unbestechliche Therapeutin aufzugeben, ihre Professionalität zum Teufel zu schicken, um ihm endlich als Frau begegnen zu können. Und da war plötzlich alles gut.
Auf dem Flughafen in Izmir hatte sie schließlich zum ersten Mal »Ich liebe dich« zu ihm gesagt.
Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht, als sie an die Zeit dachte, die sie gemeinsam im Haus ihrer türkischen Freunde verbracht hatten. Und bald schon würden sie den Blick auf das ägäische Meer vom Balkon ihrer eigenen Ferienwohnung genießen können, freute sie sich. Die neue Apartmentanlage war gerade im Bau. In ein paar Tagen wollte sie hinfliegen, um mit Ayse in Izmir Möbel auszusuchen und sich mit ihr über die Inneneinrichtung zu beraten.
Sie schrak auf. Ein Hubschrauber flog lärmend über die Autoschlange hinweg. Sie konnte jetzt erkennen, dass ein paar hundert Meter voraus Blaulicht blinkte, und seufzte resigniert. Um sieben Uhr hatte sie einen Termin auf ihrer Station. Sie musste sich vor der täglichen Teambesprechung unbedingt noch Zeit für ein Gespräch mit einem Patienten nehmen, der ihr Sorgen bereitete.
Nach einem erneuten Blick auf die Uhr stellte sie ärgerlich fest, dass ihr nun wahrscheinlich für Herrn Grabert kaum noch dreißig Minuten übrigbleiben würden.
Als Helmut Grabert, ein neunundfünfzigjähriger Sachbearbeiter bei einer Versicherungsgesellschaft, vorgestern auf der Station eintraf, war Karen Terhovens Dienstzeit schon längst beendet. Gerade hatte sie das letzte Diktat aufs Band gesprochen und begonnen sich umzuziehen, da rief Stationsschwester Walburga im Bereitschaftszimmer an und teilte ihr mit, dass eine Akutaufnahme auf dem Weg zu ihnen war. Ob Karen sich den Mann nicht kurz ansehen könne, bevor nur noch der Assistenzarzt im Dienst sein würde?
Also zog sie ihren Kittel wieder an und machte sich auf den Weg zum Behandlungszimmer. Dort saß ein mittelgroßer Mann, dessen graues Haar sich schon lichtete, in sich zusammengesunken auf einem Stuhl. Eine Frau in hellbeigem Kostüm – offenbar seine Ehefrau – hatte drei Meter entfernt von ihm auf einem Stuhl in der Ecke Platz genommen.
Walburga trötete mit ihrem Viktualienmarkt-Organ: »Das ist Frau Doktor Terhoven, unsere Oberärztin!«
Die Frau sah Karen mit distanziertem Interesse an. Grabert selbst nahm keinerlei Notiz von ihr, sondern starrte auf irgendeine Stelle vor seinen Schuhen. Er hatte einen marineblauen Geschäftsanzug an und trug eine dazu passende Streifenkrawatte. Seine Hände steckten zwischen seinen zusammengepressten Oberschenkeln.
Karen ging auf ihn zu, streckte ihre Hand aus und sagte: »Guten Abend, Herr Grabert, ich würde mich gern …«
Weiter kam sie nicht. Mit einem Unterton von Hysterie schaltete sich Frau Grabert ein: »Ich habe meinem Mann gesagt, dass er endlich zum Arzt gehen soll. Aber dass unser Hausarzt ihn direkt hierher in die Anstalt …, äh, also in dieses … Krankenhaus überwiesen hat …« Sie brach ab, holte ein Taschentuch aus ihrer Handtasche und tupfte sich damit die Nase. Dann blickte sie auf Karens ausgestreckte Hand und sagte: »Er wird Ihnen nicht die Hand geben. Sie werden schon noch merken, warum nicht.«
Schwester Walburga verdrehte die Augen und reichte Karen den Einweisungsschein des Hausarztes. Sie warf nur einen kurzen Blick darauf. Augenblicklich wusste sie, dass mit Helmut Grabert ein Problem auf ihre Station gekommen war. Der Hausarzt hatte wenige Worte geschrieben, aber die zusammengesunkene Haltung des Mannes, seine gequälten Gesichtszüge und seine zwischen die Beine geklemmten Hände waren eine deutliche Bestätigung für die Vermutungen des allgemeinmedizinischen Kollegen.
»Ich sehe hier den Vermerk Ihres Hausarztes, dass Sie freiwillig bei uns sind, Herr Grabert. Ist das richtig?«, fragte sie freundlich.
»Äh … ja«, antwortete der Mann und hielt seinen Blick weiter gesenkt.
»Gut«, wandte sich Karen an die Ehefrau, »dann darf ich Sie bitten, ein paar Minuten draußen Platz zu nehmen. Ich möchte mich ein wenig mit Ihrem Mann unterhalten.«
Zögernd zog Grabert die Hände zwischen den Knien hervor, sobald sich die Tür hinter seiner Frau geschlossen hatte. Dabei fixierte er weiter seine Schuhspitzen. »Ich lasse mich aber von Ihnen nicht ausfragen«, stieß er hervor.
Der Anblick seiner Hände war erschütternd. Selten hatte Karen Terhoven ein ähnlich gründliches Werk von Selbstverletzung gesehen. Nägelbeißer gab es viele – an diesen Fingern aber gab es nichts mehr abzubeißen. Die Fingerkuppen waren nur noch unförmige Stümpfe, blutverkrustet.
Langsam setzten sich die Fahrzeuge in der Schlange vor ihr in Bewegung. Über eine halbe Stunde hatte sie jetzt auf der Stelle gestanden. In der Autobahnausfahrt standen vor dem Polizeiwagen mit immer noch blinkendem Blaulicht drei leicht beschädigte Autos auf dem Seitenstreifen. Es sah nicht so aus, als hätte es Verletzte gegeben. Ein Rettungswagen war nirgends zu sehen.
Na, wenigstens etwas Gutes, dachte sie, als sie sich in den dichten Verkehr auf der Wasserburger Landstraße einfädelte. Mit ihren Gedanken war sie schon bei Grabert.
»Er will sich vertilgen«, hatte Professor Köhler vorgestern gesagt. »Wir müssen herausfinden, warum er das tut, bevor er bei seinen Oberarmen angekommen ist.«
Der Humor des Chefs war gewöhnungsbedürftig. Manchmal fiel er seinen Mitarbeitern damit arg auf die Nerven, vor allem, weil er bei seinen Sprüchen nie eine Miene verzog.
Wenige Minuten später war sie am Ziel, stellte das Auto auf ihrem reservierten Parkplatz ab und machte sich eilig auf den Weg.
Vertilgen – was für ein Ausdruck! Und doch mit erbarmungsloser Treffsicherheit genau der passende.
***
Eine gute Stunde nach Karen verließ auch ihr Lebensgefährte das Reihenhaus in Aying, das sie vor einem Jahr gemietet hatten. Sorgfältig schloss er die Außentür ab. In den letzten Monaten waren in dieser ruhigen Wohnstraße einige Einbrüche vorgekommen. Auf dem Weg zur Gartenpforte drehte er sich noch einmal um und warf einen Blick zum Küchenfenster im Erdgeschoss.
Ja, er hatte es wieder zugeklappt, stellte er befriedigt fest und durchquerte den kleinen Vorgarten. Aus dem dichten Rhododendron neben dem Zaun hörte er leises Miauen. Eine kleine hellgraue Katze sprang übermütig darunter hervor, lief zu ihm und rieb sich an den Hosenbeinen seines Anzuges.
»Guten Morgen, Akgül«, rief Johannes Clasen lachend, beugte sich zu ihr hinunter und kraulte sie im Nacken. »Nun aber schnell ab mit dir ins Haus!«
Die Katze hob kurz ihren Kopf mit der rosa Nasenspitze und sah zu ihm hoch. Dann setzte sie sich gemächlich in Bewegung. Neben der Eingangstür gab es eine Katzenklappe, durch die sie jederzeit hinein- und herauskonnte. Sie aber stolzierte mit keck aufgerichtetem Schwanz wieder zurück zu ihrem Versteck unter den Büschen.
Johannes lächelte und rief ihr hinterher: »Tust ja sowieso nur, was du willst.« Kurz erschien ein brennendes Segelschiff vor seinen Augen, das, eingehüllt in dichten Qualm, in einer malerischen Bucht an der türkischen Ägäisküste sank. Am Bug lief eine kleine graue Katze in Panik hin- und her und stieß angstvolle Laute aus.
Nicht einmal drei Jahre war das jetzt her. Obwohl es sich heute für ihn anfühlte, als sei das alles in einem anderen Leben gewesen, verging doch kaum ein Tag, an dem ihm nicht ein solches Bild der Erinnerung vor die Augen trat. Dann dachte er an den schicksalhaften Segeltörn nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus. Sein verzweifelter Kampf mit den erbarmungslosen Killern, die Versenkung der Yacht und seine Rettung durch die Küstenwache in letzter Minute gehörten zu diesen immer wiederkehrenden Erinnerungssplittern.
Akgül, auf Deutsch ›Weiße Rose‹, war der Name des Bootes gewesen. Er wurde dann wie selbstverständlich zum Namen der Katze, als Karen und Johannes sie mit nach Deutschland nahmen. Noch heute mussten sie beide darüber lachen: Eine graue Katze, die ›Weiße Rose‹ hieß – mit Vernunft hatte diese Namenswahl eher nichts zu tun.
Er atmete tief durch und machte sich, seinen schmalen Aktenkoffer in der Hand, auf den Weg zum Bahnhof, der nur ein paar Minuten entfernt lag. Es war noch früh, trotzdem spürte er schon die wärmende Kraft der Sonne, die am wolkenlosen blauen Himmel stand.
Sie hatten sich darauf geeinigt, dass Karen das Auto benutzte und er mit der S-Bahn in die Stadt fuhr. Ihre Dienstzeiten im Klinikum waren so unberechenbar wie die seinen in früheren Jahren, als er noch Offizier in einer Spezialeinheit der Bundeswehr gewesen war. Außerdem musste er zur Arbeit mitten in die Stadt fahren. Er leitete die deutsche Niederlassung des Handelsunternehmens seines Freundes Mehmet Görgün, der – hier in München als Sohn türkischer Einwanderer geboren – früher einmal sein Dozent an der Hochschule gewesen war. Später war Dr. Görgün in die Heimat seiner Eltern nach Izmir gezogen und hatte dort sein Unternehmen gegründet. Sein Jobangebot war genau recht gekommen, als Johannes den Dienst quittiert hatte. Von heute auf morgen war er bald danach der Nachfolger des damaligen Niederlassungsleiters geworden, als der überraschend einem Herzinfarkt erlag.
Mehmets Anspruch an seinen deutschen Repräsentanten war hoch, daran änderte auch die Tatsache nichts, dass die beiden Männer seit vielen Jahren Freunde waren. Oft saß Johannes bis in die Nacht hinein im Büro. Außerdem reiste er kreuz und quer durch Deutschland, um den Kontakt zu den Geschäftspartnern zu halten.
Oft stellte er sich die Frage, ob er nach dem letzten Afghanistan-Einsatz seinem Gewissen so konsequent gefolgt wäre ohne die Sicherheit, diese neue Stellung antreten zu können. Er kannte sich gut genug, um daran zu zweifeln.
Dennoch war es irgendwie befremdlich, dass er sein Leben so radikal hatte ändern können. Zwischen diesem und seinem früheren Beruf lagen Welten. Solch geschmeidiger Übertritt von der einen in die andere wäre ihm früher unmöglich erschienen, hatte durchaus etwas Irreales an sich. Es gab Stunden, in denen ein gefährlicher Gedanke in ihm aufstieg: War es tatsächlich eine Gewissensfrage gewesen, oder gab es damals andere Motive für seine Entscheidung? Waren nicht eher Angst und Verzweiflung seine Ratgeber gewesen – oder gar … Feigheit?
Er wusste, dass er zu oft grübelte, dass Karen sich schon Sorgen machte. In manchen Nächten suchten ihn schlimme Träume aus den Jahren seiner Einsätze in Afghanistan heim. Selbst wenn er tagsüber am Schreibtisch saß, passierte es nicht selten, dass er plötzlich an die Höhle im Hindukusch dachte. Mehr tot als lebendig hatten sie ihn dort herausgeholt.
Manchmal geriet ihm wieder der modrige Geruch der feuchten Felsen in der Nase. Dann hörte er auch das Stakkato der Maschinenpistolen.
Ein kalter Schauer durchfuhr ihn, und seine Schritte stockten. Für einen Augenblick verloren die Sonnenstrahlen ihre Wärme, und ihn überfiel die Erinnerung an die Monate der Amnesie und an seinen Kampf um die Erinnerung, den er fast mit dem Leben bezahlt hatte.
Unwillig schüttelte er den Kopf und nahm seinen Gang wieder auf. Wurde er denn diese Gedanken nie mehr los?
Während er durch die sonnigen Straßen des freundlichen kleinen Ortes lief und in die bunten Sommergärten blickte, erschien ihm sein bisheriges Leben sonderbar unwirklich, bestimmt durch eine willkürliche Abfolge unglaublicher Zufälle.
Unwirklich. Ein besseres Wort wollte ihm nicht einfallen.
***
Der sommerlich heiße Tag ging zu Ende. Das Blau am wolkenlosen Himmel färbte sich allmählich dunkel ein, und weich legte sich die Abenddämmerung über die große Stadt.
Metin Kaymaz – mit seinem olivfarbenen Teint, den fein geschnittenen Gesichtszügen und seinen glänzenden, fast schwarzen Augen ein auffallend gutaussehender Mann Mitte zwanzig – saß im dritten Stockwerk eines schäbigen ehemaligen Geschäftshauses am PC und tippte nervös auf der Tastatur. Die letzten Sonnenstrahlen warfen, verzerrt durch die milchigen Glasbausteine, ein paar goldene Lichtstreifen auf den Tisch.
Kaymaz konnte sich nicht konzentrieren. Immer wieder schaute er auf seine Armbanduhr. Ungeduldig wartete er auf seine Freunde, die gleich eintreffen mussten.
Warten. Wie er es hasste. Unruhig zuckte sein Blick durch den Raum: Ein durchgesessenes Sofa, ein paar zerschlissene Sessel und einige alte Regale bildeten die karge Möblierung, vor allem aber viele Stühle, von denen kaum einer so aussah wie der andere. Eine lange Platte, die auf Holzböcken ruhte, diente als Tisch.
War auch fast alles hier alt und schäbig, so galt dies nicht für die drei Computer, die Flachbildmonitore und den Farbdrucker, die auf der Tischplatte standen, umgeben von vielfarbigem Kabelgewirr.
Metin Kaymaz schwitzte. Er konnte die Anspannung kaum noch ertragen. Ärgerlich hob er die Arme und sah unter seinen Achselhöhlen nasse Flecken auf dem hellen Hemd, das er erst vor einer Stunde frisch angezogen hatte. Hektisch schaltete er den Computer ab, stand von seinem Arbeitsplatz auf und überlegte, ob ihm noch genug Zeit blieb, das Hemd zu wechseln. Auf keinen Fall durften sie sehen, wie sehr ihm zu schaffen machte, was sie heute Nacht vorhatten – vor allem der Öncü nicht, der ›Leitwolf‹!
Dann fiel ihm ein, dass dies das letzte gewaschene Hemd war, das er vorhin in seinem Zimmer noch gefunden hatte. Wieder warf er einen ungeduldigen Blick auf seine Uhr und wischte sich mit dem Handrücken den kalten Schweiß von der Stirn. Er fröstelte. Unangenehm kalt klebte das feuchte Hemd an seiner Haut. Über die Ursache machte er sich keine Illusionen: Dass die Zeit für die Akıncı gekommen war, mit einem Fanal auf sich aufmerksam zu machen, war eine Sache. Eine andere war es, dies in die Tat umzusetzen.
Und genau das sollte heute Nacht geschehen.
Obwohl er darauf gewartet hatte, fuhr Kaymaz zusammen, als endlich der schrille Ton der Türglocke mit dem vereinbarten Klingelcode ertönte. Wütend auf seine schwachen Nerven hastete er durch den langen Flur und warf einen schnellen Blick auf den kleinen Monitor an der Wand, der ihm zeigte, was die Überwachungskamera über der Außentür drei Stockwerke tiefer aufnahm. Die Ersten waren da.
Kaymaz lauschte an der Wohnungstür. Kurz darauf hörte er Schritte durch das Treppenhaus hallen. Nach einem Blick durch den Türspion öffnete er, und drei Männer – etwa in seinem Alter – betraten die Wohnung.
Mehrmals noch klingelte die Türglocke in der nächsten Stunde. Manchmal kam nur einer, manchmal standen auch zwei oder drei Männer gleichzeitig vor der Tür – nie jedoch mehr. Es wäre viel zu auffällig gewesen, wenn die gesamte Gruppe auf einmal das Haus betreten hätte. Inzwischen zählte sie immerhin fünfzehn aktive Kämpfer. Metin Kaymaz war stolz darauf, nicht wenige von ihnen selbst angeworben zu haben.
Die Wartezeit füllten sie mit leisen Gesprächen und tranken Tee. Draußen war es völlig dunkel geworden, als er schließlich kam. Als Letzter.
Der Öncü.
Als er den Raum betrat, standen die jungen Männer auf. Der Öncü – ein mittelgroßer, bärtiger Mann Anfang dreißig – ließ seine Augen hinter der Stahlbrille aufmerksam über jeden der Anwesenden gleiten. Dann nickte er fast unmerklich.
Sofort kam Bewegung in die Männer. Sie stellten sich schweigend in einer Linie nebeneinander vor die reich bestickte Flagge, die die gesamte Wand gegenüber den Glasbausteinen bedeckte. Drei starke Strahler an der Decke beleuchteten das farbenprächtige Tuch. Blutrot stand auf Türkisch an ihrem oberen Rand: ›Unser Führer ist der Koran, unser Ziel ist Turan!‹
Vor stilisierten weißen Wolken zeigte die Flagge die geflügelte blaue Wölfin, das heilige alttürkische Totemtier. Ihr edler Kopf war, ebenso wie die Federn ihrer Schwingen, mit feinen Stichen kunstvoll gestickt. Sie sprang durch einen Himmel, an dessen Rand drei rote Halbmonde prangten. Ebenfalls in türkischer Sprache trug das Tuch unten in breiten goldenen Lettern die Worte: ›Heilige Wölfin Asena, unsere Mutter‹.
Noch immer war kein Wort gefallen, da nickte der Öncü wieder sanft mit dem Kopf. Feierlich langsam hob jeder der Männer seinen rechten Arm, formte die Hand zum Geheimzeichen der Akıncı und blickte hinauf zum Bildnis der Wölfin.
Dann sprachen sie gemeinsam ihren Schwur.
3
Ein trockener Knall und der klirrende Lärm von zerberstendem Glas ließen Dersim Bağdaş aus dem Schlaf hochfahren. Übergangslos begann er zu zittern. Nur zu gut kannte er diese verhassten Geräusche. Vor langer Zeit hatte er sie viele Jahre lang hören müssen. Sie klangen nach Zerstörung, Hass und Verfolgung. Dieser Klang hatte ihn und seine Familie vor fast zwanzig Jahren aus ihrer Heimat in die Fremde getrieben – bis hierher in die ferne deutsche Stadt.
Nie mehr hatte er diese Geräusche hören wollen!
Er sprang aus dem Bett und hastete zum Fenster, das wegen der frühsommerlichen Wärme offenstand. Im Licht der Straßenlaternen konnte er das riesige gezackte Loch in der Ladenscheibe sofort erkennen.
Das Ehepaar Bağdaş wohnte im dritten Stockwerk eines Mietshauses in einer ruhigen Seitenstraße im Münchener Stadtteil Berg am Laim. Der Wohnung gegenüber lag auf der anderen Straßenseite im Erdgeschoss der kleine Laden, in dem Schneidermeister Bağdaş seine Änderungsschneiderei betrieb.
Er sah, wie ein ganz in Schwarz gekleideter Mann mit einer Axt einige große, spitze Glasstücke aus dem Rahmen schlug, dann einhielt und kurz die Hand hob. Zwei weitere schwarz vermummte Gestalten, die irgendwelche Gegenstände trugen, lösten sich aus dem Schatten des Hauseingangs nebenan. Mit ein paar schnellen Schritten an der zerstörten Scheibe angekommen, sprangen sie durch das inzwischen mannshohe Loch in das Innere des Ladens hinein.
Nicht noch einmal! Dersim Bağdaş stand wie versteinert an seinem Schlafzimmerfenster und starrte hinüber. Seine Frau war neben ihn getreten. Sprachlos vor Entsetzen, eine Hand vor den Mund geschlagen, klammerte sie sich mit der anderen an die Schulter ihres Mannes.
Als in einigen Wohnungen gegenüber das Licht anging, erwachte Bağdaş aus seiner Starre. Er rannte in den Flur und schlüpfte mit nackten Füßen in seine Schuhe. Dann griff er nach seiner Jacke. »Ruf die Polizei an«, rief er seiner Frau zu, die noch immer am Fenster stand. »Los, mach schon! Ruf sofort die 110 an! Sag denen, dass sie sofort kommen müssen …«
»Aber ich kann doch nicht …«
Natürlich, fiel es Bağdaş jetzt ein. Seine Frau hatte es in fast zwanzig Jahren nicht geschafft, Deutsch zu lernen. Auf jeden Fall nicht genug, um der Polizei etwas erklären zu können – vor allem, wenn sie so aufgeregt war.
»Bleib doch hier! Was willst du denn machen?«, rief sie verzweifelt.
»Ich laufe rüber! Glaubst du, ich sehe zu, wie sie mir noch einmal alles kaputtmachen?« Rasch zog er seine Jacke über den Schlafanzug und öffnete die Wohnungstür. »Geh hoch und klingele bei Mercan. Sie soll die Polizei anrufen!«
Im obersten Stockwerk des Hauses wohnte seine Tochter Mercan mit ihrem Mann. Sie war zwei Jahre alt gewesen, als die Familie Anfang der Neunziger aus der Türkei geflohen war, und hier in München aufgewachsen.
Reich war Dersim Bağdaş nicht geworden, aber sein kleines Geschäft lief gut. Auch viele deutsche Kundinnen schätzten seine saubere Arbeit und die günstigen Preise. Sie alle glaubten, er sei Türke, doch das spielte für den Schneidermeister schon lange keine Rolle mehr. Anfangs hatte er manchmal noch zu erklären versucht, dass er kein türkischer Gastarbeiter war. Schnell aber musste er feststellen, dass er für die Deutschen stets ›der türkische Änderungsschneider‹ bleiben würde. Bis heute verstanden die wenigsten von ihnen, dass aus der Türkei nicht nur Türken nach Deutschland gekommen waren. Und die Türkei selbst tat sich nach wie vor schwer damit, endlich zu akzeptieren, dass ihr Staatsvolk aus verschiedenen Ethnien bestand. Die blutigen Kämpfe im Lande sprachen da eine deutliche Sprache.
Dersim Bağdaş war Kurde. In einer Stadt im südöstlichsten Zipfel der Türkei, fast in Sichtweite zur irakischen und iranischen Grenze geboren und aufgewachsen, musste er schon in der Schule erfahren, welch schmerzhafte Folgen es hatte, wenn jemand seine Geburtsstadt bei ihrem kurdischen Namen Gewer nannte, wie die Eltern und Großeltern zu Hause es taten.
»Dies ist eine türkische Stadt«, sagte der Lehrer dann streng und ließ die biegsame Gerte auf die Finger seiner Schüler schnalzen, von denen in dieser Region die allermeisten kurdischer Herkunft waren, »also hat sie auch einen türkischen Namen. Wie lautet dieser Name?«
»Meine Stadt heißt Yüksekova«, sagte der kleine Dersim dann. Immer wenn der Lehrer sie dabei erwischte, dass sie ein Wort auf Kurdisch sagten, mussten die Kinder sich vor die Klasse stellen, zum großen Bild Atatürks an der Wand aufblicken und dreimal laut auf Türkisch rufen: »Glücklich ist, wer sich Türke nennen darf!«
Dersim lernte das Schneiderhandwerk wie schon sein Vater und Großvater. Nach dem Militärdienst trat er in das väterliche Geschäft ein. Es war ein stolzer Betrieb – in der Schneiderei Bağdaş erhielt man die besten Anzüge und die feinsten Mäntel der ganzen Stadt. Zu ihren Kunden gehörten viele Beamte, leitende Angestellte und wohlhabende Kaufleute.
Die Zukunft schien gesichert, da putschte sich 1980 in Ankara das Militär erneut an die Macht. Festnahmen und Folter waren fortan jahrelang an der Tagesordnung, und die Minderheiten im Lande erlebten eine Welle der Verfolgung. Eine besondere Gefahr für die Machthaber in Ankara war die kurdische PKK mit ihrer separatistischen Guerillatruppe. Alle staatlichen Repressalien dienten daher stets angeblich der Bekämpfung des Terrorismus. Daran hatte sich bis heute nichts geändert. Im Gegenteil: Nach ein paar Jahren trügerischer Ruhe war der ethnische Konflikt unter dem islamisch-konservativen Präsidenten gerade wieder brutal aufgeflammt.
Ende der achtziger Jahre heiratete Dersim Bağdaş. All seine Kraft setzte er für das Geschäft und das Wohlergehen seiner jungen Familie ein. Mit den Umtrieben seiner radikalen Landsleute hatte er nichts zu schaffen, dennoch brachte es ihn mehr und mehr auf, die vielen Übergriffe durch Polizei und Militär in seiner Stadt miterleben zu müssen.
Ohnmächtige Verzweiflung breitete sich unter den Kurden in Südostanatolien aus. Menschen verschwanden am helllichten Tag aus ihren Häusern, wurden monatelang festgehalten und gefoltert. Täglich war man in Gefahr, auf offener Straße in ein Gefecht zwischen dem Militär und den immer gewalttätigeren PKK-Kämpfern zu geraten.
Und dann kam jene Nacht, die Dersim nie vergessen würde. In dieser Nacht wurde das Geschäft, das drei Generationen ernährte, angezündet und dem Erdboden gleichgemacht. Seine Eltern, die ihre Wohnung über dem Laden hatten, verbrannten. Selbstverständlich wurden die Täter nie ermittelt.
Wenige Wochen später verließ der junge Schneider mit seiner Frau und der zweijährigen Tochter in einem alten Auto die Heimat. Ihr Weg führte sie Tausende von Kilometern durch die gesamte Türkei und durch halb Südeuropa. Im Kofferraum und auf dem Dach führten sie einige Habseligkeiten mit, in der Tasche hatte er umgerechnet knapp tausend Deutsche Mark. Im August 1991 kamen sie in München bei einer befreundeten Familie an, die schon ein Jahr zuvor geflüchtet war.
Noch in derselben Woche beantragte Dersim Bağdaş Asyl.
Hastig, immer zwei oder drei Stufen überspringend, stürzte er durch das Treppenhaus nach unten, riss die Eingangstür auf und trat ins Freie. Aus seinem Geschäft schräg gegenüber drang der Lärm von zerberstendem Holz und splitterndem Glas an seine Ohren. Blinde Wut packte ihn, als er plötzlich das Feuer sah, das im Inneren des Ladens aufflammte.
»Verdammte Bande!«, fluchte er und ballte die Fäuste. Gerade wollte er die Straße überqueren, da raste ein Auto heran und hielt mit quietschenden Reifen vor der zerstörten Schaufensterscheibe. Der Lärm hörte plötzlich auf, und die schwarzen Gestalten kamen rasch nacheinander nach vorn – gespenstisch beleuchtet vom immer heller werdenden Feuerschein im Inneren. Sie sprangen durch das gezackte Loch der Scheibe und rannten zu dem Wagen, der mit laufendem Motor wartete.
Jemand rief: »Bleib hier, Vater! Du kannst doch nichts gegen sie ausrichten. Es ist zu gefährlich«, und Bağdaş spürte eine Hand, die ihn am Ärmel festhielt. Unwirsch blickte er auf seinen Schwiegersohn, der neben ihn getreten war.
Wütend riss er sich los und schrie wie von Sinnen: »Ich lass mir das nicht noch einmal gefallen!« Mit großen Schritten stürmte er auf das Auto zu, das sich schon mit durchdrehenden Rädern in Bewegung setzte. »Halt, ihr Feiglinge! Feige Hunde! Ich bring euch um!«
Das plötzlich eingeschaltete Fernlicht des Wagens erfasste ihn, und geblendet schloss er für eine Sekunde die Augen. Im letzten Augenblick riss sein Schwiegersohn ihn zurück. Das Auto schoss so dicht an ihnen vorbei, dass sie es mit ihren Händen hätten berühren können. Während es sich immer schneller entfernte, hallten aus den geöffneten Seitenscheiben laute Rufe durch die stille Seitenstraße.
Diese Rufe kannte Dersim Bağdaş. Er hörte sie nicht zum ersten Mal. Und es waren immer dieselben. Seit so vielen Jahren. »Tod den kurdischen Hunden!«, hallte es in seinen Ohren und »Zuerst das Vaterland!« Auf Türkisch.
Dann verschwand das Auto in der Dunkelheit, und Bağdaş sackte am Arm seines Schwiegersohnes in sich zusammen.
Das Feuer war gelöscht.
Die Feuerwehr war mit drei Löschfahrzeugen schnell vor Ort gewesen und hatte ihre Arbeit schon nach kurzer Zeit erfolgreich beendet. Viele neugierige Anwohner hatten sich auf dem Schauplatz eingefunden – die meisten nur mit Schlafanzug und Mantel bekleidet -, kommentierten das Geschehen lautstark und mussten von der Polizei immer wieder zurückgedrängt werden.
Niemand war bei dem Anschlag verletzt worden, auch die Wohnungen über dem Laden blieben unversehrt. Der aber bestand nur noch aus einem Haufen verkohlter Trümmer.
Kaum fühlte er sich etwas besser, ließ der Schneider sich nicht davon abhalten, die qualmenden Reste seiner Existenz in Augenschein zu nehmen. Sofort sah er es. Mit roter, fluoreszierender Farbe gesprüht, prangten die Worte an der Wand des Verkaufsraumes. Dieselben Worte, die sie ihm aus dem Auto nachgeschrien hatten. Und daneben leuchteten ihm höhnisch drei rote Halbmonde und ein ›A‹ entgegen.
Auch der Kriminalbeamte, der die Spurensicherung leitete, sah dieses Graffiti. Er murmelte etwas, das sich für die Umstehenden wie ›Rumpelstilzchen‹ anhörte, und wählte eine Nummer, die auf seinem Handy gespeichert war.
Eine halbe Stunde danach fuhr ein unscheinbarer Mitteklassewagen mit getönten Scheiben vor, und ein kleiner, fast schmächtiger Mann mit einer wirren dunklen Haarmähne und übergroßen Extremitäten betrat den Tatort. Er unterhielt sich kurz mit den Feuerwehrleuten und dem Einsatzleiter der Polizei, zog dann ein Paar riesige Gummistiefel an und stapfte in dem nassen, verwüsteten Laden herum.
Die Schaulustigen waren in ihre Häuser zurückgekehrt, als Kripo und Feuerwehr abzogen. Clemens Venske saß mit Bağdaş und seiner Frau in der Wohnung auf der anderen Straßenseite am Küchentisch und trank türkischen Kaffee. Hin und wieder warfen sie einen Blick aus dem Fenster. Das Innere des Ladens war im ersten Morgenlicht als dunkle Brandruine hinter einem großen offenen Loch auszumachen. Der Ruß hatte auch die Hauswand rundherum geschwärzt. Der Schwiegersohn des Schneiders hielt auf einem Gartenstuhl zwischen den rotweißen Bändern der Polizeiabsperrung Wacht und wartete auf den Sachverständigen der Versicherung. Bağdaş hatte vorhin – die Police seiner Geschäftsversicherung in der Hand – mit ihm telefoniert.
»Köstlich, Gulxan Hanım«, lobte Venske die Hausfrau und schlürfte hörbar den starken Kaffee. Es war bereits seine vierte Tasse. Über eine Stunde lang sprach er nun schon mit den Eheleuten. Immer wenn er sich an Frau Bağdaş wandte, wechselte er wie selbstverständlich ins Türkische, das er nahezu perfekt beherrschte. Sie dankte ihm, indem sie die Zufuhr an frisch gebrühtem Kaffee nie versiegen ließ und selbstgebackene Kuchenstückchen servierte. Während er den Zigarettenvorrat des Hausherrn – eine wunderbar aromatische orientalische Tabakmischung – genüsslich dezimierte, erzählten ihm die Eheleute von den Umständen ihrer Flucht, von ihren Kindern und von ihrem Geschäft. Bald kannte er die ganze Geschichte der kurdischen Familie.
Soweit sie ihn interessierte.
Venske war ein geschickter Fragensteller. Wer sich mit ihm unterhielt – Verhöre ausgenommen –, fühlte sich stets wohl und meinte, das ungeteilte Interesse des kleinen freundlichen Mannes gelte allem, was er in diesem Moment zu hören bekam. Doch Venske hatte die Fähigkeit entwickelt, selbst in stundenlangen Gesprächen nur das wirklich aufzunehmen, was er für wichtig hielt. Diese Sätze aber konnte er später mühelos wieder abrufen. Fast wörtlich.
»Ich habe mich damals nicht für Politik interessiert. Und heute tue ich das auch nicht«, sagte Bağdaş. »Aber natürlich merken wir auch, dass das Verhältnis zwischen uns und den Türken hier in der Stadt immer schlechter wird.«
Venske stellte die Tasse ab und fragte: »Gehen Sie und Ihre Frau regelmäßig zu den Veranstaltungen der kurdischen Kulturvereine?«
»Hin und wieder«, gab Bağdaş sichtlich erstaunt zurück, »vor allem, wenn Vorführungen stattfinden, also Tanzgruppen oder Diavorträge aus unserer Heimat und so etwas.«
Venske sah ihn aufmerksam an und schwieg. Er brauchte nicht lange zu warten.
»Ich weiß schon, warum Sie das fragen«, stieß Bağdaş hervor. »Aber von den politischen Aktionen halten wir uns fern. Es gibt auch unter den Kurden hier in der Stadt ein paar Fanatiker, darauf wollen Sie ja wohl hinaus.« Er holte tief Atem und fuhr fort: »Dieses Land hat mir und meiner Familie Asyl gewährt. Hier können wir frei leben. Es tut mir weh, wenn ich sehe, dass auch junge Kurden die deutsche Kultur missachten und immer radikaler werden.«
Seine Frau blickte vor sich auf den Tisch und sagte leise etwas auf Kurdisch. Dann hob sie den Kopf, sah Venskes fragenden Blick und wiederholte auf Türkisch: »Entschuldigung, ich habe gesagt, dass sie ihr Verhalten immer mit dem Koran erklären. Als ob sie den verstanden hätten …«