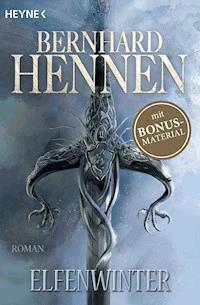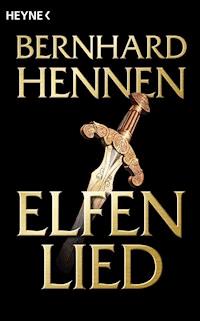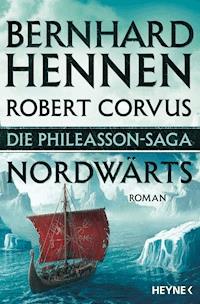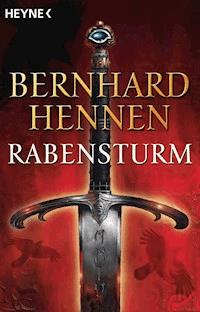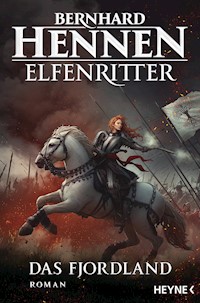
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Elfenritter-Trilogie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Nach einem erbitterten Kampf ist es der klugen und mutigen Herrscherin Gishild gelungen, den Thron des Fjordlands zurückzuerobern. Gemeinsam mit den Albenkindern drängt sie die Krieger der verhassten Tjuredkirche aus ihren Ländereien zurück, doch noch ist die Freiheit nicht gewonnen: Die Ordenskrieger greifen das Reich der Elfen an und zerstören die legendäre Stadt Vahan Calyd. Außer sich vor Wut schwört die Elfenkönigin Emerelle Rache. Rache, die auch vor Gishilds Geliebtem Luc nicht haltmacht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 988
Ähnliche
DASBUCH
Still verfluche ich die Ritter von der blutroten Eiche. Voller Heimtücke haben sie sich nach Vahan Calyd geschlichen. Möge der Fluch der bösen Tat auf sie zurückfallen. So wie Vahan Calyd in der Stunde seines schönstes Festes fiel, soll das Strafgericht auch sie überraschend und in der Stunde ihres Triumphs ereilen. Ich hoffe auf Emerelle.
Nach langen und erbitterten Kämpfen ist es Gishild gelungen, den Thron ihres Vaters zurückzuerobern. Durch Klugheit, Mut und politisches Geschick konnte sie, gemeinsam mit ihren Verbündeten, die Tjuredritter aus ihren Ländereien zurückdrängen. Doch von Frieden kann noch lange keine Rede sein, denn ihre Feinde drohen nun durch ihre fanatische Hetze und unbarmherzige Kriegstreiberei die Albenmark ins Verderben zu stürzen: Sie greifen sie sogar die legendäre Stadt Vahan Calyd an und zerstören sie. Außer sich vor Wut plant die mächtige Elfenkönigin Emerelle ihre Rache. Ein Akt der Rache, der auch vor Gishilds geliebtem Luc nicht haltmacht …
Schon lange hat Luc, der Krieger im Dienste der Tjuredkirche, seine große Liebe freigegeben, doch vergessen kann er Gishild nicht. Als er von Emerelle gefangen genommen wird, scheint jede Hoffnung, Gishild noch einmal lebend wiederzusehen, dahin. Doch als sich Albenkinder, Fjordländer und Tjuredritter in einer letzten großen Schlacht gegenüberstehen, werden die Karten des Schicksals neu gemischt …
DERAUTOR
Bernhard Hennen, 1966 geboren, studierte Germanistik, Geschichte und Vorderasiatische Altertumskunde. Mit seiner Elfen-Saga stürmte er alle Bestsellerlisten und schrieb sich an die Spitze der deutschen Fantasy-Autoren. Bernhard Hennen lebt mit seiner Familie in Krefeld.
»In seinen Romanen inszeniert Bernhard Hennen ein bildgewaltiges Kopfkino.« NEUEWESTFÄLISCHE
»Man nennt ihn auch den HERRNDERELFEN. Bernhard Hennen ist der zurzeit erfolgreichste Fantasy Autor im deutschsprachigen Raum.« EXPRESS
»Bernhard Hennens Elfen-Romane gehören zum Besten, was die Fantasy je hervorgebracht hat.« WOLFGANGHOHLBEIN
BERNHARD
HENNEN
ELFENRITTER
DAS FJORDLAND
Dritter Roman
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Vollständig überarbeitete Neuausgabe 09/2021
Redaktion: Angela Kuepper
Überarbeitung: Uta Dahnke
Copyright © 2008 by Bernhard Hennen
Copyright © 2021 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Das Illustrat GbR, München
unter Verwendung einer Illustration von Kerem Beyit
Karten und Illustrationen: Andreas Hancock
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-28815-0V001
Für die Schöne vom großen Fluss
Andrea: »Unglücklich das Land,
das keine Helden hat.« (…)
Galilei: »Unglücklich das Land,
das Helden nötig hat.«
Aus: »Leben des Galilei«
von Bertold Brecht (1898–1956)
PROLOG
»Wenn ich von Süden komme, in der ersten Morgendämmerung, und die Palasttürme Vahan Calyds als bleiche Schemen aus dem Nebel treten, dann berührt mich ihr Anblick zutiefst. Die mich kennen, würden mich wohl kaum sentimental oder romantisch nennen. Mein Leben zählt nach Jahrhunderten, so wie deines, mein Bruder. Oft war ich in Vahan Calyd, dieser uralten Stadt am Waldmeer, wo Schönheit und Verfall in Harmonie zueinandergefunden haben. Stets plane ich meine Reisen so, dass ich den Hafen gemeinsam mit dem Morgenlicht erreiche. Zwischen Bangen und Hoffen stehe ich am Bug. Ich habe Angst, dass der seltsame Zauber, den die Stadt auf mich ausübt, eines Tages verflogen sein wird. Du bist ein Krieger, ich eine Heilerin. Den Anblick von Elend und Tod sind wir gewohnt. Wie du habe auch ich gelernt, mein Herz zu verhärten. Mich darf nicht berühren, was ich sehe, mit kaltem Blut vermag ich besser zu helfen. Wenn ich an das Lager eines sterbenden Kindes gerufen werde, werde ich gewiss keine Tränen vergießen. Ich habe zu kämpfen mit jenem Feind, der zuletzt doch immer obsiegt. Dem Tod.
So hart ist mein Herz geworden, dass mich nur noch selten etwas bewegt. Darum ist mir Vahan Calyd so kostbar. Und deshalb verbringe ich zuweilen eine Nacht auf See, nur um den Hafen im ersten Morgenlicht zu sehen.
Nun aber war der Tag gekommen, den ich so lange gefürchtet hatte. Es war der zweite Tag nach dem Fest der Lichter. Im Nebel über den Wassern lagen der Geruch von Rauch und Tod. Und im Wasser sah ich die Rückenflossen der Räuber und Aasfresser, die der Stadt entgegeneilten. Ein Wald von Masten umlagerte Vahan Calyd, und die Banner der blutroten Eiche hingen schlaff von ihnen herab. Die Türme der Stadt erhoben sich wie todwunde Riesen aus dem Nebel. Gezeichnet von klaffenden Wunden, hielten sie sich mit letzter Kraft aufrecht. Ihre Schönheit war zerstört, ihr Stolz gebrochen.
Wir glitten in den Wald der Masten. Der Nebel ließ alles um uns herum seltsam unwirklich erscheinen, wie in einer Traumreise. Er dämpfte die Geräusche und verbarg barmherzig das ganze Ausmaß des Schreckens.
Die stählernen Krallen eines Enterhakens griffen in die Reling. Plötzlich, ohne Vorwarnung. Ein Schemen wurde zu einem Schiff. Und dann kamen sie. Misstrauisch und vorsichtig, wie geprügelte Hunde. Mit gehetztem Blick und fahrigen Bewegungen nahmen sie mein Schiff. Ihre Anführer versuchten ihre Angst zu überspielen. Sie wichen meinem Blick nicht aus, doch ich konnte ihre Furcht riechen Sie warteten darauf, dass ich ihnen einen Grund lieferte, mir ihre Macht zu zeigen. Ich verharrte still. Und auch ich hatte Angst.
Drei Mal durchsuchten die Menschenkinder mein Schiff, bevor sie uns einen Liegeplatz zuwiesen. Sie nennen sich Ritter, und doch sind sie schamlose Diebe. Sie nahmen alles, was ihnen wertvoll erschien, meinen Schmuck ebenso wie mein Wundbesteck. Und ihr laszives Lächeln verriet, dass sie noch mehr begehrten. Doch die letzten Wälle des Anstands waren noch nicht gefallen. Nie habe ich mich so ohnmächtig, so hilflos gefühlt. Wie konnten die Menschenkinder, die wir in allem zu übertreffen glaubten, so mächtig werden?
Mein geliebtes Vahan Calyd … Niemals hätte ich mir träumen lassen, dass der Tag kommen könnte, an dem Menschenkinder entscheiden, wann ich den Fuß auf dein uraltes Pflaster setzen darf. Der Nebel trieb noch immer zwischen den Ruinen, als mich die Ritter ziehen ließen.
Der Stadt hafteten die vielfältigen Gerüche des Todes an, als sei sie ein einziger riesiger Leichnam. War ich in der Stunde meiner Heimkehr in sprachlosem Entsetzen erstarrt, so brachen nun all mein Zorn und meine Trauer aus mir heraus. Ich weinte … zum ersten Mal seit den Tagen meiner Kindheit. Und als meine Tränen nicht aufhören wollten zu fließen, da erkannte ich, dass mir die Menschenkinder mit all ihrer blinden Zerstörungswut nicht hatten nehmen können, was mein kostbarster Schatz war: Vahan Calyd berührte noch immer mein Herz. Mehr als je zuvor!
So überwand ich das Entsetzen. Und ein Königinnenfalter schenkte mir neuen Mut. Auf seinen Flügeln aus Weiß, Silber und zartem Gelb schwebte er aus dem Nebel, so plötzlich, als habe der Dunst, der wie ein Leichentuch über der Stadt hing, ihn geboren. Er verschwand in torkelndem Flug in der Gruft eines halb verfallenen Tortunnels. Unbeirrt eilte er dem Licht am Ende des finsteren, mit Trümmern gefüllten Gemäuers entgegen. Ich folgte ihm, und er führte mich in den Orchideengarten des Palastturms von Alvemer. Aus dem Dunkel in den Garten zu treten war wie ein Schritt in eine andere Welt. Licht und Farben feierten den Morgen. Das Dach aus Kristall war beinahe unversehrt. Dutzende kleiner Brunnen murmelten eine leise Melodie. Tausende Blüten wetteiferten darum, sich mit den strahlendsten Farben und schmeichelndsten Wohlgerüchen zu schmücken. Die Plünderer, die über den Kadaver der Stadt hergefallen waren, suchten nur Gold und Geschmeide. Diesen Ort hatten sie nicht geschändet.
Jetzt, da ich diese Zeilen schreibe, habe ich die Besatzung meines Schiffes ausgeschickt, um Verwundete zu suchen, denen noch zu helfen ist. Sie sollen sie hierherbringen. Hier wird nicht allein ihr Leib, sondern auch ihre Seele genesen. Hier zu sein heißt zu wissen, dass die Menschenkinder mit all ihrem Zorn und ihren Kanonen der Welt doch nicht ihre Schönheit zu entreißen vermögen.
Es geht die Kunde, Emerelle sei tot. So oft habe ich mir gewünscht, dass die Mörderin unserer Mutter ein grausames Schicksal ereilen möge. Und nun hoffe ausgerechnet ich, dass diese Nachricht nur ein haltloses Gerücht ist. Die Albenkinder, die überlebt haben, gehen gebeugten Hauptes. Sie fürchten die Menschen. Wagen es nicht, ihren Blicken zu begegnen …
Ich wünschte, Emerelle wäre hier, um die Gebeugten wieder aufzurichten. Ich vermag zerschlagene Glieder zu heilen, doch den Verzweifelten neue Hoffnung zu geben, das vermag ich nicht. Still verfluche ich die Ritter von der blutroten Eiche. Voller Heimtücke haben sie sich nach Vahan Calyd geschlichen. Möge der Fluch der bösen Tat auf sie zurückfallen. So wie Vahan Calyd in der Stunde seines schönstes Festes fiel, soll das Strafgericht auch sie überraschend und in der Stunde ihres Triumphs ereilen. Ich hoffe auf Emerelle. Welch ein seltsamer, unvertrauter Gedanke … Sie darf nicht tot sein. Sie muss die Schönheit Albenmarks retten! …«
BRIEF MORWENNAS AN TIRANU, DEN FÜRSTEN VON LANGOLLION
VERWAHRT IN DER BIBLIOTHEK DES ROSENTURMS
1
VON SCHWIELEN UND SCHWIMMERN
Luc musste sich zwingen, den Blick gesenkt zu halten. Zu gern würde er sehen, wie die Elfenzauberin starb, die seine Mannschaft gemordet hatte. Aber er durfte sich nicht verraten.
Ein wenig taumelnd kam er auf die Beine. Müden Schrittes schlurfte er über das Deck des fremden Schiffs. Seine Rechte ruhte auf dem blutigen Verband an seinem Arm. Er zuckte leicht zusammen, denn die Wunde brannte.
Dann griff er nach seinen Kräften.
Kälte durchdrang sein Innerstes. Er dachte an den Sturz zum Meeresgrund. Das Geräusch splitternder Planken und die Schreie seiner Männer. All jener, die auf ihn gesetzt hatten. Die Opfer dieser Elfe. Luc zitterte vor Wut. Jetzt würde er es ihr mit gleicher Münze heimzahlen!
Jemand rief etwas mit sich überschlagender Stimme. Luc verstand die Worte nicht. Er blickte auf. Neben der Elfenzauberin stand ein kleiner Fuchsmann mit weißem Fell. Es war der Kerl, dem Honoré vertraut hatte. Er hatte das magische Tor nach Albenmark geöffnet. Wie kam dieser Verräter an die Seite der Elfe?
Luc versuchte verzweifelt, sich auf die Gabe Gottes zu konzentrieren. Er musste seinen Zorn beherrschen. Nur so konnte er siegen. Die Macht, die Tjured ihm gewährte, würde alle Elfen an Bord binnen eines Herzschlags töten.
Die Zauberin sah ihn an. Er konnte es spüren.
Herausfordernd begegnete er ihrem Blick und drückte seine Rechte fest auf den Verband. Sein Geist musste frei sein. Er musste sich Gott öffnen! Sie war ganz ruhig. Sie hatte keine Angst vor ihm.
Seine Wunde schmerzte. Warmes Blut sickerte durch das Leinen und benetzte seine Finger. Luc atmete tief und regelmäßig. Er bemerkte, wie einige der Elfen ihre Schwerter zogen. Sonnenlicht brach sich auf kaltem Stahl.
Luc fühlte sich auf einmal seltsam unbeteiligt. Er war halb in Trance. Tjured war ihm jetzt ganz nah. Alles um ihn herum schien entrückt zu sein. Nichts konnte ihm etwas anhaben.
Ein einzelnes Wort der Zauberin ließ die Elfen innehalten. Sie sprach es nicht laut, und doch war ihre Stimme deutlich zu vernehmen. Sie klang melodisch, auch wenn das Wort unverwechselbar ein Befehl war.
Ihr letzter Befehl, dachte Luc grimmig. Noch ein oder zwei Herzschläge, dann würden sie niedersinken, hingestreckt von göttlicher Macht.
Der junge Ritter spürte, wie Blut seinen Arm hinabrann und auf seine nackten Füße troff. Die Zauberin kam ihm entgegen. Ohne Eile. Sie ließ ihn nicht aus den Augen. Sie näherte sich ihm wie einem Hund, von dem man nicht wusste, ob er beißen würde.
Luc schloss die Augen. Warum geschah nichts? Sie und diese ganze verfluchte Elfenbrut hätten schon längst tot sein müssen! Lautlos murmelte er ein Stoßgebet. Warum verweigerte Tjured ihm das Wunder der Heilung? Wo war jene Macht, die das Fleisch der Menschen genesen ließ und gleichzeitig die widernatürlichen Geschöpfe Albenmarks vernichtete? Was hatte er getan, dass Gott ihm nicht mehr beistand?
Es war totenstill auf dem Elfensegler. Obwohl Luc die Augen jetzt geschlossen hielt, spürte er, wie alle ihn und die Zauberin ansahen. Ihm wurde übel. Die Kraft wich aus seinen Beinen. Er wusste, wenn er die Augen öffnete, würde ihm schwindelig werden.
»Bitte, Beschützer aller Gläubigen, bitte, mein himmlischer Vater, hilf! Mein Leben gehört dir. Aber hilf! Bitte, Gott …«
Die Erkenntnis traf Luc wie ein Schlag. Was war er für ein Narr! Er hätte es besser wissen müssen. Dies war nicht Gottes Welt! Tjured konnte ihm hier, inmitten der Gefilde der Alben, nicht helfen. Er war auf sich allein gestellt!
Luc riss die Augen auf. Die Zauberin hatte ihn fast erreicht. Sie war klein, von zierlicher Gestalt. Und sie war schön … Ein Lächeln umspielte ihre Lippen. Sie glaubte wohl, er würde sich fügen wie ein Hund, den man mit einer Wurst köderte.
Die übrigen Elfen standen alle mindestens drei Schritt entfernt. Wenn er schnell und entschlossen handelte …
Luc spannte seinen Körper an. Er war größer und schwerer als die Zauberin; er würde ihr den schlanken, milchweißen Hals brechen und für immer dieses überhebliche Lächeln von ihren Lippen verbannen.
»Verzeih mir, Gishild«, flüsterte er. Auch wenn die anderen Elfen ihn töten würden, so durfte er die Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Diese Ausgeburt der Finsternis, die sich hinter der Maske der Schönheit verbarg, durfte nicht länger leben. Nie wieder würde sie ein Schiff voller Gläubiger in den Abgrund des Ozeans stürzen lassen!
Er sprang auf sie zu. Die Elfe tat einen Schritt zur Seite. Es geschah ohne Hast und mit geradezu tänzerischer Anmut. Ein Schlag traf ihn dicht unter den Rippen. Die Luft entwich seiner Lunge, er taumelte und stürzte.
Was für ein niederträchtiger Zauber war das? Alle Kraft war aus ihm gewichen. Er konnte nicht aufstehen, ja, er bekam kaum noch Luft.
Die Elfe setzte ihren schmalen Fuß auf seine Brust und sagte etwas in beiläufigem Tonfall. Die fuchsgestaltige Missgeburt war wieder an die Seite der Zauberin geeilt und rief mit schnarrendem Akzent einen Befehl. »Alle Gefangenen stellen sich in einer Linie auf. Sie treten einzeln vor die Königin!«
Luc gaffte die zierliche Elfenzauberin mit offenem Mund an. Das konnte nicht sein … Die Königin war tot! Zerrissen von den Explosionen, die die fremdartige Hafenstadt der Elfen verwüstet hatten. Er hatte ihre verbogene, blutbesudelte Krone selbst gesehen. Was für eine Intrige war das? Hatten die Albenkinder Honoré getäuscht? Oder versuchten sie nun ihn zu täuschen, damit er falsche Kunde nach Drusna brachte, falls er entkommen sollte?
Ein stämmiger Ruderer mit ersten grauen Strähnen im schwarzen Bart trat vor die Zauberin. Er sah aus wie jemand, der keinem Händel aus dem Weg ging. Sein kantiges Gesicht war vernarbt und rot verbrannt von der viel zu heißen Sonne dieser fremden Welt. Aber jetzt, da er von zwei Elfenkriegern vorgeführt wurde, die zusammen wohl kaum mehr wogen als der stiernackige Ruderer allein, wirkte er ängstlich. Sein Blick war auf das Deck gerichtet.
»Streck deine beiden Hände vor!«, befahl das Fuchsgesicht.
Die Wachen lockerten ihren Griff, und statt die Gelegenheit zu nutzen, der heimtückischen Zauberin die Gurgel zu zerquetschen, hielt der Feigling tatsächlich seine Hände hin.
»Die Handflächen nach oben!«, fuhr ihn der Fuchsmann an.
Der Seemann gehorchte.
Luc bekam nun wieder besser Luft. Doch er ließ sich nichts anmerken. Er verhielt sich ganz ruhig und wartete auf seine Gelegenheit.
Die Zauberin sagte etwas. Worte, die den Ohren schmeichelten, auch wenn ihr Sinn unbegreiflich blieb.
Die Wachen wiesen den Seemann an, zum Vordeck zu gehen.
Der nächste Schiffbrüchige, der ihr vorgeführt wurde, war ein schmalhüftiger Mann. Er verhielt sich nicht so unterwürfig wie der Ruderer. Er forderte die Zauberin mit keiner seiner Gesten heraus, aber er wich ihrem Blick auch nicht aus, als sei er ein geprügelter Hund. Luc glaubte, ihn einmal mit der Bauchbinde eines Offiziers gesehen zu haben, war sich aber nicht ganz sicher. Jetzt trug der Mann nur ein schlichtes Leinenhemd und eine ausgefranste Hose aus gutem Stoff.
Die Elfe blickte nur flüchtig auf seine Handflächen. Mit einem Kopfnicken wies sie ihre Krieger an, den Mann zum Hauptmast zu bringen.
»Fällt es dir leicht zu töten?« Die Zauberin beherrschte seine Sprache fast ohne Akzent. Sie blickte zu ihm hinab. Zunächst war er zu verblüfft, um zu antworten. Sie betrachtete ihn so, wie Kinder einen besonders eigentümlichen Käfer ansehen mochten, den sie unter einem vermodernden Baumstamm entdeckt hatten.
»Dich würde ich, ohne zu zögern, töten.«
»Halt deine Zunge im Zaum«, fauchte der Fuchsmann. »Du …« Die Elfe gebot ihm mit einer knappen Geste zu schweigen.
»Ich weiß, dass du noch immer hoffst, mich ermorden zu können, Luc. Doch das war nicht, wonach ich gefragt habe.«
Dass sie seinen Namen kannte, versuchte er damit abzutun, dass sie eine Zauberin war. Er antwortete ihr aus Trotz nicht. Und weil er nicht genau wusste, was er darauf hätte sagen sollen.
»Dein Schweigen ist auch eine Antwort.«
Obwohl sie so klein und zierlich war, dass sie auf den ersten Blick harmlos wirkte, lag etwas in ihren rehbraunen Augen, was Luc erschaudern ließ. Es waren Augen, die ungeheuerliche Dinge gesehen hatten. Kalt und wissend. »Ich habe keinerlei Skrupel mehr zu töten, sei es mit kaltem Stahl, sei es durch meine Befehle. Ich bin der Schild Albenmarks und sein Schwert. Wer den Meinen Böses tut, der hat von mir keine Gnade zu erwarten. Ich erkenne euch an euren Händen. Wer einem Schiff dient, dem haben die Jahre an Bord Schwielen an beiden Händen eingebracht, denn mit beiden Händen muss zupacken, wer sein Brot mit ehrlicher Arbeit verdient. Wer sich aber dem Schwerte verschrieben hat so wie du, Luc, der hat nur an einer Hand Schwielen. Dein Orden nennt sich die Neue Ritterschaft, doch mit ritterlichen Tugenden beschwert ihr euch im Kampf gegen Albenmark schon lange nicht mehr.« Ihre Augen verengten sich, während sie ihn unvermindert ansah. »Niemand im Umkreis von zweihundert Schritt um die beiden Schiffe, die sich im Schutze der Nacht in meinen Hafen geschlichen haben, hat überlebt. Euch war es egal, ob Frauen oder Kinder starben. Keiner, der in jener Nacht auf meinem Schiff zu Gast war, ist noch am Leben. Nur mich vermochtet ihr nicht zu töten. Ich bin Emerelle, die Herrscherin Albenmarks, und man sagt mir nach, dass ich ein kaltes Herz habe. Kannst du gut schwimmen, Luc?«
Er würde ihr nicht antworten! Sie war die Herrscherin der Lügen. Sie war das Böse. Jedes ihrer Worte war wie Gift. Man musste sich ihnen verschließen!
Die Zauberin blickte die Reihe der Gefangenen entlang. »Seht die Male in euren Händen, und ihr wisst, wem ich freies Geleit in seine Welt gewähre. Ihr anderen aber werdet eurem Glück vertrauen müssen. Keiner der Meinen wird eine Waffe gegen euch erheben. Zweihundert Schritt, das war der Bannkreis des Todes. Wer dort weilte, für den gab es keine Hoffnung, und auch jenseits dieser Grenze wurde noch hundertfach gestorben. Zweihundert Schritt werdet ihr morgen dort schwimmen müssen, wo euer Hass keine Schranken mehr kannte. Wer das Ufer erreicht, ist frei.«
Luc sah, wie einige der Männer schmunzelten. Zweihundert Schritt in ruhigem Hafenwasser zu schwimmen war keine Kunst.
»Ich habe gehört, du wurdest mit einer Glückshaut auf dem Kopf geboren, Luc.« Die Elfe sah ihn an, und ihr Blick war wie Eis. »Du wirst all dein Glück gebrauchen können. Du schwimmst morgen als Erster.«
2
DER JUNGE RITTER
Ahtap leckte sich nervös über die Schnauze, während er unruhig an der Reling auf und ab ging. Er war nicht zart besaitet. Und er war gewiss der Letzte, dem man vorwerfen würde, dass er Sympathien für diese verfluchten Ordensritter hatte. Zu lange war er ihr Gefangener gewesen! Aber das, was nun bevorstand, machte ihm zu schaffen.
Der Lutin hatte nach einer Ausrede gesucht, um nicht an Bord sein zu müssen, aber Emerelle hatte auf seiner Anwesenheit bestanden. Warum wusste er nicht. Was machte es schon aus, ob ausgerechnet er bei diesem blutigen Spektakel anwesend war?
Es war drückend heiß im Hafen von Vahan Calyd. Oder dem, was von dem Hafen noch übrig geblieben war. Ahtap verscheuchte mit einer fahrigen Bewegung eine der dicken, in allen Regenbogenfarben schimmernden Fliegen von der Reling. Diese widerlichen Viecher waren überall. Aasfliegen … Der Geruch hatte sie aus den Mangroven und dem Dschungel gelockt. Er wollte einfach nicht vergehen. Selbst die leichte Brise von der See vertrieb ihn nicht, diesen süßlichen Gestank nach Verwesung.
Ahtaps Blick wanderte über die Schutthügel. Hunderte, vielleicht Tausende lagen dort noch unter Trümmern begraben. Durch ihn hatten die Ordensritter gewusst, dass dies die Zeit war, in der Vahan Calyd vor Leben überquoll. Nicht einmal einen ganzen Mond dauerten die Festlichkeiten, und sie wiederholten sich auch nur alle achtundzwanzig Jahre. In der Zwischenzeit wurden die meisten Paläste von einigen wenigen Bediensteten gehütet. Dann waren in den Straßen der Stadt mehr verirrte Winkerkrabben als zweibeinige Bewohner anzutreffen …
Doch zum Krönungstag fanden der Adel und Schaulustige aus ganz Albenmark sich in der Stadt ein, um das Fest der Lichter zu feiern. Ahtap hätte niemals geglaubt, dass die Ritter es hierher schaffen würden. Er hatte sich nichts dabei gedacht, als er Leon und später Honoré von dem Fest erzählt hatte. Menschen konnten nicht nach Albenmark gelangen! Und als er das Tor geöffnet hatte, war er immer noch davon überzeugt gewesen, die Zaubermacht der Königin könne die Schiffe der Menschen mit Leichtigkeit vernichten, wie es letztlich ja auch geschehen war. Nur was sich hier ereignet hatte … Ein Kloß, groß wie seine Faust, saß ihm im Hals. Er hatte nicht geahnt, was kommen würde! Aber das machte es nicht besser. Er war genauso am Tod dieser Albenkinder hier schuld wie die Kapitäne, die die beiden großen Schiffe in den Hafen gesteuert hatten. Ob Emerelle das ahnte? Hatte sie deshalb darauf bestanden, dass er bei den Hinrichtungen anwesend sein sollte?
Ahtap vermied es, zum Wasser hinabzusehen. Warum veranstaltete die Königin dieses unwürdige Schauspiel? Der Lutin blickte zu den zerstörten Kais. Dort stand die Antwort. Zu Tausenden waren sie gekommen. Viele trugen schmutzige Verbände.
Ahtap musste sich unwillkürlich kratzen. Vahan Calyd war kein guter Ort, um sich zu verletzen. Überall wimmelten Insekten. Grässliche Viecher, deren Namen er nicht kannte. Kreaturen mit viel zu vielen Beinen und widerlichen Beißwerkzeugen, die ihren Weg zwischen Mullbinden und Bandagen aus Leinen hindurch fanden. Angelockt vom Geruch von Blut und Verwesung. Vom Schweiß, den Hitze und Schmerz aus den Poren trieb. Er sah einen Schatten durch das trübe Wasser gleiten. Nicht nur Insekten wurden davon angelockt.
Emerelle hätte sie auch einfach an den Rahen aufknüpfen lassen können. Wenn man sie langsam hochzog, sodass der Henkersknoten ihnen nicht das Genick brach, dann tanzten sie noch eine Weile. Ihre Beine zuckten hilflos in der Luft. Das wäre Spektakel genug gewesen.
Die Königin kam vom Bug, wo sie sich mit einigen Elfenkriegern in weißen Leinenrüstungen unterhalten hatte. Sie erweckte nicht den Anschein, dass ihr das, was nun kommen würde, zu schaffen machte.
Ahtap senkte den Blick. Er hatte Angst, dass sie erraten würde, wie viel Schuld er an dem trug, was geschehen war. Bislang hatte sie ihm keine Fragen gestellt.
Die Königin sagte irgendetwas zu den drei großen Trollen, die mittschiffs nahe beim Hauptmast warteten. Die grauhäutigen Hünen antworteten mit einem derben Grunzen. Einer von ihnen streckte und krümmte seine knotigen, grauen Finger.
Ahtap dachte an seine Zeit im Kerker der Ordensburg und an Nhorg, den die Jahre der Gefangenschaft den Verstand gekostet hatten. Immerzu hatte der Kerl von Essen geredet … Er hatte wohl so ziemlich alles gegessen, was man sich vorstellen konnte. Und etliche Dinge, von denen Ahtap bis dahin nicht einmal im Entferntesten gedacht hatte, dass jemand auf die Idee kommen könnte, sie zu verschlingen. Ihm klangen noch Nhorgs Worte in den Ohren. Fell kitzelt auf der Zunge. Ich fresse gern Viecher mit Fellhaut.
Der Lutin kratzte sein dichtes Halsfell. Nie hatte er sich aus der Türnische des Kerkers gewagt. Das war der einzige Ort außerhalb der Reichweite des angeketteten Trolls gewesen. Und wenn er eingeschlafen war, dann hatte Ahtap stets Angst gehabt, in einem unruhigen Traum auf dem leicht abschüssigen Boden zur Mitte der Kerkerzelle zu rollen. Oder sich einfach nur einen Zoll zu weit in Richtung des Trolls zu bewegen, um in dessen Klauenhänden zu erwachen und zu wissen, dass Nhorg gleich noch einmal das Kitzeln von Fell an seinem Gaumen spüren wollte. Es war die verfluchte dritte Prophezeiung der Apsara gewesen, die ihn im Kerker so oft aus seinen Träumen gerissen hatte. Eines Tages würde er gefressen werden, so hatte sie geweissagt, als er sie nach seiner Zukunft befragt hatte.
Emerelle kam jetzt in seine Richtung. Sie will nur zum Achterdeck, versuchte er sich vorzumachen. Er hatte sie aus den Augenwinkeln gesehen und wagte es nicht, sie direkt anzublicken. Er schwitzte jetzt stärker. Und er roch den stechenden Gestank der Angst. Das würde ihr nicht verborgen bleiben. Elfen entging nichts. Am allerwenigsten ihr.
»Bringt sie hoch! Alle auf einmal.« Sie sprach leise, aber mit einer Stimme von durchdringender Kälte.
Ahtap ballte die Fäuste. Er durfte jetzt nicht zu zittern anfangen!
»Erstaunlich, wie viele gekommen sind, um zuzusehen«, sagte die Königin nun in leichtem Plauderton.
»Ja.« Es kostete den Lutin größte Anstrengung, nur dieses eine Wort hervorzubringen. Nichts anmerken lassen, ermahnte er sich stumm.
Emerelle sog hörbar die Luft ein. Wollte sie, dass er wusste, dass sie seine Angst bemerkt hatte? Er blickte zum Ufer. Es konnte belanglose Gründe geben, warum die Königin tief einatmete. Vielleicht mochte sie ja den Geruch des Hafens? Unsinn! Niemand mochte den Geruch nach verwesendem Fleisch, außer vielleicht Trolle.
Die Gefangenen wurden an Deck gebracht. Sie sahen elend aus. Keiner leistete den Wächtern Widerstand. Sie alle waren hier im Hafen gewesen. Sie wussten, was sie erwartete.
»Den Jungen zuerst«, sagte Emerelle.
Ein Troll trat vor, doch es war keine Gewalt nötig. Der junge Ritter trat freiwillig an die Reling. Er sah zu ihnen.
Ahtap war sich immer noch nicht ganz sicher, was er von dem Jungen halten sollte. Er hatte Honoré im Rabenturm besucht und war sofort empfangen worden. Ein Privileg, das keineswegs allen Rittern der Bluteiche zuteilwurde. Er musste auf irgendeine Art wichtig sein. Auch glaubte er, ihn in Valloncour gesehen zu haben. Gestern hatte er befürchtet, dass der junge Ritter über jene geheimnisvolle Macht verfügte, die einst Nhorg auf so grausame Weise getötet hatte. Jene Macht, die Ahtap nur einen kurzen Augenblick zu spüren bekommen hatte. Ein Augenblick, der doch lang genug gewesen war, ihn für immer zu verändern. Diese Spanne von kaum ein paar Herzschlägen hatte eine Angst in ihn gepflanzt, die tiefer ging als die Furcht vor dem verrückten Troll oder vor der Prophezeiung der Apsara. An jenem Tag war sein Fell weiß geworden. Er war innerlich zerbrochen.
Als damals der einäugige Primarch zu ihm gekommen war, hatte er keinen Widerstand mehr geleistet. Er hatte zu reden begonnen. Der Lutin blickte zu der zerstörten Hafenstadt. Besser, er wäre gestorben.
Gestern hatte er geglaubt, der Junge gebiete über die geheimnisvolle Macht. Er hatte so entschlossen gewirkt. Ahtap war sich sicher gewesen, dass der Kerl alle Albenkinder an Bord töten wollte. Aber nichts war geschehen! Der Ritter war lediglich auf Emerelle zugegangen und hatte dabei seine Hand auf den Verband gepresst. Er hatte auch keine Waffe bei sich gehabt. Vielleicht war er einfach nur durcheinander gewesen.
Jetzt wirkte der Junge sehr gefasst. Er trug ein langes, weißes Hemd, sonst nichts. In der Hand hielt er einen Brief. Er blickte zur Königin.
»Komm zu mir!«, sagte Emerelle in der Zunge der Menschenkinder und bedeutete den Trollen mit knapper Geste, ihn gewähren zu lassen.
»Ich bitte nicht um Gnade«, sagte der junge Ritter trotzig. Er hatte Mühe, seine Stimme unter Kontrolle zu halten. Sie klang heiser. »Darf ich einem unserer Männer, die zurückkehren werden, diesen Brief mitgeben?«
Ahtap sah zur Königin auf. Sie zögerte einen Augenblick. Dann nickte sie. »Dein Wunsch sei dir gewährt, Menschensohn«, erwiderte die Königin mit warmer Stimme. Hätte sie an einem anderen Ort als diesem gesprochen, man hätte ihre Worte für herzlich halten können.
Der junge Ritter ging zu den Seemännern hinüber, die dazu verdammt waren, dem Spektakel beizuwohnen. Er drückte einem großen Kerl mit grauen Fäden im Bart den Brief in die Hand und flüsterte ihm hastig einige Worte zu. Dann kehrte er zur Königin zurück; er wirkte erleichtert. »Darf ich den letzten Schritt selbst tun?«
»Eine Frage der Ehre, nehme ich an.« Emerelles Antlitz zeigte keine Regung. Im grellen Licht der Mittagsonne wirkte es ebenmäßig und alterslos.
Sie trat zur Seite. »Dann zeig uns, wie ein Menschenritter stirbt.«
Ahtap erinnerte sich, dass die Königin den Jungen gestern Luc genannt hatte. Woher kannte sie dessen Namen? Wie weit reichte ihre Macht? Blieb ihr nichts verborgen? Er verschränkte die Hände hinter dem Rücken, damit sie nicht zitterten, doch seine nervös zuckende Rute vermochte er nicht zu beherrschen. Was wusste Emerelle über ihn? Darüber, dass er es war, der das Unheil nach Albenmark gebracht hatte?
Luc stieg auf die Reling und wurde mit einem Johlen vom Ufer begrüßt.
»Stoßt ihn endlich hinab«, brüllte ein Minotaur mit blutigem Kopfverband, dem eines seiner Hörner fehlte.
Der Junge tat den letzten Schritt allein. Er stürzte ins dunkle Wasser und begann mit ruhigen, kräftigen Zügen zu schwimmen.
Ahtap folgte ihm gebannt mit Blicken, obwohl er gar nicht sehen wollte, was nun geschehen würde. Er wusste um die dunklen Schatten im Wasser. Und dann erschien die erste gelbschwarze Finne. Sie schnitt einen Keil in das brackige Hafenwasser, dessen Spitze genau auf den Jungen wies.
Luc bemerkte die Gefahr. Er änderte die Richtung und hielt auf einen riesigen Marmorklotz zu, den die Explosion ins Hafenbecken geschleudert hatte. Auf halbem Weg zum Kai erhob er sich aus der schwachen Dünung.
Ahtap hielt den Atem an. Mit ein bisschen Glück könnte der Junge es schaffen. Die Bestie kam schnell näher, aber Luc hatte den Marmorklotz fast erreicht!
Auf den Kais war es still geworden. Nur wenige feuerten mit ihren Rufen die Bestie an.
Luc streckte den Arm aus. Seine Hand tastete über den geborstenen Marmor.
Ahtap konnte sehen, wie sich die Schultermuskeln des Jungen spannten. Die Bestie war noch fast zwanzig Schritt entfernt! Er würde es schaffen.
Plötzlich glitten die Hände ab. Blankes Entsetzen lag in den Zügen des Jungen. Sein Mund klaffte auf, als wolle er schreien. Dann war er im trüben Wasser verschwunden.
Ahtap traute seinen Augen nicht. Der Hai war immer noch nicht ganz bis an den Marmorklotz heran.
Die dunkle Wolke im Wasser tilgte alle Zweifel. Zu viele Räuber und Aasfresser tummelten sich seit dem Unglück im Hafen von Vahan Calyd. Irgendetwas hatte im tiefen Wasser gelauert und den Jungen geschnappt.
Rot umspülte das Hafenwasser den Marmorblock, und ein feines Blütenmuster zeichnete sich auf dem behauenen Stein ab. Ahtap wurde übel.
»Als Nächstes den Capitano, der die Mörder hierhergebracht hat!« Emerelle sprach nun wieder in der Zunge Albenmarks. Zwei Trolle ergriffen einen der Gefangenen, die sich in stummem Entsetzen eng aneinanderdrängten. Die Hünen packten den Menschensohn bei Armen und Beinen und schleuderten den Capitano dorthin, wo die Blutwolke durch das Wasser trieb.
Hilflos mit Armen und Beinen rudernd und einen gellenden Schrei auf den Lippen, flog der Schiffsführer durch die Luft.
Immer mehr Rückenflossen erschienen im Wasser. Dort, wo der Mensch aufschlug, schäumte es vor Bewegung. Sofort wurde er hinabgerissen.
Schon schleuderten Emerelles Henker ihr nächstes Opfer in die See. Jubelrufe begleiteten das unwürdige Spektakel. Ahtap wollte sich verkriechen, aber seine Beine versagten ihm den Dienst. Wie unter einem Zauberzwang war er unfähig, den Blick von dem blutigen Gemetzel zu lassen. Die Brust war ihm eng geworden. Emerelles letzte Worte hallten in seinem Kopf nach. Waren sie zufällig so gewählt? Durfte er hoffen, dass sie nicht wusste, was er getan hatte? Oder sollte er sich hier und jetzt bekennen? War das klug? Was sollte er nur tun?
»Du warst lange fort, Ahtap«, sagte Emerelle.
Der Lutin wollte etwas antworten, aber er brachte nur ein heiseres Räuspern zustande.
»Wusstest du, dass Nathania zu den Toten des Festes der Lichter gehörte?«
Ahtap keuchte. Seine Beine gaben nach. Er sank an der Reling in sich zusammen. Nathania! In den dunkelsten Stunden seiner Gefangenschaft hatte der Gedanke an Nathania ihm Kraft gegeben. Sie war eine Lutin, so wie er. Eine Späherin Emerelles. Erfahren darin, den trügerischen Pfaden der Alben zu folgen. Vor langer Zeit hatte Ahtap ihre Liebe verspielt. Aber er hatte die Hoffnung nie aufgegeben, dass er sie eines Tages zurückgewinnen könnte.
»Wie?«, brachte er schließlich hervor.
»Ich weiß es nicht. Ihr Name stand auf den Totenlisten, die man mir gebracht hat. Lange Listen, Ahtap. Du solltest sie dir auch einmal ansehen.«
Er blickte zu Emerelle auf. Sie wusste es, er konnte es in ihren Augen sehen. Voller Verachtung waren sie.
»Nathania.« Er versuchte sich an ihr Gesicht zu erinnern, doch es wollte ihm nicht gelingen. Nur ihren Geruch hatte er noch deutlich in der Nase. Ihr Pelz hatte nach Herbstwald gerochen und nach Pilzen. Tränen standen ihm in den Augen. Er richtete sich auf. Er hatte sich bei ihr entschuldigen wollen … Dass ihre Liebe zu ihm noch einmal entflammen könnte, hatte er nicht wirklich gehofft. Es hätte ihm genügt, wenn sie ihn verstanden hätte.
Ahtap zog sich an der Reling hoch. Der Handlauf war so breit wie eine Elfenhand. Es war leicht, darauf zu balancieren. Er drehte sich um und sah zu Emerelle. Jetzt war er fast auf Augenhöhe mit ihr.
»Ich habe es nicht gewollt«, sagte er sehr leise.
»Erwartest du mein Mitleid?«
Nein, dachte der Lutin. Er erwartete gar nichts mehr. Was er getan hatte, war nicht zu entschuldigen.
Emerelle stand reglos. Sie hätte die Hand ausstrecken können, um ihn zu halten. Schöne Augen hatte sie, dachte Ahtap. Braun, fast wie das Fell eines jungen Rehkitzes. Wieder dachte er an Nathania. Daran, wie sie früher zusammen durch die Wälder gestreift waren. Er vermisste den Alten Wald im Herzland. Das Fest der Silbernacht. Zweimal war er dort mit Nathania gewesen.
Ahtap machte einen Schritt zurück. Er musste an die Apsara denken, die er im Turm der mondbleichen Blüten besucht hatte. Sie war wirklich eine gute Wahrsagerin gewesen. Jetzt würde sich auch ihre dritte Prophezeiung erfüllen.
Das Wasser verschlang ihn, und er unternahm erst gar nicht den Versuch, zum Ufer zu schwimmen.
3
DER RICHTIGE AUGENBLICK
Gishild blickte die Reihe der schwarz gerüsteten Reiter entlang. Wie lange würden sie die Garnison des Vorratslagers wohl täuschen können? Nachdem kleinere Lager in den letzten Jahren immer wieder zum Ziel von Angriffen geworden waren, hatten die Ritter vom Aschenbaum ihre Strategie geändert. Sie legten nun große Versorgungsstützpunkte an. Das Lager Eisenwacht lag zwanzig Meilen hinter der vorrückenden Armee.
Sie wischte sich den Schweiß von der Stirn. Es war ein drückend heißer Sommertag. Kein Lüftchen regte sich. Vor ihnen lag Eisenwacht in einem weiten Tal, eingefasst von sanft ansteigenden Bergen, deren Flanken mit dichtem Mischwald bedeckt waren.
Das Terrain war uneben. Ein kleiner Bach, der offenbar schon häufiger sein Bett gewechselt hatte, hatte tiefe Schlangenlinien in das schwarze Erdreich gegraben. Kleine Birkenhaine und lichtes Buschwerk fassten die Ufer ein. Eine schlecht befestigte Straße teilte das Tal. Zahllose eisenbeschlagene Karrenräder hatten tiefe Furchen, in denen sich Wasser gesammelt hatte, in den Weg geschnitten. Mücken tanzten dort in der Luft. Hin und wieder sah man sogar eine Regenbogenlibelle.
Drei Gehöfte lagen auf niedrigen Hügeln verteilt. Ihre Dächer waren eingestürzt. Gerippe aus schwarzen Balken ragten über die Ruinen. Vor einer Woche hatte es im Tal eine Schlacht gegeben. Und jeder Ort, an dem Widerstand geleistet wurde, wurde nach den Kämpfen den Truppen zum Plündern überlassen.
Gishild wusste, dass in einer Bodensenke im Süden des Tals Dutzende unbestatteter Leichen lagen. Auch jetzt sah man dort noch Raben kreisen. Die Ritterschaft vom Aschenbaum hatte das Kommando in diesem Feldzug. Und sie führten den Krieg mit unbarmherziger Härte. Tote Feinde wurden nicht bestattet. Gefangene überließ man den Fragenden, die auf ihren Folterbänken auch den tapfersten Mann dazu brachten, seine Freunde zu verraten.
Fast in der Mitte des Tals lag Eisenwacht. Gefangene arbeiteten an den Schanzwerken aus Erde. Rings um das Lager wurde ein tiefer Graben ausgehoben. Nach Süden hin waren die Befestigungen noch im Bau. Der Graben war nicht vollendet. Im Wall gab es direkt neben dem Tor eine breite Lücke, die notdürftig mit Schanzkörben verbarrikadiert war. Dazwischen standen einzelne Bronzeschlangen. Die meisten der Geschütze waren jedoch entlang des Nordwalls in Stellung gebracht und wachten über den Eingang zum Tal.
Mehr als dreihundert Schritt maßen die Erdwälle an den Seiten des Lagers. Sie schützten lange Reihen von Zelten aus vergilbtem Leinen. Ein Zug von vierzig großen, von Kaltblütern gezogenen Planwagen war vergangene Nacht im Lager eingetroffen. Dort warteten sie auf die Verstärkung ihrer Eskorte, bevor sie zur Spitze der Armee vorstoßen konnten, die auf die Hafenstadt Haspal vorrückte.
Endlose Reihen aus Fässern und Kisten türmten sich entlang der Lagerstraßen. In großen Zelten wurden Säcke mit Korn, Bohnen und Linsen verwahrt sowie andere Güter, die es vor dem Regen zu schützen galt. Der Orden vom Aschenbaum führte einen glänzend organisierten Feldzug. Ihnen mangelte es an nichts.
Gishild streckte sich. Ihre Rüstung klirrte leise, sie war ihr ein wenig zu groß. Der Capitano, dem sie einmal gehört hatte, war breiter und muskulöser als sie gewesen. Sie spürte, wie der Schweiß sich unter ihren Achseln sammelte. Auch der Orden vom Aschenbaum hatte inzwischen mehrere Schwadronen berittener Pistoliere aufgestellt. So wie ihre Vorbilder von der Neuen Ritterschaft trugen sie geschwärzte Rüstungen, was während der Sommerhitze eine Qual war.
Gishild hatte ihren Helm abgenommen. Ihr Haar war strähnig und fettglänzend. Sie konnte sich nicht mehr erinnern, wann sie sich zum letzten Mal gewaschen hatte. Das Jahr war schlecht gelaufen für sie. Die Übermacht der Tjuredkirche war zu erdrückend. Die Provinz Leal war der letzte Zipfel Drusnas, der noch nicht von den Kirchentruppen überrannt worden war. Das Frühjahr und der Sommer hatten elf blutige Schlachten und zahllose Scharmützel gebracht. Sieben Siege hatten sie davongetragen, aber sie vermochten ihre Verluste nicht mehr zu ersetzen. Selbst wenn sie siegten, mussten sie sich anschließend vor den Truppen der Kirche zurückziehen. Die Entscheidung um Drusna war gefallen. Immer mehr Adlige traten offen auf die Seite der Tjuredkirche. Jetzt ging es nur noch darum, jene, die sich nicht unterwerfen wollten, über den Hafen von Haspal zu evakuieren und ins Fjordland zu bringen.
Eine offene Feldschlacht gegen die Kirchentruppen konnten sie nicht mehr wagen. Trotz der Unterstützung durch Albenmark fehlte es ihnen an Kriegern. Die schlagkräftigsten Truppen, die Gishild noch zur Verfügung standen, verbargen sich hinter ihr im Wald. Es waren ihre Mandriden, die in den Rüstungen von getöteten Schwarzreitern steckten, Fürst Tiranus Schnitter und eine Horde von Kentauren aus Dailos. Sie waren ein zwielichtiger Haufen, und ihr Anführer, Appanasios, erinnerte mehr an einen Strauchdieb als an einen Reiterführer, wie Gishild sie aus ihrer Zeit bei den Ordensrittern kannte. Er hatte ungepflegtes schwarzes Haar und einen üppigen Vollbart. Über seiner braun gebrannt muskulösen Brust spannte sich ein Lederbandelier, in dem mehrere Radschlosspistolen steckten. Und das, obwohl Emerelle ihren Albenkindern den Gebrauch von Schwarzpulverwaffen streng untersagt hatte. Zusätzlich hatte er einen Köcher mit Pfeilen um die Hüften geschnallt, aus dem ein kurzer Reiterbogen ragte. Über seiner rechten Schulter war der Griff eines Langschwertes zu sehen. Die Narben auf Brust und Armen wiesen Appanasios als erfahrenen Kämpfer aus. Gishild wusste, dass sich der Kentaur und ihr Gatte bestens verstanden. Das war keine Empfehlung!
»Wann schlagen wir los?«, fragte Tiranu ungeduldig.
Gishild blickte in die Runde ihrer Befehlshaber. Nur der Elf und Appanasios schienen den Kampf nicht abwarten zu können. Ihre Mandriden wirkten so erschöpft, wie sie sich fühlte. Doch der Angriff musste glücken! Wenn das Vorratslager brannte und die Versorgungslinie unterbrochen war, würde die Armee der Kirche ihren Vormarsch auf Haspal einstellen. So konnten sie für die Stadt ein paar Tage gewinnen. Im günstigsten Fall sogar eine Woche.
»Königin?«
Gishild blickte zu Tiranu.
»Worauf warten wir, Herrin?« Der Elf gab sich keine Mühe, respektvoll zu erscheinen.
»Wir warten darauf, dass die Sonne uns den Sieg erleichtert. Wir sind im Schatten der Bäume vor der ärgsten Hitze geschützt. Die Wachen auf den Erdwällen braten jetzt in ihren Rüstungen. Sie werden weniger aufmerksam sein. Meine Mandriden sind keine Ordensreiterei. Dazu gehört mehr, als die Rüstungen von Schwarzreitern zu tragen. Wir können nur hoffen, dass die Wachen nicht so genau hinschauen, wenn wir unbehelligt bis zum Graben kommen wollen.«
Tiranu bedachte sie mit einem Blick, als sei sie ein störrisches Kind und keine Königin. »Wir werden nicht ewig unentdeckt bleiben«, sagte er dann mit einem Achselzucken, wendete sein Pferd und kehrte zu seinen Schnittern zurück.
Appanasios Pferdeschweif peitschte unruhig.
»Was?«, fuhr Gishild den Kentauren an.
»Ich denke auch, wir sollten es hinter uns bringen. Wenn wir zu lange warten, werden sie die Wachen ablösen.«
»Ich kenne sie. Ich habe viele Jahre unter ihnen gelebt. Die Wachablösung ist immer zur dritten Mittagsstunde. Sie haben in allem, was sie tun, ihre strenge Ordnung, deshalb sind sie so verdammt erfolgreich.« Gishild musste sich beherrschen, um keine Bemerkung über die undisziplinierten Truppen Drusnas zu verlieren oder gar über Kentaurenhorden, die die halbe Zeit über besoffen waren.
Appanasios’ Zähne blitzten durch seinen dichten, schwarzen Bart. »Ich wette, ich weiß, was du jetzt denkst, Königin. Aber sei’s drum … Das Einzige, was mir Sorgen macht, ist, dass unsere Feinde dich vielleicht inzwischen genauso gut kennen wie du sie. Wenn du weißt, wie sie denken, weil du so lange unter ihnen gelebt hast, dann gilt das auch umgekehrt. Es wird dir immer schwerer fallen, sie zu überraschen. Es sei denn, du gebärdest dich plötzlich wie eine ungewaschene Barbarin, die einen feuchten Pferdefurz auf die Regeln der Kriegskunst der Ritterorden gibt. Verschwende einmal einen Gedanken daran, Königin.« Der Kentaur trabte davon und verschwand zwischen den Bäumen.
Eine leichte Brise fuhr in die Baumkronen. Tausende gleißende Lichtpunkte tanzten über den Waldboden. Unter den verbliebenen Anführern herrschte betretenes Schweigen. Sie alle kannten Gishilds aufbrausendes Temperament.
Erek räusperte sich.
Sie sah ihren Mann an. Er hatte sich gestern den Bart abrasiert, um in der ersten Reihe der Schwarzreiter an ihrer Seite zu sein. Mit seinem zu Zöpfen geflochtenen Bart wäre er schon von Weitem aufgefallen. Wangen und Kinn waren weiß wie der Bauch eines toten Fisches, während der Rest seines Gesichts von der Sonne verbrannt war. Er sah gut aus mit dem kantigen Kinn und dem entschlossen wirkenden Mund. Ungehobelt, geradeheraus und ein bisschen einfältig, war er so ganz anders als Luc. Sie würde ihn niemals lieben!
»Und was bedrückt dich, mein Gemahl?«
Erek lächelte kurz, weil sie ihn so nannte. Ironie war ihm völlig fremd. »Ich habe mir das Lager lange angeschaut. Ich glaube, die Erdwälle sind zu hoch.«
Gishild atmete tief ein. Sie sollte sich im Zaum halten! Wenn sie ihn zu abfällig behandelte, dann würde sie auch sich damit schaden. Die meisten Fjordländer hatten sehr altmodische Vorstellungen von dem Verhältnis zwischen Männern und Frauen. »Wir werden dort angreifen, wo eine Lücke im Wall ist. Es schert uns nicht, wie hoch er dort ist, wo er vollendet wurde.«
Erek machte eine Geste, als wolle er über seinen Bart streichen, verharrte aber mitten in der gewohnten Bewegung, als er ins Leere griff. »Da hast du natürlich recht. Trotzdem sind die Wälle zu hoch. So viel Erde können sie unmöglich allein aus den Gräben haben, die sie davor gezogen haben. Ich kenn mich da aus. Ich hab wochenlang an den Schanzen von Firnstayn mitgeschuftet. Über Erde weiß ich jetzt fast so viel wie ein ungewaschener Bauer.«
Er grinste, aber Gishild erwiderte sein Lächeln nicht. Sie hielt nicht viel davon, dass ihre Kriegerjarle auf die einfachen Bauern und Fischer herabsahen. Wenn der Kampf um das Fjordland begann, würde sie jeden Mann brauchen, der eine Waffe halten konnte. Da war so eine Überheblichkeit nicht angebracht.
»Worauf willst du hinaus?«
»Irgendwo in dem Lager gibt es ein großes Loch. Und es beunruhigt mich, dass ich es nicht sehe.«
Gishild seufzte innerlich. »Sie werden Latrinen ausgehoben haben.«
»Nein, es muss ein größeres Loch sein«, beharrte Erek.
Wieder ließ ein Luftzug die Blätter rauschen. Flirrendes Licht blendete Gishild. Und plötzlich ergriff sie eine tödliche Kälte. Sie war tief in ihr. Von einem Herzschlag zum anderen. Die Ahnung kommenden Unheils wie damals, als ihr Vater von den Ordensrittern betrogen worden war und man sie entführt hatte.
»Geht es dir nicht gut, Herrin?«, fragte Sigurd, der Hauptmann ihrer Mandriden.
Sie winkte ab, doch ihre Hand zitterte leicht. Sie musste an Luc denken. Plötzlich fühlte sie sich ihm so nah, als stünde er neben ihr.
Gishilds Blick wanderte über die alten Bäume. Gestern hatten sie eines der Waldheiligtümer der Drusnier passiert. Einen Geisterwald, wo man Gesichter in die Bäume geschnitten hatte und hoch im Geäst zwischen Windspielen die Toten bestattete. Ihre Verbündeten, die Drusnier, glaubten, dass die Geister der Toten mit dem Wind ritten und die Windspiele aus Holz und Messing ihnen eine Stimme verliehen. Man musste nur genau hinhören, dann konnte man ihre Botschaften vernehmen.
Die feinen Härchen auf ihrem Handrücken richteten sich auf. Wieder raschelte das dichte Laubdach über ihnen. Gab es einen Toten, der ihr eine Botschaft schicken wollte? Eine Warnung vielleicht? Sie musste an Lucs Liebesschwüre denken. So oft hatte er ihr versprochen, dass er ihr beistehen würde. Wäre er jetzt doch nur hier! Ob ihm etwas zugestoßen war?
Sie atmete tief ein. Das war abergläubischer Unsinn!
Gishild zitterte leicht. Wieder musste sie an den heißen Sommertag denken, der jener Nacht vorausgegangen war, in der die Ordensritter sie geraubt hatten. Auch damals hatte sie diese Kälte gespürt.
Sie hob energisch den Kopf. Nichts war mehr so wie früher! Sie hatte leichtes Fieber, das erklärte die Kälte. Ein Sommerfieber …
Ihr Blick streifte Erek, und sie musste unwillkürlich schmunzeln. Ohne seinen üppigen Bart sah er fremd aus. Fremd, aber wirklich nicht schlecht. Er gab sich Mühe, ihr zu gefallen. Man könnte ihn so tatsächlich für einen echten Pistolier halten. Gishild wusste, welches Opfer es für einen Fjordländer bedeutete, sich von seinem Bart zu trennen. Es würde mindestens zwei Jahre dauern, bis er wieder so aussah wie noch gestern Nachmittag. Und all das hatte er nur getan, um an ihrer Seite reiten zu können.
Sie betrachtete das Lager am Talgrund. Die Fahne am hohen Fichtenmast in der Mitte des Lagers hing schlaff herab. Dort stand der Wagenzug. An drei Seiten des Platzes waren die Planwagen ordentlich aufgereiht. Niemand zeigte sich zwischen den Zelten. Nur auf den Erdwällen waren ein paar Wachen zu sehen. Wer konnte, hatte sich vor der Mittagshitze verkrochen.
Sie seufzte leise. Im Grunde hatten ihre Verbündeten recht. Es war ganz gleich, ob sie jetzt angriffen oder in zwei Stunden. Sie winkte Erek.
»Reite zu Fürst Tiranu und sag ihm, er soll sich mit seinen Schnittern bereit machen. Wir greifen an!«
4
TODFREUNDE
Corinne wusste, dass sich dieser ungewaschene Mistkerl nur für Gold interessierte. Und für die Briefe, die sie mitbrachte. Sie gab sich Mühe, sich ihre Missbilligung nicht anmerken zu lassen. Diese abgerissene, schmutzige Gestalt war nur mehr das Zerrbild eines Fürsten. Er erinnerte sie an einen Wolf. Hager war er. Abgemagert, so wie Wölfe es waren, wenn die Winter zu lang und zu kalt waren und sie kaum noch Beute stellen konnten.
Der Bojar trug schmutzige, abgetragene Kleidung. In seinem breiten Gürtel steckte eine ganze Sammlung von Dolchen. An der Seite baumelte ein altmodisches Breitschwert mit einem verschlungenen Messingkorb, der in ihren Augen nicht recht zu der schwerfälligen Klinge passte. Strähnige, dünne Haare lugten unter seinem Barett hervor. Seine Wangen waren schwarz von Stoppeln. Augenscheinlich hatte er sich seit Tagen nicht mehr rasiert. Und er roch, als habe er sich seit Wochen nicht mehr gewaschen.
Corinne verzog das Gesicht bei dem Gedanken, dass ganz Drusna ihn für einen Freiheitshelden hielt. Ein Stück Dreck war er, im wahrsten Sinne des Wortes, und sonst nichts. Eine Waffe der Neuen Ritterschaft in einem Krieg, von dem selbst die Mehrheit der Heptarchen nichts wusste.
»Was amüsiert dich?«, fragte der Bojar gereizt.
Einen Herzschlag lang war Corinne versucht, ihm die Wahrheit zu sagen. Aber das kam natürlich nicht in Frage. Noch brauchten sie diesen Mistkerl. »Ich dachte daran, was für launische Wege der Krieg doch geht, dass wir heute unseren treuesten Verbündeten darum bitten müssen, unsere größte Feindin zu retten. Das ist schon ein wenig grotesk, nicht wahr?«
Der Bojar runzelte die Stirn. Seine Faust schloss sich fester um den prallen Lederbeutel in seiner Linken, sodass die Goldstücke darin leise klirrten. »Was soll ich tun?«
Corinne deutete auf das kleine Modell aus Erde, das sie gebaut hatte, während sie auf den Verräter gewartet hatte. Sie hob den langen Eschenstecken auf, den sie bereitgelegt hatte. Dann erläuterte sie ihm alles, was sie über das Vorratslager Eisenwacht wusste. Nur dass Louis de Belsazar, der neue Komtur von Drusna, persönlich anwesend war, verschwieg sie wohlweislich. De Belsazar hatte den Ruf, verschlagen und gnadenlos zu sein. Und obwohl er ein Fanatiker war, vermochte er kühl zu planen. Wenn der Bojar wusste, dass Belsazar dort unten war, würde er sich vielleicht zu Dummheiten hinreißen lassen. Sein Tod würde den Orden vom Aschenbaum tief treffen, aber heute war nicht der Tag dazu. Es galt allein, Gishild davon zu überzeugen, nicht anzugreifen. Und dazu reichte es, dass der Bojar ihr erzählen konnte, was sie im Lager Eisenwacht erwartete. Wer sie dort erwartete, war von untergeordneter Wichtigkeit.
Der Bojar räusperte sich und spuckte dann auf den Platz, der die Mitte des Lagers markierte. Den Ort, wo die Planwagen aufgefahren waren.
»Da wird sie selbst mit ihren Elfen und Trollen nicht mehr herauskommen«, bemerkte er trocken.
Corinne hatte den Eindruck, dass der Verräter nicht allzu traurig wäre, wenn Gishild im Kampf fiel. »Deshalb ist es wichtig, dass du sie rechtzeitig warnst.«
»Du sagtest, sie ist schon da. Wie soll ich das schaffen? Außer den Maurawan vielleicht gibt es niemanden, der schneller die Wälder durchquert als ich und meine Männer. Aber selbst wir werden mehr als eine Stunde brauchen, um die Königin zu erreichen.«
»Du hast mehr als genug Zeit.«
»Kannst du hellsehen? Wie willst du wissen, dass sie nicht gerade in diesem Augenblick den Befehl zum Angriff gibt?«
Der anmaßende Tonfall des Bojaren missfiel Corinne, aber sie versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Der Kerl war zu wichtig. Außer dem einen, dessen Namen Lilianne nie preisgegeben hatte, war der Bojar ihr einziger Spitzel, der stets uneingeschränkten Zugang zur Königin hatte. »Mein Orden hat Königin Gishild ausgebildet. Wir wissen, wie sie denkt! Sie wird abwarten, bis die Hitze die Wachen mürbegemacht hat. Sie wird keinesfalls früher als eine halbe Stunde vor der Wachablösung angreifen. Das heißt, du hast mehr als anderthalb Stunden Zeit, um sie zu erreichen. Das sollte genügen.«
»Auch ich kenne die Königin ganz gut. Und ich finde, sie ist launisch wie ein junges Kätzchen. Man muss sich ja nur ihren Wappenschild ansehen. Wer wählt sich ein Strumpfband zum Wappen! Wie kannst du glauben, dass du vorhersagen kannst, wie sie handelt?«
Jetzt gab sich Corinne keine Mühe mehr, sich ein Lächeln zu verkneifen. »Unser Primarch hat einst bis auf den Grund ihrer Seele geblickt. Wir wissen, aus welchem Holz sie geschnitzt ist. Und wir haben all ihre Gefechte beobachtet. Sie weiß genau, wie wir denken. Sie kennt unsere militärischen Gepflogenheiten. Deshalb fiel es ihr oft so leicht zu siegen. Das ist ihre Stärke und zugleich ihre Schwäche. Es erlaubt uns, ihr Handeln vorherzusehen.«
»Dann könnte auch Komtur de Belsazar ihr Handeln vorhersehen.«
Es war mehr eine Feststellung als eine Frage. Corinne nickte. »Ja, so ist es. Deshalb hat er ihr diese Falle gestellt. Und nun beeile dich. Die Zeit verrinnt. Du musst sie warnen. Wir brauchen sie … noch.«
5
WARTEN
Louis tupfte sich mit einem Tuch über die Stirn. Es war drückend heiß im Wagen. Sie hatten die Leinenplane nur einen kleinen Spalt weit öffnen können, damit die Späher draußen in den Bergen sie nicht entdecken konnten. Abgerichtete Krähen, die hoch über dem Lager kreisten, schützten sie vor Falken und diesen widernatürlichen kleinen Geschöpfen mit den Schmetterlingsflügeln. Näher als auf eine Meile konnten sie dem Lager Eisenwacht eigentlich nicht kommen, dachte der Komtur. Aber wer wusste schon, was diese verdammten Elfen und ihre Magie vermochten.
Gott sei bei uns, betete er inständig. Seine Lippen bewegten sich lautlos. Die Arkebusiere im Wagen sollten nicht ahnen, was ihn beschäftigte. Seine Zweifel durften sie nicht anstecken.
Louis versuchte an etwas anderes zu denken als daran, welche niederträchtigen magischen Mittel ihren Feinden wohl zu Gebote stehen mochten. Er musterte eindringlich die Maserung der dicken Eichenholzbohlen, die für jeden Beobachter von außen hinter der Plane verborgen waren. Sie gaben dem Wagen auf der Seite, die zum weiten Platz in der Mitte des Lagers wies, zusätzlichen Schutz. Jeder der vermeintlichen Fouragewagen war mit einer dicken Holzwand versehen, die, wenn man stand, bis über die Mitte der Brust reichte. Und in jedem der Wagen warteten acht Arkebusiere.
Louis atmete tief aus. Es war drückend heiß. Er spürte den Schweiß seinen Rücken hinabrinnen. Louis trug den Halbharnisch der Schwarzen Schar. Seine breite, purpurne Bauchbinde mit den goldenen Quasten, die ihn als ranghohen Offizier auswies, hatte er abgelegt. Seine Hauptleute hatten bis kurz vor Morgengrauen noch versucht, ihn davon abzubringen, in der vordersten Linie zu stehen. Der Verzicht auf die Bauchbinde war sein Tribut an ihre Besorgnis. Er mochte seine Schwächen haben, aber Feigheit gehörte nicht dazu.
Es machte ihm zu schaffen, in diesem stickigen, engen Wagen eingesperrt zu sein. Zum Glück gab es nur eine solide Wand, sonst hätte er es nicht ertragen können. In den Erdgruben zu lauern wäre völlig unmöglich gewesen. Louis presste die Lippen zusammen. Er musste seine Ängste beherrschen! Der Komtur legte den Kopf in den Nacken. Durch den Leinenstoff konnte er matt die Sonne hoch am Himmel erkennen. Er war nicht wirklich eingesperrt, redete er sich ein. Auch wenn er wie all die anderen Ordenskrieger den Wagen nicht verlassen konnte.
Drei Nächte mit wolkenverhangenem Himmel hatten es ihm erlaubt, seine Vorbereitungen in aller Heimlichkeit zu treffen. Letzte Nacht war der falsche Wagenzug eingetroffen. Er hatte nicht Lebensmittel, sondern Waffenknechte gebracht. Hunderte von Waffenknechten! Die verdammten Rebellen und die Anderen würden in ihrem eigenen Blut ertrinken, wenn sie angriffen!
Sein Leibwächter drehte das Stundenglas um. Louis sah zu, wie der feine, gelbe Sand durch die Enge rieselte. Anderthalb Stunden noch bis zur Wachablösung! Also mussten sie noch mindestens eine Stunde warten. Das alles wäre nicht nötig gewesen, wenn die verdammte Neue Ritterschaft den Befehlen des Ordensmarschalls vom Aschenbaum nachgekommen wäre.
Louis betrachtete die dicke, langsam schwelende Lunte eines der Arkebusiere. Sie steckte in einer Messinghülse an einem breiten Lederbandelier, das quer über dessen Brust lief. Daran würde er die Lunte seiner Arkebuse entzünden, sobald der Befehl kam, sich gefechtsbereit zu machen. Der kleine Glutfunken war durch die Luftlöcher der Messinghülse kaum zu sehen. Ein dünner Rauchfaden stieg davon auf.
Louis schob sich einen Finger unter den Kragen. Auf seinem Hals stand der blanke Schweiß. Hämmernde Kopfschmerzen machten ihm zu schaffen. Er nahm seine Feldflasche und trank von dem leicht mit Essig versetzten Wasser. Es war warm und schmeckte metallisch. Er spürte, wie sein Herz schneller schlug. In diesem verdammten Wagen eingesperrt zu sein und den Himmel nicht richtig sehen zu können, das war nichts für ihn! Doch er musste seine Angst beherrschen! Heute würde er siegen. Er durfte jetzt keinen Fehler machen. Nicht wie damals im Turm von Marcilla. Hätte er sich nur den Truppen des Komturs ergeben! Bei der Erinnerung daran, wie man ihn und die Überlebenden lebendig eingemauert hatte, wurde ihm die Kehle eng. Nicht daran denken!
Er starrte hinauf zur Plane des Wagens, um sich zu vergewissern, dass der matte gelbe Fleck noch durch das Leinen schien.
Mit fahriger Geste strich er sich über die Stirn. Diesmal hatte die Neue Ritterschaft einen schweren Fehler gemacht. Sie hatten eine große Flotte im Norden versammelt. Auch wenn das in aller Heimlichkeit geschehen war, hatten sie nicht verhindern können, dass Gerüchte bis zu Tarquinon, dem Großmeister des Ordens vom Aschenbaum, gedrungen waren. Nachdem die Flotte des Ordens vom Aschenbaum durch eine Springflut überrascht worden war und etliche Schiffe an den trügerischen Küsten der Dvina-See zerschellt waren, hatte der Orden die Flotte der Neuen Ritterschaft zur Unterstützung aufgefordert. Mit ihrer Hilfe hätte man den Hafen von Haspal blockieren können. Dann hätten die letzten Drusnier und alle Fjordländer und Albenkinder, die sie unterstützten, in der Falle gesessen.
Aber kein einziges Schiff war aufgetaucht. Stattdessen war die Flotte vom Blutbaum spurlos verschwunden! Diese Befehlsverweigerung würde der hochmütigen Ritterschaft endgültig das Genick brechen. Der Orden vom Aschenbaum führte den Oberbefehl in Drusna. Den Befehlen des Großmeisters Tarquinon nicht Folge zu leisten war offene Rebellion. Und einen rebellischen Ritterorden würden die Heptarchen in Aniscans nicht dulden. Man würde die Neue Ritterschaft auflösen. Und ihre Truppen und Besitztümer würden an den Orden vom Aschenbaum übergehen.
Louis’ Herzschlag ging nun wieder ruhiger. Ein ferner Donner erscholl, so als sei jenseits des Tals ein Gewitter aufgezogen. Der Komtur lauschte. Das Donnern schwoll weiter an, statt zu verebben. Das war kein Unwetter. Verwundert blickte er auf das Stundenglas.
»Sie kommen«, sagte einer der Arkebusiere mit von der Hitze heiserer Stimme.
Louis zog den Kantschlüssel aus seinem Gü