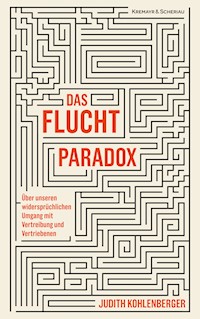
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Flucht ist ein Widerspruch: Man will bleiben, muss aber weg. Flucht ist traumatisierend: Man sucht Sicherheit, muss dafür aber sein Leben aufs Spiel setzen. Und Flucht (nach Europa) ist paradox: Man muss Recht brechen, nämlich "illegal" Grenzen passieren, um zu seinem Recht auf Asyl zu kommen. Nur um sich im Aufnahmeland abermals mit widersprüchlichen Anforderungen und unerfüllbaren Zuschreibungen der Integration auseinandersetzen zu müssen. Die Fluchtforscherin Judith Kohlenberger liefert eine detaillierte Analyse unseres Umgangs mit Vertreibung und Vertriebenen, zeichnet die historischen und rezenten Entwicklungen, nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine, in rechtlicher, gesellschaftlicher und individueller Perspektive nach und zeigt, wie wir zu einer menschlichen Asyl- und Integrationspolitik kommen, wenn wir unsere moralische Verantwortung wahrnehmen und der Stärke unserer Institutionen, unseres Rechtsstaats und unserer Zivilgesellschaft vertrauen. "Grundrechte kann man nicht einfach für die einen abstellen, während sie für die anderen weiter gelten. Sie sind, wie Maya Angelou, die amerikanische Schriftstellerin und Ikone der Bürgerrechtsbewegung, so treffend formulierte, wie Luft: Entweder alle haben sie – oder niemand."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Judith Kohlenberger
DAS FLUCHTPARADOX
DAS FLUCHTPARADOX
Über unseren widersprüchlichen Umgang mit Vertreibung und Vertriebenen
JUDITH KOHLENBERGER
KREMAYR & SCHERIAU
INHALT
VORWORT: ALLE ODER NIEMAND
1. LAGER
2. PARADOXES
3. SICHERHEIT
4. SCHUTZ
5. GRENZEN
6. AUSSCHLUSS
7. ANKUNFT
8. AUFSTIEG
9. ZUGABE, ODER: APPLAUS VOM BALKON
10. VERANTWORTUNG
DANKSAGUNG
ANMERKUNGEN
Equal rights, fair play, justice, are all like the air;
we all have it or none of us has it.
Maya Angelou
We move because of environmental stresses and physical
dangers and the small-mindedness of our neighbors –
and to be who we wish to be, to seek what we wish to seek.
Mohsin Hamid
VORWORT: ALLE ODER NIEMAND
„If you’re not outraged, you’re not paying attention“, besagt ein geflügeltes Wort aus den Vereinigten Staaten, das von Klimaaktivist*innen, Feminist*innen und Kongressabgeordneten gleichermaßen als Losung vor sich hergetragen wird. Dieses Buch ist dazu gedacht, unsere Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken, welches genau diese outrage (dt. Wut) schon längst verdient hätte, sie aber trotzdem viel zu selten hervorruft: Das anhaltende, allgegenwärtige und mittlerweile bereits systemimmanente Untergraben von Grund- und Freiheitsrechten Schutzsuchender an unseren Außengrenzen und ihr konsequentes, unwidersprochenes Fremdermachen innerhalb dieser.
Die Aufmerksamkeit darauf und in weiterer Folge die daraus resultierende outrage fehlen wohl auch deshalb, weil „uns“ (sprich: weiße Europäer*innen) das vermeintlich nichts angeht, sind wir uns doch unserer Menschen- und Bürger*innenrechte innerhalb der Europäischen Union gewiss. In regelmäßigen Abständen versichern uns freie Wahlen, dass wir der Souverän sind und die Kontrolle über unsere Regierenden haben. Unabhängige Gerichte bis hinauf zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte stehen für die Einhaltung der Menschenrechtskonvention und ahnden ihre Verletzung ohne Ausnahme. Darüber hinaus sorgen ein engmaschiges Sozialsystem und institutionelle Solidarität für die Sicherstellung unserer Grundbedürfnisse, vom Wohnen über die Nahrung bis hin zu Gesundheits- und Altersvorsorge. Die Demokratie ist für uns eine gut geölte, reibungslos funktionierende Maschine, die zwar manchmal Ermüdungserscheinungen zeigt (die österreichische Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft kann ein Lied davon singen), aber im Großen und Ganzen das aufrechterhält, was uns versprochen wurde: Dass wir in Würde und Gleichheit geboren und unsere Grundrechte unveräußerlich und unantastbar sind. Mag die Unzufriedenheit mit den und die Empörung über die Regierenden noch so groß sein, insgeheim lässt uns eine essenzielle Überzeugung dann doch Nacht für Nacht gut schlafen: Dass uns Europäer*innen das, was in Moria, in Belarus, in Bosnien, in Ceuta oder im Mittelmeer geschieht, nämlich eine wissentlich und willentlich herbeigeführte Rechtlosigkeit, nicht passieren kann.
Diese Grundannahme möchte ich mit diesem Buch nachhaltig erschüttern. Grundrechte kann man nicht einfach für die einen abstellen, während sie für die anderen weiter gelten. Sie sind, wie es die amerikanische Schriftstellerin und Ikone der Bürgerrechtsbewegung Maya Angelou so treffend formulierte, wie Luft: Entweder alle haben sie oder niemand hat sie. Schutzsuchende, Marginalisierte und Minderheiten erfüllen in westlichen Demokratien deshalb die Funktion eines Kanarienvogels in der Kohlemine, der Bergleute vor einem drohenden Sauerstoffverlust warnte: Bleibt ihnen die Luft weg, weil man ihnen Grund- und Menschenrechte verwehrt, so wird es auch für uns bald brenzlig werden.1 Man muss weder tief in die Geschichte zurückgehen noch geografisch weite Distanzen überbrücken, um die Beschneidung der Rechte von Marginalisierten und Ausgegrenzten, den poor and huddled masses yearning to be free,2 als Einfallstor für illegitime Tendenzen und Verletzungen der Grund- und Freiheitsrechte zu erkennen. Nicht von ungefähr werden die Rechte von Asylsuchenden in Ländern wie Polen und Ungarn mit Füßen getreten, also genau dort, wo die Rechtsstaatlichkeit generell oft nur mehr wie eine vage Empfehlung statt wie ein grundlegendes demokratisches Prinzip wirkt. Symptomatisch dafür mag der Umstand stehen, dass ausgerechnet der Begriff „Pushback“, also das völkerrechtswidrige Zurückweisen von Schutzsuchenden an der Grenze, häufig durch Einsatz von Gewalt, zum deutschen Unwort des Jahres 2021 gewählt wurde3 – wohlgemerkt in einem Jahr, das von Inzidenzen, Impfdurchbrüchen und Mutationen geprägt war.
Nicht erst seit dem Fluchtherbst 2015 wurde der Umgang mit Schutzsuchenden zum Lackmustest der europäischen Demokratie – den wir, so viel sei den folgenden Seiten vorweggenommen, oft mehr schlecht als recht bestehen. Manchmal fallen wir einfach durch. Dann wieder scheinen wir ihn bravourös zu meistern, etwa im Frühling 2022, als Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine in der EU Schutz suchten und diesen rasch, unbürokratisch und in seltener europäischer Einigkeit erhielten.
Doch halt!, mag man da rufen, handelt es sich bei ankommenden Menschen aus der Ukraine doch nicht um Flüchtlinge, zumindest nicht um „klassische“, wie etwa der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer und nach ihm zahlreiche weitere Politiker*innen klarstellten, sondern um „Vertriebene“. Und diese finden sich sogar, wie der aufmerksamen Leserin nicht entgangen sein wird, im Untertitel dieses Buchs wieder. Das hat inhaltliche wie strategische Gründe, allen voran aber jene, die aus der eingangs erwähnten outrage geboren sind: „Vertriebene“ sind nämlich alle, die ihr Land verlassen müssen, ohne es zu wollen – sei es aufgrund persönlicher Verfolgung, wegen (Bürger-)Kriegen oder repressiven Regimen, oder bedingt durch Naturkatastrophen und die Klimakrise, die ihre Heimat unbewohnbar machen. Vertreibung, im Englischen displacement, widerfährt allen, deren Welt verwüstet wurde, durch welche Umstände, Machthaber und geopolitischen Verwerfungen auch immer, und die nun gezwungen sind, anderswo Zuflucht zu suchen. Ob ihnen das gelingt, hängt auch davon ab, wie legitim das „Anderswo“ diese ihre Suche sieht.
Vertrieben zu sein verdeutlicht in seiner passiven Form nämlich, dass man keine Wahl hat, dass man den Umständen, die zum Aufbruch zwingen, unterworfen ist. „Keine Wahl“ haben Syrer*innen und Afghan*innen genauso wie Ukrainer*innen, in der Geschichte war die Flucht für Ungar*innen, für Jugoslaw*innen und für viele Österreicher*innen gleichsam alternativlos. Sie wurden verdrängt und versetzt, aber auch irgendwie „verlegt“, also an einen Ort gebracht, an den man sich später nicht mehr erinnern kann, wie in der englischen Phrase to displace an object. Die pakistanische Aktivistin und Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai erzählt in ihrem Buch We are Displaced: My Journey and Stories from Refugee Girls Around the World4 von genau dieser Erfahrung, nicht mehr dort hinzugehören, wo man war, aber auch nicht dort dazuzugehören, wo man hinkam.
Flucht passiert ausschließlich unter Zwang – was aber im täglichen Sprachgebrauch so wenig präsent zu sein scheint, dass man einen neuen Begriff für jene schaffen musste, die aus der Ukraine flohen. Der Flüchtling mag im politischen Diskurs zum Akteur, auch im zweifelhaften Sinne, geworden sein. Immerhin ist „flüchten“ ein aktives Verb und ausschließlich positiv sind unsere Assoziationen mit dem Fliehen und Flüchten, dem Entschwinden, sich Entziehen und Weggehen, gar dem Abhauen nicht. Den Vertriebenen aber kann man jegliche agency oder gar Mitschuld an ihrer prekären Lage absprechen. Sie sind ganz und gar ihren Umständen unterworfen, nahezu ausgeliefert, passiv. Den Asyldiskurs der letzten Jahrzehnte quasi über Nacht zu drehen und die Bevölkerung auf diese Kehrtwende einzuschwören – das gelingt nur durch radikale sprachliche (und rechtliche) Trennung.
Ungeachtet der neuen Kategorie des „temporären Schutzes“, die aus guten und nachvollziehbaren Gründen geschaffen wurde5 und Ukrainer*innen (fürs Erste) langwierige Asylverfahren und damit rein rechtlich den „Flüchtlingsstatus“ erspart (bzw., je nach Sichtweise, verwehrt), lässt sich aber inhaltlichnur eines konstatieren: „Flüchtlinge“ wurden aus Syrien vertrieben und „Vertriebene“ sind aus der Ukraine geflohen – oder wahlweise umgekehrt, denn die Bedingungen ihrer Ausreise sind in beiden Fällen solche der Unfreiheit, der Unfreiwilligkeit und des Zwangs. Nicht von ungefähr war ich im Jahr 2015 an einer Studie beteiligt, die den Titel „Displaced Persons in Austria Survey“ trug – und damit ankommende Menschen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak meinte.6 Und dass bereits 2015 die Massenzustromrichtlinie aus dem Jahr 2001 hätte aktiviert werden sollen, die Ukrainer*innen nun spezielle Rechte als ebensolche Vertriebene zuerkennt und gleichzeitig die Asylsysteme der Aufnahmeländer entlastet, ist eine verbreitete Expert*innenmeinung.7
Es geht also nicht nur bei der Zuerkennung universaler Rechte und dem Zugeständnis internationalen Schutzes, sondern auch mit Blick auf Begrifflichkeiten wie jener der „Vertriebenen“ immer um Maya Angelous Losung: Alle oder niemand.
Denn hinter Begrifflichkeiten und Rhetorik stehen auch grundlegende Annahmen über unseren Umgang mit den Folgen von Vertreibung und Verdrängung: Soll Flüchtlingsschutz „universal“ gelten (für „alle“), oder sollen anlassbezogen spezielle Schutzkategorien (wie etwa jene des „temporären Schutzes“) für bestimmte Gruppen, ohne vorherige Einzelfallprüfung, geschaffen werden? Letzteres betont die humanitäre „Notlage“, in denen sich diese Gruppe befindet, und ermöglicht eine beispiellose Reaktion auf einen „Ausnahmezustand“. Damit wird die Universalität des internationalen Schutzes aber zunehmend von speziellen Rechten für spezifische Gruppen abgelöst.
Die europäische Aufnahmepolitik angesichts des Kriegs in der Ukraine erinnerte damit an die politisierte Flüchtlingspolitik des Kalten Kriegs, als Europa die Aufnahme von Geflüchteten an seinen politischen Interessen ausrichtete: Der Antrieb, Dissident*innen und Deserteur*innen aus der Sowjetunion Zuflucht zu gewähren, entsprang nicht (nur) einem universalen Schutzgedanken, sondern war (auch) der eigenen Ideologie geschuldet, Oppositionelle und in weiterer Folge „den Westen“ stärken zu wollen. In seiner krassesten Ausprägung würde durch eine solche interessengeleitete Aufnahmepolitik das universale Asylrecht ausgehebelt, wie der deutsche Fluchtforscher J. Olaf Kleist mit Blick auf die Aktivierung der Massenzustromrichtlinie für ukrainische Ankommende argumentiert.8 Aus dieser Perspektive heraus ist auch die Differenzierung zwischen ukrainischen Staatsangehörigen und Drittstaatsangehörigen in der Ukraine zu erklären, die vor allem aus dem Globalen Süden stammen. Laut Medien- und Betroffenenberichten wurden Letztere immer wieder an Grenzübergängen zurückgewiesen oder ihnen wurde, wenn sie es doch bis in die EU geschafft hatten, im Ankunftsland der Reisepass abgenommen, um sie abzuschieben. All das verwundert angesichts der europäischen 3A-Asylpolitik der letzten Jahre (Abschottung, Abschreckung und Auslagerung) kaum.
Dabei ist diese differenzierte Form der Solidarität eine höchst fragile, selbst für jene, die eben noch in ihren vollen Genuss kommen. Was, wenn ukrainische Männer nachkommen? Was, wenn Schutzsuchende nicht so „schutzbedürftig“ daherkommen, wie wir sie uns vorstellen, sondern im SUV oder „im Bentley mit Ledersitzen“ über die Grenze fliehen (siehe Kapitel 3 – „Sicherheit“)? Was, wenn einer oder mehrere von ihnen straffällig werden (wie Österreicher*innen auch)? Dann sind es immer noch Menschen, die vor Verfolgung oder einem Krieg fliehen und die aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen, denen wir uns verpflichtet haben, Anspruch auf Schutz haben. Eine Hilfs- und Aufnahmebereitschaft, die auf dem Geschlecht, der Kultur oder der Hautfarbe der Schutzsuchenden basiert, steht auf tönernen Füßen.
Doch vielleicht, und nun versuche ich mich im berufsbedingten Zweckoptimismus, eröffnet der paradoxe Umgang Europas mit den Folgen des Krieges in der Ukraine auch einen Möglichkeitsraum. Denn möglicherweise steht hinter all den verblüfften Kommentaren, die nun Flüchtenden sähen aus „wie wir“, hinter der schrillen Betonung ihrer geografischen und kulturellen Nähe, hinter den wortreichen Bekundungen einer unmittelbaren Betroffenheit und historischen Verbundenheit, die unheimliche wie unbewusste europäische Erkenntnis, dass uns die Idee des internationalen Schutzes, wie er in der Genfer Flüchtlingskonvention und der Menschenrechtskonvention verbrieft ist, doch etwas angehen könnte. Dass es vielleicht doch ganz gut ist, wenn Flüchtenden bedingungslos Zuflucht geboten und Schutz gewährt wird – denn würden Putins Bomben nur einige Kilometer weiter westlich fallen, wären wir diejenigen, die um ihn ansuchen müssten. Und darauf hoffen, dass uns dann nicht die Luft wegbleibt, so wie den Zigtausenden, die im Mittelmeer ertrunken oder im Sumpfgebiet vor Polen erfroren sind.
„Alle oder niemand“ bedeutet nämlich genau das. Welche Wahl ich getroffen habe, beschreibt dieses Buch.
Wien, im Mai 2022
1. LAGER
„Und, waren Sie auch schon einmal in so einem Flüchtlingslager?“ Gar nicht so selten, wie man meinen (oder hoffen) möchte, wurde mir diese Frage in den letzten Jahren in verschiedenen öffentlichen und semi-öffentlichen Situationen gestellt. Bei Interviews, auf Podien oder nach Vorträgen – immer wieder besteht der Wunsch, unmittelbar berichtet zu bekommen, „wie es den Menschen dort wirklich geht“. Gemeint ist damit meistens, wie schlimm es ihnen wirklich geht, um dadurch meine davor gehörten, aber leider nur theoretischen Ausführungen zum internationalen Flüchtlingsschutz, zur europäischen Migrationspolitik oder zur Dynamik globaler Migrationsbewegungen zu legitimieren und zu untermauern. Wenn Kinder in Schlamm, Kälte und Dreck ausharren müssen, wenn Schwangere so verzweifelt ob ihrer aussichtlosen Lage sind, dass sie ins Wasser gehen, wenn Menschen monatelang in gefängnisähnlichen Komplexen hausen müssen, ohne auch nur im Verdacht zu stehen, ein Verbrechen begangen zu haben, dann wird so richtig offenkundig, dass das bestehende Flüchtlingsregime an allen Ecken und Enden ächzt und kracht.
Je nach Verfassung und aktueller Stimmungslage antworte ich entweder gar nicht darauf, lächle die Frage souverän weg, oder aber – und diese Variante möchte ich für die geschätzte Leserin, den geschätzten Leser wählen – ich erkläre, warum sie mich im Kern grantig macht, und zwar sowas von.
Denn im Vordergrund des Interesses steht selbst bei jenen Fragenden, denen man nichts als gute Absichten unterstellen kann, die konkrete Ausgestaltung (und damit das Elend) der Lager, nicht aber das ihnen zugrunde liegende System. Es ist aber genau jenes System, das die interdisziplinäre Fluchtforschung ins Zentrum stellt, das jedoch, so schwant mir, seltener gesehen wird (werden möchte?) als unmittelbare und ja, gerade auch hässliche9 Bilder. Jene, die sich schon lange mit internationaler Asylpolitik beschäftigen, werden nicht müde, auf die bewusste Systematik hinter diesen Bildern hinzuweisen: Dass eben Bilder wie jene der desaströsen sanitären Bedingungen im ehemaligen Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos nicht nur willentlich in Kauf genommen, sondern wissentlich produziert werden. Die regelmäßig wiederkehrenden humanitären „Katastrophen“ an den EU-Außengrenzen wirken in der politmedialen Aufbereitung oft wie eine Naturgewalt, die ungehemmt und völlig überraschend auf das schutzlose Europa hereinstürzt, sind aber tatsächlich das Endprodukt einer bewussten, jahrelang verfolgten Strategie der Abschottung, Abschreckung und Auslagerung von Asylverantwortung.
Die Frage nach dem Lagerbesuch bringt somit auf den Punkt, wie das Gros der „europäischen Flüchtlingsfrage“ medial wie gesellschaftlich verhandelt wird: Mit Blick auf tragische Einzelschicksale, auf die Rettung von Kindern und Frauen, oder am besten in Personalunion kleiner Mädchen (bei gleichzeitiger Unteilbarkeit der Menschenrechte und Solidarität), auf die Linderung der Lage „vor Ort“ (als wäre Europa nicht schon längst „vor Ort“ gewesen, ob auf eigenem Boden oder durch koloniale Herrschaft) oder als „Nachbarschaftshilfe“, nicht aber auf die rezidivierende Produktion und Verfestigung solcher Zustände. Die in der Forschung bewusst als „Lagerhaltung“ (engl. warehousing)10 bezeichnete „Routine-Lösung des Aufenthaltsproblems“11 von Geflüchteten ist das Resultat einer Asylpolitik, die sich nicht erst seit 2015 vorrangig als Sicherheitspolitik geriert – ironischerweise bisher aber, wie der tatsächliche und symbolische Brennpunkt Moria veranschaulichte, nur chronische Unsicherheit für die eigentlich Betroffenen und damit nur eine trügerische Sicherheit für Europäerinnen und Europäer erzeugt hat. Das vermeintliche „subjektive Sicherheitsempfinden“12 hierzulande, für welches sinkende Asylantragszahlen und Investitionen in den Grenzschutz herhalten müssen, ist teuer erkauft. Laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) ist das Mittelmeer die tödlichste Grenze der Welt, noch vor der stark militarisierten Grenze der USA zu Mexiko.13 Nicht von ungefähr bezeichnete es Papst Franziskus als den größten Friedhof Europas. Während uns Lagerbesuche also meist nur die unmittelbare Katastrophe vergegenwärtigen können, haben wir es de facto mit einer chronischen Krisensituation zu tun, die weit über zerfledderte Zelte und gesunkene Schlauchboote als ihre augenscheinlichsten und zugleich tragischsten Ausprägungen hinausgeht.
Dazu kommt noch erschwerend die Funktion der Adressatin solch einer Frage nach Lagerbesuchen hinzu. Nonchalant dahingesagt klingt sie fast so, als würde sich der oder die Fragende nach einer Reisedestination oder dem letzten Wochenende erkundigen. Denn wenn man als weiße, mitteleuropäische Fluchtforscherin diese Frage gestellt bekommt, ist natürlich klar, dass man nur aus einer ganz bestimmten Position heraus in „so einem Flüchtlingslager“ gewesen sein kann, und das ist dezidiert nicht die eines Flüchtlings. Eher ist es jene einer Journalistin, einer Aktivistin, einer UN-Sonderberichterstatterin, einer Angelina Jolie oder Cate Blanchett: als stille, aber empathische Beobachterin, die das Leid vor Ort sieht, dokumentiert, der Welt berichtet und es gleichzeitig zumindest im Kleinen zu lindern versucht, sei es durch Zuspruch, Spenden oder (tatsächliche, statt nur symbolischer) Hilfe vor Ort.
Nichts davon möchte ich in Abrede stellen oder kritisieren, im Gegenteil: Meine Ausführungen sind keinesfalls dazu gedacht, die Arbeit der wichtigen Organisationen vor Ort, von Ärzte ohne Grenzen über UNHCR bis hin zu mutigen Einzelinitiativen, zu schmälern.14 Sie alle leisten Übermenschliches unter widrigsten Umständen, und damit sind nicht nur die Zustände vor Ort gemeint, sondern auch die Anfeindungen zuhause, on- wie offline. Selbst die Bewusstseinsbildungskampagnen der zahlreichen UNHCR-Sonderberichterstatter*innen tragen – bei aller berechtigten Kritik aus Wissenschaft und Aktivist*innenkreisen15 – ihren Teil dazu bei, dass das willentlich in Kauf genommene Leid an der Peripherie des Globalen Nordens nicht in Vergessenheit gerät und zumindest Einzelschicksale verbessert werden können. Und weil eben jedes einzelne dieser Schicksale wertvoll ist, ist es auch jeder einzelne dieser Einsätze vor Ort wert, durchgeführt und unterstützt zu werden, ob monetär oder ideell. Nicht alle retten zu können, bedeutet im Umkehrschluss nämlich nicht, gar niemanden zu retten. Das ist kein „NGO-Wahnsinn“,16 wie es manche Nationalpolitiker haben wollen, im Gegenteil, das gebieten Vernunft und Humanität gleichermaßen.
Dennoch, und daraus speist sich mein Unbehagen an der Frage nach meinen Lagerbesuchen, können diese humanitären Bemühungen im gegenwärtigen Regime wenig mehr als Symptombekämpfung sein. Denn das Drängen auf den Vor-Ort-Bericht trägt immer auch zur Individualisierung struktureller Problemlagen bei, indem Einzelschicksale gesehen und (zu Recht) beklagt werden, nicht aber ihrer Ursache nachgespürt wird. Würden wir die nämlich vehement und unbeirrt angehen, bräuchte es gar keine Bilder von weinenden, halbnackten Kindern auf Lesbos, die das harte europäische Herz erweichen sollen, damit zumindest die unmittelbare Not gelindert wird.
Dann würde auch deutlich, dass das brennende Moria, der gestürmte Grenzzaun in Ceuta, die gestrandeten Menschen im polnisch-belarussischen Grenzgebiet, die regelmäßigen Drohgebärden Erdoğans, die Friedhöfe auf Lampedusa, der „Dschungel“ in Calais, die vermummte, prügelnde Grenzpolizei in Kroatien, der Lieferwagen bei Parndorf, so heftig das auch klingen mag, reine Symptome sind. Symptome eines fehlgeleiteten, inkonsistenten, inhumanen und vor allem widersprüchlichen Asyl- und Migrationsregimes. Genau solche inhärenten Widersprüche will dieses Buch aufspüren, offenlegen und, so die damit verbundene Hoffnung, womöglich den Weg zu einem anderen, politischen wie persönlichen, Umgang mit diesen Fragen bereiten.
Denn aus Sicht der interdisziplinären Flucht- und Flüchtlingsforschung, aus welcher dieses Buch verfasst ist, verstellt die Frage nach Flüchtlingslagerbesuchen auch den Blick darauf, worum es in der Asyl- und Migrationsfrage eigentlich gehen sollte: nicht um Almosen, um Akte der Barmherzigkeit und Nächstenliebe, zu der wir uns durch Bilder von Leid, Elend und absoluter Verzweiflung bemüßigt fühlen, sondern um Rechte. Rechte, die genau deshalb mit zähem Ringen, mit Blut, Schweiß und Tränen erkämpft wurden und aus den Wirren der beiden Weltkriege hervorgegangen sind, damit Menschen eben nicht mehr monate- oder gar jahrelang ohne Perspektive unter widrigsten Bedingungen ausharren müssen; damit sie eben nicht mehr zum Spielball diplomatischer Auseinandersetzungen werden; damit sie eben nicht mehr an Grenzen abgewiesen werden können, sondern innerhalb dieser angehört werden. Doch genau das passiert an den Grenzen Europas und darüber hinaus. Es geht also um Rechte, die Menschen zuerst systematisch aberkannt wurden, und deren erst durch ihre Rechtlosigkeit erzeugtes Leid nun durch Spenden gelindert werden soll.
Das liegt nicht zuletzt daran, so die These dieses Buches, dass der Themenkomplex Flucht und Asyl von zentralen Paradoxien geprägt ist, die eine Lösung der sogenannten „Flüchtlingsfrage“ schon a priori verunmöglichen. Eben weil wir von grundfalschen, vor allem aber in sich widersprüchlichen Grundannahmen ausgehen, was Flucht und Asyl im Europa des 21. Jahrhunderts betrifft. In der aktuellen Situation sind diese Widersprüche unauflösbar, weil dem System immanent, sie erhalten es aufrecht, obwohl uns die ins System eingespeisten Sollbruchstellen, von Moria bis Ceuta, von Parndorf bis Calais, immer deutlicher vor Augen führen, dass sich das alles wohl nicht mehr lange ausgehen wird, und zwar für niemanden der Beteiligten, ob Ankommende oder Aufnehmende. Innerhalb der bestehenden Paradoxien, deren Dénouement schon allein deshalb verhindert werden muss, um die Festung Europa aufrechtzuerhalten und ihre Mauern weiter zu verstärken,17 können die Flüchtlingsfrage nicht beantwortet, das Asylregime und damit die vielen Schicksale nicht verbessert, der Kampf nicht gewonnen werden. Im Folgenden möchte ich alle drei Paradoxien darlegen, beschreiben und aufschlüsseln, damit sie den Zweck erfüllen können, für den sie eigentlich gedacht sind: zu mehr Verständnis und einer tieferen Wahrheit zu führen.
Vorab noch ein Wort zu den Begrifflichkeiten: Sie werden hier immer wieder von „Regimen“ lesen. Die Begriffe des Migrations-, Asyl- und Flüchtlingsregimes, die ineinander übergehen und ineinandergreifen, entstammen der Regimetheorie. Im Gegensatz zum „Asylsystem“ wird damit nicht ein konkretes, nationales Regelwerk mit einer zentralen Instanz (der nationalstaatlichen Regierung) beschrieben, sondern implizite sowie explizite Prinzipien, Normen, Regeln und Verhaltenskodizes.18 In einem weiter gefassten Verständnis werden darin auch sozioökonomische Bedingungen für die unterschiedlichen Mobilitätsformen sowie ihre soziale Organisation miteinbezogen.19 Die Idee des „internationalen Flüchtlingsregimes“ geht zurück auf das Jahr 1921, als der aus der Pariser Friedenskonferenz hervorgegangene Völkerbund den Begriff des „Flüchtlings“ prägte und in weiterer Folge eine internationale Rechtsordnung für Verfolgung und Vertreibung schuf.20 Das Flüchtlingsregime beschreibt im Wesentlichen ein „national-internationale[s] Institutionengefüge“21 und regelt die Rechte, Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten von Herkunfts- und Aufnahmeländern (in neueren Ausprägungen auch von Transitländern) von Asylsuchenden und Asylberechtigten. Das Kernstück des Flüchtlingsregimes ist und bleibt die 1951 verabschiedete Genfer Flüchtlingskonvention, die definiert, wer ein Flüchtling ist – nämlich jemand, der bzw. die aufgrund von Herkunft, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischer Überzeugung verfolgt wird. Als wesentliches Element regelt die Konvention auch das Non-Refoulement-Prinzip, also den Grundsatz der Nichtzurückweisung: Menschen dürfen nicht in Staaten deportiert werden, in denen ihnen Folter oder andere schwere Menschenrechtsverletzungen drohen.22
Während in der Fluchtforschung klassischerweise unterschieden wird zwischen dem Asylregime, das auf das nationalstaatliche Asylrecht fokussiert (mit dem Staat als schutzgewährender Institution), und dem Flüchtlingsregime, das die Wahrung der universalen Menschenrechte von Schutzsuchenden auch abseits des Asylanspruchs ins Zentrum stellt, ist diese Unterscheidung für die Zwecke dieses Buches zweitrangig.23 In der Realität wie in der öffentlichen Debatte gehen diese Begriffe nämlich fließend ineinander über. Auch deshalb hat sich in der neueren Fluchtforschung ab der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts der Begriff des refugee regime complex24 herausgebildet, der der Überlappung des internationalen Flüchtlingsregimes mit Regimen, die andere Formen menschlicher Mobilität reglementieren (etwa Tourismus und Arbeitsmigration), sowie mit nicht-mobilitätsbezogenen Regimen im Bereich der Menschenrechte, der Entwicklungszusammenarbeit, der humanitären Hilfe und der Sicherheit, gerecht werden möchte. In seiner inhaltlichen Breite folgt der in diesem Buch verwendete Regimebegriff dieser Konzeption, zur leichteren Verständlichkeit wird aber im Folgenden immer wieder abwechselnd von Asyl-, Flüchtlings- und Integrationsregimen gesprochen, je nachdem, welcher Aspekt der Fluchtmobilität und welche Station auf dem Weg von Geflüchteten, vom Aufbruch bis zum Ankommen, im Vordergrund steht.
Taxativ geht meine Verwendung von „Regime“ aber noch darüber hinaus und schließt neben rechtlichen Normen und Institutionen, wie es der klassischen Definition entspricht, auch Wertvorstellungen, Narrative, (die Herstellung von) Bedeutungen und politische, soziale und kulturelle Positionierungen mit ein, also alles, was dem diskursiven Spektrum zuzuordnen ist. Es soll nicht nur darum gehen, welchen rechtlichen und faktischen Realitäten sich Geflüchtete und Schutzsuchende gegenübersehen, sondern auch darum, wie über Flucht, Migration und Asyl „gedacht“ wird und welche Zuschreibungen geflüchtete Menschen erfahren. Völkerrechtliche und nationalstaatliche Bestimmungen sind ein Teil davon, decken aber nicht die Ganzheit eines Asyl-, Flüchtlings- und Integrationsregimes ab. Im kulturwissenschaftlichen Sinne sollen die signifying (oder meaning-making) practices, also sinnstiftende oder bedeutungserzeugende Praktiken, wie der britische Soziologe Stuart Hall sie nannte, aufgespürt und offengelegt werden.25 Es geht mir also vielfach um die Art und Weise, wie im herrschenden Regime über Flucht und Geflüchtete, über Vertreibung und Vertriebene gedacht, geschrieben und in weiterer Folge gehandelt wird, welche Bedeutungszuschreibungen durch soziale Praxis erzeugt, zirkuliert und verfestigt werden. Diese Bedeutungszuschreibungen sind in vielen Fällen so sehr sedimentiert, dass sie als normalisiert oder „natürlich“ wahrgenommen werden und nicht als das, was sie eigentlich sind: sozial, historisch und kulturell bedingt und damit „produziert“. In ihrer abstraktesten Form sind Asyl-, Flüchtlings- und Integrationsregime deshalb auch Netze von Bedeutungen, die durch nationale und internationale Institutionen, Regelungen, Normen, Diskurse und Bilder generiert werden. Sie mögen damit „unausweichlich“ erscheinen, sind es aber nie. Und genau darin besteht die Macht des Paradoxen, so es denn als solches erkannt wird: Ist seine Absurdität erst einmal offenbar, werden Alternativen denkbar – und machbar.
Übrigens, ich war noch nie in einem Flüchtlingslager, und beabsichtige auch in Zukunft nicht, dort zu leben – und auch nicht, eines zu besichtigen. Das Einsatzgebiet der Fluchtforscherin liegt in der Offenlegung jener Strukturen, die solche Lager erst notwendig machen.
2. PARADOXES
In der Literatur, ob Epik, Lyrik oder Dramatik, hat das Paradox die Funktion, durch einen vermeintlichen Widerspruch schlussendlich zu mehr Klarheit zu führen. Es soll Aufmerksamkeit schaffen, zu neuen Gedankengängen anregen, eine scheinbar ausweglose Situation neu in den Blick nehmen. Das alles gelingt aber nur dann, wenn das Paradox auch als solches wahrgenommen wird, wenn sein inhärenter Widerspruch von der Leserin entlarvt wird und Erstaunen, Verwirrung und Innehalten auslöst. Paradoxien unterbrechen den Lese- und den Denkfluss gleichermaßen, lassen uns stolpern, wenn wir das erste Mal auf sie stoßen. So können sie durch das Zusammentreffen und die gedankliche Gleichzeitigkeit zweier unvereinbarer Ideen eine darunterliegende Logik offenbaren, der gesellschaftliche, politische, soziale Strukturen gehorchen. Dadurch werden Situationen wie Konzepte auf eine innovative Art verstanden, und zwar im Wortsinne „begriffen“. Wenn also Sokrates (so man Überlieferungen Glauben schenkt) sinniert, er wisse, dass er nichts wisse, dann klingt dies zunächst widersprüchlich und lässt uns innehalten. Bei näherer (wenn man so will: bei philosophischer) Betrachtung offenbart seine Aussage aber eine tiefere Wahrheit, einen doppelten Sinn.
Wenn Shakespeares Hamlet proklamiert, er müsse „grausam sein, doch nur, um liebevoll zu sein“, so sind wir als Publikum zuerst irritiert, befremdet, vielleicht sogar peinlich berührt ob der fehlenden Logik. Wir schütteln womöglich sogar innerlich den Kopf, sträuben uns gegen diese Widersinnigkeit und diesen semantischen Zirkelschluss. Im Laufe des Stückes offenbart sich jedoch, was Hamlet damit meint und wie er dadurch seine (Un-)Tätigkeit begründet, ja, was er durch den Widerspruch auf den Punkt bringt, den er durch eine widerspruchsfreie Feststellung wohl gar nicht getroffen hätte – zumindest nicht in dieser Kürze und Prägnanz. Die paradoxe Aussage ist damit Hinweigeberin und „Auflösung“ zugleich, fasst sie doch den Antrieb des Protagonisten und den Kern des Stückes zusammen und kündigt dessen Kulmination an.
Paradoxien in der Literatur eignen sich also gut dazu, die Leserin zu aktivieren, sie aufmerksam zu machen und gedanklich anzuregen: Durch den vermeintlichen Widerspruch ins Wanken gebracht, soll sie nun selbst diesen Konflikt zwischen widersprüchlichen Konzepten, Werte(-haltungen) oder Ideen einer Klärung zuführen, um somit, einem Sokrates ähnlich, zu einem tieferen Verständnis zu gelangen. „Der angemessene Umgang mit Paradoxien besteht dann weniger darin, sie aufzulösen, als sie vielmehr zu entfalten“, so der Philosoph Daniel Kersting.26 Damit können Paradoxien zum Motor der Fortentwicklung werden, weil sie zu vertiefter Betrachtung und damit letztendlich zu einem erweiterten Verständnis führen.
Denn nur dieses Verständnis kann wiederum zu einer Entwirrung eines Sachverhalts führen, der sich dadurch als doppeldeutig, unhaltbar oder schlicht unlogisch zeigt. Damit solch ein Durchdringen und Zerlegen gelingt, muss der dem Paradox zugrundeliegende Widerspruch aber erst als solcher erkannt werden. Nehmen wir eine Situation nicht als paradox wahr, ist uns der inhärente Widerspruch nicht zugänglich, so kann das Paradox auch nicht seine angedachte Wirkung entfalten, nämlich schlussendlich zu mehr Klarheit, Verständnis und womöglich Veränderung führen – zumindest in Form einer alternativen Sicht auf Althergebrachtes und Naturalisiertes.
Und genau in diesem Aufzeigen von alternativen Sicht-, Denk- und Handlungsweisen liegt die Macht des Paradoxen: Bereits seit Langem normalisierte Wesenszustände werden dadurch ihrer eingebauten Absurdität überführt. Ein Paradox als solches zu erkennen bedeutet, gleichzeitig gewahr zu werden, dass der beschriebene Zustand eben nicht „logischerweise“ und „unausweichlich“ so sein muss, weil er ja im Kern widersinnig ist. Nun mag dies nicht sofort folgerichtig zur Auflösung oder gar zu Alternativen führen, jedoch zu einer Art De-Naturalisierung dessen, was lange naturalisiert, also als vermeintlich natürlich, unerlässlich, alternativlos gesehen wurde. Wenn Sokrates weiß, dass er nichts weiß, so kann er zumindest genau dort ansetzen, um vielleicht irgendwann zu (mehr) Wissen zu gelangen, und gleichzeitig die darunterliegende Dynamik jeglichen Erkenntnisgewinns im Blick behalten. Wenn Hamlet vermeint, grausam handeln zu müssen, um liebevoll zu sein, so erkennt er, dass ihn die paradoxen Bedingungen seiner unglücklichen Lage als Thronfolger, der den Mord an seinem Vater sühnen soll, indem er ehemals Vertraute tötet oder seine Mutter bedroht, in diese Bredouille gebracht haben. Ändern sich die Bedingungen dieser Situation, dann löst sich die gedankliche Pattstellung, sind Alternativen zum Paradox denkbar und wird Liebe ohne Grausamkeit greifbar.
Das Fluchtparadox nun eröffnet sich entlang der tatsächlichen wie symbolischen Reise, die ein flüchtender Mensch im derzeitigen internationalen wie nationalen Asylregime durchläuft, vom Moment der Ausreise bzw. versuchten Einreise zwecks Asylantragstellung im Aufnahmeland, über seine Aufnahme und Konstitution als „Flüchtling“ in der Gastgesellschaft [sic!] bis hin zur teils implizit, teils vehement eingeforderten „Integration“ in das soziale, ökonomische und kulturelle Gefüge eben dieser aufnehmenden Gesellschaft. Den drei Zwischenzielen auf dieser Reise entspricht jeweils ein konkretes paradoxes Moment, das ich wie folgt zusammenfassen möchte: Erstens das Asylparadox, oder auch die Unmöglichkeit legaler Zugangswege zum Recht auf Asylantragstellung, wodurch Flüchtende „Recht brechen“ müssen, um zu ihrem Recht zu gelangen; zweitens das Flüchtlingsparadox, oder auch der vulnerable, aber gleichzeitig leistungsbereite Schutzsuchende, der schutzbedürftig und selbstständig sein soll; und drittens das Integrationsparadox, oder auch das gesellschaftliche Konfliktpotenzial, das der Figur des Flüchtlings immanent ist, befeuert doch gerade seine erfolgreiche, vehement eingeforderte „Integration“ in die Aufnahmegesellschaft erst Debatten um Verteilung, Aufstieg und Sichtbarkeit in ebendieser.
Dazwischen offenbaren sich viele paradoxe Momente im Kleinen, die im Wesentlichen auf diese drei Momente zurückzuführen sind und sie wiederum verstärken. Während Vieles an diesen Paradoxien nicht neu ist und Teilaspekte wie die zunehmende Unzugänglichkeit des Menschenrechts auf Asylbeantragung gut dokumentiert sind, werden andere, wie etwa die Gleichzeitigkeit der Forderungen nach Schutzbedürftigkeit und Leistungsbereitschaft, kaum wahrgenommen oder erforscht. Vor allem aber ist es die Zusammenschau dieser drei zentralen Paradoxien, die in Summe die Widersprüchlichkeit des gegenwärtigen Asyl- und Migrationsregimes auf den Punkt bringen, indem sie sich gegenseitig potenzieren. Jede Handlung innerhalb des Paradoxes erhält nur das Paradox aufrecht und verfestigt es weiter. „Im Rahmen der Möglichkeiten“, eine häufig gehörte Floskel im Asyl- und Fluchtwesen, hat wenig Aussage- und noch weniger Wirkmacht, wenn eben dieser (absurde) Rahmen das Problem ist.
Die symbolische Reise durch die Paradoxien findet die geschätzte Leserin, der geschätzte Leser auch in der Kapitelabfolge dieses Buches wieder. Vom „Lager“ über „Sicherheit“, „Schutz“ und „Grenzen“ bis hin zu „Ankunft“, „Aufstieg“ und dem (vermeintlichen?) Ziel, der „Verantwortung“, wird der Bogen gespannt. Eine Perspektive will ich im Folgenden in den Vordergrund stellen: Wie wirkt das Fluchtparadox auf Geflüchtete und auf den (nur scheinbar alternativlosen) Umgang mit ihnen in Recht, Gesellschaft und Nation? Welche Konsequenzen zieht das Fluchtparadox auf den einzelnen Stationen der Reise, von Aufbruch bis Aufstieg, nach sich?
Während alle drei Paradoxien im Wesentlichen auf rechtlichen Widersprüchen oder zumindest Überschneidungen fußen, wurden und werden sie im gegenwärtigen Regime konsequent moralisch wie symbolisch aufgeladen. Es ist eben diese diskursive Aufladung und Bedeutungszuschreibung, die mich als Kulturwissenschaftlerin im Besonderen interessiert. Wie kommt es, dass ausgerechnet diese Paradoxien solch eine semantische Strahlkraft entwickeln, dass man ihren Effekt nur als Verblendung der Betrachterin beschreiben kann? Wodurch sind sie bedingt, welche diskursiven wie rechtlichen Rahmenbedingungen des Ein- und Ausschlusses von Schutzsuchenden brauchen sie und erhalten sie gleichzeitig aufrecht? Und vor allem: Welchen übergeordneten Zweck erfüllen diese Paradoxien im europäischen wie nationalen Asylregime? Die genannten Paradoxien sind somit im Weitesten auch Legitimationspraktiken, eben weil sie nicht als paradox erkennbar, sondern naturalisiert sind. Es wird als gegeben hingenommen, dass der Status quo „einfach so ist“, wie er eben ist, weil es die Notwendigkeit oder Dringlichkeit des Asylsystems erfordert und die Sicherheit, der Wohlstand und die kulturelle Unversehrtheit des Aufnahmelandes es gebieten.27 Durch ihre moralische Aufladung werden diese Paradoxien verschleiert und gleichzeitig mit quasirationalen Argumenten aufrechterhalten und perpetuiert.28 Bestehende Interventionen, seien es Hilfe vor Ort, humanitäre Versorgung oder Aktivismus, bewegen sich notgedrungen in den engen Grenzen (no pun intended) des Fluchtparadoxes und sind deshalb von vornherein nicht dazu in der Lage, wenig mehr als die oben erwähnte Symptombekämpfung zu bewerkstelligen.
Deshalb ist es unerlässlich, gerade im Umgang mit dem politisch und ethisch sensiblen Bereich von Flucht und Vertreibung, die Tatsachen offenzulegen und sich immer wieder vor Augen zu führen, dass systemisch-politische wie persönlich-individuelle Entscheidungen unter grundlegenden Bedingungen von Widersprüchlichkeit getroffen werden. Dadurch fällt es aber umso schwerer, wie im politischen Alltag der Asyl- und Fluchtdebatte unschwer zu erkennen ist, Verantwortung für ebendiese Entscheidungen zu übernehmen, die auf Basis inkonsistenter, paradoxer Grundlagen und hoher Unsicherheit getroffen wurden. Genau diese Verantwortung muss aber immer und konsequent eingefordert werden, gerade wegen der inhärenten Widersprüchlichkeit des Asylregimes. Denn das zugrundeliegende Spannungsverhältnis unterschiedlicher, teils widersprüchlicher oder zumindest konträr ausgerichteter Interessen führt nicht zur Entbindung von Verantwortung, sondern zur potenzierten Aufforderung zur Verantwortungsübernahme.
Folgerichtig argumentiert der deutsche Soziologe Alfred Scherr, „dass es sich bei Positionierungen zu Fragen der Flüchtlingspolitik und des Flüchtlingsrechts gerade deshalb um zu verantwortende Entscheidungen handelt, weil diese nicht zwingend und eindeutig aus widerspruchsfreien und rational begründbaren Prinzipien abgeleitet werden können“.29 Je uneindeutiger, je widersprüchlicher, je arbiträrer sie sind, desto mehr politische, aber auch moralische Begründung brauchen Entscheidungen im geltenden Asyl- und Flüchtlingsregime. Dies gelingt nur mit konsequent durchgehaltener und nie abstumpfender Humanisierung des vermeintlich „Anderen“ – das Gegenüber immer Mensch sein lassen, denn nur dann ist „Hineinversetzen“ im Sinne Arendts möglich. Das wird auch die Handlungsmaxime sein, die ich den Leserinnen und Lesern am Ende unserer gemeinsamen Reise mitgeben möchte.
Denn es wäre wohl so naiv wie gefährlich zu meinen, jetzt geltende Normen im Bereich des globalen Flüchtlingsschutzes oder der universellen Menschenrechte wären „ein nicht hintergehbarer Referenzrahmen“.30 Rückschritte hinter das bereits Erreichte sind eine stets vorhandene und sich immer wieder materialisierende Möglichkeit, wie man mit Blick auf die zahllosen Brennpunkte an europäischen Außengrenzen feststellen muss. Nicht von ungefähr warnen selbst erfahrene Asylexpert*innen regelmäßig davor, die Genfer Flüchtlingskonvention „aufzuschnüren“, um neue Fluchtgründe wie etwa die Klimakrise hineinzuverhandeln. Zu groß und real erscheint die Sorge, dass der Minimalkonsens, der nach den Wirren des Zweiten Weltkriegs mühevoll erreicht wurde, noch weiter nach unten nivelliert werden könnte.
3. SICHERHEIT
Das bekannteste und am besten dokumentierte Paradox im geltenden Asylregime ist wohl das Asylparadox. Genau genommen beschreibt es mehrere eng miteinander verwandte Phänomene. Das erste, dem wir uns an dieser Stelle genauer widmen wollen, bezieht sich auf die inhärente Illegalisierung von Schutzsuchenden: Um überhaupt erst in die Lage zu kommen, ihr Recht auf Asylantragstellung in Anspruch nehmen zu können, müssen sie zuerst „illegal“ (also ohne gültiges Visum, ohne vorhandenen Aufenthaltsstatus, ohne Einreisegenehmigung) die Grenze passieren.31 Anders ausgedrückt: Flüchtende müssen Recht brechen, um zu ihrem Recht zu gelangen.
Das klingt nicht nur absurd, sondern ist es auch, und noch dazu mit einer perfiden Wirkweise, weil in weiterer Folge die allerorts zu beobachtende Kriminalisierung von Migration (auch als crimmigration bezeichnet) ermöglicht wird – so sehr, dass man für ukrainische Schutzsuchende einen neuen Begriff brauchte, den man in den letzten Jahren noch nicht ins Kriminal gerückt hatte.32 Beim Thema Flucht von „illegaler Migration“ zu sprechen ist nämlich insofern richtig, als im aktuellen Asylregime Grenzen von der Mehrheit der Ankommenden gar nicht anders als „illegal“ überschritten werden können, weil ja der legale Aufenthaltstitel (jener eines Asylberechtigten) erst innerhalb dieser Grenzen beantragt und bewilligt werden kann. Dieser Akt des „illegalen“ Grenzübertritts liegt im Fehlen legaler, sicherer Fluchtwege begründet und ist somit nicht nur geduldet, sondern gewollt. Es ist der Dreh- und Angelpunkt des gegenwärtigen Asylregimes, egal wie lautstark Aktivist*innen,





























