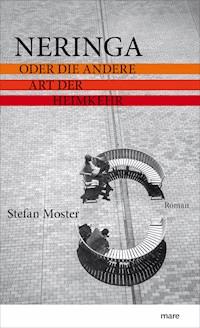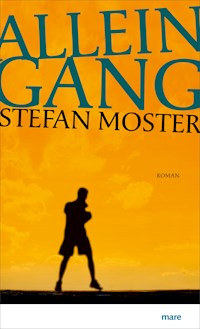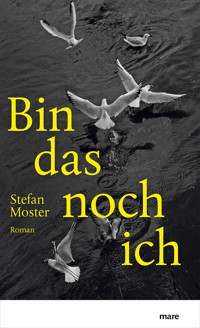Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Als die lang geplante Nordreise platzt, lässt die Arktis-Sehnsucht ihn nicht los. Und so versucht der für seine Romane bekannte Autor ihr anders nachzugehen als an Bord eines Schiffes: träumend – und lesend. Er liest über frühe Polarhelden und heutige Arktisforschende, er vergegenwärtigt sich die Erhabenheit, aber auch die Gefährdung der Natur, er imaginiert eisige Weiten und ewige Dunkelheit, Eisberge und Eisbären, und er erinnert sich an persönliche Begegnungen: mit dem Nordwind auf dem zugefrorenen Meer, mit freiheitlichen Gesellschaften, mit Fjällbirken und Stürmen, mit Polarlichtern und Elfenbeinmöwen. So entsteht nach und nach ein Buch, das auf einzigartige Weise Fantasie, Sehnsucht und Arktis-Wissen miteinander verbindet. Nach der Lektüre wird jeder sofort aufbrechen wollen – muss es aber nicht, denn nach dieser Lektüre war man schon dort. Stefan Mosters persönlichstes Buch und eine Arktis-Reise der besonderen Art.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Moster
Das Fundament des Eisbergs
Eine arktische Sehnsucht
© 2022 by mareverlag, Hamburg
CovergestaltungNadja Zobel, Petra Koßmann / mareverlag
Coverabbildungakg-images
Datenkonvertierung E-BookBookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-810-6
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-680-5
www.mare.de
Inhalt
Prolog
I
Kompass
Arktisches Fieber
Faszination und Gefahr
Zeit und Zumutung (1)
Sucht und Suche
Der Pol (1)
Rätsel und Glaube
Sextant
Drift (1)
Gegen das Navigationsprinzip
Unterm Walrossdach
Eine Frage des Charakters
Nach den Entdeckern
Sehnsucht
Ich will nicht zum Nordpol
II
»Skandinavien«
»Nordisch«
Hasenfüße
Wachstümer
Der Pol für alle
Name und Ideal
Weite und Enge
Weite und Entfernung
Weite und Nähe
Gemeinschaften
Wärme für alle
Weite und Stille
Zonen
III
Erste Versuche
Farben (1)
Licht (1)
Eberesche, Ankermast
Der äußerste Osten des Westens im Norden
Eine höhere Macht
Arktische Kälte
Kalte Wärme
Walfänger
Blut
Rost
»Eingeborene«
Übergänge
Erstes Eis
Unbehagen
IV
Eisbergwirkungen
Weiße Flecken, blauer Planet
V
Aus der Luft
Fast gefahrlos
Amundsen fliegt
Amundsen guckt
Amundsen verschwindet
Fragwürdige Flüge
Der Pol (2)
Zeit und Zumutung (2)
Profanierung
VI
Touristen und Entdecker
Svalbard
Paradoxe Zuflucht
In der Welt, aus der Welt
Licht (2)
Farben (2)
Vögel
Schönheit
Eis
VII
Satellit
Schwund
Daten
Drift (2)
Hinschauen
Ursus maritimus
Angst
Melosira arctica
Paradoxie und Unheimlichkeit
Faszination
Epilog
Prolog
An einem Laternenmast in der finnischen Hafenstadt Kotka sah ich einen Aufkleber, der in bereits verblassenden blauen Buchstaben erklärte: »Wenn wir die Arktis verlieren, verlieren wir den ganzen Planeten.«
Bündig formuliert, dachte ich und schrieb den Aphorismus einer Organisation wie Greenpeace zu, doch dann sah ich, wer als Urheber des Zitats genannt wurde: Sauli Niinistö, Präsident der Republik Finnland, Angehöriger einer wirtschaftsliberalen Partei und bislang nicht mit Übereifer in Sachen Umweltschutz in Erscheinung getreten.
Wenn so ein Mann hinsichtlich der Arktis Sätze sagt, die von Umweltaktivisten stammen könnten, darf man das wohl als Indiz für einen breiten Konsens deuten. Wer über ein Mindestmaß an Vernunft verfügt, leugnet nicht, dass die Arktis für die Erde lebenswichtig ist und wir ein zu starkes Abschmelzen der Eisflächen in der nördlichen Polregion verhindern müssen. Schwindendes Polareis lässt die Meeresspiegel steigen. Das weiß heute jedes Kind.
Und weil die Arktis nicht nur von der Erderwärmung bedroht ist, sondern auch von den Begehrlichkeiten diverser Staaten und Konzerne, die sich von einem eisarmen Polargebiet leichteren Zugang zu kostbaren Ressourcen und schnellere Schiffsrouten versprechen, hat sie den Status einer sensiblen politischen Zone und zugleich einer Region von existenzieller Bedeutung für den ganzen Planeten.
Für den Verfasser einer persönlichen Betrachtung über die Arktis stellt sich darum unweigerlich die Frage, ob man einem Teil der Welt, der eine solche Relevanz besitzt, gerecht wird, wenn man ihn mit subjektivem, gar sehnsüchtigem Blick betrachtet. Darf man sich angesichts der aktuellen Lage überhaupt noch wünschen, jene Region, die im Begriff ist, die Schönheit und Besonderheit, die man dort sucht, für immer zu verlieren, mit eigenen Augen zu sehen?
Darf man sich die Begegnung mit dem ewigen Eis wünschen, das sich eben als nicht ewig erweist?
Darf man heute noch zum Nordpol wollen? Oder wenigstens bis zur Packeisgrenze am 80. Breitengrad?
Ja, das darf man. Zwar müssen wir uns um unseren Planeten wesentlich mehr bemühen, als wir es bislang getan haben, und uns auf Dauer andere Formen der Fortbewegung, der Ernährung, der Energiegewinnung, der Nutzung von Ressourcen aneignen, aber die Erde kann nur retten wollen, wer ihren Wert und ihre Schönheit kennt und anerkennt. Anstatt uns zu verbieten, die Welt sehen zu wollen, sollten wir versuchen, sie in ihrer Vielfalt und Verletzlichkeit wahrzunehmen.
Ohne Wertschätzung kein Schutz. Ohne Anschauung keine Wertschätzung. Ohne Annäherung keine Anschauung. Ohne Sehnsucht keine Annäherung.
Wenn wir den Wunsch, den Kompass in die Hand zu nehmen, aufgeben, geben wir uns selbst auf – und die Erde mit uns.
I
Kompass
Meinen ersten Kompass schenkte mir mein Großvater. Er war Lehrer für Mathematik und Chemie und hatte eine Vorliebe für Präzisionsmessgeräte mit sensiblen Zeigern. Er gehörte zu den Menschen, die hin und wieder mit dem Finger aufs Glas des Barometers klopften und mehrmals am Tag nicht nur die Temperatur, sondern auch den Luftdruck überprüften. Außerdem hing er an Uhren, nichts konnte ihm mehr Befriedigung verschaffen, als eine Uhr nach der anderen aufzuziehen, der Größe nach, von der Armbanduhr seiner Frau bis zur Standuhr im Wohnzimmer. Den Kompass bewahrte er in einer kleinen Pappschachtel in der Schreibtischschublade auf, und da er keine weitere Verwendung für ihn hatte, als ihn hin und wieder hervorzuholen und zu betrachten, schenkte er ihn mir irgendwann, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er mich damit nicht auf die Reise in unwegsames Gelände oder gar in menschenleere Regionen schicken wollte. Seine Absicht, so glaube ich, bestand darin, mich mit einem Insigne auszustatten, das mir sagte, dass ich mich auf dem rechten Weg befand und diesem folgen solle, bis ich ein Mann wäre, der Thermometer, Barometer, Kompasse zu lesen verstand und darum stets wusste, wo er sich befand und womit er zu rechnen hatte.
Hält man als Kind zum ersten Mal einen Kompass in der Hand, versehen nur mit den gröbsten Erläuterungen durch einen Erwachsenen, macht man eine interessante, wohl auch etwas irritierende Doppelerfahrung. Einerseits kann man das kleine, leichte Gerät mit all den Markierungen, Ziffern, Strichen, Klappmechanismen, Spiegeln nicht bis ins Detail begreifen, andererseits versteht man auf Anhieb, worauf es ankommt: Die Nadel zeigt immer nach Norden. Warum auch immer. Die Erklärung mit dem Magnetfeld nimmt man zur Kenntnis, vielleicht sogar mit einem Nicken, aber so richtig verstehen kann man sie nicht. Gleichzeitig kann man den Blick nicht von der Kompassnadel wenden: Wie man sich auch dreht und wendet, sie findet verlässlich die nördliche Richtung. Als Kind probiert man es aus, ein ums andere Mal, sieht zu, wie die Nadel manchmal eine Sekunde zögert und zittert, bis sie die richtige Richtung einschlägt, immer stärker wird das Empfinden, ein Zaubergerät in der Hand zu halten, und immer mehr glaubt man, der Norden sei den anderen Himmelsrichtungen übergeordnet. Man fühlt sich in einen magischen Sachverhalt einbezogen, man wird in die magnetische Ordnung der Welt integriert, man wird sozusagen eingenordet und weiß, wo oben und wo unten ist. Es kommt etwas in Deckungsgleichheit: Der Kompass in der Hand entspricht dem Kompass, den wir in uns tragen und dessen Nadel ebenfalls beharrlich nach Norden zeigt, ganz gleich, wohin wir uns wenden.
So jedenfalls lautet meine These. Ob sie der Überprüfung standhält? Erfasst die Anziehung des Nordens unweigerlich jeden? Sind wir uns alle dieser Anziehung bewusst? Oder gilt das nur für wenige? Scheiden sich an den Himmelsrichtungen die Geister? Auf jeden Fall nehme ich mit diesem Denken die Perspektive eines Bewohners der Nordhalbkugel ein, der sich am Nordpol orientiert und sich Weihnachten im Winter vorstellt, im Gegensatz zu den Menschen auf der Südhalbkugel, für die das Christfest ein Sommerfest ist und die Antarktis möglicherweise das, was für uns die Arktis ist. Insofern müsste man wohl sagen, dass nicht die Himmelsrichtungen die Geister scheiden, sondern der Äquator die Himmelsrichtungen und die mit ihnen verbundenen mentalen Orientierungen.
In der europäischen Perspektive, die ich in diesem Buch einnehme, ist der Norden kalt und der Süden warm. Und als europäische Menschen mit dieser Perspektive können wir sagen, dass wir alle die Wärme des Südens lieben. Wir verfallen dem Thymianduft der Provence wie dem Licht über den Hügeln der Marken oder dem Blau-Weiß-Puzzle der ägäischen Inselwelt. Der Süden verheißt Leichtigkeit, weil er den Menschen von der Mühe entbindet, für warme Verhältnisse zu sorgen.
Der Norden hingegen ruft die Vorstellung hervor, was es bedeutet, sich vor Kälte schützen zu müssen.
Je weiter die Einbildungskraft in den Norden vorrückt, desto deutlicher erkennt sie, was einem dort abverlangt wird. Hütten bauen, Feuer machen – das lässt sich noch als etwas denken, zu dem man in der Lage wäre, irgendwie, sofern man Werk- und Feuerzeug zur Hand hätte, aber was finge man in Regionen an, in denen kein Baum und kein Strauch mehr wächst? Woraus dort eine Behausung bauen, woher Brennholz nehmen, wie sich vor der Kälte schützen, überleben?
Die wenigsten werden auf Anhieb auf die Idee kommen, dass man aus Walrosshäuten ein Zelt fertigen und Robbenfett verbrennen könnte, um es warm zu haben. Die meisten werden einen Schauder spüren, wenn sie sich in jene totale Unwirtlichkeit versetzen, aber sie werden, glaube ich, auch Kontakt mit dem Reiz aufnehmen, den der extreme Norden unterschwellig oder tief im Innern auslöst. Man würde schon gern wissen, wie es dort ist. Und wie man selbst dort wäre.
Diese Behauptung ist leicht zu überprüfen, man muss sich nur die Frage stellen, ob man Nein sagen würde, wenn sich einem die unkomplizierte Möglichkeit böte, in den äußersten Norden unseres Planeten zu fahren, auch um den Preis, dass man in dem betreffenden Sommer auf seinen Urlaub am Mittelmeer verzichten müsste. Schlüge da am Ende nicht die Faszination des ewigen Eises die leicht zugänglichen Verlockungen des mediterranen Flairs aus dem Feld?
Ich glaube, die meisten würden die Offerte annehmen, und zwar voller reisefieberhafter Aufregung. Ich glaube das, weil ich es so erlebt habe und mir nicht einbilde, mein Empfinden hebe sich entscheidend von demjenigen meiner Mitmenschen ab.
Was mich allerdings überrascht hat, war die Intensität meiner Gemütsregung, denn im selben Moment, in dem mir das Angebot gemacht wurde, an Bord eines kleinen Expeditionsschiffes die arktischen Gewässer zu befahren, fing mein Herz so spürbar an zu pochen, dass ich endlich verstand, was gemeint ist, wenn man sagt, das Herz schlage einem bis zum Hals.
Ich bin kein Stubenhocker und reise gern, aber meine Neugier hat in den vierzig Jahren, in denen ich selbstständig unterwegs bin (bei der ersten »echten« Tour war ich sechzehn und haute nach Norden ab, wenn auch nur nach Kopenhagen), nicht nachgelassen, ebenso wenig wie mein Interesse für Landschaften, Lebensräume, Lebensweisen. Es gibt viele Gegenden der Welt, die ich gern sehen würde, aber nie hatte die Aussicht, in eine bestimmte Region zu reisen, meinen Herzschlag wie auf Knopfdruck so sehr beschleunigt.
Vielleicht hatte es mit dem banalen Umstand zu tun, dass ich immer davon ausgegangen war, die arktischen Regionen nie besuchen zu können, allein aus finanziellen Gründen, vielleicht auch damit, dass ich mir keine angemessene Reiseform vorstellen konnte. Womöglich war ich überrascht, dass sich diese Aussichten überraschend änderten. Denkbar wäre auch, dass sich mein innerer Kompass, der immer schon gewusst hatte, wo Norden war, bemerkbar machte und auf sein Recht pochte.
Oder es geschah das Gegenteil von etwas Gewöhnlichem, und in mir wurde schlagartig eine Vorform des arktischen Fiebers geweckt.
Arktisches Fieber
Arktisches Fieber – dieser Begriff tauchte Mitte des 19. Jahrhunderts auf, und das nicht von ungefähr. Er war notwendig geworden. Es war die Zeit der Entdeckungen unerforschter Gebiete, die Zeit der Suche nach den Quellen von Nil und Kongo, aber eben auch die Zeit, in der ernsthaft versucht wurde, die Polarregion für die Menschheit zu kartieren und zu erschließen, all die kursierenden Theorien über die Gegend rund um den Punkt, an dem es keine Zeit gab, zu verifizieren oder zu widerlegen und nebenbei den Nordpol zu erobern.
Kapitän George DeLong, der 1879 versuchte, sich mit seinem Schiff, der USS Jeannette, und zweiunddreißig Mann Besatzung von der Beringstraße kommend im Eis einschließen zu lassen und unter Nutzung der Drift zum Pol zu gelangen, bietet dafür das beste Beispiel. Er hatte als Lieutenant der US Navy zumindest eine Hälfte der Welt bereist, nämlich die Ostküste Amerikas, die Karibik, Südamerika sowie Europa, und wäre nie auf die Idee gekommen, die unwirtliche Region im Norden zu befahren, denn er hielt sich am liebsten in den Tropen auf. Dann aber musste er 1873 als Erster Offizier auf der USS Juniata nach Grönland fahren, um in den dortigen Gewässern nach dem verschollenen Expeditionsschiff Polaris zu suchen und dessen vermisste Besatzungsmitglieder zu retten, falls es noch Überlebende gab. DeLong segelte nach Norden, weil die Dienstpflicht es von ihm verlangte. Das Rennen um den Nordpol, an dem die Öffentlichkeit seit Mitte des Jahrhunderts, seit John Franklins gescheitertem Versuch mit den Schiffen Erebus und Terror, mit sonderbar übersteigertem Interesse Anteil nahm, berührte ihn wenig.
Das änderte sich zunächst auch nicht, als er schon unterwegs war. »Nie zuvor habe ich einen derart trostlosen Landstrich gesehen, und ich kann nur hoffen, dass mir das Schicksal es erspart, irgendwann in einer so gottverlassenen Gegend zu stranden«1, schrieb er an seine Frau, nachdem die Juniata im Südwesten Grönlands festgemacht hatte.
Als die Juniata aber den Polarkreis überquerte und an der zerklüfteten Westküste Grönlands entlang zur Diskoinsel hinauffuhr, tat sich bei DeLong etwas. Auf einmal fand er das, was er sah, nicht mehr so abstoßend und trostlos. Im Gegenteil. In ihm wuchs eine Art von Faszination, die er nicht kannte. Sie wurde von der Umgebung geweckt, die sich mit nichts vergleichen ließ, in der ein spezifisches Licht herrschte, das überdies durch Reflexion und Brechung etliche Effekte hervorrief: Luftspiegelungen, Polarlicht, Nebenmonde, Halos. Auch die Luft war von besonderer Konsistenz. Sie schien reiner zu sein, alle Geräusche klangen darin anders, als man es gewohnt war, sodass man sich selbst mit anderen Ohren hörte – und spätestens dann, in dem Moment, in dem der Mensch sich unvermittelt neu wahrnimmt, ist seine Faszination nicht mehr zu halten. Er entdeckt sich selbst auf neue Weise und hofft, weitere Entdeckungen zu machen, noch mehr von sich fasziniert zu sein.
Bald nahm die Intensität der Eindrücke zu. Es kam der Eisblink. Es kam das Eis. Es kamen Eisberge, Eismassen, es kamen Gletscher, von denen gewaltige Bestandteile abbrachen und ins Wasser stürzten, es kamen Treibeis und Packeis, und mit dem Eis kamen völlig neue Geräusche in die Welt, die entstanden, wenn Eis gegen Eis stieß oder Eis sich an Eis rieb. Selbst die Brandung klang hier anders als dort, wo DeLong bislang gesegelt war, und welche Geräusche es machte, wenn ein Wal eine Wasserfontäne ausstieß, hatte er ebenfalls nicht gewusst.
DeLongs Faszination wuchs und mit ihr die Bereitschaft, sich noch weiter nach Norden zu wagen. Und so meldete er sich als Freiwilliger, als der Kapitän der Juniata beschloss, wegen des gefährlichen Eises nicht über Upernavik hinauszufahren, sondern ein wendigeres Beiboot, die Little Juniata, weiter nach Norden zu schicken, in Regionen, in denen es nichts mehr gab als Eisberge, bis zum 650 Kilometer nördlich gelegenen Kap York.
Faszination und Gefahr
Mit zunehmender Faszination wuchs freilich die Bedrohung. Innerhalb kurzer Zeit nahm sie existenzielle Dimensionen an.
Gefrierender Nebel überzog die Masten, Taue, Segel der Little Juniata mit Eis. Gleichzeitig drohte das Schiff vom Packeis eingeschlossen zu werden, ständig musste es Schollen rammen und sich zwischen ihnen durchkämpfen, immer unter der Gefahr, dass es an einer scharfen Kante leckschlug. Unablässig drohte die Zerstörung des kleinen Schiffes, aber DeLong und seine Männer kämpften sich frei und erreichten wieder offenes Wasser.
Dieser Erfolg unterfütterte die Faszination, die DeLong erfasst hatte, mit der Euphorie des gewonnenen Überlebenskampfs. Er war unter extremen Bedingungen dem Tod entronnen und durfte dies seinen eigenen seemännischen Fähigkeiten zuschreiben!
Was bedeutet eine solche Erfahrung für einen Menschen?
Ich kann es nicht wissen, aber ich stelle mir einen solchen Menschen als einen vor, der seine Umrisse vollkommen ausfüllt. Als einen, der bis in jede Zelle eins und einverstanden ist mit sich. Und ein Mensch, der mit sich eins ist, kann nur ein glücklicher Mensch sein. Warum sollte er nicht zur Quelle seines Glücks zurückkehren wollen?
DeLong tat genau das sechs Jahre später. Alle Polarfahrer, die bei ihrer Expedition nicht ums Leben kamen, kehrten zurück, ob sie Scott oder Amundsen hießen, und wenn sie – wie Nansen – nicht zurückkehrten, so träumten sie davon.
Wovon sie gewiss nicht träumten, was aber als naheliegende Möglichkeit, gar als Unausweichlichkeit in ihre Vorstellung rückte, sobald sie Pläne machten, über die Breiten von Kap York hinaus in die Arktis vorzudringen, war die Aussicht, vom Eis eingeschlossen zu werden. Einzufrieren und dann einen ganzen arktischen Winter lang abwarten zu müssen, bis das Schiff wieder freikam. In den begrenzten Räumlichkeiten von Kombüse und Kajüten. Auf einem zwar stabilen, trotz allem aber doch zerbrechlichen Schiff. Umgeben von nichts als Eis. Umgeben von nichts als dunkler Polarnacht. Weit weg von jeder Zivilisation. Ohne jegliche Verbindung zu irgendeinem Menschen außerhalb des eingeschlossenen Schiffes.
Eine Schreckensvorstellung erster Güte, sollte man meinen.
Man scheint das allerdings anders sehen zu können, wenn man einer ist, den das Polareis zum Menschen gemacht hat, der mit sich eins ist. Jedenfalls schrieb George DeLong in auffallend unbekümmertem Ton an seine Frau: »Wenn du eine Weile nichts von mir hörst, mach dir bitte keine Sorgen. Sollten wir das Pech haben und hier oben einfrieren, kann es bis zum nächsten Lebenszeichen von mir Frühling werden.«2
Zeit und Zumutung (1)
Kann es bis zum nächsten Lebenszeichen von mir Frühling werden.«
Alles, was man von George DeLong und seiner Ehefrau Emma weiß, deutet darauf hin, dass sich die beiden wirklich liebten, was ja nichts anderes heißen kann, als dass sie sich an der Nähe des anderen freuten und Sehnsucht hatten, wenn ihnen diese Nähe verwehrt war. Angesichts dessen kann man über Georges Vertröstung auf den nächsten Frühling nur staunen. Was er da schrieb, muss eine ungeheuerliche Zumutung für seine Frau gewesen sein: eine so lange Trennung in vollkommener Ungewissheit, nicht nur ohne jedes gesprochene oder geschriebene Wort, sondern auch ohne Erleichterung durch Informationen über das Befinden des Geliebten!
Je größer die Zumutung, desto schmerzlicher spürbar der Faktor Zeit. Ein Paar von heute kann sich auf eine Trennung von einem halben Jahr einigen, wenn beide Beteiligten die Gründe einsehen, sie für vernünftig oder nötig halten, wenn beide eine Vorstellung davon haben, wie sie während der Zeit Kontakt zueinander halten werden, und wenn sie das Ende der besagten Periode datieren können. Welches Paar aber ließe sich auf eine Periode ohne Lebenszeichen ein, deren Ende nicht absehbar ist?
Die Zumutung für Emma war enorm und wurde durch den Aspekt der unbestimmten Dauer ungeheuerlich.
Für George stellte sich das Ganze etwas anders dar, aber ich bin nicht sicher, ob man seine Sicht der Dinge auch nur annähernd erfassen kann, wenn man nicht im 19. Jahrhundert in der Arktis unterwegs gewesen ist und überdies vom arktischen Fieber erfüllt war.
Tatsache scheint zu sein, dass die Arktis das normale Zeitgefühl des Menschen beeinträchtigt oder gar außer Kraft setzt, sodass es einem Menschen plötzlich möglich ist, der Frau, die er liebt, zu schreiben, sie solle nicht auf ihn warten, es könne sein, dass sie erst nächsten Frühling wieder etwas von ihm höre.
Es gibt schlicht und einfach keine andere Lebenssituation, in der man sich einen solchen Satz vorstellen kann. Solche Sätze sind Arktiserkundern vorbehalten, Menschen, die alles anders sehen, sobald sie den Blick auf den Nordpol richten. Der Zeitbegriff dieser Männer (im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert waren es ausschließlich Männer) ist mir nie ganz geheuer gewesen. Allein die Information, dass Roald Amundsen 1918 zu seiner Nordpolexpedition mit der Maud Proviant für fünf Jahre mitnahm, jagt mir Schauer über den Rücken, weil es mir gespenstisch vorkommt, als realistische Option einzuplanen, mehrere Jahre lang im Packeis der Arktis eingeschlossen zu sein – umgeben von den lebensfeindlichsten Bedingungen, die dieser Planet zu bieten hat.
Im Zusammenhang mit der Arktis erhält das Phänomen Zeit einen unheimlichen Anstrich, weil es von einer Ungewissheit eingefasst ist, die sich durch Planungen kaum verringern lässt. Fridtjof Nansen hatten einen Plan, durchaus auch einen Zeitplan, als er 1893 mit der Fram gen Nordpol aufbrach, und seinem Plan entsprechend Proviant geladen, trotzdem konnte er nicht mit Gewissheit sagen, wann er seine Tochter Liv, die ein halbes Jahr zuvor geboren worden war, wiedersehen würde, ob sie dann noch das Sprechen oder schon das Rechnen lernen würde. Und das bedeutete natürlich auch, dass seine Frau Eva mit dem Kind an der Brust, mit dem Kind auf dem Arm, mit dem Kind an der Hand eine Zeit des Wartens vor sich hatte, der jede hilfreiche Umgrenzung fehlte. Die Zeit der Sehnsucht musste, so stelle ich es mir vor, selbst den Charakter einer sich nach allen Seiten hin ausdehnenden Eisfläche annehmen, die im Dunst des Horizonts mit dem diesigen Himmel verschmilzt.
Die Unheimlichkeit der arktischen Zeit beginnt schon mit der Fragwürdigkeit des Begriffes, denn genau genommen gibt es am Nordpol keine Zeit. Am Nordpol laufen mit den Längengraden auch die Zeitzonen zusammen, und die Uhren werden auf null gestellt. Ein Spaziergang um den Pol führt durch alle vierundzwanzig Zeitzonen, ohne dass man etwas merkt. Die Zeit orientiert sich nach dem Sonnenstand, dessen Variationsbreite sich am Pol in engen Grenzen hält. Entweder ist es hell, oder es ist dunkel. Entweder herrscht Polarsommer, oder es herrscht Polarnacht. Anders gesagt: Es gibt am Nordpol nur einen Tag, und der dauert ein halbes Jahr.
Wenn ich einen solchen Satz nur schreibe, zittern mir schon die Finger, weil ich immer, wenn ich etwas Unglaubliches wiedergebe, befürchte, etwas Falsches zu äußern. Schließlich bin ich noch nie am Nordpol gewesen und kann meine Aussagen nicht durch eigene Erfahrungen bezeugen. Zwar habe ich mich häufig in Regionen nördlich des Polarkreises aufgehalten, und zwar zu allen Jahreszeiten, weiß also, wie es ist, wenn es tagsüber nicht richtig hell und nachts nicht richtig dunkel wird, aber das totale Entweder-oder der Polregion, das einen für ein halbes Jahr entweder zu totaler Helligkeit (verstärkt noch durch die Lichtreflexion des Eises) oder zu totaler Finsternis (vertieft noch durch die Abwesenheit jeglicher Lichtemission) verurteilt, kenne ich nicht.
Darum halte ich mich lieber nicht länger als nötig im Umkreis solcher irritierenden Vorstellungen auf, sondern versuche die Besonderheit des Phänomens arktische Zeit in kleineren Einheiten verständlich zu machen.
Nehmen wir einen Zeitabschnitt von sechsunddreißig Stunden, und kehren wir zu George DeLong an Bord der Little Juniata zurück.
Das kleine Schiff geriet 650 Kilometer nördlich des Polarkreises an der Westküste Grönlands in einen Sturm, wie ihn DeLong noch nicht gesehen hatte. Der Wind war so stark, dass er die Eisfelder aufwühlte, Wellen schlugen mit einer solchen Wucht gegen die Eisberge, dass riesige Teile abbrachen, herabrutschten und das Schiff zu zerschmettern drohten, das Schiff, das unablässig vom Wind gebeutelt und von Brechern überschwemmt wurde.
Wie gesagt, ein Sturm, wie ihn die Schiffsbesatzung noch nie erlebt hatte. Eine gigantische Zumutung.
Damit komme ich auf den angekündigten Zeitabschnitt, denn dieser Sturm wurde den Männern auf der Little Juniata sechsunddreißig Stunden lang zugemutet.
Man führe sich vor Augen, was es bedeutet, sich sechsunddreißig Stunden lang in Lebensgefahr zu befinden.
Schwer vorstellbar? Versuchen wir es eine Nummer kleiner und stellen uns vor, sechsunddreißig Stunden im Sturm zu stehen, meinetwegen an Land, in Sicherheit, oder, ersatzweise, sich sechsunddreißig Stunden lang in schwerer See zu befinden, ohne Lebensgefahr.
Sechsunddreißig Stunden – das bedeutet: Setzt der Sturm um acht Uhr abends ein und hat um Mitternacht nicht nachgelassen, hofft man zunächst darauf, dass er sich wenigstens gegen Morgen legt. Unwillkürlich baut man diese Hoffnung auf, weil sich die Fantasie stets Fixpunkte sucht, an denen sie sich vorwärtshangeln kann, hin zu den Bildern der Erleichterung. Stürmt es am nächsten Morgen weiterhin, wird das den Mut bereits beträchtlich schwächen. Dann aber hat man noch immer vierundzwanzig Stunden Unwetter vor sich!
Aber zurück zur Little Juniata. Wenn fortwährend Brecher über Bord kommen, muss man ständig lenzen, also pumpen und mit Eimern Wasser schöpfen, und zwar schnell und ohne Pause, denn wenn zu viel Wasser an Bord kommt, passiert das, was am 28. September 1994 mit der RoPax-Fähre Estonia vor der finnischen Ostseeinsel Utö passierte, als Wasser durch die vordere Ladeklappe eindrang: Wasser hat Gewicht, und wenn Wasser an Bord durch die Bewegung des Schiffes im Wellengang hin und her schwappt und sein Gewicht somit hin und her schlägt, dauert es nicht lange, bis das Schiff durch die rapide zunehmende Unwucht krängt, kentert und sinkt.
Es musste auf der Little Juniata also pausenlos gelenzt werden, und wenn man sechsunddreißig Stunden lang lenzen muss, heißt das, dass man sechsunddreißig Stunden lang schuftet, während Brecher über Bord schlagen, wobei man zwangsläufig klatschnass wird, und dies 650 Kilometer nördlich des Polarkreises, also im Kalten, umgeben von brüchigen Eisbergen.
Noch lange nachdem sich der Sturm gelegt hatte, muss das Frieren fürchterlich gewesen sein.
Die Little Juniata überstand den Sturm, sie überquerte den 75. Breitengrad, aber dann entschloss sich DeLong nur zwanzig Kilometer vor Kap York dazu, aufzugeben und umzukehren, um das Leben seiner Leute nicht im unberechenbaren Eis aufs Spiel zu setzen. Nach zwei Wochen und 1300 Kilometern erreichte die Little Juniata wieder ihr Mutterschiff, wo DeLong und seine Crew mit Jubel begrüßt wurden, »als wäre ich von den Toten auferstanden«3, wie DeLong notierte.
Erneut strenge ich meine Einbildungskraft aufs Äußerste an und versuche etwas von DeLongs Erfahrung zu erahnen: Da waren die enormen Zumutungen über eine lange Zeit, da war die Frustration, weil er kurz vor dem Ziel umkehren musste, da waren die Gefahren, denen er mit Geschick und Kompetenz begegnete. Da war das Glück, das ihm half, die Gefahr zu überstehen. Und schließlich nach überstandenen Leiden und Gefahren die umjubelte Rückkehr.
Extreme Erfahrungen, extreme Emotionen. Das kann nicht ohne Wirkung auf einen Menschen bleiben.
Einen weiteren Monat später, Mitte September 1873, traf die Juniata in New York ein. Auch dort herrschte Begeisterung, wieder schlugen die Wellen der Emotion hoch, und auf George DeLong warteten überdies seine Frau Emma und seine kleine Tochter, die er monatelang nicht gesehen hatte.
Georges Gefühle bei der Heimkehr können nicht alltäglicher Natur gewesen sein, schließlich kommt auch ein Kapitän nicht jede Woche aus einem lebensgefährlichen Sturm in der Hocharktis zurück.
Sucht und Suche
George DeLong hatte in der Arktis die Erfahrung gemacht, eins zu sein mit sich selbst. Er hatte in der Arktis aber auch den Tod vor Augen gehabt. Und dann war er nach überstandener Lebensgefahr nach Hause zurückgekehrt und von den Menschen, die er liebte, in Empfang genommen worden.
Die Erfahrung des Einsseins mit sich selbst, die Erfahrung des Überlebens, die Erfahrung der Heimkehr – wenn das keine Intensivkur ist, um sich in seinem Menschsein wahrzunehmen!
Eine solche Ballung tiefer Erfahrung konnte nicht folgenlos bleiben. Emma DeLong, die später ein Buch über ihr Leben als Frau eines Polarfahrers veröffentlichte, merkte, dass ihr Mann sich verändert hatte. »Die Abenteuerlust hatte ihn gepackt und ließ ihn nicht ruhen«4, schreibt sie. Auch erwähnt sie ein Fieber, das ihn erfasst habe, und dass er schon bald nach dem Wiedersehen davon sprach, in die Arktis zurückkehren zu wollen.
Tatsächlich beließ es George DeLong nicht dabei, einschlägige Bücher zu lesen und Karten der Polarregion zu studieren, sondern meldete sich vorsorglich schon mal als Freiwilliger für die nächste Expedition in die Arktis, obwohl von einer solchen noch gar keine Rede war.
Wenn es stimmt, dass die Erfahrungen, die man in der Arktis machen kann (oder muss), bewirken, dass man sich mehr als Mensch fühlt als je zuvor, ist es nur zu verständlich, dass sie süchtig machen und diejenigen, die einmal dort waren, immer wieder anziehen.
Das würde dann erklären, warum John Franklin sich im Alter von sechzig Jahren noch einmal dafür entschied, eine strapaziöse Arktisexpedition zu unternehmen, um mit den Schiffen Erebus und Terror die Nordwestpassage zu finden – zu einem Zeitpunkt, als er bereits auf ein erfülltes Leben zurückblicken konnte, das ihn nicht nur schon zweimal in die Arktis geführt hatte, sondern in dem er auch zum Gouverneur von Van-Diemens-Land geworden war und höchste Auszeichnungen und Ehrentitel erhalten hatte. Ihn hielt nicht einmal die Erinnerung daran ab, dass er zu diesem Zeitpunkt längst den Spitznamen »Der Mann, der seine Schuhe aß« trug, da er nach dem Scheitern seiner ersten Expedition, bei der neunundzwanzig seiner Leute ums Leben gekommen waren, zusammen mit den anderen Crewmitgliedern nur überlebte, weil er neben Flechten auch Leder aß.
Es würde erklären, warum ein Mensch wie Robert Bartlett, einst Begleiter von Robert Edwin Peary bei dessen Expeditionen zum Nordpol, mehr als vierzig Mal an Forschungsreisen in die Arktis teilnahm und damit einen Rekord aufstellte, der noch heute gilt.
Es würde auch erklären, warum Roald Amundsen keine Schwierigkeiten hatte, eine Mannschaft für seine Expeditionen zusammenzustellen und zum Beispiel Hjalmar Johansen dafür zu gewinnen, mit ihm zum Südpol und dann in Richtung Nordpol aufzubrechen, obschon eben dieser Hjalmar Johansen Jahre zuvor mit Fridtjof Nansen zusammen acht Monate im arktischen Winter festgesessen hatte und nach normalmenschlichem Ermessen die Nase hätte voll haben müssen von den Unwägbarkeiten des ewigen Eises.
Amundsen selbst hätte übrigens ebenfalls allen Grund gehabt, sich aus dem arktischen Entdeckergeschäft zurückzuziehen, spätestens nachdem er unter einen Eisbären geraten, von diesem verletzt und im letzten Moment gerade noch von Jakob, dem Wachhund seines Schiffes, gerettet worden war.
Unter einen Eisbären geraten – für mich persönlich wäre es damit für alle Zeiten des Abenteuers genug gewesen.
Allerdings habe ich auch all die anderen Erfahrungen nicht gemacht, weshalb ich bestenfalls erahnen kann, dass die mentale polare Anziehung eine Intensität hat, die sämtliche Erinnerungen an erlittene Entbehrung und überstandene Gefahren entkräftet oder in etwas verwandelt, das erst recht die Entschlusskraft stärkt, es ein weiteres Mal mit besserem Erfolg zu versuchen.
Wenn ich mir das irgendwie entfernt vorstellen kann, dann wohl nur deshalb, weil in der eingeschriebenen Sehnsucht nach dem Norden, in dieser Einnordung in uns, die unbewusste Ahnung enthalten ist, dass dort, wo die Kompassnadel so aufgeregt zitternd hinweist, etwas zu erwarten ist, das den Horizont auf einzigartige Weise erweitert. Denn selbst wenn es nicht darum geht, auf Nansens Fram oder Amundsens Maud anzuheuern, sondern man sich auf deutlich ungefährlicherem Niveau entscheiden muss, ob man die Polarregion bereisen soll, spürt man, dass dieser Entschluss auf einer anderen Ebene fällt als der, ob man die Ferien lieber auf den Sporaden oder auf den Kykladen verbringen möchte.
Man fährt nicht in die Arktis, um Urlaub zu machen oder zu entspannen. In die Arktis reist man nicht wegen des Wetters, sondern seiner selbst wegen, also wegen der Person, mit der man sein Leben lang auskommen muss, die einem aber durchaus fremd sein kann und die überdies die verflixte Neigung zur Unzufriedenheit mit dem eigenen Dasein aufweist.
Dieser Aspekt hat sich nach der Epoche der Entdecker nicht in Luft ausgelöst, sondern ist heute, da alles entdeckt ist (auch die Tatsache, dass die »Entdecker« sich als solche nur bezeichnen konnten, weil sie die Angehörigen der indigenen Völker des Nordens nicht als ebenbürtig anerkannten) und die Schiffe sicher und eisfest sind, weiterhin wirksam.
Der Pol (1)
Allerdings verlieh ein Faktor der ganzen Angelegenheit im 19. Jahrhundert eine heute nicht wiederherstellbare Triebkraft: die unentdeckten Pole. Dabei ging es zunächst gar nicht um ein Wettrennen, sondern um die Frage, wie es an jenen Punkten, die noch nie jemand gesehen hatte, eigentlich aussah.
Bekanntermaßen motivierten im 19. Jahrhundert auch andere unentdeckte Stellen der Erde Forscher und Abenteurer (oft in Personalunion) zu riskanten Expeditionen, aber es ist etwas fundamental anderes, sich auf die Spuren der Nilquelle zu begeben (um ein prominentes Beispiel zu nennen), als an den Nordpol oder an den Südpol zu wollen. Erstens lagen bereits Beschreibungen ostafrikanischer Landschaften vor, man konnte sich also ungefähr vorstellen, was einen dort erwartete, und zweitens ahnte man wohl, dass ein solcher Fluss nicht aus einem einzigen faustgroßen Loch im Boden blubbert, sondern sich aus diversen Quellflüssen speist, sodass man das magische Bild von dem einen Ursprungsort durch Vorstellungen verschiedener Regionen im afrikanischen Hochland ersetzen musste.
Die Pole hingegen blieben unverrückbar ganz oben und ganz unten auf dem Globus, dort, wo die Erdachse endete. Sie verzweigten sich nicht und zerfaserten nicht. Jeder konnte mit dem Finger darauf deuten, das war leicht, aber keiner wusste, was er dabei berührte.
An Theorien herrschte freilich kein Mangel, und viele wichen wesentlich von dem ab, was wir heute wissen.
Isaac Newton hatte festgestellt, dass die Polregion leicht abgeplattet, die Erdkugel also leicht elliptisch war, und das konnte man seiner Meinung nach so interpretieren, dass die Pole dichter am heißen Erdkern lagen und somit womöglich eisfrei waren. Die Theorie der hohlen Erde, die von Newtons jüngerem Zeitgenossen Edmond Halley erstmals vorgebracht wurde, hielt es sogar für möglich, dass sich an den Polen Öffnungen befanden, durch die man in die hohle Erdkugel gelangen könne.
Die europäische Fantasie richtete sich bevorzugt auf den nördlichen der beiden Pole. Weniger gelehrte Personen rechneten im äußersten Norden mit prähistorischen Tierarten oder speziellen Wesen, manche vermuteten dort das glückliche Reich der Hyperboreer. Die Vorstellungen kannten kaum Grenzen und wiesen nicht unbedingt große Schnittmengen auf, wenn man bedenkt, dass nicht einmal Einigkeit darüber herrschte, ob es in der Region Leben gab oder nicht, ob sie kalt war oder warm, ein Kontinent oder ein Meer.
Der Nordpol war ein Rätsel, und Rätsel faszinieren. Zumal wenn sie von globaler Bedeutung sind und wenn zu ihrer globalen Dimension auch noch Einmaligkeit hinzukommt.
Es gab nur einen Nordpol. Man konnte ihn nur ein Mal entdecken. Und nur einer konnte der Erste sein. Der Erste und derjenige, der ganz allein das größte Rätsel der Menschheit löste.
Rätsel und Glaube
Man stelle sich einen Mann vor, der sich vorstellt, derjenige zu sein, der das größte Rätsel der Menschheit löst.
Einen wie George DeLong.
Sein »Verlangen, die Antwort zu finden, auf die die Welt wartete«, sei immer größer geworden, je mehr er über den Nordpol nachgedacht habe, schreibt seine Frau. »Die Arktis hatte ihn in ihren Bann gezogen, und seit dem Tag seiner Rückkehr nach New York war er von diesem Rätsel fasziniert.«5
DeLong hatte den 75. Breitengrad überschritten und dabei die Erfahrung gemacht, dass er in physischer und mentaler Hinsicht in der Lage war, die extremen Bedingungen des Nordens auszuhalten. Er glaubte, sich auf sich verlassen zu können.
Allerdings glaubte er auch an etwas anderes, das er weder mit eigenen Augen gesehen noch am eigenen Leib erlebt hatte, und damit sind wir bei den aus heutiger Sicht kurios anmutenden Theorien, die sich bis ins letzte Viertel des 19. Jahrhunderts hinein hielten. DeLong glaubte, dass es sich bei dem harten, von allen erdenklichen Eisformationen durchsetzten Nordmeer, dem er mit seiner Crew am 75. Breitengrad standgehalten hatte, nur um den Rand eines Eiskranzes handelte, der ein eisfreies Polarmeer einschloss.
Sein Glaube stützte sich auf eine Theorie, die auf einen Deutschen zurückging, nämlich auf den Geografen und Kartografen August Petermann, der seit 1855 in Gotha die Zeitschrift Petermanns Geographische Mitteilungen herausgab. Der Deutsche aus der Provinz (der allerdings auch schon in Edinburgh und London gelebt hatte) war berühmt, weil Geografie und Kartografie im 19. Jahrhundert, als man fieberhaft bestrebt war, die weißen Flecken auf den Landkarten zu füllen, einen Stellenwert hatten, den man sich heute nur noch schwer vorstellen kann. Petermann zeichnete gute Karten und formulierte kühne Thesen zu Themen, für die sich alle interessierten. Das machte ihn zum globalen Promi.
Was die Polarregion betraf, stellte er die Hypothese auf, dass sich der Golfstrom bis in den äußersten Norden fortsetze und sich dort mit dem Kuroshio, seinem Pendant von der Pazifikseite, vereinige. Die gebündelte Kraft von zwei warmen Meeresströmungen reichten laut Petermanns Theorie aus, um die Gegend rund um den Pol eisfrei zu halten.
Petermann ging von einem Packeisgürtel aus, der sich ungefähr um den 80. Breitengrad lege, aber eben nur einen Gürtel bilde, oberhalb dessen der Arktische Ozean bis zum Nordpol schiffbar sei.
Man hätte das durchaus für ein bisschen unlogisch halten können, denn wieso kann die warme Strömung, die bis zum Nordpol reicht, zehn Breitengrade vorher einen Eisgürtel zulassen?
Petermann erklärte es so, dass die Meeresströmung zwischen Spitzbergen und der russischen Doppelinsel Nowaja Semlja abtauche und sich kurz vorm Pol wieder in eine Oberflächenströmung verwandle.
Auch nach dieser Erklärung möchte man noch etwas den Kopf wiegen. Aber Petermann sammelte Indizien und erhielt für seine Theorie die Bestätigung von zwei amerikanischen Augenzeugen. Der Arzt und weit gereiste Forscher Elisha Kent Kane brachte von seiner Expedition, die vergeblich versucht hatte, den verschollenen John Franklin zu finden, den Bericht mit, auf 81° 22' N Wasser gesehen zu haben. Er meinte den Kennedy-Kanal, der tatsächlich schiffbar ist – im Sommer und für kurze Zeit. Sechs Jahre später stieß Isaac Israel Hayes, der bereits an Kanes Expedition teilgenommen hatte und 1860/61 selbst eine Expedition leitete, bis auf 81° 35' N vor und sah ebenfalls eisfreies Wasser. Leider auch nur den Kennedy-Kanal, was er aber nicht wusste. Vielleicht wollte er es auch nicht wissen oder herausfinden, erstens, weil er auf seiner Expedition ohnehin schon jede Menge Pech gehabt hatte (schlechtes Wetter, Epidemie unter den Schlittenhunden, Tod von Crewmitgliedern mit Polarerfahrung – alles, was die Arktis so an Unbill zu bieten hatte), und zweitens, weil er unbedingt den eisfreien Weg über den Arktischen Ozean zum Nordpol finden wollte. Es war eine Obsession, die er damals mit manch anderem teilte, etwa mit seinem deutschen Kollegen Carl Koldewey, der 1868 und 1869/70 mit zwei Nordpolarexpeditionen Petermanns These vom eisfreien Nordpolarmeer zu beweisen versuchte.
Ich frage mich, wie eine solche Obsession entstehen kann. Woher der Drang, mit dem Schiff souverän zum Pol zu segeln? Ist das eine männliche Eroberungsfantasie? Müsste man die Geschichte der Polarforschung psychoanalytisch deuten, um sie wirklich zu verstehen? Oder genügt es zu sagen, dass bei manchen die Kompassnadel ein bisschen heftiger ausschlägt als bei anderen?
Kommen wir zu George DeLong zurück. Bei diesem sprach ich vom arktischen Fieber, nicht von einer Obsession, und das hat damit zu tun, dass ich ihn nicht als einen sehe, der vom Eroberungswahn getrieben war. Was ihn antrieb, war, so glaube ich, die Faszination der arktischen Natur mit ihrer extremen Eigenheit und Rätselhaftigkeit. Ich halte ihn, ungeachtet des arktischen Fiebers, für einen vernünftigen Mann. Darum finde ich es umso fataler, dass er sich auf August Petermanns Theorie verließ, als er 1879 mit der USS Jeannette aufbrach, um einen Weg durch den Eiskranz ins eisfreie Nordpolmeer zu finden.
Soweit ich weiß, hatte DeLong so gut wie alles gelesen, was es zu seiner Zeit an Literatur über die Polarregion gab, und sämtliche zugänglichen Karten studiert. Dabei war er unweigerlich verschiedenen Thesen und Antithesen begegnet, gewiss auch einer Menge seriöser wissenschaftlicher Artikel. Trotzdem klammerte er sich an eine Theorie, die sich wie eine mythische Vorstellung ausnimmt.
Könnte vielleicht genau hier die Antwort auf die Frage liegen, woher die Obsession von der eisfreien Polarregion kam? Im Wunsch, einen attraktiven Mythos zu begründen?
Womöglich glaubten DeLong und all die anderen, die seine Überzeugung teilten, an die eisfreie Polarregion, weil es nun einmal schön ist, an etwas zu glauben, das einem gefällt. Man möchte ein Bild sehen, in das man sich hineinversetzen oder in das man – wie in DeLongs Fall – mit einem Dampfsegler, der über die hinreißend elegante Silhouette einer Bark verfügt, hineinfahren kann.
In der Vorstellung sah das richtig gut aus. Es endete aber böse. Man könnte meinen, das Schicksal habe DeLong dafür verspotten wollen, dass er seinen Traum auf die Überlegungen eines Deutschen aus dem Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha gründete, der noch nie einen Eisberg aus der Nähe gesehen hatte.
1873 hatte DeLong seiner Frau von der Südwestküste Grönlands geschrieben – »ich kann nur hoffen, dass mir das Schicksal es erspart, irgendwann in einer so gottverlassenen Gegend zu stranden«6 –, sechs Jahre später sollte ihm genau das passieren, wovor er sich damals gefürchtet hatte: Er sollte vom Eis eingeschlossen in der Arktis festsitzen. Einundzwanzig Monate lang.