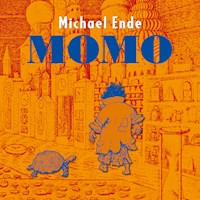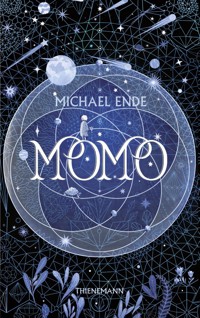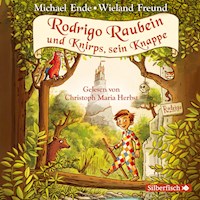9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Michael Ende, dem Großmeister phantastischer Literatur, gelingt es mit seinen Geschichten, junge und alte Leser aus allen Ländern in seinen Bann zu ziehen. Mit den acht Erzählungen dieses Bandes entführt der große Geschichtenerzähler den staunenden Leser in die Welt der Phantasie, in eine Welt voller Wunder und Zeichen. In dem Erzählband »Das Gefängnis der Freiheit« erzählt Michael Ende von dem Korridor eines imposanten römischen Palazzo, dessen Ende niemals erreicht werden kann, von einer herrschaftlichen Villa, die durch ihr weites, einladendes Portal niemals zu betreten ist – und die Geschichte von einem, der auszog, das Wundern zu lernen. Und auch wenn es die magischen Orte, an denen die phantastischen Geschichten spielen, in Wirklichkeit nicht gibt, erkennen wir sie wieder: Sie führen in die Innenwelt eines jeden von uns, der sich mit den hier versammelten Abenteuern auf eine phantasievolle Reise zu sich selbst begibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Ähnliche
Michael Ende
Das Gefängnis der Freiheit
Geschichten von Wundern und Zeichen
Einer langen Reise Ziel
Mit acht Jahren kannte Cyril alle Grandhotels des europäischen Kontinents und die meisten des Vorderen Orients, aber darüber hinaus kannte er so gut wie nichts von der Welt. Der goldbetresste Portier, der überall den gleichen imposanten Backenbart und die gleiche Schirmmütze trug, war sozusagen der Grenzwächter und Hüter der Schwelle seiner Kinderzeit.
Cyrils Vater, Lord Basil Abercomby, stand im diplomatischen Dienst Ihrer Majestät, der Königin Victoria. Das Ressort, in dem er wirkte, war schwer zu definieren, es bestand aus sogenannten besonderen Aufgaben. Jedenfalls brachte es mit sich, dass der Lord ständig von einer Großstadt in die andere unterwegs war, ohne sich je länger als ein oder zwei Monate an demselben Ort aufzuhalten. Um der notwendigen Mobilität willen begnügte er sich mit der geringstmöglichen Anzahl von Begleitpersonal. Das war an erster Stelle sein persönlicher Kammerdiener Henry, ferner Miss Twiggle, die Gouvernante, ein ältliches Mädchen mit Pferdezähnen, das die Aufgabe hatte, sich um Cyrils Wohl zu kümmern und ihm Manieren beizubringen, und schließlich Mr. Ashley, ein magerer junger Mann von farblosem Charakter, wenn man von seiner Neigung absah, sich in seinen Mußestunden einsam und in aller Stille zu betrinken. Er diente Lord Abercomby als Privatsekretär und versah zugleich das Amt des Tutors, also des Hauslehrers für Cyril. In der Anstellung dieser beiden erschöpfte sich Basils väterliche Fürsorge. Einmal in der Woche dinierte er allein mit seinem Sohn, doch da beide darauf bedacht waren, den anderen nicht näher an sich herankommen zu lassen, schleppte sich die Konversation eher mühsam dahin. Am Ende waren beide gleichermaßen erleichtert, wenn es wieder einmal überstanden war.
Cyril war kein Kind, das Sympathie erweckte, schon rein äußerlich nicht. Er war – was man sonst nur von älteren Menschen zu sagen pflegt – hager von Gestalt, von einem knochigen, sozusagen fleischlosen Körperbau, hatte strohige, farblose Haare, wässrige, ein wenig vorquellende Augen, dicke Lippen, die Unzufriedenheit ausdrückten, und ein ungewöhnlich langes Kinn. Am merkwürdigsten aber für einen Jungen seines Alters war der völlige Mangel an Bewegung in seinem Gesicht. Er trug es wie eine Maske. Die meisten Hotelangestellten hielten ihn für arrogant. Manche – vor allem die Zimmermädchen in mediterranen Ländern – fürchteten sich vor seinem Blick und vermieden es, ihm allein zu begegnen.
Das war natürlich übertrieben, doch gab es da etwas in Cyrils Charakter, was alle, die mit ihm zu tun hatten, gleichermaßen zu spüren bekamen und gleichermaßen in Schrecken versetzte, und das war seine exzessive Willenskraft. Glücklicherweise äußerte sie sich nur hin und wieder, denn für gewöhnlich verhielt er sich eher indolent, zeigte keinerlei bestimmtes Interesse und schien ohne jedes Temperament zu sein. So konnte er tagelang in der Empfangshalle des Hotels sitzen und die Ankommenden und Abreisenden beobachten, oder er las, was er eben zu lesen fand, sei es die Finanzzeitung oder der Ratgeber für Badekuren, und vergaß das Gelesene sofort wieder. Doch diese gleichgültige Haltung änderte sich schlagartig, wenn er einen bestimmten Entschluss gefasst hatte. Dann gab es nichts auf der Welt, was ihn davon hätte abbringen können. Die kühle Höflichkeit, mit der er seinen Willen bekundete, ließ keinen Widerspruch zu. Versuchte jemand, sich seinem Befehl zu widersetzen, so hob er nur ein wenig erstaunt die Augenbrauen, und nicht nur Miss Twiggle und Mr. Ashley, sondern sogar der würdige alte Kammerdiener Henry beugte sich unverzüglich seinem Wunsch. Wie der Knabe das anstellte, war keinem der Betroffenen klar, und er selbst hielt es für so selbstverständlich, dass er nicht darüber nachdachte.
Einmal zum Beispiel sah er in der Hotelküche, in der er sich zum schweigenden Verdruss der Köche bisweilen herumtrieb, eine lebende Languste und ordnete sofort an, dass sie in seine Badewanne zu bringen sei. Das geschah, obwohl das Krustentier für den Abend von einem Hotelgast bestellt worden war. Cyril beobachtete das seltsame Geschöpf eine halbe Stunde lang, doch da es nichts weiter tat, als ab und zu mit seinen langen Fühlern zu winken, verlor er das Interesse, ging fort und dachte nicht mehr daran. Erst am Abend, als er baden wollte, fiel es ihm wieder ein, er trug es auf den Korridor hinaus und ließ es dort frei. Das Tier schleppte sich unter einen Schrank und kam nicht wieder zum Vorschein. Erst nach Tagen alarmierte zunehmender Fäulnisgestank das Hotelpersonal, welches einige Mühe hatte, die Quelle des unliebsamen Geruches ausfindig zu machen. Ein andermal zwang Cyril den Empfangschef eines dänischen Hotels, mehrere Stunden lang mit ihm gemeinsam einen Schneemann zu bauen, der dann in der Eingangshalle aufgestellt werden musste, wo er langsam zerfloss. In Athen ließ er nach einem Klavierkonzert, das im Speisesaal stattgefunden hatte, sowohl den Konzertflügel als auch den Pianisten auf sein Zimmer schaffen, wo er von dem unglücklichen Künstler forderte, ihm unverzüglich beizubringen, wie man auf dem Instrument spielte. Als er einsehen musste, dass es dazu offensichtlich längerer Übung bedurfte, bekam er einen Wutanfall, unter dem vor allem der Flügel zu leiden hatte. Danach wurde er ernstlich krank und musste etliche Tage mit Fieber das Bett hüten. Wenn Lord Basil von solchen exzentrischen Unternehmungen seines Sohnes erfuhr, schien er eher amüsiert als entrüstet.
»Er ist eben ein Abercomby«, pflegte sein gleichmütiger Kommentar zu sein. Er wollte damit vermutlich sagen, dass es in der langen Reihe ihrer Vorfahren so ziemlich jede Sorte von Verrückten gegeben hatte und dass Cyrils Launen aus diesem Grunde nicht mit dem Maßstab gewöhnlicher Menschen zu messen seien.
Geboren war Cyril übrigens in Indien, doch erinnerte er sich kaum noch an den Namen der Stadt und überhaupt nicht mehr an das Land. Sein Vater war damals am dortigen Konsulat beschäftigt gewesen. Auch über seine Mutter, Lady Olivia, wusste er nur, was Lord Basil ihm ein einziges Mal auf seine Fragen hin in mehr als knappen Worten mitgeteilt hatte, nämlich dass sie schon wenige Monate nach seiner Geburt mit einem Stehgeiger durchgebrannt war. Ganz offensichtlich schätzte der Vater Gespräche über dieses Thema ganz und gar nicht, und so fragte der Sohn ihn nie wieder. Von Mr. Ashley erfuhr er allerdings später, dass es sich dabei keineswegs um einen Stehgeiger, sondern um den seinerzeit weltberühmten Violinvirtuosen Camillo Berenici gehandelt habe, den Abgott der europäischen Damenwelt. Doch habe sich diese romantische Beziehung schon ein knappes Jahr später wieder aufgelöst, wie das bei solchen Affären eben so zu gehen pflege. Mr. Ashley schien die Angelegenheit nicht ohne Vergnügen zu erzählen, vielleicht war er aber auch nur etwas angetrunken und deshalb redselig. Der gesellschaftliche Skandal, so fuhr er fort, sei selbstverständlich beträchtlich gewesen. Lady Olivia habe sich danach ganz und gar von der Welt zurückgezogen und lebe inzwischen mehr oder weniger vereinsamt auf einem ihrer Landgüter in South-Essex. Offiziell hatte sich Lord Basil übrigens nie von ihr scheiden lassen, doch hatte er alle Bilder und Daguerreotypien, die es von seiner Gattin gab, verbrannt, und ihr Name wurde – bis auf jenes eine Mal – nie wieder von ihm erwähnt. Cyril kannte mithin nicht einmal das Aussehen seiner Mutter.
Warum Abercomby seinen Sohn mit sich in der Welt herumschleppte, anstatt ihn in eines der für seine Klasse obligatorischen Erziehungsinstitute zu stecken, war niemandem so recht klar und gab zu allerlei Vermutungen Anlass. Väterliche Zuneigung konnte es wohl kaum sein, denn es war allgemein bekannt, dass er sich, von seinen diplomatischen Pflichten einmal abgesehen, einzig und allein für seine Sammlung von Waffen und Militaria interessierte, die er durch ständige Ankäufe in aller Welt ergänzte und nach Claystone Manor, dem Stammsitz der Familie schickte – sehr zum Leidwesen des alten Butlers Jonathan, der schon nicht mehr wusste, wohin damit. Tatsächlich bestand der Grund ganz einfach in der Sorge, Lady Olivia könnte versuchen, auf irgendeine Weise heimlich Kontakt mit ihrem Kind aufzunehmen, wenn er die Situation nicht ständig unter Kontrolle hätte. Für Abercomby galt es, diese Möglichkeit absolut auszuschließen, nicht etwa wegen des Jungen, sondern um seine Gattin für die angetane Schmach zu bestrafen. Aus dem nämlichen Grunde vermied er es übrigens auch in all den Jahren, nach England zurückzukehren – es sei denn rein dienstlich für wenige Tage, während welcher er seinen Sohn im Ausland in der Obhut des Personals zurückließ.
Bei einer solchen Gelegenheit geschah es, dass der Knabe seine beiden Erzieher einmal in einer äußerst peinlichen Situation überraschte. Es war spät in der Nacht, als er aus irgendeinem Grund erwachte und nach der Gouvernante rief, die im Nebenzimmer schlief. Da er keine Antwort bekam, stand er auf und sah nach. Miss Twiggles Bett war unberührt. Er machte sich auf die Suche nach ihr. Als er am Zimmer des Tutors vorüberkam, hörte er seltsame, unterdrückte Laute. Behutsam öffnete er die Tür. Was er sah, interessierte ihn, darum trat er unbemerkt ein, setzte sich auf einen Stuhl und beobachtete aufmerksam die Szene. Mr. Ashley und Miss Twiggle, beide nahezu unbekleidet, rollten mit ineinander verschlungenen Gliedern wie in einem Ringkampf auf dem Teppichboden umher, wobei er grunzende und sie quietschende Laute von sich gab. Auf dem Tisch stand eine leere Whiskyflasche und zwei halb volle Gläser. Nach einer Weile schienen die beiden zu erlahmen und hielten keuchend inne. Cyril hüstelte diskret. Das Paar fuhr erschrocken empor und starrte ihn mit erhitzten Gesichtern an. Er wusste nicht recht, wie er sich die Sache deuten sollte, doch las er in beider Blicken Scham und Schuldbewusstsein. Das genügte ihm. Er erhob sich und ging schweigend in sein Zimmer zurück. Keiner von ihnen erwähnte den Vorfall an den Tagen danach, und auch Cyril schwieg. In das bisher schon reichlich hilflose Verhalten der Gouvernante und des Tutors mischte sich von da an eine Art von Unterwürfigkeit, die Cyril durchaus genoss. Wenn er auch nicht genau wusste warum, so fühlte er doch ganz deutlich, dass er die zwei moralisch in der Tasche hatte. Um den Abstand zwischen sich und ihnen zu betonen, bestand er darauf, hinfort beim Diner einen Tisch für sich allein zu haben. Dass er dabei von allen anderen Hotelgästen heimlich oder ganz unverhohlen angestarrt wurde wie ein sonderbares Tier im Zoo, störte ihn nicht im Geringsten. Danach setzte er sich meist noch allein für ein oder zwei Stunden in die Lounge. Wenn Miss Twiggle ihn schüchtern bat, doch ins Bett zu gehen, verbot er ihr kurzerhand den Mund und schickte sie fort. Er saß auf seinem Platz wie jemand, der nur die Zeit herumbringt, bis es endlich so weit ist. Und in der Tat wartete Cyril. Im Grunde wartete er, seit er auf der Welt war, nur wusste er nicht worauf.
Das änderte sich, als er eines Abends im Hotel »Inghilterra« in Rom durch die teppichbelegten Korridore wanderte und aus einer Fensternische, die durch großblättrige Zimmerpalmen verdeckt war, unterdrücktes, aber herzzerbrechendes Schluchzen hörte. Er näherte sich leisen Schrittes und entdeckte ein kleines Mädchen, etwa in seinem Alter, das mit hochgezogenen Beinen in einem der großen Lederfauteuils kauerte, ihr Gesicht in die Seitenlehnen drückte und in Tränen zerfloss. Das Schauspiel eines solch hemmungslosen Gefühlsausbruchs war für ihn neu und erstaunlich. Er betrachtete es eine Weile schweigend, ehe er schließlich fragte: »Kann ich etwas für Sie tun, Miss?«
Sie wandte ihm ihr verheultes Gesicht zu, schaute ihn bitterböse an und fauchte: »Glotz nicht so blöd mit deinen Fischaugen! Lass mich in Ruhe!«
Sie hatte Englisch gesprochen, aber auf eine breite, eigentümlich platt gedrückte Art, die er noch nicht kannte.
»Tut mir leid, Miss«, antwortete er mit einer kleinen Verbeugung. »Ich wollte nicht stören.«
Sie schien darauf zu warten, dass er wegging, aber das tat er nicht.
»Hau endlich ab«, schniefte sie. »Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten.« Trotz der Grobheit ihrer Worte klang es schon weniger unfreundlich.
»Gewiss«, sagte er, »ich verstehe vollkommen, Miss. Erlauben Sie, dass ich mich einen Augenblick setze?«
Sie warf ihm einen zweifelnden Blick zu, weil sie sich nicht klar darüber war, ob er sich über sie lustig machte oder nicht. Dann zuckte sie die Achseln. »Tu doch, was du willst. Die Sessel gehören mir ja nicht.«
Er setzte sich ihr gegenüber und sah zu, wie sie sich die Nase putzte.
»Hat Ihnen jemand ein Leid zugefügt, Miss?«, erkundigte er sich schließlich.
Das Mädchen schnaubte. »Ja, Tante Ann. Sie hat mich überredet, auf diesen scheußlichen Europatrip mitzukommen. Und jetzt sind wir schon fast vier Monate von zu Hause weg, vier Monate, verstehst du, weil sie alles im Voraus bezahlt hat, und es war eine Menge Geld, sagt sie, und das will sie nicht zum Fenster rausschmeißen, bloß meinetwegen.«
Cyril überlegte eine Weile, dann meinte er: »Offen gestanden, Miss, ich sehe nicht, was daran so überaus schmerzlich sein könnte.«
»Hach«, machte sie ungeduldig, »ich hab eben einfach Heimweh, ganz schlimmes Heimweh.«
»Sie haben – was?«, fragte er verständnislos.
Das Mädchen plapperte weiter, als ob es Cyrils Frage nicht gehört hätte. »Wenn sie mich wenigstens allein zurückfahren ließe! Ich verlange ja gar nicht, dass sie mitkommt. Ich würde einfach das nächste Schiff nehmen und nach Hause fahren. Es ist mir ganz gleich, wie lange es dauert, es wäre jedenfalls die richtige Richtung. Ich würde mich sofort besser fühlen, jeden Tag ein bisschen mehr. Dad und Mum könnten mich ja vielleicht in New York abholen, weil ich mich mit der Eisenbahn nicht so gut auskenne.«
»Sind Sie denn krank, Miss?«, erkundigte sich Cyril.
»Ja … nein … ach, was weiß ich?« Sie sah ihn ärgerlich an. »Jedenfalls ist eines sicher. Wenn ich nicht sofort heimfahren kann, dann sterbe ich.«
»Tatsächlich?«, fragte er interessiert. »Und wieso?«
Und nun erzählte sie von einem kleinen Ort irgendwo im mittleren Westen der Vereinigten Staaten, wo ihr Vater und ihre Mutter lebten, zusammen mit ihren beiden kleineren Geschwistern Tom und Aby, und Sarah, die alte, dicke Schwarze, die so viele Lieder und Geistergeschichten kannte, und ihr kleiner Hund Fips, der Ratten fangen konnte und es einmal sogar mit einem Dachs aufgenommen hatte, und von dem großen Wald hinter dem Haus, wo es irgendwelche besonderen Beeren gab, und von einem gewissen Mr. Cunnigle, der im nächsten Ort einen Laden hatte, in dem man einfach alles kaufen konnte und in dem es so und so roch, und von tausend anderen völlig belanglosen Dingen. Sie redete sich in Begeisterung, es schien ihr richtig gutzutun, jede Einzelheit zu erwähnen, auch wenn diese noch so unwichtig war.
Cyril hörte zu und versuchte dahinterzukommen, was zum Teufel an alldem so Besonderes war, dass irgendjemand auf der Welt es nicht einmal für ein paar Monate vermissen mochte. Das Mädchen dagegen schien sich verstanden zu fühlen, denn zuletzt bedankte es sich bei ihm für sein Interesse und lud ihn ein vorbeizukommen, wenn er sich je in dieser Gegend befände. Dann ging die Kleine offensichtlich getröstet und erleichtert fort. Er hatte nicht einmal ihren Namen erfahren.
Am nächsten Tag war sie mit ihrer Tante wahrscheinlich schon weitergereist, er konnte sie nirgends entdecken und mochte nicht nach ihr fragen. Im Grunde war sie ihm auch völlig gleichgültig. Was ihn beschäftigte, war vielmehr der sonderbare Zustand des Mädchens, das, was sie Heimweh genannt hatte und worunter er sich ganz und gar nichts vorstellen konnte. Zum ersten Mal wurde ihm dunkel bewusst, dass er nie so etwas wie ein Zuhause besessen hatte, überhaupt nichts, wonach er sich hätte sehnen und verzehren können. Irgendetwas fehlte ihm da, das war offensichtlich, aber er konnte sich nicht klar darüber werden, ob das ein Vorzug oder ein Mangel war. Er beschloss, der Sache nachzugehen.
Mr. Ashley und Miss Twiggle und erst recht seinem Vater gegenüber erwähnte er nichts davon, aber mit fremden Leuten versuchte er von nun an häufig ins Gespräch zu kommen. Früher oder später brachte er die Konversation dahin, dass sie anfingen, über ihr Zuhause zu sprechen. Es war ihm gleich, ob es sich dabei um Kinder oder um alte Damen und Herren handelte, um das Zimmermädchen, den Pagen oder den Direktor des Hotels, denn er stellte schon bald fest, dass sie alle ohne Ausnahme gern darüber zu sprechen schienen, dass häufig ein Lächeln ihre Gesichter verklärte. Manche bekamen glänzende Augen und wurden redselig, andere befiel Melancholie, aber jedem schien die Sache eine Menge zu bedeuten. Obwohl die jeweiligen Einzelheiten bei allen verschieden waren, glichen die Berichte einander doch auch wieder in bestimmter Hinsicht. Nie war etwas Einmaliges, Besonderes daran, etwas, das einen solchen Aufwand von Gefühl gerechtfertigt hätte. Und noch etwas fiel ihm auf: Dieses Zuhause musste keineswegs der Ort sein, wo jemand geboren war. Ebenso wenig war es aber identisch mit dem gegenwärtigen Wohnort. Wodurch bestimmte es sich also, und wer bestimmte es? Tat das jeder nach eigenem Gutdünken? Warum hatte er dann nichts dergleichen? Offenbar besaßen alle Menschen außer ihm so etwas wie ein Heiligtum, eine Kostbarkeit, deren Wert zwar in nichts Handgreiflichem lag, in nichts, worauf man hinzeigen konnte, was aber dennoch Wirklichkeit war. Der Gedanke, dass gerade er von einem solchen Besitz ausgeschlossen sein sollte, schien ihm ganz unerträglich. Er war willens, ihn sich um jeden Preis zu verschaffen. Irgendwo auf der Welt musste es schließlich auch für ihn so etwas geben.
Cyril erwirkte von seinem Vater die Erlaubnis, längere Streifzüge außerhalb des jeweiligen Hotels unternehmen zu dürfen. Die Erlaubnis wurde ihm erteilt, allerdings unter der strikten Bedingung, solche Exkurse ausschließlich in Begleitung von Mr. Ashley oder Miss Twiggle oder beiden gemeinsam zu unternehmen.
Anfangs kam es ein paar Mal zu solchen Unternehmungen zu dritt, doch wurde Cyril sie sehr bald leid, denn die beiden Erzieher waren hauptsächlich mit sich beschäftigt. Miss Twiggle schien aus irgendeinem unerfindlichen Grund schrecklich unter Mr. Ashley zu leiden. Jedes ihrer Worte enthielt einen Vorwurf gegen ihn. Mr. Ashley dagegen antwortete mit Kälte und Spott. Cyril machte sich aus keinem der beiden viel, aber wenn er schon wählen musste – und das schien unvermeidlich – dann zog er Mr. Ashley für seine bestimmten Zwecke vor. Zur Überraschung und ein wenig auch zum Verdruss des Tutors, der sich inzwischen daran gewöhnt hatte, außerhalb der Dienst- und Unterrichtsstunden seinen eigenen, nicht immer ganz sittenstrengen Vergnügungen nachzugehen, schien Cyril entschlossen, ihn von nun an überallhin zu begleiten. Mr. Ashley, der ja die wahren Motive seines Schülers nicht kannte, seufzte zwar insgeheim, war aber andererseits sogar ein wenig stolz, weil er das plötzlich erwachte Interesse des Knaben für Land und Leute als das Ergebnis seiner langjährigen erzieherischen Bemühungen betrachtete.
Anfangs beschränkte er sich darauf, ihm die Prachtstraßen und Plätze, die Paläste, Kirchen, Tempelruinen und andere Sehenswürdigkeiten zu zeigen, die zu jener Zeit zum Bildungsstandard jedes reisenden Engländers gehörten. Cyril betrachtete alles mit einer gewissen prüfenden Aufmerksamkeit, doch schien ihn, was er sah, indifferent zu lassen. Um der unausgesprochenen Erwartung des Knaben gerecht zu werden, ging Mr. Ashley weiter und durchstreifte mit ihm weniger bekannte Gegenden, Slums und Elendsviertel, Hafengegenden und Spelunken, aber auch außerhalb der Städte Berge und Buchten, Wüsten und Wälder. Während dieser gemeinsamen Unternehmungen bildete sich zwischen den beiden so etwas wie ein kameradschaftliches Verhältnis heraus, das Mr. Ashley schließlich veranlasste, seinen Schüler nicht nur zu Hahnenkämpfen und Hunderennen, sondern auch zu Tingeltangel-Veranstaltungen und noch zweifelhafteren Belustigungen mitzuschleppen. Als er schließlich sicher war, dass er auf Cyrils Diskretion zählen konnte, und weil er ihn absolut nicht loszuwerden vermochte, landeten sie sogar hin und wieder gemeinsam in Häusern besonderer Art, wo der Junge im Salon auf seinen Lehrer warten musste, bis dieser von seiner dringenden Besprechung unter vier Augen mit einer der angestellten Damen zurückkehrte.
Cyril nahm alles mit dem gleichen unbeweglichen Gesicht zur Kenntnis, denn ein Zuhause, das hatte er aus seinen zahllosen Unterhaltungen gelernt, konnte schließlich überall sein. Doch vergebens wartete er darauf, dass ihm bei irgendeiner Gelegenheit froh oder traurig zumute wurde. Nichts von allem, was er sah, bedeutete ihm etwas. Aber das behielt er natürlich für sich.
Diese fragwürdigen Studienausflüge konnten freilich dem Vater auf die Dauer nicht verborgen bleiben. Zwar hatte sich das Gerücht davon längst in der ganzen viktorianischen Gesellschaft verbreitet und gehörige Entrüstung ausgelöst, nur Lord Abercomby war, wie es oft so geht, ahnungslos. Eines späten Abends jedoch – es war wenige Tage nach Cyrils zwölftem Geburtstag – begegneten sich Vater und Sohn in einem Etablissement der Madrider Lebewelt, welches zu dieser Zeit gerade in Mode war. Der Junge saß im Empfangsraum auf einem orientalischen Diwan unter Draperien und Pfauenfedern, um ihn herum rekelten sich vier junge Damen im Negligé, die angeregt mit ihm schwatzten und – wie konnte es anders sein? – von ihren jeweiligen Zuhause erzählten. Lord Abercomby schritt wortlos an seinem Sohn vorüber, als kenne er ihn nicht, und verließ die Stätte des Lasters. Am nächsten Tag aber erfuhr Cyril beim Fünfuhrtee, dass der Tutor fristlos entlassen worden war. Sonst wurde zwischen Vater und Sohn über den Vorfall kein weiteres Wort gewechselt, denn es war eine sittenstrenge Epoche. Zwei Tage später kündigte Miss Twiggle dem Lord mit gefasstem Gesicht, aber rot geweinter Nase. Als sie mit Cyril allein war, gestand sie ihm: »Du kannst das alles wahrscheinlich noch nicht verstehen, mein Lieber. Aber Max – ich meine Mr. Ashley – ist die erste und einzige Liebe meines Lebens. Ich werde ihm folgen, wohin auch immer er geht, und sei es in Not und Tod. Denke an mich – später, wenn du selbst einmal lieben wirst.« Dann versuchte sie ihn zum Abschied zu küssen, was Cyril mit Erfolg verhinderte.
Die Suche nach einem neuen Hauslehrer und einer neuen Gouvernante erwies sich alsbald als überflüssig, denn schon drei Wochen später erreichte den Lord die telegrafische Nachricht, dass Lady Olivia an einer langwierigen Krankheit, die sie sich wahrscheinlich aus Indien mitgebracht hatte, verstorben sei. Vater und Sohn reisten unverzüglich nach South-Essex und nahmen an der feierlichen Beerdigung teil, die, wie nicht anders zu erwarten, bei strömendem Regen stattfand. Es war dies das erste Mal, dass Cyril den Boden Englands betrat. Wenn er möglicherweise erwartet hatte, dass ihn hier irgendwelche, wenn auch noch so leisen heimatlichen Gefühle überkommen würden, so hatte er sich getäuscht. Auch der Stammsitz der Abercombys, Claystone Manor, wohin der Vater anschließend mit ihm reiste, war eher eine Enttäuschung für ihn. Dieser riesige, dunkle, mit Waffen vollgestopfte Kasten, der im Vergleich zu den internationalen Hotels so gut wie keinen Komfort aufwies und in dem man ständig fror, war und blieb ihm vollkommen fremd.
Dass die Mutter ihren Sohn, den sie außer in den wenigen Monaten nach seiner Geburt nie zu Gesicht bekommen hatte, zum Alleinerben all ihrer Besitztümer eingesetzt hatte, verschwieg Lord Abercomby seinem Sprössling. Er hatte vor, ihn darüber erst am Tage seiner Mündigkeit zu unterrichten, um mögliche kindliche Dankgefühle gar nicht erst aufkommen zu lassen. Auch das gehörte noch zu der – inzwischen allerdings posthumen – Bestrafung seiner ungetreuen Gattin.
Da sich ja nun die Notwendigkeit erübrigt hatte, den Jungen weiterhin mit sich in der Welt herumzuschleppen, steckte er ihn unverzüglich in eines jener berühmten Lehrinstitute der Oberklasse, das College in E., wo englische Knaben zu englischen Männern erzogen werden. Cyril fügte sich den pädagogischen Unbilden mit einer gewissen verächtlichen Indolenz, er ließ seine Klassenkameraden, vor allem aber seine Lehrer deutlich fühlen, dass er sie allesamt nicht recht ernst nahm. Da er aber ein hervorragender Schüler war – er sprach zu diesem Zeitpunkt bereits acht Sprachen nahezu fehlerfrei – galt er als Leuchte des Colleges, obwohl keiner ihn besonders leiden mochte. Nach Abschluss der Schule wechselte er standesgemäß nach O. und begann an der dortigen Hochschule Philosophie und Geschichte zu studieren.
Nach wenigen Semestern – und merkwürdigerweise war es wiederum kurz nach seinem Geburtstag, diesmal nach dem einundzwanzigsten – erhielt er überraschend Besuch von Mr. Thorne, dem Rechtsanwalt der Familie. Der alte Herr nahm schnaufend auf einem Stuhl Platz und begann mit umständlichen Worten den jungen Mann auf ein – wie er sagte – »tragisches Ereignis« vorzubereiten. Lord Basil Abercomby war während einer Fuchsjagd in der Nähe von Fontainebleau so unglücklich vom Pferd gestürzt, dass er sich dabei das Genick gebrochen hatte. Cyril nahm die Nachricht unbewegten Gesichts entgegen.
»Sie sind nun also«, sagte Mr. Thorne, wobei er sich mit einem Schnupftuch Stirn und Doppelkinn trocknete, »nicht nur Erbe des Titels Ihres verehrten Herrn Vaters, sondern auch der alleinige Erbe sowohl des väterlichen wie auch des mütterlichen Vermögens, der Besitztümer an beweglichen und unbeweglichen Gütern aus beiden Hinterlassenschaften, da Sie, mein verehrter junger Freund, der einzige Nachkomme beider Familien sind. Ich habe mir erlaubt, Ihnen alle Unterlagen, Dokumente, Aufstellungen und Bilanzen mitzubringen, damit Sie sich, falls Sie dies wünschen, unverzüglich Einblick in alles verschaffen können.«
Er zog eine schwere Aktentasche heran und wuchtete sie auf seine Knie.
»Danke«, sagte Cyril, »bemühen Sie sich nicht.«
»Oh, ich verstehe«, meinte Mr. Thorne, »wir werden das zu einem späteren Zeitpunkt erledigen. Verzeihen Sie mir, ich wollte nicht pietätlos sein. Haben Sie besondere Wünsche im Hinblick auf die Beerdigungsfeierlichkeiten?«
»Nicht dass ich wüsste«, versetzte Cyril. »Ich überlasse das Ihnen. Sie werden schon das Nötige veranlassen.«
»Gewiss, Mylord. Wann gedenken Sie abzureisen?«
»Wohin?«
»Nun, zur Beerdigung Ihres Vaters, nehme ich an.«
»Mein lieber Mr. Thorne«, sagte Cyril, »ich sehe bei Gott nicht ein, wozu ich mir dergleichen antun sollte. Ich verabscheue solche Veranstaltungen. Machen Sie mit der Leiche, was Sie für richtig halten.«
Der Rechtsanwalt hustete, sein Gesicht lief rot an. »Nun, gewiss –«, sagte er und rang sichtlich nach Fassung, »es ist ja ein offenes Geheimnis, dass zwischen Ihnen und Ihrem Herrn Vater kein, wie soll ich sagen, ideales Einvernehmen bestand, aber trotzdem, ich meine, jetzt, da er entschlafen ist – verzeihen Sie, wenn ich mir erlaube, Sie daran zu erinnern, dass es so etwas wie Sohnespflichten gibt.«
»So?«, fragte Cyril und hob ein wenig die Augenbrauen.
Mr. Thorne öffnete unschlüssig die Aktentasche und schloss sie wieder. »Bitte missverstehen Sie mich nicht. Mylord, das ist selbstverständlich ganz und gar Ihre persönliche Entscheidung. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Öffentlichkeit alle Einzelheiten eines solchen Ereignisses beobachten wird.«
»Oh, wird sie das?«, entgegnete Cyril gelangweilt.
»Nun ja, also gut«, sagte Mr. Thorne, »und was die Erbschaftsangelegenheiten betrifft, so schlage ich vor …«
»Verkaufen Sie alles«, schnitt ihm Cyril das Wort ab.
Der Rechtsanwalt erstarrte und sah ihn mit offenem Mund an.
»Ja«, fuhr Cyril fort. »Sie haben richtig verstanden, mein Bester. Ich will nichts davon behalten. Also machen Sie alles zu Geld, was nicht schon Geld ist. Sie wissen sicher am besten, wie so etwas zu bewerkstelligen ist.«
»Sie meinen«, stieß Mr. Thorne heraus, »die Landgüter, die Waldungen, die Schlösser, die Kunstschätze, die Sammlung Ihres Herrn Vaters …?«
Cyril nickte kurz. »Weg damit. Verkaufen.«
Der alte Mann schnappte nach Luft wie ein Fisch auf dem Trockenen. Sein Gesicht wurde violett.
»Wir wollen das gründlich bedenken, Mylord. Wir sind jetzt vielleicht in einer gewissen gefühlsbetonten Verfassung, die … Also um es ganz deutlich zu sagen, Mylord: Das können Sie nicht machen. Das geht nicht, auf gar keinen Fall. Ich bin nun seit fünfundvierzig Jahren der Vertrauensanwalt Ihrer Familie, und ich muss Ihnen sagen, das wäre … das wäre … gegen jede … Bedenken Sie bitte, es handelt sich schließlich um einen Besitz, den Ihre Vorfahren im Laufe von Jahrhunderten … Nein, hören Sie, Cyril, wenn ich Sie noch einmal so nennen darf, Sie sind moralisch verpflichtet, all das Ihren eigenen Nachkommen …«
Der junge Lord drehte ihm abrupt den Rücken zu und blickte zum Fenster hinaus. Kühl, aber mit deutlicher Ungeduld in der Stimme erwiderte er: »Ich werde keine Nachkommen haben.«
Der Rechtsanwalt hob abwehrend die dicken Hände. »Lieber Junge, das weiß man in Ihrem Alter nicht so sicher. Es könnte doch sein …«
»Nein«, unterbrach ihn Cyril scharf, »es könnte nicht sein. Und nennen Sie mich nicht lieber Junge.«
Er wandte sich ihm wieder zu und schaute ihn kalt an. »Wenn Sie unüberwindlich starke Bedenken haben, Mr. Thorne, dann wird sich unschwer jemand anders für diese Aufgabe finden. Guten Tag.«
Mr. Thorne, aufs Äußerste erbost über die unverschämte Behandlung, die ihm ganz unverdientermaßen widerfahren war, fasste zunächst den Entschluss, diesen, wie er es nannte, »unmoralischen und gewissenlosen Auftrag« nicht anzunehmen. Doch schon während der Rückreise nach London wich seine Erregung nach und nach klaren und vernünftigen Überlegungen. Und nachdem er sich während der folgenden zwei Tage ausführlich mit seinen beiden Kompagnons, Saymor & Puddleby, beraten hatte, kam er zu der Einsicht, dass die Gewinnspanne, die allein durch die Provisionen bei Verkäufen dieser Größenordnung ganz legal zu erwarten war, alle Schäden am bisher untadeligen Ruf ihrer Kanzlei durch Mitverantwortung an dem zu erwartenden Skandal bei Weitem übertraf.
In einem klauselreichen Schriftsatz an den jungen Lord erklärten Mr. Thorne & Co. alsbald ihre Bereitschaft, die Abwicklung der Geschäfte zu übernehmen, und erhielten diesen postwendend von Cyril Abercomby unterzeichnet zurück. Die Sache nahm ihren Lauf.
Als die Öffentlichkeit davon erfuhr – was ja nun wirklich nicht zu umgehen war – brach ein Sturm der Entrüstung los. Nicht nur der Hochadel und die gesamte Oberschicht des Königreiches brachten einhellig größten Abscheu vor einem so unerhörten Mangel an Traditionssinn und Standesbewusstsein zum Ausdruck, die Angelegenheit beschäftigte auch das Parlament für etliche Tage, ja, sogar in den Pubs der unteren Schichten gab es verschiedentlich erhitzte Diskussionen über die Frage, ob ein solcher Mensch überhaupt noch das Recht habe, sich Untertan Ihrer Majestät zu nennen. Juristisch bestand jedoch keinerlei Handhabe gegen diesen »Ausverkauf englischer Kultur und Würde«, wie es mehrere Zeitungen nannten, dafür hatte Mr. Thorne & Co. in weiser Voraussicht bei der Formulierung aller Konditionen gesorgt.
Cyril selbst war die ganze Aufregung, die er da verursachte, völlig gleichgültig. Er hatte sein eben erst begonnenes Studium unverzüglich abgebrochen und war längst außer Landes gegangen. In den folgenden Jahren reiste er ohne bestimmtes Ziel, nur von Launen und Zufällen geleitet, durch die Städte und Länder der Welt, aber jetzt nicht mehr nur, wie zu seines Vaters Lebzeiten, durch Europa und den Vorderen Orient, sondern nun auch durch Afrika, Indien, Südamerika und den Fernen Osten. Und er langweilte sich fast zu Tode dabei, denn weder Landschaften noch Bauwerke, weder Ozeane noch die Sitten und Gebräuche fremder Völker riefen in ihm mehr wach als ein oberflächliches Interesse, für welches es sich kaum lohnte, die Bequemlichkeiten des jeweiligen Grandhotels auch nur vorübergehend zu verlassen. Da er das Geheimnis seiner eigenen Zugehörigkeit zu irgendetwas auf dieser Welt nirgends finden konnte, waren auch alle anderen Wunder für ihn stumm und bedeutungslos.
Sein einziger Begleiter auf diesen Irrfahrten war ein Diener namens Wang, den er in Hongkong dem Chef des Opium-Syndikats abgekauft hatte. Wang besaß die ans Übernatürliche grenzende Fähigkeit, nicht zu existieren, wenn er nicht gebraucht wurde, aber stets zur Stelle zu sein, wenn sein Herr seine Dienste benötigte. Auch schien er dessen Wünsche schon jeweils im Voraus zu wissen, sodass sie kaum ein Wort miteinander zu wechseln brauchten.
Die englische Aristokratie war zunächst stillschweigend übereingekommen, den Verkauf des Abercomby’schen Erbes zu boykottieren, aber bald wurde sie eines Besseren – oder wenn man so will – Schlechteren belehrt. Ausländische Interessenten in nicht geringer Zahl meldeten sich und trieben durch ihre Angebote die Preise in die Höhe. Und als schließlich ein amerikanischer Kautschuk-Milliardär namens Jason Popey, ohne lange zu fackeln, Claystone Manor mit allem, was darin und darum war, kaufte – sogar den alten Butler Jonathan übernahm er –, war das wie ein Schock für den nationalen Stolz. Um zu retten, was noch zu retten war, begann ein wahrer Run seitens der reichen und mächtigen Familien des Empires auf alles, was noch zu haben war. Zu Ehren von Mr. Thorne & Co. muss gesagt werden, dass sie solche Käufer bevorzugt behandelten, selbst wenn man im Preis bisweilen etwas nachgeben musste. Jedenfalls gehörte der junge Lord Abercomby schon drei Jahre nach dem Tode des alten zu den hundert reichsten Männern dieser Erde – zumindest, was seine Bankguthaben betraf.
Der Sturm legte sich nach und nach wieder, und die Gesellschaft ging zu anderen Gesprächsthemen über. Die einzige Frage, die noch hin und wieder einige Gemüter bewegte – vor allem die von Müttern heiratsfähiger Töchter –, war, was Cyril Abercomby wohl mit dieser Unmasse Geld anzufangen gedachte. Soweit bekannt frönte er weder dem Spiel noch beteiligte er sich an Wetten irgendwelcher Art. Er hatte auch keine anderen kostspieligen Leidenschaften wie etwa das Sammeln von Ming-Vasen oder indischen Juwelen. Er kleidete sich tadellos, aber ohne Aufwand. Er wohnte standesgemäß, aber immer nur in Hotels. Er unterhielt keine teuren Geliebten oder gab sich anderen, noch diskreteren Lastern hin. Was hatte er mit dem Geld vor? Niemand wusste es, am allerwenigsten er selbst.
Während des folgenden Jahrzehnts setzte Cyril sein unstetes Reiseleben fort. Er hatte sich inzwischen so sehr an das gewöhnt, was er seine »Quest« nannte, dass es ihm zur selbstverständlichen Daseinsweise geworden war. Die naive Hoffnung seiner Jugendjahre, irgendwann oder irgendwo tatsächlich zu finden, was er suchte, war ihm natürlich längst abhandengekommen. Im Gegenteil, inzwischen wollte er es nicht mehr, es wäre ihm höchst peinlich gewesen. Er hatte seine Situation auf folgende Formel gebracht: Die Länge des Weges steht in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Möglichkeit, das Erreichen des Zieles zu wünschen. Eben darin lag nach seiner Ansicht die Ironie allen menschlichen Strebens; der eigentliche Sinn aller Erwartung lag gerade darin, dass sie für immer unerfüllt blieb, denn alle Erfüllung musste letzten Endes doch nur auf eine Enttäuschung hinauslaufen. Ja, Gott selbst tat gut daran, all jene Verheißungen, die er dem Menschengeschlecht vorzeiten gemacht hatte, niemals einzulösen. Angenommen, er käme eines unseligen Tages auf die Idee, Ernst damit zu machen – der Messias käme tatsächlich in den Wolken wieder, das Jüngste Gericht fände tatsächlich statt, das Himmlische Jerusalem schwebe tatsächlich von oben herab – es könnte gar nichts anderes dabei herauskommen als eine kosmische Blamage. Zu lange hatte er seine Gläubigen darauf warten lassen, als dass jetzt noch irgendein Ereignis, und sei es noch so bombastisch, eine andere Reaktion bei ihnen auslösen konnte als ein allgemeines »Ach so, das war alles?«. Andererseits war es zweifellos weise von Gott (immer vorausgesetzt, dass er überhaupt existierte), niemals eines seiner Versprechen zu widerrufen. Denn die Erwartung, und sie allein, hielt die Welt in Gang.