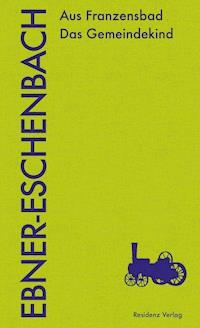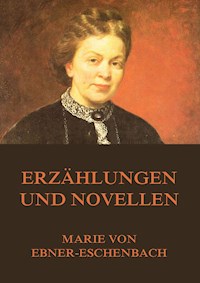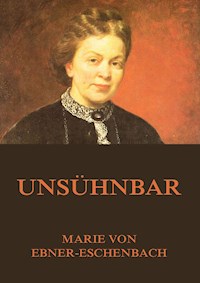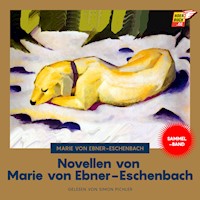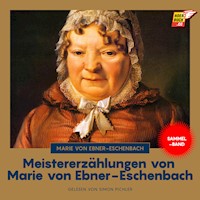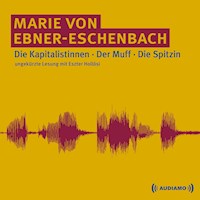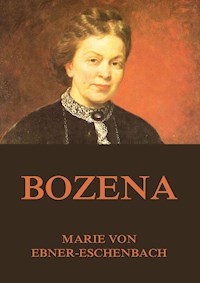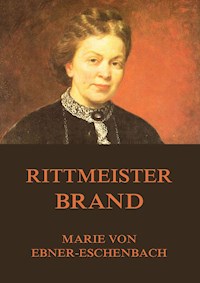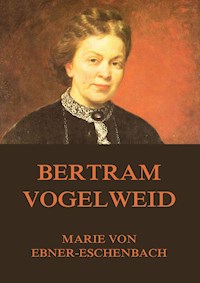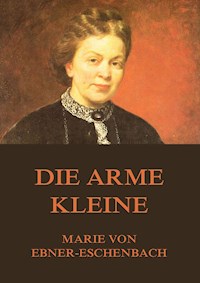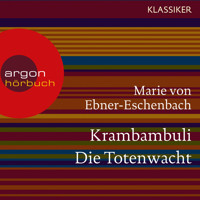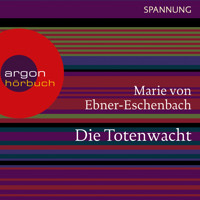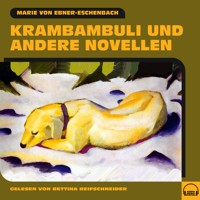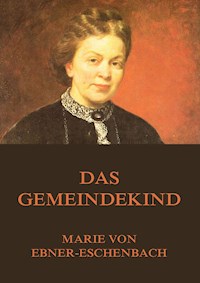
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Der 1887 veröffentlichte Roman Das Gemeindekind gilt als das Hauptwerk der österreichischen Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916). Die adelige Autorin erlangte Bekanntheit durch ihre psychologischen Erzählungen mit gesellschaftskritischem Inhalt, verbunden mit der Forderung nach Emanzipation. Der Titel Das Gemeindekind steht für den energischen Protagonisten Pavel Holub, der der Gemeinde zur Last fällt, weil sein Vater erhängt und seine Mutter mit Kerker bestraft wird. Thema der Geschichte ist der Einfluss der Erziehung und des Milieus, aber auch des Willens eines Individuums auf seine Entwicklung: Trotz wiederholten Rückschlägen gelingt Pavel der Aufstieg von einem abgeschobenen Gemeindekind zu einem respektierten Gemeindemitglied. (aus wikipedia.de)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Gemeindekind
Marie von Ebner-Eschenbach
Inhalt:
Marie von Ebner-Eschenbach – Biografie und Bibliografie
Das Gemeindekind
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Das Gemeindekind, M. von Ebner-Eschenbach
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849611194
www.jazzybee-verlag.de
Marie von Ebner-Eschenbach – Biografie und Bibliografie
Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach, geborene Gräfin Dubsky, Dichterin und Novellistin, geb. 13. Sept. 1830 auf Schloß Zdislavic in Mähren, genoß ihre Erziehung teils in Wien, teils in Zdislavic und heiratete 1848 den Freiherrn Moritz v. C., damals Hauptmann im Geniekorps und Lehrer an der Kriegsschule zu Klosterbruck, später Feldmarschalleutnant. In der kinderlosen Ehe widmete sich Marie v. E. mit großem Eifer umfassenden literarischen und wissenschaftlichen Studien, und ihr frühzeitig sich offenbarendes Talent fand Ermunterung durch Grillparzer und Förderung durch Fr. Halm. Seit Mitte der 1860er Jahre wohnte sie ständig in Wien, 1900 erfuhr sie zu ihrem 70. Geburtstag zahlreiche Ehrungen. Der dichterische Ehrgeiz Marie v. Ebner-Eschenbachs galt anfänglich der Bühne; ihr Schauspiel »Maria Stuart in Schottland« wurde 1860 in Karlsruhe ausgeführt, während das Trauerspiel »Marie Roland« (1867), wie das vorige nur als Manuskript gedruckt, nicht auf die Bühne gelangte. Im Wiener Burgtheater wurden zwei Einakter von ihr: »Doktor Ritter« (Wien 1871) und »Die Veilchen« (das. 1878) gespielt; im Wiener Stadttheater ihr Schauspiel aus der modernen Wiener Gesellschaft. »Das Waldfräulein« (1873) und der Einakter: »Untröstlich« (1874). Doch konnte die Dichterin auf der Bühne bei aller Begabung nicht festen Fuß fassen, und sie wandte sich daher der Erzählung zu. Ihre ersten Bücher: »Die Prinzessin von Banalien« (Wien 1872), ein satirisches Märchen, »Erzählungen« (Stuttg. 1875, 4. Aufl. 1901) und »Božena« (das. 1876, 6. Aufl. 1902) fanden indessen noch nicht viel Beachtung. Als sie aber mit heitern Sittenbildern der österreich ischen Aristokratie, den »Zwei Komtessen« (Berl. 1885, 6. Aufl. 1902), großes Aufsehen erregt hatte, wirkte ihr Ruhm auf die früher erschienenen Dichtungen zurück und steigerte sich noch, als die Dichterin in rascher Folge poesiereiche Novellen schrieb, die nicht bloß porträttreue Bilder des österreichischen Adels und seiner Umgebung in Stadt, Schloß und Dorf enthalten, sondern auch von einer hohen ethischen Gesinnung getragen und glänzend in der geistsprühenden Darstellung, fesselnd durch die Anmut des Humors sind. Es erschienen die Novellen: »Neue Erzählungen« (Berl. 1881, 3. Aufl. 1894; darunter die Meisterstücke: »Die Freiherren von Gemperlein«, »Nach dem Tode« und »Lotti, die Uhrmacherin«), »Dorf- und Schloßgeschichten« (das. 1883, 5. Aufl. 1902), »Neue Dorf- und Schloßgeschichten« (das. 1886, 3. Aufl. 1901), »Miterlebtes« (das. 1889, 3. Aufl. 1897), »Margarete« (Stuttg. 1891, 5. Aufl. 1901), »Drei Novellen« (Berl. 1892, 3. Aufl. 1901), »Das Schädliche. Die Totenwacht« (das. 1894), »Rittmeister Brand. Bertram Vogelweid« (das. 1896), »Alte Schule« (das. 1897), »Aus Spätherbsttagen« (das. 1901, 2 Bde.), »Agave« (das. 1903); die Romane: »Das Gemeindekind« (das. 1887, 7. Aufl. 1901), ihre bedeutendste Dichtung, »Unsühnbar« (das. 1890, 6. Aufl. 1902), »Glaubenslos?« (das. 1893, 3. Aufl. 1903). E. gilt jetzt mit Recht als die größte deutsche Schriftstellerin der neuesten Zeit. Ausgehend von der Kritik des Adels, in dem sie aufgewachsen war, hat sie nach und nach zu allen Zuständen und Streitfragen ihrer Zeit Stellung genommen und das Ideal der Menschenliebe, ohne Rücksicht auf Nation und Konfession, und der tätigen Entsagung in den verschiedensten Variationen verkündet. Freimütig und tapfer, fesselt sie durch die Schönheit ihrer Seele, die sich als der Erwerb eines durch reiche Erfahrung zur Harmonie gelangten empfindsamen Herzens erweist. Außer den Novellen veröffentlichte sie die mit Recht berühmten »Aphorismen« (Berl. 1880, 5. Aufl. 1901), die gehaltvollen »Parabeln, Märchen und Gedichte« (das. 1892) und das Märchen »Hirzepinzchen« (Stuttg. 1900). Ihre »Gesammelten Schriften« erschienen in 8 Bänden (Berl. 1893–1901). Vgl. Bettelheim, Marie v. E., biographische Blätter (Berl. 1900); Necker, Marie v. E. nach ihren Werken geschildert (das. 1900).
Das Gemeindekind
1
Im Oktober 1860 begann in der Landeshauptstadt B. die Schlußverhandlung im Prozeß des Ziegelschlägers Martin Holub und seines Weibes Barbara Holub.
Die Leute waren gegen Ende Juni desselben Jahres mit zwei Kindern, einem dreizehnjährigen Knaben und einem zehnjährigen Mädchen, aus ihrer Ortschaft Soleschau am Fuße des Hrad, einer der Höhen des Marsgebirges, im Pfarrdorfe Kunovic eingetroffen. Gleich am ersten Tage hatte der Mann seinen Akkord mit der Gutsverwaltung abgeschlossen, seinem Weib, seinem Jungen und einigen gedungenen Taglöhnern ihre Aufgabe zugewiesen und sich dann zum Schnaps ins Wirtshaus begeben. Bei der Einrichtung blieb es während der drei Monate, welche die Familie in Kunovic zubrachte. Das Weib und Pavel, der Junge, arbeiteten; der Mann hatte entweder einen Branntweinrausch oder war im Begriff, sich einen anzutrinken. Manchmal kam er zur gemeinschaftlichen Schlafstelle unter dem Dach des Schuppens getaumelt, und am nächsten Tag erschien dann die Familie zerbleut und hinkend an der Lehmgrube. Die Taglöhner, die nichts hören wollten von der auch ihnen zugemuteten Fügsamkeit unter die Hausordnung des Ziegelschlägers, wurden durch andere ersetzt, die gleichfalls »kehr-um-die-Hand« verschwunden waren. Zuletzt traf man auf der Arbeitsstätte nur noch die Frau und ihre Kinder. Sie groß, kräftig, deutliche Spuren ehemaliger Schönheit auf dem sonnverbrannten Gesicht der Bub plump und kurzhalsig, ein ungeleckter Bär, wie man ihn malt oder besser nicht malt. Das Mädchen nannte sich Milada und war ein feingliedriges, zierliches Geschöpf, aus dessen hellblauen Augen mehr Leben und Klugheit blitzte als aus den dunklen Barbaras und Pavels zusammen. Die Kleine führte eine Art Kontrolle über die beiden und machte sich ihnen zugleich durch allerlei Handreichungen nützlich. Ohne das Kind würde auf der Ziegelstätte nie ein Wort gewechselt worden sein. Mutter und Sohn plagten sich vom grauenden Tag bis in die sinkende Nacht rastlos, finster und stumm. Lang ging es so fort, und zum Ärgernis der Frommen im Dorfe wurde nicht einmal an Sonn- und Feiertagen gerastet. Der Unfug kam dem Pfarrer zu Ohren und bewog ihn, Einsprache dagegen zu tun. Sie blieb unbeachtet. Infolgedessen begab sich der geistliche Herr am Nachmittag des Festes Mariä Himmelfahrt selbst an Ort und Stelle und befahl dem Weibe Holub, sofort von seiner den Feiertag entweihenden Beschäftigung abzulassen. Nun wollte das Unglück, daß Martin, der eben im Schuppen seinen jüngsten Rausch ausschlief, sehr zur Unzeit erwachte, sich erhob und hinzutrat. Gewahr werden, wie Pavel offenbar voll Zustimmung mit aufgesperrtem Mund und hangenden Armen der priesterlichen Vermahnung lauschte, und hinterrücks über ihn herfallen war eins. Der Geistliche zögerte nicht, dem Knaben zu Hilfe zu eilen, entzog ihn auch der Mißhandlung des Vaters, lenkte aber dadurch den Zorn desselben auf sich. Vor allen Zeugen, die das Geschrei Holubs herbeigelockt hatte und deren Anzahl von Minute zu Minute wuchs, überschüttete ihn der Rasende mit Schimpfreden, sprang plötzlich auf ihn zu und hielt ihm die geballte Faust vors Gesicht. Der Pfarrer, keinen Augenblick außer Fassung gebracht, wandte angeekelt den Kopf und gab mit seinem abwehrend in der Rechten erhobenen Stock dem Trunkenbold einen leichten Hieb auf den Scheitel. Martin stieß ein Geheul aus, warf sich nieder, krümmte sich wie ein Wurm und brüllte, er sei tot, mausetot geschlagen durch den geistlichen Herrn. Im Anfang antwortete ihm ein allgemeines Hohngelächter, doch war seine Sache zu schlecht, um nicht wenigstens einige Verteidiger zu finden.
In der Schar der Neugierigen, welche den am Boden Liegenden umdrängte, erhoben sich Stimmen zu seinen Gunsten, erfuhren Widerspruch und gaben ihn in einer Weise zurück, die gar bald Tätlichkeiten wachrief. Die Autorität des Pfarrers genügte gerade noch, um die Krakeeler zu zwingen, den Platz zu räumen. Sie zogen ins Wirtshaus und ließen dort den vom geistlichen Herrn Erschlagenen so lange hochleben, bis ein Trupp Bauernbursche dem wüsten Treiben des Gesindels ein Ende zu machen suchte. Da kam es zu einer Prügelei, wie sie in Kunovic seit der letzten großen Hochzeit nicht mehr stattgefunden hatte. Die Ortspolizei gönnte dem Sturm volle Freiheit, sich auszutoben, und hatte zum Lohn für diese mit Vorsicht gemischte Klugheit am nächsten Morgen das ganze Dorf auf ihrer Seite. Die allgemeine Meinung war, in der Sache gebe es nur einen Schuldigen – den Ziegelschläger –, und man solle keine Umstände mit ihm machen. Zur Lösung des Akkords verstand die Gutsverwaltung sich gern, Martin hätte ihn ohnedies unter keiner Bedingung einhalten können; so fleißig Weib und Kind auch waren, zu hexen vermochten sie doch nicht. Holub wurde abgefertigt und entlassen. Von dem Gelde, das ihm außer den bereits erhobenen Vorschüssen noch zukam, sah er keinen Kreuzer; darauf hatte der Wirt Beschlag gelegt.
Nach einem vergeblichen Versuch, sich sein vermeintliches Recht zu verschaffen, blieb dem Gesellen nichts übrig, als seiner Wege zu gehen. Der Auszug der Ziegelschläger fand statt. An der Spitze schritt das Oberhaupt der Familie in knapp anliegender ausgefranster Leinwandhose, in zerrissener blauer Barchentjacke. Er hatte den durchlöcherten Hut schief aufgesetzt; sein rotes betrunkenes Gesicht war gedunsen; seine Lippen stießen Flüche hervor gegen den Pfaffen und die Pfaffenknechte, die ihn um seinen redlichen Broterwerb gebracht.
Ein paar Schritte hinter ihm kam die Frau. Sie hatte die Stirn verbunden und schien sich selbst kaum schleppen zu können, schleppte aber doch ein Wägelchen, in dem sich Werkzeug und einiger Hausrat befand und Milada in eine Decke eingehüllt lag. Krank? Zerbleut? Man konnte das letztere wohl vermuten, denn vor der Abreise hatte Martin noch entsetzlich gegen die Seinen gewütet. Pavel schloß den Zug. Mit beiden Armen gegen die Rückseite des Wagens gestemmt, schob er ihn kräftig vorwärts und half auch mit dem tief gesenkten Kopfe nach, sooft Leute des Weges kamen, die den Auswandernden entweder mit einem Blick des Mitleids folgten oder einen Trumpf auf Holubs wilde Schimpfreden setzten.
Einige Tage später, an einem stürmischen grauen Septembermorgen, fand der Kirchendiener, als er, sich ins Pfarrhaus begebend, um dort die Kirchenschlüssel zu holen, an der Sakristei vorüberkam, die Tür derselben nur angelehnt. Ganz erstaunt und erst nicht wissend, was er davon denken sollte, trat er ein, sah die Schränke offen, die Meßgewänder auf den Boden zerstreut und der goldenen Borten beraubt. Er griff sich an den Kopf, schritt weiter in die Kirche, fand dort das Tabernakel erbrochen und leer.
Ein Zittern befiel ihn. »Diebe!« stieß er hervor, »Diebe!« und er meinte, es fasse ihn einer am Genick, und wußte nicht, wie er aus der Kirche und über den Weg zur Pfarrei gekommen...
Der Pfarrer pflegte seine Tür nicht zu versperren. »Was sollen die Leute bei mir suchen?« meinte er; so brauchte der Sakristan nur aufzuklinken. Er tat es... Schreck und Grauen! Im Flur lag die greise Magd des Pfarrers ausgestreckt, besinnungslos, voll Blut. Wie der scharfe Luftzug durch die offene Tür über sie hinbläst, regt sie sich, starrt den Kirchendiener an und deutet mit einer schwachen, aber furchtbar ausdrucksvollen Gebärde nach der Stube des geistlichen Herrn.
Der Sakristan, der dem Wahnsinn nahe ist, macht noch ein paar Schritte, schaut, stöhnt – und fällt auf die Knie, aus Entsetzen über das, was er sieht.
Eine Viertelstunde später weiß das ganze Dorf: der geistliche Herr ist heute nacht überfallen und, offenbar im Kampf um die Kirchenschlüssel, ermordet worden, im schweren Kampf, das sieht man, darauf deutet alles hin.
Über den Urheber der gräßlichen Tat ist niemand im Zweifel. Auch wenn die Aussagen der Magd nicht wären, wüßte jeder: der Martin Holub hat's getan. In Soleschau wird zuerst auf ihn gefahndet. Er war vor kurzem da, hat seine Kinder beim Gemeindehirten in Kost gegeben und ist mit seinem Weibe wieder abgezogen.
Nach kaum einer Woche wurde das Paar in einer Diebsherberge an der Grenze entdeckt, in demselben Moment, in welchem Holub einen Teil der in Stücke gebrochenen Monstranz aus der Kirche von Kunovic an einen Hausierer verhandeln wollte. Der Strolch konnte erst nach heftigem Widerstand festgenommen werden. Die Frau hatte sich mit stumpfer Gleichgültigkeit in ihr Schicksal gefügt. Bald darauf traten beide in B. vor ihre Richter.
Die Amtshandlung, durch keinen Zwischenfall gestört, ging rasch vorwärts. Von Anfang an behauptete Martin Holub, nicht er, sondern sein Weib habe das Verbrechen ausgeheckt und ausgeführt, und sooft die Unwahrscheinlichkeit dieser Behauptung ihm dargetan wurde, sooft kam er auf sie zurück. Dabei verrannte er sich in sein eigenes grob gesponnenes Lügennetz und gab das widrige, hundertmal dagewesene Schauspiel des ruchlosen Wichtes, der zum Selbstankläger wird, indem er sich zu verteidigen sucht.
Merkwürdig hingegen war das Verhalten der Frau.
Die Gleichförmigkeit ihrer Aussagen erinnerte an das bekannte: Non mi ricordo; sie lauteten unveränderlich: »Wie der Mann sagt. Was der Mann sagt.«
In seiner Anwesenheit stand sie regungslos, kaum atmend, den Angstschweiß auf der Stirn, die Augen mit todesbanger Frage auf ihn gerichtet. War er nicht im Saale, konnte sie ihn nicht sehen, so vermutete sie ihn doch in der Nähe; ihr scheuer Blick irrte suchend umher und heftete sich plötzlich mit grauenhafter Starrheit ins Leere. Das Aufklinken einer Türe, das leiseste Geräusch machte sie zittern und beben, und erschaudernd wiederholte sie ihr Sprüchlein: »Wie der Mann sagt. Was der Mann sagt.«
Vergeblich wurde ihr zugerufen: »Du unterschreibst dein Todesurteil!« – es machte keinen Eindruck auf sie, schreckte sie nicht. Sie fürchtete nicht die Richter, nicht den Tod, sie fürchtete »den Mann«.
Und auf diese an Wahnsinn grenzende Angst vor ihrem Herrn und Peiniger berief sich ihr Anwalt und forderte in einer glänzenden Verteidigungsrede, in Anbetracht der zutage liegenden Unzurechnungsfähigkeit seiner Klientin, deren Lossprechung. Die Lossprechung nun konnte ihr nicht erteilt werden, aber verhältnismäßig mild war die Buße, welche der Mitschuldigen an einem schweren Verbrechen auferlegt wurde. Das Verdikt lautete: »Tod durch den Strang für den Mann, zehnjähriger schwerer Kerker für die Frau.«
Barbara Holub trat ihre Strafe sogleich an. An Martin Holub wurde nach der gesetzlich bestimmten Frist das Urteil vollzogen.
2
An den Vorstand der Gemeinde Soleschau trat nun die Frage heran: Was geschieht mit den Kindern der Verurteilten? Verwandte, die verpflichtet werden könnten, für sie zu sorgen, haben sie nicht, und aus Liebhaberei wird sich niemand dazu verstehen.
In seiner Ratlosigkeit verfügte sich der Bürgermeister mit Pavel und Milada nach dem Schlosse und ließ die Gutsfrau bitten, ihm eine Audienz zu gewähren.
Sobald die alte Dame erfuhr, um was es sich handelte, kam sie in den Hof geeilt, so rasch ihre Beine, von denen eines merklich kürzer als das andere war, es ihr erlaubten. Das scharf geschnittene Gesicht vorgestreckt, die Brille auf der Adlernase, die Ellbogen weit zurückgeschoben, humpelte sie auf die Gruppe zu, die ihrer am Tore wartete. Der Bürgermeister, ein stattlicher Mann in den besten Jahren, zog den Hut und machte einen umfänglichen Kratzfuß.
»Was will Er?« sprach die Schloßfrau, indem sie ihn mit trüben Augen anblinzelte. »Ich weiß, was Er will; aber da wird nichts daraus! Um die Kinder der Strolche, die einen braven Pfarrer erschlagen haben, kümm'r ich mich nicht... Da ist ja der Bub. Wie er ausschaut! Ich kenn ihn: er hat mir Kirschen gestohlen. Hat Er nicht?« wandte sie sich an Pavel, der braunrot wurde und vor Unbehagen zu schielen begann.
»Warum antwortet Er nicht? Warum nimmt Er die Mütze nicht ab?«
»Weil er keine hat«, entschuldigte der Bürgermeister.
»So? Was sitzt ihm denn da auf dem Kopf?«
»Struppiges Haar, freiherrliche Gnaden.«
Ein helles Lachen erscholl, verstummte aber sofort, als die Greisin den dürren Zeigefinger drohend gegen diejenige erhob, die es ausgestoßen hatte.
»Und da ist das Mädel. Komm her.«
Milada näherte sich vertrauensvoll, und der Blick, den die Gutsfrau auf dem freundlichen Gesicht des Kindes ruhen ließ, verlor immer mehr von seiner Strenge. Er glitt über die kleine Gestalt und über die Lumpen, von denen sie umhangen war, und heftete sich auf die schlanken Füßchen, die der Staub grau gefärbt hatte.
Einer der plötzlichen Stimmungswechsel, denen die alte Dame unterworfen war, trat ein.
»Allenfalls das Mädel«, begann sie von neuem, »will ich der Gemeinde abnehmen. Obwohl ich wirklich nicht weiß, wie ich dazu komme, etwas zu tun für die Gemeinde. Aber das weiß ich, das Kind geht zugrunde bei euch, und wie kommt das Kind dazu, bei euch zugrunde zu gehen?«
Der Bürgermeister wollte sich eine bescheidene Erwiderung erlauben.
»Red Er lieber nicht«, fiel die Gutsfrau ihm ins Wort, »ich weiß alles. Die Kinder, für welche die Gemeinde das Schulgeld bezahlen soll, können mit zwölf Jahren das A vom Z nicht unterscheiden.«
Sie schüttelte unwillig den Kopf, sah wieder auf Miladas Füße nieder und setzte hinzu: »Und die Kinder, für welche die Gemeinde das Schuhwerk zu bestreiten hat, laufen alle barfuß. Ich kenn euch«, wies sie die abermalige Einsprache zurück, die der Bürgermeister erheben wollte, »ich hab es lang aufgegeben, an euren Einrichtungen etwas ändern zu wollen. Nehmt den Buben nur mit und sorgt für ihn nach eurer Weise; der verdient's wohl, ein Gemeindekind zu sein. Das Mädel kann gleich dableiben.«
Der Bürgermeister gehorchte ihrem entlassenden Wink, hocherfreut, die Hälfte der neuen, seinem Dorfe zugefallenen Last losgeworden zu sein. Pavel folgte ihm bis ans Ende des Hofes. Dort blieb er stehen und sah sich nach der Schwester um. Es war schon eine Dienerin herbeigeeilt, welcher die gnädige Frau Anordnungen in bezug auf Milada erteilte.
»Baden«, hieß es, »die Lumpen verbrennen, Kleider aussuchen aus dem Vorrat für Weihnachten.«
Bekommt sie auch etwas zu essen? fuhr es Pavel durch den Sinn. Sie ist gewiß hungrig. Seitdem er dachte, war es seine wichtigste Obliegenheit gewesen, das Kind vor Hunger zu schützen. Kleider haben ist schon gut, baden auch nicht übel, besonders in großer Gesellschaft in der Pferdeschwemme. Wie oft hatte Pavel die Kleine hingetragen und sie im Wasser plätschern lassen mit Händen und Füßen! – Aber die Hauptsache bleibt doch – nicht hungern.
»Sag, daß du hungrig bist!« rief der Junge seiner Schwester ermahnend zu.
»Jetzt ist der Kerl noch da! Wirst dich trollen?« hallte das Echo, das seine Worte weckten, vom Schlosse herüber.
Der Bürgermeister, der schon um die Ecke des Gartenzauns biegen wollte, kehrte um, faßte Pavel am Kragen und zog ihn mit sich fort.
Drei Tage dauerten die Beratungen der Gemeindevorstände über Pavels Schicksal. Endlich kam ihnen ein guter Gedanke, den sie sich beeilten auszuführen. Eine Deputation begab sich ins Schloß und stellte an die Frau Baronin das untertänigste Ansuchen: weil sie schon so dobrotiva (allergütigst) gewesen, sich der Tochter des unglücklichen Holub anzunehmen, möge Sie sich nun auch des Sohnes desselben annehmen.
Der Bescheid, den die Väter des Dorfes erhielten, lautete hoffnungslos verneinend, und die Beratungen wurden wiederaufgenommen.
Was tun?
»Das in solchen Fällen Gewöhnliche«, meinte der Bürgermeister; »der Bub geht von Haus zu Haus und findet jeden Tag bei einem andern Bauern Verköstigung und Unterstand.«
Alle Bauern lehnten ab. Keiner wünschte, den Sprößling der Raubmörder zum Hausgenossen der eigenen Sprößlinge zu machen, wenn auch nur einen Tag lang in vier oder fünf Wochen.
Zuletzt wurde man darüber einig: Der Junge bleibt, wo er ist – wo ja sein eigener Vater ihn hingegeben hat: bei dem Spitzbuben, dem Gemeindehirten.
Freilich, wenn die Gemeinde sich den Luxus eines Gewissens gestatten dürfte, würde es gegen dieses Auskunftsmittel protestieren. Der Hirt (er führte den klassischen Namen Virgil) und sein Weib gehörten samt den Häuslern, bei denen sie wohnten, zu den Verrufensten des Ortes. Er war ein Trunkenbold, sie, katzenfalsch und bösartig, hatte wiederholt wegen Kurpfuscherei vor Gericht gestanden, ohne sich dadurch in der Ausübung ihres dunkeln Gewerbes beirren zu lassen.
Ein anderes Kind diesen Leuten zu überliefern wäre auch niemandem eingefallen; aber der Pavel, der sieht bei ihnen nichts Schlechtes, das er nicht schon zu Hause hundertmal gesehen hat.
So biß man denn in den sauren Apfel und bewilligte jährlich vier Metzen Korn zur Erhaltung Pavels. Der Hirt erhielt das Recht, ihn beim Austreiben und Hüten des Viehes zu verwenden, und versprach, darauf zu sehen, daß der Junge am Sonntag in die Kirche und im Winter sooft als möglich in die Schule komme.
Virgil bewohnte mit den Seinen ein Stübchen in der vorletzten Schaluppe am Ende des Dorfes. Es war eine Klafter lang und breit und hatte ein Fenster mit vier Scheiben, jede so groß wie ein halber Ziegelstein, das nie aufgemacht wurde, weil der morsche Rahmen dabei in Stücke gegangen wäre. Unter dem Fenster stand eine Bank, auf welcher der Hirt schlief, der Bank gegenüber eine mit Stroh gefüllte Bettlade, in der Frau und Tochter schliefen. Den Zugang zur Stube bildete ein schmaler Flur, in dessen Tiefe sich der Herd befand. Er hätte zugleich als Ofen dienen sollen, erfüllte aber nur selten eine von beiden Bestimmungen, weil die Gelegenheiten, Holz zu stehlen, sich immer mehr verminderten. So diente er denn als Aufbewahrungsort für die mageren Vorräte an Getreide und Brot, für Virgils nie gereinigte Stiefel, seine Peitsche, seinen Knüttel, für ein schmutzfarbenes Durcheinander von alten Flaschen, henkellosen Körben, Töpfen und Scherben, würdig des Pinsels eines Realisten.
Zwischen dem Gerümpel hatte Pavel eine Lagerstätte für Milada zurechtgemacht, auf der sie ruhte, zusammengerollt wie ein Kätzlein. Er streckte sich auf dem Boden dicht neben dem Herde aus, und wenn die Kleine im Laufe der Nacht erwachte, griff sie gleich mit den Händen nach ihm, zupfte ihn an den Haaren und fragte: »Bist da, Pavlicek?«
Er brummte sie an: »Bin da, schlaf du nur«, biß sie wohl auch zum Spaß in den Finger, und sie stieß zum Spaß einen Schrei aus, und Virgil wetterte aus der Stube herüber: »Still, ihr Raubgesindel, ihr Galgenvögel!«
Bebend schwieg Milada, und Pavel erhob sich unhörbar auf seine Knie, streichelte das Kind und flüsterte ihm leise zu, bis es wieder einschlief.
Als er zum ersten Male ohne die Schwester zur Ruhe gegangen war, hatte er gedacht: Heut wird's gut, heut weckt er mich wenigstens nicht auf, der Balg. Am frühesten Morgen aber befand er sich schon auf der Dorfstraße und lief geraden Weges zum Schlosse. Das stand mitten im Garten, der von einem Drahtgitter umgeben war; ein dichtes, immergrünes Fichtengebüsch verwehrte ringsum den Einblick in dieses Heiligtum. Pavel pflanzte sich am Tore auf, das dem des Hauses gegenüberlag, preßte das Gesicht an die eisernen Stäbe und wartete. Sehr lange blieb alles still; plötzlich jedoch meinte Pavel, das Zuschlagen von Fenstern und Türen und verworrenes Geschrei zu hören, meinte auch die Stimme Miladas erkannt zu haben. Zugleich erbrauste ein heftiger Windstoß, schüttelte die toten Zweige von den Bäumen und trieb die dürren Blätter im rauschenden Tanze durch die Luft. Zwei Mägde kamen aus dem Dienertrakte zum Hause gelaufen; eine von ihnen wäre beinah über den alten Pfau gestolpert, der im Hofe auf und ab stelzte. Er sprang mit einem so komischen Satz zur Seite, daß Pavel laut auflachen mußte. Im Schlosse und in seiner Umgebung wurde es nun lebendig; es kamen auch Leute zum Gartentor; wer aber durch dasselbe ein-und ausging, sperrte es langsam hinter sich ab. Es war das eine Einführung, die ihrer Neuheit wegen manchem Vorübergehenden auffiel. Das Gartentor absperren bei hellichtem Tage; was soll denn das heißen? Wird sich schwerlich lange halten, die unbequeme Einrichtung.
Aber sie hielt sich doch zum allgemeinen und mißbilligenden Erstaunen der Dorfbewohner, und nach und nach erfuhr man auch ihren Grund.
Dem Pavel wurde er durch Vinska, des häßlichen Hirten hübsche Tochter, in folgender Weise mitgeteilt: »Du Lump du, deine Schwester ist just so ein Lump wie du! Die Petruschka aus der herrschaftlichen Küche sagt, daß die gnädige Frau es mit deiner Schwester treibt wie mit einem eigenen Kind, und deine Schwester will immer nur auf und davon. Darum wird das Schloß jetzt abgesperrt wie eine Geldtruhe. Wenn ich die gnädige Frau wäre, ich möcht solche Geschichten nicht machen; was ich tät, weiß ich... Deinen Vater hat man am Hals aufgehängt, deine Schwester würde ich an Händen und Füßen binden und an die Wand hängen.«
Dieses Bild schwebte dem Pavel den ganzen Tag vor Augen, und nachts verschwamm es ihm mit einem andern, dessen er sich aus der Kindheit besann.
Da hatte er gesehen, wie der Heger ein gefangenes blutjunges Reh aus dem Walde getragen hatte. Die Läufe waren ihm mit einem Strick zusammengeschnürt, und an denen hing es am Stock über des Hegers Rücken. Pavel erinnerte sich, wie es den schlanken Hals gebogen, die Ohren gespitzt und das Haupt emporzuheben gesucht; er erinnerte sich der Verzweiflung, die dem feinen Geschöpf aus den Augen geschaut hatte.
Im Traume kamen ihm diese Augen nun vor – aber wie Miladas Augen.
Einmal rief er laut: »Bist da?« richtete sich im Halbschlafe auf, wiederholte: »Bist da?« tastete suchend umher und erwachte darüber völlig. Mit der Schnelligkeit des Blitzes, mit der Gewalt des Sturmes kam das verwaisende Gefühl der Trennung über ihn und warf ihn nieder. Der harte Junge brach in Tränen, in ein leidenschaftliches Schluchzen aus, weckte die Leute in der Stube, weckte die Häusler, seine Wandnachbarn, mit seinem Geheul. Die ganze Gesellschaft kam herbei, bedrohte ihn, und da er taub blieb für jede, auch die nachdrücklichste Ermahnung, wurde er mit vereinten Kräften zur Tür hinausgeschleudert.
Das war eine tüchtige Abkühlung, selbst für den heißesten Schmerz. Pavel blieb eine Weile ganz ruhig und still auf der fest gefrornen Erde liegen. Die ihm völlig neue und gräßliche Empfindung einer ungeheuren Sehnsucht verminderte sich allmählich, und eine alte wohlbekannte trat an ihre Stelle: Trotz, kalter, wühlender Groll.
Wartet, dachte er, wartet, ich werde euch! ...
Der Entschluß, ein Ende zu machen, war gleich da; der Plan zu dessen Ausführung reifte langsam in Pavels schwerfälligem Kopf. Nachdem aber die große Anstrengung, ihn auszudenken, überstanden war, erschien dem Burschen alles übrige nur noch wie Spielerei. Er wollte ins Schloß eindringen, die Schwester entführen, mit ihr über die Berge in die Fremde gehen, sich als Arbeiter verdingen und nie wieder den Vorwurf hören, daß er der Sohn seiner Eltern sei.
Mit dem Bewußtsein eines Siegers erhob Pavel sich vom Boden und ging in weitem Bogen hinter den Häusern des Dorfes dem Schloßgarten zu. Die Pfeife des Nachtwächters warnte freundlich vor den Wegen, die zu vermeiden waren. Auf den Feldern lag harter, hoher Schnee; die Erde schimmerte lichter als der Himmel, an dem die bleiche Mondessichel immer wieder hinter treibendem Gewölk verschwand. Pavel gelangte ans Gartengitter, überkletterte es und ließ sich von oben in die Fichten und dann von Zweig zu Zweig zu Boden fallen. Da befand er sich nun im Garten, wußte auch, in welcher Gegend desselben, in der dem Dorf entgegengesetzten, der besten, die er hätte wählen können, für jetzt sowohl wie später zur Flucht. Von steigender Zuversicht erfüllt, ging er vorwärts... immer geradeaus, und man muß zum Schlosse kommen. Was dann zu geschehen hätte, malte Pavel sich nicht deutlich aus; er ging, Milada zu befreien, das war ihm herrlich klar, und mochte alles übrige Zweifel und Ratlosigkeit sein, der Gedanke erleuchtete ihm die Seele, den hielt er fest. Daß er jämmerlich zu frieren begann in seinen elenden Kleidern, daß ihm die Glieder steif wurden, grämte ihn nicht; aber schlimm war's, daß immer tiefere Finsternis einbrach und Pavel alle Augenblicke an einen Baum anrannte und hinfiel. Wenn er auch das erstemal gleich wieder auf die Beine sprang, beim zweiten Male schon kam die Versuchung: Bleib ein wenig liegen, raste, schlafe! Trotzdem aber erhob er sich mit starker Willenskraft, tappte weiter und gelangte endlich ans Ziel, das er sich vorgesetzt – ans Schloß. Hochauf schlug ihm das Herz, als er an die alte verwitterte Mauer griff. Weiß Gott, wie nahe er der Schwester ist; weiß Gott, ob sie nicht in dem Zimmer schläft, vor dessen Fenster er jetzt steht, das er zu erreichen vermag mit seinen Händen... Es könnte so gut sein – warum sollte es nicht? und leise, leise fängt er an zu pochen... Da vernimmt er dicht am Boden ein knurrendes Geräusch, auf kurzen Beinen kommt etwas herbeigekrochen, und ehe er sich's versieht, hat es ihn angesprungen und sucht ihn an der Kehle zu packen. Pavel unterdrückt einen Schrei; er würgt den Köter aus allen seinen Kräften. Aber der Köter ist stärker als er und wohlgeübt in der Kunst, einen Feind zu stellen. Das Geheul, das er dabei ausstieß, tat seine Wirkung, es rief Leute herbei. Sie kamen schlaftrunken und ganz erschrocken; als sie aber sahen, daß sie es nur mit einem Kind zu tun hatten, wuchs ihnen sogleich der Mut. Pavel wurde umringt und überwältigt, obwohl er raste und sich zur Wehr setzte wie ein wildes Tier.
3
Was Pavel im Schlosse gewollt, erfuhr niemand; aber die Hartnäckigkeit, mit welcher er jede Auskunft verweigerte, bewies deutlich genug, daß er die schlechtesten Absichten gehabt haben mußte. Einbrechen wahrscheinlich oder Feuer anlegen, dem Kerl ist alles zuzutrauen. So sprach die öffentliche Meinung, und die mit Elternrechten ausgestattete Gemeinde beschloß Pavels exemplarische Züchtigung durch den Herrn Lehrer Habrecht in Gegenwart der sämtlichen Schuljugend.
Der Lehrer, ein kränklicher, nervöser Mann, verstand sich äußerst ungern zur Ausübung des ihm zugemuteten Strafgerichts. Seine Ansicht war, daß solche vor einem jugendlichen Publikum vorgenommene Exekution demjenigen, an dem sie vollzogen wird, selten nützt, und denen, die ihr zusehen, immer schadet. »Dieses Vieh wird durch den Anblick ein noch ärgeres Vieh«, äußerte er, viel zu derb für einen Pädagogen. Man hatte, wenn auch nicht ganz überzeugt, seine Einwendung oft gelten lassen, dieses Mal fruchtete sie nichts.
An dem Tage, der zur Bestrafung des nächtlichen Einschleichers bestimmt war, übernahm ihn denn der Lehrer seufzend aus den Händen der Schergen und führte ihn am Schopfe bis zur Tür der Schulstube. Hier blieb er stehen, hob den gesenkten Kopf des Knaben in die Höbe und sagte: »Schau mich an, was schaust denn immer auf den Boden, schlechter Bub!«
Nicht liebreich waren diese Worte! und doch, woran lag es denn, daß sie dem Pavel ordentlich wohltaten und daß sogar die Art, in welcher der Herr Lehrer ihn dabei an den Haaren zauste, etwas Vertraueneinflößendes hatte und wie eine Herzstärkung wirkte?
»Fürcht dich, du Bosnickel, du Trotznickel! Fürcht dich!« fuhr jener fort, machte schreckliche Augen und schwang mit äußerst bezeichnender Gebärde den dürren Arm in der Luft. Und Pavel, aus dem seit drei Tagen kein Wort herauszubringen gewesen, der seit drei Tagen keinem Menschen ins Gesicht geschaut hatte, richtete mit einem Male seinen scheuen Blick blinzelnd auf den Lehrer und sprach mit einem halben Lächeln: »Ich fürcht mich aber doch nicht.«
Aus der Schulstube hatte es früher herausgesummt wie aus einem Bienenkorbe, dann war das Summen in wüsten Lärm übergegangen, und jetzt wurde da drinnen gerauft um die besten Plätze zum bevorstehenden Schauspiel. Der Lehrer brummte unwillig vor sich hin und schüttelte Pavel von neuem: »Wenn du dich schon nicht fürchtest, so schrei, schrei, was du kannst, rat ich dir!« sagte er, öffnete die Tür und trat ein. Sogleich wurde es still in der Stube, nur einzelne unwillkürliche Ausrufe befriedigter Erwartung ließen sich hören; freundschaftlich rückte man aneinander in den Bänken; die rührendste Eintracht herrschte. Der Lehrer stellte Pavel neben das Katheder und sah sich nach der Rute um. Da er sie eine Weile nicht fand oder nicht zu finden schien, rief eine Stimme: »Dort im Fenster steht sie, im Winkel.« Die Stimme kam aus einer der letzten Reihen und gehörte dem Arnost, dem Sohne des Häuslers, bei dem Virgil zur Miete wohnte. Pavel ballte die Faust gegen ihn, was zu einem Gemurmel der Entrüstung Anlaß gab. Mehr als hundert Augen richteten sich schadenfroh und gehässig auf den braunen zerlumpten Jungen. In ihm kochte die Galle, und so klar er zu denken vermochte, so klar dachte er: Was hab ich euch getan? Warum seid ihr meine Feinde?
Habrecht gebot Stille und hielt eine Ansprache, in welcher er die Schuljugend auf eine merkwürdige Enttäuschung vorbereitete. »Ihr seid voll Vergnügen. Warum? wieso? Tun euch die Prügel wohl, die ein anderer kriegt? Paßt auf! Weh tun werden sie euch! Jeder von euch« – seine Stimme senkte sich zu einem geheimnisvollen Geflüster, und er streckte den Zeigefinger langsam gegen das Auditorium aus: »Jeder, der dasitzt und vor Schadenfreude aus der Haut fahren möcht, wird bald vor Schmerz aus der Haut fahren mögen. Jeder, der herglotzt und zuschaut, wie ich meine Schläge austeile, wird sie mitspüren... mitspüren!« wiederholte er seine unheimliche Prophezeiung, bei der ihm selbst zu gruseln schien. »Und jetzt gebt acht, was der Herr Lehrer kann!«
Alle Kinder schauderten vor dem Wunder, das sich an ihnen vollziehen sollte; nur noch von der Seite streiften zage Blicke den gefürchteten Mann, dessen Erscheinung in ihrer Länge und Magerkeit etwas Gespenstisches hatte. Die Buben stierten zu Boden, die Mädchen verdeckten die Augen mit den Schürzen.
Der Lehrer aber ging rasch ans Werk. Mit fabelhafter Geschwindigkeit wirbelte er die Fuchtel um den Kopf des Delinquenten und führte dann eine Anzahl Hiebe, die Pavel für die Einleitung zur eigentlichen Straße hielt. Statt diese jedoch folgen zu lassen, sprach der Lehrer plötzlich: »Herrgott, da fällt mir jetzt die Brille herunter... Heb sie auf... Für die Strafe bedanken kannst du dich nach der Stunde.«
Pavel starrte ihn mit stumpfsinnigem Staunen an; er wartete noch auf die richtige Wichse – da hörte er, daß er sie schon habe, und erhielt Befehl, sich zu setzen; – auf den letzten Platz in die letzte Bank.
Der Lehrer zog das Taschentuch, wischte sich den Schweiß von der Stirn, nahm umständlich eine Prise und begann den Unterricht.
Arnost, der so rot war wie ein Krebs, flüsterte seinem Nachbar zu: »Hast g'schaut?« – »Ein bissel«, antwortete der. »Spürst was?« – »Ich spür's im Buckel.« – »Mich brennt's am Ohr.« – Ein neugieriges kleines Ding von einem Mädchen, das zufällig mit einem Auge an einen Riß in der Schürze geraten war und ihn zum Auslugen benützt hatte, gestand einigen Gefährtinnen, daß es meine, auf lauter Erbsen zu sitzen.
Nach beendigter Lehrstunde wollte Pavel sich mit den anderen davonmachen; aber der Schulmeister hielt ihn zurück, betrachtete ihn lange mit stechenden Blicken und fragte ihn endlich, ob er sich schäme.
Pavel antwortete leise: »Nein.«
»Nein? wieso nein? Hast aller Scham den Kopf abgebissen?«
Der Bursche verfiel wieder in das hartnäckige Schweigen, das der Lehrer an dem armseligsten und seltensten Besucher seiner Schule kannte. Bisher hatte er ihn laufen lassen, heute jedoch, als er ihn strafen sollte für eine unbekannte Schuld, Mitleid mit ihm gefühlt. Um diese Regung tat's ihm nun leid, und er fuhr giftig fort: »Aufgewachsen in Schande, ja wirklich schon aufgewachsen, bald vierzehn Jahre – an die Schande gewöhnt, weiß nicht einmal mehr, wie sie tut!«
Nun sprach Pavel: »Weiß schon«, und den Mund des Kindes verzerrte ein alternder Zug verbissener Bitterkeit. Er hatte nicht verstanden, was der Herr Lehrer früher gewollt mit seinen Schlägen, die beinahe nicht weh taten; daß er ihm jetzt den Jammer seines Lebens vorwarf, verstand er wohl.
»Weiß schon«, wiederholte er in einem Tone, durch dessen erzwungene Keckheit unbewußt der Schmerz einer tiefen Enttäuschung drang.
Der Lehrer betrachtete ihn aufmerksam – er war das verkörperte Elend, der Bub! – Nicht durch die Schuld der Natur. Sie hatte es gut mit ihm gemeint und ihn kräftig und gesund angelegt; das zeigte die breite Brust, das zeigten die roten Lippen, die starken, gelblich schimmernden Zähne. Aber die wohlwollenden Absichten der Natur waren zuschanden gemacht worden durch harte Arbeit, schlechte Nahrung, durch Verwahrlosung jeder Art. Wie der Junge dastand mit dem wilden braunen Haargestrüpp, das den stets gesenkten Kopf unverhältnismäßig groß erscheinen ließ, mit den eingefallenen Wangen, den vortretenden Backenknochen, die magere derbe Gestalt von einem mit Löchern besäten Rock aus grünem Sommerstoff umhangen, die Füße mit Fetzen umwickelt, bot er einen Anblick, abstoßend und furchtbar traurig zugleich, weil das Bewußtsein seines kläglichen Zustandes ihm nicht ganz verlorengegangen schien. Lange schwieg der Lehrer, und auch Pavel schwieg; aber immer verdrossener ließ er die Unterlippe hängen und begann verstohlen nach der Tür zu sehen, wie einer, der eine Gelegenheit zu entwischen wahrzunehmen sucht.
Da sprach der Lehrer endlich: »Sei nicht so dumm. – Wenn du aus der Schule draußen bist, sollst du denken: wie kann ich hinein, und nicht, wenn du drin bist: wie kann ich hinaus?«
Pavel stutzte; das war nun wieder ganz unerklärlich und stimmte mit der weitverbreiteten Meinung überein, der Schulmeister vermöge die Gedanken der Menschen zu erraten.
»Geh jetzt«, fuhr jener fort, »und komm morgen wieder und übermorgen auch, und wenn du acht Tage nacheinander kommst, kriegst du von mir ein Paar ordentliche Stiefel.«
Stiefel? – wie die Kinder der Bauern haben? ordentliche Stiefel mit hohen Schäften? Unaufhörlich während des Heimwegs sprach Pavel die Worte: »Ordentliche Stiefel« vor sich hin, sie klangen märchenhaft. Er vergaß darüber, daß er sich vorgenommen hatte, den Arnost zu prügeln, er stand am nächsten Morgen vor der Tür der Schule, bevor sie noch geöffnet war, und während der Stunde plagte er sich mit heißem Eifer und verachtete die Mühe, die das Lernen ihm machte. Er verachtete auch die drastischen Ermahnungen Virgils und seines Weibes, die ihn zwingen wollten, statt zum Vergnügen in die Schule zur Arbeit in die Fabrik zu gehen. Freilich mußte dies im geheimen geschehen; zu offenen Gewaltmaßregeln zu greifen, um den Buben im Winter vom Schulbesuch abzuhalten, wagten sie nicht; das hätte gar zu auffällig gegen die seinetwegen mit der Gemeinde getroffene Übereinkunft verstoßen.
Sieben Tage vergingen, und am Nachmittage des letzten kam Pavel nach Hause gerannt, in jeder Hand einen neuen Stiefel.
Vinska war allein, als er anlangte; sie beobachtete ihn, wie er das blanke Paar in den Winkel am Herd, sich selbst aber in einiger Entfernung davon aufstellte und in stille Bewunderung versank. Freude vermochten seine vergrämten lüge nicht auszudrücken, aber belebter als sonst erschienen sie, und es malte sich in ihnen ein plumpes Behagen.
Einmal trat er näher, hob einen der Stiefel in die Höhe, rieb ihn mit dem Ärmel, küßte ihn und stellte ihn wieder an seinen Platz.
Aus der Stube erscholl ein Gelächter, Vinska trat auf die Schwelle, lehnte sich mit der Schulter an den Türpfosten (eine Tür gab es zwischen der Stube und dem Eingange nicht) und fragte: »Wo hast die Stiefel gestohlen, du Spitzbub?«
Er sah sich nicht einmal nach ihr um, von antworten war gar keine Rede. Vinska jedoch wiederholte ihre Frage so oft, bis er sie anbellte: »Gestohlen! ja just gestohlen!«
»Du Esel«, murmelte sie, »siehst du? Jetzt sagst du's selbst.«
Der Blick ihrer begehrlichen grauen Augen wanderte abwechselnd von den Stiefeln zu den eigenen nackten, hübsch geformten Füßen. Pavel hatte sich auf die Erde gekauert neben sein neues köstliches Eigentum; es war ihm, als müsse er es beschützen gegen eine nahende Gefahr, und er machte sich gefaßt, ihr zu begegnen. Vinska neigte den Kopf auf die Seite, lächelte den Burschen, der drohend zu ihr emporsah, plötzlich an und sprach mit einschmeichelnder Stimme: »Geh, sag mir, woher hast sie?«
Er wußte nicht, wie ihm geschah. In dem Ton hatte er die Vinska vor kurzem zum Peter sprechen hören, der ihr Liebhaber war. Heiße Wellen wogten auch in seiner Brust, er verschlang seine reizende Hausgenossin mit den Augen und meinte, was ihn da mit ungeheurer Macht angepackt hatte, sei die Lust, auf sie loszustürzen und sie durchzuprügeln.
Dabei rührte er sich nicht, öffnete nur ganz willenlos die Lippen und sprach: »Der Herr Lehrer hat sie mir gegeben.«
Vinska begann leise zu kichern. »O je – der! Wenn du sie von dem hast, dann hast du nichts.«
»Was – nichts?«
»Nun – nichts! Wenn du morgen aufwachst, sind die Stiefel weg.«
»Weg? ... Warum nicht gar!«