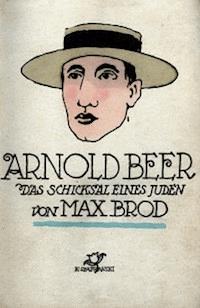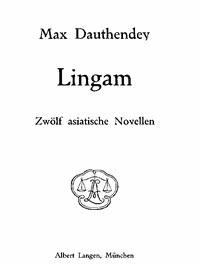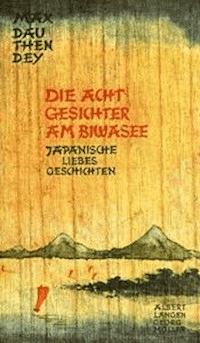0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Ähnliche
DAS GESCHLECHTSLEBENIN DER DEUTSCHEN VERGANGENHEIT
VON
MAX BAUER
LEIPZIG 1902 HERMANN SEEMANN NACHFOLGER
Alle Rechte vom Verleger vorbehalten!
Zum Geleit.
Einen kurzen, nur die behandelten Themen erschöpfenden Abriss des Geschlechtslebens der deutschen Vorzeit zu geben, ist der Zweck der vorliegenden Arbeit, die kein Lehrbuch, sondern hauptsächlich eine auf wissenschaftlicher Grundlage fussende Abhandlung über eine Materie sein will, der alle für jung und alt geschriebenen Kulturgeschichten ängstlich aus dem Wege gehen.
Für den ernsten Laien ist mein Werkchen bestimmt, für den gebildeten Mann und die reife, denkende Frau, denen es »ein herrliches Ergötzen, sich in den Geist der Zeiten zu versetzen«, auch dann, wenn dieser Geist düstere Bilder zeitigt, auf die unsere vielgeschmähte Gegenwart mit Schaudern zurückblickt.
Manch kerniges Wort ist in den nachfolgenden Blättern gesprochen, doch nur, wenn es der Stoff erforderte. Gar mancher wird sich darob entsetzen und entrüsten, aber: »Niemand lügt so viel, als der Entrüstete,« sagt Friedrich Nietzsche – und ich glaube, er hat recht!
Friedenau, September 1902.
Max Bauer.
INHALT.
Seite
Das frühe Mittelalter
1
Das Leben auf dem Dorfe
51
Die Klöster
74
Beilager und Ehe
89
Die feile Liebe
133
Das Badewesen
215
Tanz und Spiel
265
Das Schönheitsideal
304
Die Kleidung
318
Liebeszauber und Zauberliebe
339
Das frühe Mittelalter.
An einer dem Urwalde abgerungenen Stelle, die ein Bächlein durchrieselt, dessen Ufer Blumen schmücken und Weiden beschirmen, liegt das Gehöft des Germanen. Wiesen mit vereinzelten Bäumen und Felder von bescheidener Ausdehnung, bestellt mit der Brotfrucht oder Gerste, um den Trank des Hausherrn daraus zu brauen, oder dem gelbblühenden Hanf, aus dessen Fäden die Hausfrau manch Gewand zu wirken weiss, umschliessen die Baulichkeiten bis an die Grenze des Waldes hin, dessen breitästige Riesen ihre Schatten auf die wogenden Halme werfen. Waldesnähe war Notwendigkeit für den Urdeutschen, denn der gewaltige Wald war geradezu Lebensbedingung für ihn. Aus seinen Stämmen zimmerte er das kunstlose, schirmende Dach; seine harzreichen Äste und das Reisig gaben der fensterlosen Halle Licht und Wärme im rauhen Herbste; die aus Waldesstämmen geschnittenen Pallisaden und der aus biegsamen Zweigen geflochtene Zaun hielten das Raubzeug von dem Einbruch in des Herrn Herden ab, wenn Schnee und Eis die Erde deckte und der Hunger die Tiere den menschlichen Behausungen zutrieb. Die aus seinen Scheiten genährten Essen verflüssigten das Erz, aus dem der Germane die Schutz- und Trutzwaffen schmiedete, wie die Werkzeuge für das Feld: Sichel und Sense. Im Waldesdickicht barg sich das Wild: Hirsch, Reh, Elen, Ur, das Schwarzwild, Meister Petz und anderes Getier, dessen Jagd des Mannes Herzensfreude war, und das ihn und die Seinen mit Fleisch und wärmendem Rauchwerk zur Kleidung versorgte. Aus Waldesdüster stieg vom Opfersteine der Rauch gen Walhalla auf; an entlegenen, schwer zugänglichen Stellen hauste einsam die Seherin, »die weit und breit für ein göttliches Wesen galt«[1], durch dessen Mund die Götter in seltsam gefügter Rede sprachen, ihren Willen kundgaben, lobten oder tadelten, verhiessen oder verdammten, die Prophetin, verehrter als der Oberpriester, als der erkorene Herr und Führer in Frieden und Kampf, sie das heilige Weib!
Denn »der Germane schreibt dem Weibe eine gewisse Heiligkeit und prophetische Gabe zu«[2]. Darum war ihm auch heilig die Frau, die er an seinen Herd genommen, heilig das Weib des Nachbarn und unantastbar, wie die eigenen Töchter. Nur den Feind traf er tödlich damit, dass er nach erfochtenem Sieg dessen Weiber seinen Lüsten opferte. »Die frouwen sie nôtzogeten, Und die megde wol getan« heisst es noch Jahrhunderte später von den Weibern einer erstürmten Stadt. Aber auch das Gegenteil lässt sich bezeugen. Als König Rudolf 925 die Stadt Auga (Eu) erstürmte, in die sich die Normannen unter Rallo geworfen hatten, wurden alle Männer niedergemacht, die Frauen aber unberührt gelassen. Gleiche Schonung hatte früher Totila den Neapolitanerinnen und Römerinnen bewiesen, und als ein vornehmer Gote sich eine Ungebührlichkeit gegen ein neapolitanisches Mädchen erlaubt hatte, liess er ihn trotz allgemeiner Verwendung hinrichten und sein Vermögen jenem Mädchen geben.[3] Also auch im Kriege bewahrten deutsche Stämme die Achtung vor den Frauen.
Dem Germanen, dem rauhen Sohne eines unwirtlichen Landes, galt eben sein Weib als die Gefährtin seines Lebens, eins mit ihm in Freud und Leid, die für ihn schaffte, für ihn sorgte, ihn pflegte, wenn er siech darniederlag, seine Wunden verband und sie mit geheimnisvollen Sprüchen zu heilen suchte; die er dafür mit seinem Leibe schützte, für die er starb, wenn es das Geschick erforderte, gleichwie sie selbst den Tod der Ehrlosigkeit vorzog. Ihre Gemeinschaft war ernst und unverbrüchlich, kein loses Spiel, wie bei vielen kulturell höher stehenden Völkern jener Epoche, die in der Frau nur den Gegenstand zur Befriedigung der Lüste, oder die tief unter dem Manne stehende Sklavin, im günstigsten Falle das zur Fortpflanzung nötige Werkzeug sahen. Nimmt es da wunder, wenn Cornelius Tacitus, der erste, dem wir sichere Kunde von germanischen Sitten und Gebräuchen verdanken, der elegante Römer, das leichtlebige Kind der Weltkloake Roma mit ihren marklosen Männern, ihren entarteten Weibern, bei denen der Ehebruch zum guten Ton gehörte, deren abgestumpfte Nerven nur die raffinierteste Wollust reizte, in Germanien und der unverfälschten Natürlichkeit seiner Eingeborenen eine neue Welt, ein Utopien zu sehen glaubte, das er seinen Landsleuten nicht genug preisen konnte. »So lebt denn das Weib dahin, unter der Obhut reiner Sitten, nicht verderbt vom Sinnenreiz lüsterner Theaterstücke, noch durch wollustreizende Gelage. Geheimen Verkehr durch (Liebes-) Briefe kennt weder Mann noch Frau. Ehebruch ist unter diesem doch so zahlreichen Volke äusserst selten. Seine Bestrafung ist schnell, und dem Ehemanne überlassen. Mit abgeschnittenem Haar, nackt, und in Gegenwart der Verwandten, stösst der Gatte die Schuldige zum Hause hinaus und peitscht sie durch das ganze Dorf. Auch die preisgegebene Jungfräulichkeit findet keine Verzeihung. Nicht Schönheit, noch Jugend, noch Reichtum gewinnt ihr einen Mann. Denn dort freilich lacht niemand des Lasters; verführen und verführt werden nennt man nicht Zeitgeist. Besser, wenigstens bis jetzt noch, steht es mit einem Lande, wo nur Jungfrauen in die Ehe treten und wo es mit der Hoffnung und dem Gelübde der Gattin ein für allemal abgethan ist. So erhalten sie nur den einen Gatten, gleichwie sie Leib und Leben nur einmal empfingen, damit in Zukunft kein Gedanke über ihn hinaus, kein weiteres Gelübde sich rege, damit Liebe nicht sowohl zum Ehemanne, als zum Ehebunde sie beseele.«[4]
Nur das reine Weib hatte Geltung bei den Germanen. Der auf uralten Rechtsgrundsätzen sich aufbauende Sachsenspiegel, das sächsische Landrecht, niedergeschrieben im 13. Jahrhundert, vertritt die Anschauung, dass ein einmal gefallenes Weib, selbst wenn sie wider ihren Willen ihre Ehre verloren, nie wieder die Rechte eines reinen Mädchens erlangen könne.[5] Da den germanischen Jünglingen strenge Gesetze die Keuschheit bis zur vollendeten Männlichkeit zur Pflicht machten – der Umgang mit Weibern galt für den jungen Mann vor Vollendung des 20. Lebensjahres für eine Schmach[6] – ebenso wie den Mädchen, so war der Unmoral nur ein enger Spielraum gegeben. Sexuelle Ausschreitungen kamen wohl vor, doch dürften sie immerhin als Ausnahmen zu betrachten sein.
Mit der Errichtung von befestigten Dörfern, den Vorläufern der deutschen Städte, dem engeren Aneinanderrücken ursprünglich weit voneinander abgelegener Anwesen und dem Eindringen fremder oder aus der Fremde wieder heimgekehrter Elemente, vollzog sich allmählich eine Sittenwandlung zum schlechteren, die aber vorderhand noch nicht bis zum häuslichen Herde vordrang. Die Hausfrau und die Töchter des Deutschen blieben ebenso keusch und züchtig wie vordem.
War es erst die römische Invasion und die Rückkehr deutscher Krieger aus römischen Kriegsdiensten, die manche Unsitte auf deutschen Boden verpflanzten, manche leichtere Sittenanschauung nach Germanien eingeführt hatten, die wie stets bei allen Naturvölkern nur zu leicht Wurzeln fasste und üppig weiterwucherte, so ging auch später die Völkerwanderung und die mit ihr einbrechenden wilden Horden nicht spurlos an den Vorfahren vorüber. Auch das Christentum räumte mit vielem Althergebrachten für immer auf oder entstellte es, wo es galt, die Gefühle der Bekehrten zu schonen, nach und nach bis zur Unkenntlichkeit.
Eine neue, von der alten grundverschiedene Zeit war für Germania angebrochen. Das Volk, das ein Tacitus als Muster hingestellt, das das römische Weltreich zertrümmert hatte, war aus dem Naturzustand in die Kultur eingetreten. Der rauhe Naturmensch, dem bislang Krieg und Jagd als Um und Auf des Lebens galten, der jede Arbeit, die nicht mit diesen seinen Herzensneigungen zusammenhing, verachtete und sie den Frauen und den Sklaven überliess, war zum Edeling oder zum Bauerbürger geworden, der nun nicht mehr ganz so schalten und walten durfte, wie damals, wo er als unbeschränkter Gebieter auf seinem Grund und Boden hauste. Er musste jetzt selbst die Hände rühren und die Oberaufsicht über sein Eigentum übernehmen. Das mit elementarer Macht sich verbreitende Christentum erschloss eine neue Gedankenwelt und milderte vieles von der Rauheit des früheren Sohnes der Wildnis. Die allerorts entstehenden Klöster wurden zu den ersten und einzigen Bildungsstätten, aus deren festen, bewehrten Mauern so manche Kunde drang von der Kunst, seine Gedanken aufzeichnen zu können und sie auf diese Weise selbst dem Fernen mitzuteilen; dann von Glaubenshelden, die ihre Treue gegen den Heiland mit dem Leben bezahlt, die für das Christentum den Märtyrertod erlitten; vom Heiland selbst, seinem Leben, Leiden und Sterben, und von seiner Mutter, der herrlichsten, edelsten und erhabensten aller Frauen, der gebenedeiten Jungfrau Maria. In ihr erstand für den Deutschen neuerdings das göttliche Weib der Germanen, darum sammelte sich auch in dem Marienkultus die ganze Verehrung, die der Deutsche einem Weibe zu zollen vermag, in einem Brennpunkte zusammen, der aber im Gange der Jahrhunderte verblasste, um später noch einmal, aber weniger intensiv und mit einer Beimischung von Groteskkomik, als Minne und Minnedienst aufzuleuchten, ehe er für immer erlöschte.
Noch war das deutsche Staatengefüge lose aus einer Unzahl deutscher Stämme zusammengesetzt, die, in nie ruhender Eifersucht einander befehdend, kaum ein Gefühl der Zusammengehörigkeit kannten.
Erst dem Heros Karl dem Grossen, seiner eisernen Faust, seinem mächtigen, zielbewussten Willen, der mit unbeugsamer Energie das für richtig Erkannte durchzusetzen wusste, gelang es, das Völkerkonglomerat auf deutscher Erde zusammenzuschweissen und zu einer Einheit, dem römisch-deutschen Reiche, zu gestalten. Karls staatsmännisches und kulturelles Wirken zu würdigen ist nicht meine Aufgabe. Hier soll nur der Einfluss erörtert werden, den Karls Regierung auf das Geschlechtsleben seiner Zeit ausübte. Kaiser Karls Leben war in dieser Hinsicht nicht einwandsfrei. Wenn er auch am 29. Dezember 1165 heilig gesprochen und diese Kanonisation von der Kirche stillschweigend bestätigt wurde, so war Karl durchaus kein Heiliger. Er war fünfmal verheiratet. Seine erste Frau, die Fränkin Himiltrud, verstiess er, ebenso die zweite, eine Tochter des Longobardenkönigs Desiderius, nach der Angabe eines Mönches von St. Gallen deshalb, weil sie unfruchtbar gewesen. Hildegard, die dritte Gattin, ein Fräulein aus hohem schwäbischen Adel, zählte erst 13 Jahre, als er sie heimführte. Sie starb 783 im 26. Lebensjahre, nachdem sie ihm neun Kinder, darunter Hludoic, seinen Thronerben, geboren hatte. Wenige Monate nach Hildegards Tode heiratete Karl die Ostfrankin Fastrada, nach deren Hinscheiden er die Alemannin Luitgard zur Gemahlin nahm, mit der er schon vor der Verheiratung Beziehungen unterhalten hatte. Sie war seine letzte rechtmässig angetraute Gattin, und als sie um das Jahr 800 in Tours starb, wirtschaftete der Kaiser bis zu seinem Ableben mit Kebsweibern, von denen vier namhaft gemacht werden: Madelgard, Gersuinda, Regina und Adallinde.[7]
Karls sinnliche Natur vererbte sich auf seine Töchter, von denen Einhard schreibt: »Obwohl diese Töchter sehr schön waren und von ihm überaus geliebt wurden, wollte er wunderbarerweise keine von ihnen einem der Seinen oder einem Fremden zur Ehe geben; er behielt sie vielmehr alle bis an sein Ende in seinem Hause und sagte, er könne den näheren Umgang mit ihnen nicht entbehren. Aber deswegen musste er, sonst so glücklich, die Abgunst des Schicksals erfahren, was er sich jedoch so wenig merken liess, als ob in Bezug auf seine Töchter niemals irgend ein Verdacht der Unkeuschheit sich erhoben, niemals das Gerücht hiervon sich verbreitet hätte.«[8] Dieses Gerücht bestand in der That und stützte sich auf Thatsachen. Alkuin, des Kaisers Ratgeber und Freund, warnte seine Schüler vor den »gekrönten Tauben, die nächtlich durch die Pfalz fliegen.« Die Folgen der Lasterhaftigkeit liessen nicht auf sich warten.
Bertha, aus des Kaisers Ehe mit Hildegard, hatte vom gelehrten Dichter Angilbert zwei Söhne. Diese Bertha ist die Urheberin der reizenden Sage von dem treuen Liebespaare Eginhard (Einhard) und Emma (Imma), nach welcher Emma ihren Geliebten, während dessen nächtlichem Besuche Schnee im Schlosshofe gefallen war, der durch die in ihm hinterlassenen Fusstapfen des Geliebten Fortgehen hätte verraten müssen, auf ihrem Rücken zu seiner Wohnung trug. Der Kaiser, den Schmerzen auf seinem Lager wachhielten, sah dies, und gerührt von so viel Liebe, gab er dem Paare seinen Segen. »Offenbar hat die geschäftig webende Sage hier einen anderen Günstling und vertrauten Rat Karls, den gelehrten Angilbert, mit Einhard verwechselt. Letzterer hatte allerdings eine vornehme Jungfrau von trefflichem Charakter und hervorragender Bildung, Namens Imma, zum Weibe, mit der er bis zum Jahre 836 in glücklichster Ehe lebte, doch war er sicher nicht Karls Schwiegersohn, da der Kaiser eine Tochter Imma unseres Wissens nicht hatte.«
Berthas Schwester Hruotrud, in Hofkreisen Columba genannt, hatte mit dem Grafen Rorich von Maine einen Sohn, und die anderen Töchter Karls waren ebenso leichtfertig, wie die erwähnten. Das grössere Leben Ludwigs des Frommen, Karls Nachfolger, erzählt, das Treiben, das seine Schwestern im väterlichen Hause führten, habe Ludwigs Sinn, obgleich er von Natur milde war, schon lange geärgert. Bald nach seiner Thronbesteigung habe er daher den ganzen, sehr grossen weiblichen Tross mit Ausnahme der geringen Dienerinnen aus dem Palaste schaffen lassen, und seine Schwestern veranlasst, sich auf die ihnen vom Vater bestimmten oder von ihm selbst verliehenen Klöster zurückzuziehen.[9]
So gerne Karl in der eigenen Familie beide Augen zudrückte und geflissentlich übersah, was allgemein offenkundig war, so unnachsichtlich zeigte er sich gegen die öffentliche Unsittlichkeit. Aus Paris z. B. suchte er alle öffentlichen Mädchen zu vertreiben. Die Dirnen sollten, falls man sie bei der Ausübung ihres Gewerbes ertappte, gestäupt werden. Wer ihnen Vorschub geleistet oder ihnen Obdach gegeben, sollte sie auf dem Rücken zum Richtplatze tragen. Der Erfolg dieses Erlasses war ganz belanglos, denn die »verliebten Weiber« – filles folles de leurs corps – trieben ihr lichtscheues Handwerk offen und im geheimen nach wie vor und vermehrten sich wie die Wasserpest.
Gegen die auch in Deutschland immer mehr um sich greifende Sittenlockerung konnte oder wollte Karl nicht einschreiten, vielleicht schon deshalb nicht, weil sie in erster Linie bei dem an Gut und Macht vielvermögenden Adel zuerst und am auffallendsten zum Vorschein kam. Zu jedem der festen Häuser, aus denen sich die Burgen entwickelten, gehörten die Genitia, ursprünglich Werkstätten, in denen hörige und freie Dienerinnen unter Aufsicht der weiblichen Herrschaft die Stoffe für die Kleidung herzustellen, zu sticken, weben, waschen, kochen, kurz alle weibliche Hand- und Hausarbeit vorzunehmen hatten. Diese Genitia oder Frauenhäuser waren von dem Hauptgebäude, der Herrenwohnung, streng geschieden und mit Zäunen, Wall, Graben und Wachttürmen gegen fremde Eindringlinge wohl verwahrt. In diesen Frauenhäusern befanden sich auch die Schlafräume nicht allein der Mägde sondern auch der weiblichen Familienmitglieder, ein Grund mehr, sie zu sichern, besonders das vordere Abteil der Genitia, in dem die Angehörigen des Hausherrn nächtigten, während das Hinterhaus die Dienerschaft beherbergte. Nach dem alten alemannischen Rechte wurde die Notzucht an einer Insassin des Vorderhauses mit sechs Schillingen, an einer des Hintergebäudes mit nur drei Schillingen geahndet. Jedes der Häuser der Grossen und jeder Meierhof besass solch Frauenhaus oder Bordell, nach dem angelsächsischen Bord, Schwelle, benannt. Die anrüchige Nebenbedeutung kam erst viel später in Gebrauch. Diese Frauenhäuser galten bald mit Fug und Recht für die Harems ihrer Besitzer,[10] da damals, bis tief in das Mittelalter hinein, die Frauen und Töchter der Unfreien im vollsten Sinne des Wortes die Leibeigenen ihrer Herren waren. Die Allgewaltigen besassen das Recht auf Leben und Tod über ihre Hörigen, die nur als Wertobjekte galten, über dessen Vermietung, Verkauf oder Verpfändung der Besitzer nach Gutdünken zu verfügen vermochte. Da der Wille des Herrn unverbrüchlichen Gehorsam bedingte, so wehrte keine Schranke seinen sinnlichen Gelüsten; er durfte verlangen und war der Gewährung sicher.
Zu den Herrenrechten des Feudalen gehörte auch die Erteilung der Eheerlaubnis für seine Unfreien. Er durfte jeden Mann, sobald er das 18., und jedes Mädchen, das das 14. Lebensjahr erreicht hatte, zur Ehe zwingen, ebenso verwitweten Gutsleuten eine neue Ehe mit der ihnen zugeteilten Braut aufnötigen. Lag es doch in seinem Interesse, recht viele Ehepaare unter seinen Hörigen zu haben, da sich mit ihrer Kinderzahl auch sein Besitztum an Seelen vergrösserte, was einem Vermögenszuwachs gleichkam. Bisweilen hielt er es jedoch für angebracht, seine Einwilligung zu versagen oder diese von dem Jus primae noctis, nämlich dem Rechte abhängig zu machen, in der ersten Nacht den Gatten bei der Neuvermählten vertreten zu dürfen, wenn er nicht ein für allemal dieses Recht auszuüben für gut fand. Wie weit diese schmachvolle Gepflogenheit in die graue Vorzeit zurückreicht, ist meines Wissens nicht festgestellt. Doch ist ihr hohes Alter als wahrscheinlich anzunehmen, da bei der mittelalterlichen absoluten und rechenschaftsfreien Machtvollkommenheit die Herren nur zu leicht auf derartige Übergriffe verfallen mussten. Man empfand vielleicht beiderseits nicht die Erniedrigung, die in der Ausübung und Duldung dieses schmachvollsten aller Rechte bestand. Im späteren Mittelalter bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts ist das Bestehen des Jus primae noctis dokumentarisch festgestellt, trotz aller Ableugnungsversuche, die z. B. Karl Schmidt in seinem Werke »Jus primae noctis« (Freiburg i. B. 1881) mit recht negativem Ergebnisse zu unternehmen suchte. Aus der deutschen Schweiz sind zwei Gesetze vom Jahre 1538 und 1543 überliefert, die haarscharf diese Unmenschlichkeit beweisen. Diesen Dokumenten einen anderen als den unzweideutig in ihnen ausgesprochenen Sinn zu unterschieben, wie dies Karl Schmidt unternimmt, liegt keine Veranlassung vor, ebensowenig wie ich Weinholds Ansicht beipflichten kann, der mit Osenbrüggen und Gierke jene Bestimmung nur als Ausdruck »einer symbolischen Anerkennung der Leibherrschaft durch die scherzhafte Voranstellung und Ausmalung der äussersten Rechtskonsequenzen« aufgefasst wissen will.[11] Man droht mit »der äussersten Rechtskonsequenz« nicht, wenn man sie nicht, sei es auch nur in aussergewöhnlichen Fällen, zur Ausführung bringen will.
Das eine der erwähnten Schriftstücke, die »Oefnung von Hirslanden und Stadelhofen« im Kanton Zürich vom Jahre 1538, lautet: »Ouch hand die burger die rechtung, wer der ist, der uf den gütern, die in den Kelnhof gehörend, die erste nacht bi sinem wibe ligen wil, die er nüwlich zu der ee genommen hat, der sol den obgenanten burger vogt dieselben ersten nacht bi demselben sinen wibe lassen ligen; wil er aber das nüt thun, so soll er dem vogt geben 4 und 3 fl Züricher pfenning, weders er wil: die wal hat der brugom (Bräutigam), und sol man ouch demselben brugome ze stür (zur Steuer, Beihilfe) an dem brutlouf geben ein fuder holtz usz dem Zürichberg, ob er wil an demselben holtz hat.« Der Tenor des zweiten Gesetzes entspricht dem eben gegebenen ziemlich genau. Doch nicht die weltlichen Herren allein beschmutzten sich mit der Ausübung des Jus primae noctis, auch die hohe, grundbesitzende Geistlichkeit machte sich dieses Recht zu nutze – brachte es doch etwas ein. Nach dem Lagerbuche des schwäbischen Klosters Adelberg vom Jahre 1496 mussten die zu Bortlingen sesshaften Leibeigenen dies Recht dadurch ablösen, dass der Bräutigam eine Scheibe Holz, die Braut ein Pfund sieben Schillinge Heller oder eine Pfanne, »dass sie mit dem Hinteren darein sitzen kann oder mag« darbringen musste. Anderwärts hatten die Bräute dem Grundherrn so viel Käse oder Butter zu entrichten, »als dick und schwer ihr Hinterteil war«. An anderen Orten wieder mussten sie einen zierlichen Korduansessel geben, »den sie damit ausfüllen konnten«.[12] Nach den Schilderungen des bayerischen Oberappellationsgerichtsrats Welsch bestand übrigens die Verpflichtung der Lösung vom Jus primae noctis in Bayern noch im 18. Jahrhundert.[13]
Im Grunde genommen barg sich unter dem Jus primae noctis nichts weiter, als eine Erpressung mehr, da es doch dem Bräutigam freistand, sich mit Geld oder Geldeswert zu lösen. Wenn nun der arme Bauer dieses Geld nicht aufzubringen vermochte, denn eine Hochzeit kostete ohnehin auch damals schon viel Geld? Der Bräutigam hatte vor allem die Eheerlaubnis teuer durch den Erlag eines Zinses oder Übergabe eines Hemdes oder Felles zu erkaufen. Dem Zins wusste der Galgenhumor der Zahler recht bezeichnende Namen zu geben. Einige dieser aus verschiedenen Gegenden stammenden Bezeichnungen waren: Jungfernzins, Stechgroschen, Bettmund, Nadelgeld, Frauengeld, Hemdschilling, Bumede, Jungferngeld, Schürzenzins, Vogthemd, Bunzengroschen und andere, mitunter sehr eindeutige, mehr. Dieser Zins war unter allen Umständen zu erlegen, auch dann, wenn der Herr sein Recht ausgeübt und damit die Tugend der Braut ramponiert hatte.
Die zerzauste Tugend machte übrigens schon damals den Herren der Schöpfung und nicht nur den Bauern allein manchen Kopfschmerz. Und nicht allein die Mägdelein, sondern auch die Ehegattinnen, ganz besonders die letzteren, hatten oft unter mehr oder weniger begründeter Eifersucht zu leiden. Was heutzutage meist Thränen, Ohnmachten und Beteuerungen durchzusetzen vermögen, bedurfte in jener kräftiger zufassenden Zeit augenscheinlicher Beweise. Wenn diese nicht auf gewöhnlichem Wege herbeizuschaffen waren, so griff man, dem bigott-abergläubischen Zeitgeiste entsprechend, zu dem Gottesurteil. Häufig war es die angeschuldigte Frau selbst, die zu ihrer Rechtfertigung einer Ordalie unterzogen zu werden begehrte. So die Frau Karls des Dicken (881-887), die, des Ehebruches bezichtigt, durch das Gottesurteil nicht allein zeigen wollte, dass sie keine Verbrecherin, sondern dass sie trotz zwölfjähriger Ehe noch immer Jungfrau sei: »Das (ihre Unberührtheit) bewerte sü domitte, dass sü ein gewihset Hemede ane det und domit in ein Für (Feuer) gieng und blieb unversert von dem Für«, schreibt der Chronist Twinger von Königshofen. Das ganze Mittelalter hindurch waren Ordalien nahezu das einzige, jedenfalls aber das unfehlbarste Mittel, die eheliche Treue ad oculos zu demonstrieren.
Zwei Hauptarten der Gottesurteile waren im Schwange: die Feuer- und die Wasserprobe. Bei der Feuerprobe hatte die Beschuldigte die blosse Hand ins Feuer zu halten und unbeschädigt wieder herauszuziehen. War die Hand versengt, so wurde sie verbunden und der Verband nach einer gewissen Zeit gelöst. Waren die Wunden verheilt, so bewies dies die Unschuld. Weitere Abarten des Feuerordals waren: Mit einem mit Wachs durchtränkten Hemd bekleidet den Scheiterhaufen zu durchschreiten, wie Karls Gattin that; mit blossen Füssen über glühende Pflugscharen zu wandeln oder diese eine angegebene Strecke weit zu tragen. Kaiserin Kunigunde, Heinrichs II. (1002-1024) Gattin, unterzog sich dieser letzteren Probe, die übrigens schon aus den Sophokleischen Tragödien her bekannt ist.
Die Wasserprobe fusste auf dem Grundgedanken, dass das reine, heilige Wasser nichts Sündhaftes in sich dulde. Sank daher das gebundene nackte Weib unter, so war es schuldlos; blieb es auf dem Wasserspiegel schwimmen, dann war seine Schuld zum Beweis erhoben. Jahrhunderte später gewannen diese Wasserproben, deren Ausgang ganz in der Hand des Fesselnden lag, eine hohe Bedeutung bei den Hexenverfolgungen.
Eine dritte, aber seltener geübte Art der Gottesurteile waren die Zweikämpfe zwischen der Angeklagten und ihrem Ankläger. Der Kraftunterschied zwischen Mann und Weib fand dadurch seinen Ausgleich, dass der Mann bis zum Gürtel in einer Grube stehend die Angriffe der mit einem enganliegenden trikotartigen Anzuge bekleideten Frau abzuwehren hat. In »Talhoffers Fechtbuch«, der Bilderhandschrift von 1467 auf der Gothaischen Bibliothek, bekämpft die Frau ihren Widersacher mit einem Schleier, in dem sie einen vier- bis fünfpfündigen Stein eingebunden hat. Der Mann ist mit einer Keule bewehrt, ebenso lang wie der Schleier der Gegnerin. Der Kämpfer steht »bis an die waichin« in einer Grube, dessen Rand die Frau umkreist. Nach dem Apollonius vertrat mitunter einer der langen Kleiderärmel den Schleier.[14]
Dass alle Ordalien, der Zweikampf vielleicht ausgenommen, mit der Niederlage der Frau enden mussten, wenn alles mit rechten Dingen zuging, liegt auf der Hand – soferne das schwache Geschlecht in seiner ererbten Schlauheit nicht Mittel und Wege gefunden hätte, den Herren der Schöpfung ein Schnippchen zu schlagen. Sie mogelten bei den wohlvorbereiteten Gottesurteilen nach Herzenslust, und lachten hinterher die dummen, leichtgläubigen Männer weidlich aus. An Gehilfen bei dem Betruge fehlte es nicht, wenn nur Geld genug vorhanden war, die Helfer zu erkaufen.
Gottfried von Strassburg gibt im »Tristan« unumwunden den Schwindel zu, den die holde Isolde, seine Heldin, bei einem Gottesurteil ausübt. Isoldchen, bekanntlich kein Tugendspiegel, soll zur Bezeugung ihrer Unschuld die Feuerprobe bestehen. Sie ist, sehr gerechtfertigter Weise, mit Tristan, dem Neffen ihres alten Gatten, ins Gerede gekommen, und muss nun, um die bösen Mäuler zu stopfen und ihrem Gatten den Glauben an ihre eheliche Treue wiederzugeben, eine Ordalie bestehen. Klein-Isoldchen hat gewichtige Gründe, alle Vorsicht walten zu lassen, denn es ist bei ihr sehr viel faul im Staate Dänemark. Sie weiss sich aber zu helfen. Vor der Probe verteilt sie mit beiden Händen reiche Geschenke an Gold, Silber und Edelsteinen »um Gottes Huld«, das heisst an die die Feuerprobe leitenden Geistlichen, die sich solchen Gaben gegenüber nicht undankbar erweisen dürfen. Sie wissen die Sache so fein einzufädeln, dass die Ehebrecherin die Probe tadellos besteht und in ihrer »bewiesenen« Fleckenlosigkeit nun aufs neue nach Herzenslust sündigen kann. Sie weiss ja, dass bei einem neuerlichen Gottesurteil ihr die früheren Helfer wieder aus der Patsche helfen werden.
Einen weiteren Einblick in den Gottesurteil-Schwindel gestattet das Gedicht eines unbekannt gebliebenen mittelhochdeutschen Dichters, das Hans Sachs als Vorlage für sein Fastnachtsspiel »Das heisse Eisen« benützte. Eine Frau zwingt ihren Mann auf Veranlassung der Gevatterin, »die ist sehr alt und weiss sehr viel«, seine eheliche Treue durch das Tragen eines »heiss Eysen« zu beweisen. Der Gatte willfahrt scheinbar dem Wunsche seiner Gattin.
Der Schlauberger zieht dabei verstohlen einen Holzspan aus dem Ärmel in die Handfläche, auf den er das Eisen derart legen kann, dass es nirgend mit der Haut in Berührung kommt. Natürlich besteht er die Probe glänzend, weshalb er, nun den Spiess umkehrend, auch seinerseits die Tugendprobe von seiner Frau begehrt. Winselnd sinkt diese auf die Knie und gesteht, in die Enge getrieben, dass sie zuerst mit dem Herrn Kaplan in sträflichem Verkehr gestanden, den erst ein Mann, dann wieder einer, schliesslich nach und nach ein ganzes Dutzend abgelöst haben. Die würdige Frau, der »St. Stockmann« als unentrinnbarer Schutzpatron winkt, fasst nach ihrer Beichte unversehens das inzwischen erkaltete Eisen an, verbrüht sich aber daran, ein Zeichen, dass sie noch immer nicht die ganze Wahrheit gestanden hat, und rennt scheltend ab.[15]
Das von Karls eiserner Faust zusammengeschweisste Weltreich zersplitterte unter seinen schwachen Nachfolgern in jenes Staatengemengsel, dem erst das 19. Jahrhundert ein Ende machte. Karls Schöpfungen teilten das Schicksal seines Staates. Nur in den Klöstern glimmte der von Karl angefachte Funke des Bildungsbedürfnisses unter den Insassen fort.
Die Weltabgeschiedenheit, die von dem ewigen Einerlei gezeugte Langeweile liessen wohl auch manche, sonst nicht gerade wissensdurstige Mönche oder Nonnen zu den Büchern greifen, neben Reliquien, Messgeräten und Kultgewändern die kostbarsten Besitztümer der Stifte und Klöster. Und wohl ihnen, wenn sie Gefallen an dieser Beschäftigung fanden, die sie von weit sündhafterem Treiben abhielt, als es selbst die über alle Massen schlüpfrige Mönchslitteratur, das Singen und Abschreiben von weltlichen Liedern, den »winileodes«, war, das Karls Kapitular von 789 verpönte, oder das Studium der erotischen Stücke eines Plautus oder Terentius und anderer die Sinne erregender klassischer Schriftsteller. Denn auch in dieser Epoche liess die Sittenreinheit der Klostergeistlichkeit schon vieles zu wünschen übrig. Durch die Kapitularien Kaiser Karls ist erwiesen, dass manche Nonne ein vagierendes Leben führte, sich rückhaltslos, sogar gegen Entlohnung, hingab, und etwaige Folgen dieser Liebschaften durch Verbrechen beseitigte.
Der Wortlaut eines der zahmsten dieser Kapitularien (v. J. 802) ist folgender: »Die Frauenklöster sollen streng bewacht werden, die Nonnen dürfen nicht umherschweifen, sondern sollen mit grösstem Fleiss verwahrt werden, auch sollen sie nicht im Streit und Hader untereinander leben, und in keinem Stücke den Meisterinnen und Äbtissinnen ungehorsam oder zuwider handeln. Wo sie aber unter eine Klosterregel gestellt sind, sollen sie diese durchaus einhalten. Nicht der Hurerei, nicht der Völlerei, nicht der Habsucht sollen sie dienen, sondern auf jede Weise gerecht und nüchtern leben. Auch soll kein Mann in ihr Kloster eintreten u. s. w.«
Ebenso verbot Karl, die Mönchsklöster in allzu bequemer Nachbarschaft der Nonnenklöster anzulegen – er hatte Gründe dafür.
Aber nicht nur die Nonnen aus niederem Stande setzten sich über die Klosterregeln hinweg, auch solche aus den höchsten Kreisen brachen ihr Gelübde, wenn sich Gelegenheit bot. Wiederholt finden sich in den Chroniken vornehme Klosterschwestern, die sich entführen lassen, oder der Klausur entfliehen, um zu heiraten. Wer mächtig war, durfte hoffen, nachträglich die Genehmigung des Ehebundes durch den Kaiser und durch dessen Vermittlung auch die des Papstes zu erlangen. »Hadburg, die erste Gemahlin König Heinrichs, war eine Nonne, um die er als Herzog förmlich warb, die er sich nach alter Weise im Ringe der Seinen vermählte, als Herrin seines Hofes feiern liess und gegen die Angriffe der Kirche behauptete. Herzog Miseco von Polen, durch seine erste Gemahlin bekehrt, erwies sein junges Christentum nach deren Tode dadurch, dass er um 977 eine deutsche Nonne (Oda) aus ihrem Kloster entführte und heiratete.«[16]
Selbst in den sittenreinsten Klöstern dachte man im Zeitalter Karls und seiner Nachfolger sehr frei, wofür die Dramen Roswithas von Gandersheim Beweise erbringen, jener vielseitigen, hochgebildeten Nonne, mit der der lange Reigen der deutschen Schriftstellerinnen anhebt. »Der singende Mund von Gandersheim« (clamor validus Gandeshemensis) lebte und dichtete um die Mitte des 10. bis zu Anfang des 11. Jahrhunderts. Die Dichterin entnahm ihre Stoffe der Heiligengeschichte, die sie in einer dem Terenz nachgeahmten Form dramatisierte. Mit Vorliebe erhitzt sie ihre Phantasie an sinnlichen Vorwürfen, die stellenweise durch die behaglich-breite Detailschilderung von einer Vorurteilslosigkeit zeugt, von der sie ihr letzter Übersetzer trotz aller aufgewandten Mühe nicht völlig reinzuwaschen vermag.[17] In ihrem dritten Stücke »Die Auferweckung der Drusiana und des Calimachus« dringt der letztere, ein schöner heidnischer Jüngling, in die kaum geschlossene Gruft »und sucht in dem Marmorbette des Leichnams die Umarmung, welche ihm Drusiana lebend versagte«. Eine Schlange verhindert rechtzeitig die Leichenschändung. – Etwas viel auf einmal für eine schriftstellernde Himmelsbraut! In dem Drama »Fall und Busse Marias, der Nichte des Einsiedlers Abraham« führt uns Roswitha in ein Bordell; in »Die Bekehrung der Buhlerin Thais« schildert sie realistisch ein Freudenmädchen; im »Dulcitius« sollen die drei christlichen Jungfrauen Agape, Chionia und Irene wegen ihrer Standhaftigkeit im Glauben römischen Soldaten preisgegeben werden, nachdem Dulcitius vergeblich versucht hat, seine Begierden an ihnen zu stillen, und dieses alles und noch mehr trägt Roswitha mit frommem Augenaufschlag vor – ad majorem Dei gloriam –. Zur Ehre der Dichterin, die sich eines kraftvollen, aber barbarischen Mönchslateins bediente, sei angenommen, dass sie ihre Stoffe nach schriftlich vorliegenden Vorbildern formte, nichts Selbsterlebtes in ihre Darstellungen verflocht. Aber mussten nicht derartige Scenen selbst die reinste Phantasie mit unzüchtigen, dem Gelübde der Keuschheit diametral entgegenstehenden Bildern füllen und sie zu weiterer Ausspinnung reizen? Die müssiggängerischen Nönnchen hatten so unendlich viel Langeweile, wie sie oft selbst gestehen, dass sie sich wohl recht oft an den Dramen der Gandersheimerin ergötzt und die darin geschilderten Vorkommnisse recht ausführlich durchgesprochen haben mögen.....
Vom 12. Jahrhundert an datiert der geistige und materielle Aufschwung des deutschen Volkes, das ganz allein aus sich heraus erstarkte. Der Handel, das Handwerk und auch die, wenn auch nur auf eine engbegrenzte Menschenklasse, namentlich die Klosterleute und die aus den Klosterschulen Hervorgegangenen sich erstreckende Bildung, hoben sich zusehends, erweiterten den Gesichtskreis, schufen neue Lebensformen und mit ihnen neue Bedürfnisse. Das altgermanische Kriegertum, die Freude an Fehde und Jagd, das dem Adel noch immer durch die Adern pulsierte, dessen Andenken die unverklungenen, Begeisterung anfachenden Heldensagen wachhielten, gewann eine neue, modernisierte Gestalt im Rittertume, dessen romanische Urformen bald stark mit echt deutschem Geist durchsetzt waren, der manchen welschen Firlefanz noch vergröberte, um namentlich im Minnedienst, einem Hauptbestandteile des Ritterwesens, tief unsittliche Formen zu schaffen, die gleich vergiftend auf beide Geschlechter wirkten, besonders aber den Grundpfeiler der menschlichen Gesellschaft, die Ehe, untergruben. Die, gleichviel ob real oder platonisch Geliebte galt alles, die eigene Frau nichts. Man schlug sein Weib, wie Kriemhilde klagt[18], winselte aber zu Füssen der angebeteten Herrin um die Gunst, die Hand oder den Fuss küssen und den Saum des Gewandes berühren zu dürfen. »Die Ehe des Ritters, sein Hauswesen, seine Kinder, seine Familiengefühle, alles holde Behagen der Heimat stand ganz ausserhalb der idealen Welt, in welcher er am liebsten lebte.«[19] Des steirischen Ritters Ulrich von Lichtenstein Donquichoterien, sein Zug als Frau Venus im Jahre 1227, in kostbare Frauengewänder gekleidet, das Haupt mit Schleiern umhüllt, und seine sonstigen Läppereien, wie das Trinken des Waschwassers seiner Huldin, die Operation der breiten Oberlippe, das Abhauen eines ihr zu Ehren im Turnier verletzten Fingers, das Mischen unter widerliche Aussätzige, das ihm die Laune der excentrischen Geliebten anbefiehlt, sind der Gipfelpunkt des sich als ritterlichen Minnedienst gehabenden Blödsinnes. Diese sich bis zum Wahnsinn steigernden Überspanntheiten der Ritter, ihre Spielereien, die bandwurmartig anwachsenden Satzungen umgaben schliesslich das ganze Rittertum mit einem schalen Formelkram, der stark an die moderne Vereinsmeierei gemahnt, der Geheimbündeleien des 18. Jahrhunderts gar nicht zu gedenken, denen das Rittertum vielfach zum Vorbilde diente.
Das ritterliche Gehaben führte schliesslich zu einer allgemeinen Lüderlichkeit, die selbst dem überzeugten Romantiker Saint-Pelaye den Stossseufzer entlockte: »Nie sah man verderbtere Sitten, als in den Zeiten unserer Ritter, und nie waren die Ausschweifungen in der Liebe allgemeiner«.[20] Jede Modedame musste ihren Ritter haben, der ihre Farben trug und dem Gemahle ins Handwerk pfuschte. Liebschaften von Frauen aus hohem Stande mit Unebenbürtigen konnten bei solchen Anschauungen nicht ausbleiben. Die Strenge Herzog Rudolfs von Österreich, der 1361 eine Hofdame seiner Frau wegen eines Verhältnisses mit einem ihrer Diener ertränken liess, steht anscheinend vereinzelt da. Der österreichische Dichter Heinrich, der zwischen 1153 und 1163 seine Mahnworte an Pfaffen und Laien richtete, schilderte den Umgangston der ritterlichen Gesellschaft als roh. Der Hauptgegenstand ihrer Unterhaltung waren die Weiber. Wer sich rühmen konnte, die meisten verführt zu haben, galt am höchsten.[21] Der Ehebruch war alltäglich, wenn auch über seine Verwerflichkeit die damaligen Dichter einig sind. Aber es war Modesache, Ehebrecher zu sein, oder wenigstens als solcher zu gelten.
klagt Meister Sperrvogel.[22] Gottfried von Strassburgs unsterbliches »Tristan und Isolde« ist in seiner Gesamtheit eine Verherrlichung des Ehebruches, doch gab es, wie wir eben in dem biederben Sperrvogel sahen, auch Minnesänger, die gegenteiliger Meinung waren. Ein klarblickender deutscher Dichter des 12. Jahrhunderts gesteht es unumwunden ein, dass die Damen den Rittern keine Vorwürfe zu machen berechtigt seien, denn:
Die Lotterei der französischen Ritter, deren Liebeshöfe oftmals in Orgien ausarteten, bei denen sich verlarvte Mädchen und Frauen schamlos preisgaben[24], fanden hin und wieder Nachahmung in Deutschland, wenn sie sich auch nicht so allgemein verbreiteten, wie in ihrem Mutterlande, wo Liebeshöfe sogar in den Klöstern eine Stätte fanden.
»Uns ist in einem lateinischem Gedicht die Schilderung eines solchen Hofes bewahrt, welcher in einem Kloster der Diöcese von Toul an heiterem Maifest gehalten wurde. Es ist – wohlgemerkt – nicht die zornige Schilderung durch einen Frommen, sondern wohlwollende Darstellung durch jemand, der dabei war, und der den Vorfall ganz in der Ordnung erachtet. Die Thüren werden verschlossen, die alten Nonnen abgesperrt, nur einige verschwiegene Priester zugelassen. Statt des Evangeliums wird von einer Nonne Ovids »Kunst zu lieben« vorgelesen, zwei Nonnen singen Liebeslieder. Darauf tritt die Domina in die Mitte, als Mai gekleidet, in einem Gewand, das ganz mit Frühlingsblumen besetzt ist, und sagt, Amor, der Gott aller Liebenden, habe sie gesandt, um das Leben der Schwestern zu prüfen. Vor die Richterin treten einzelne Nonnen und rühmen die Liebe zu geistlichen Herren, welche Geheimnisse zu bewahren verstehen; andere loben die Ritterliebe, aber ihre Auffassung wird von der Maigöttin höchlich gemissbilligt, weil die Laien nicht verschwiegen und allzu veränderlich sind. Zuletzt werden die Rebellinnen, welche Ritterliebe nicht meiden wollen, feierlich im Namen der Venus exkommuniziert unter allgemeinem Beifall, und alle sprechen Amen.«[25]
Auch die Kreuzzüge trugen das ihre dazu bei, bisher unbekannt gebliebene Ausschweifungen aus dem Oriente nach dem Abendlande zu verpflanzen. Und die gezwungene Strohwitwerschaft eines Heeres von Frauen, deren Männer unter dem Kreuze fochten, öffnete der Unsittlichkeit Thür und Thor. Die Männer suchten sich allerdings der Treue ihrer Gattinnen durch rohe Mittel zu versichern, deren entwürdigendstes der sogenannte Keuschheitsgürtel (cingula castitatis) war. Solche Gürtel werden von den späteren Schriftstellern häufig erwähnt, sie kommen aber schon im 13. Jahrhundert vor. In der Bilderhandschrift des Bellifortis von Konrad Kyeser vom Jahre 1405 ist die Zeichnung eines solchen Gürtels enthalten; ein Modell eines dieser Instrumente befindet sich im Museum schlesischer Altertümer in Breslau. Es ist roh aus Eisen zusammengefügt, während die wirklich verwendeten aus besserem Material, meist aus Silber oder Gold, gearbeitet waren.
Bei aller Laxheit der Moral bewahrte doch das durch viele Generationen vererbte deutsche Sittlichkeitsgefühl vor jenen allzu tollen Excessen, die in Frankreich auf der Tagesordnung waren.
Man darf überhaupt im allgemeinen die Sitten der Vorzeit nicht nach dem heutigen Moralcodex messen. Andere Zeiten, andere Sitten!
»Die damalige Generation war körperlich gesund und kräftig. Von früher Jugend an hatten die Männer vor allem ihre Körperkräfte ausgebildet; viel im Freien lebend, waren sie erstarkt; die fast ausschliesslich aus scharf gewürzten Fleischgerichten bestehende Kost, der Genuss von berauschenden Getränken brachte das Blut noch mehr in Wallung; zu viel Wissen beschwerte ihren Kopf nicht und mit Gewissensskrupeln wusste man sich abzufinden. Und ebenso vollsaftig und begehrlich sind die Mädchen aufgewachsen.« Die Schamhaftigkeit im modernen Sinne ist eine Errungenschaft der verfeinerten und verfeinernden Kultur, die vielen sonst geistig hochstehenden Völkern abgeht, die ebenso wie die Ahnen im Mittelalter in absoluter Nacktheit keinen Verstoss gegen die gute Sitte sehen und erst allmählich zur Moral nach westeuropäischer Anschauung erzogen werden müssen, denn »das Schamgefühl ist etwas sekundäres und zwar die Folge, nicht die Ursache der Bekleidung«.[26] Ist doch sogar zum Teil heute noch den hochentwickelten Japanern unser mit der Muttermilch eingesogenes Schicklichkeitsgefühl ein fremder Begriff. Was uns daher im allgemeinen höchst anstössig, im allergünstigsten Falle noch äusserst naiv erscheint, gehörte in der Vorzeit zur Alltäglichkeit, die niemandem auffiel, und in der niemand Übles sah. Man war von Kindsbeinen auf an den Anblick der Nacktheit gewöhnt – schlief doch das ganze Mittelalter hindurch alles in Adamskostüm und bei den beschränkten Raumverhältnissen, meist in einer grossen Schlafstube die Eltern mit den Kindern, gleichviel ob Knaben oder Mädchen, zusammen. Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, erscheinen sonst anstössige Stellen in den gleichzeitigen Dichtwerken wesentlich gemildert, auch dann, wenn wir sie als Geschichtsquellen gelten lassen, was aber gemeinhin einige Vorsicht nötig macht. Die licentia poetica wird sich nicht immer haarscharf an Thatsachen gehalten haben, wenn schon sie aus dem wirklichen Leben ihre Kraft schöpfte und allgemein herrschende Sittenzustände zur Grundlage ihrer Schilderungen nahm. Wenn wir daher manches Anstössige auch für übertrieben halten dürfen, so bleibt doch selbst nach Ausmerzung des zu Grassen noch genug Bedenkliches übrig, um ein fast abgerundetes Bild der geltenden Moral zu gewähren, das auf Authentizität Anspruch erheben darf. Auch die Vergleichung von Parallelstellen bei verschiedenen Dichtern, die sich gegenseitig nicht beeinflussen konnten, bestätigt die Richtigkeit vieler wie Fabeln anmutender Vorfälle.
Man lebte anders, man dachte anders als heutzutage, man war trotz aller Sittenroheit reiner im Denken, als in der Gegenwart. Der Sittenverfall paarte sich häufig mit einer Einfalt, die dem Mangel an jeglicher Prüderie entsprang. Man war derb, geradeaus, wollüstig, aber ohne Cynismus und Pikanterie. Es war eben eine Zeit, in der noch nicht, wie Hippel sagt, eine unnatürliche Mode, die man Tugend nennt, im Schwange war.
Gawan, in Wolfram von Eschenbachs unsterblichem Parzival, wird von Bene, der jungfräulichen Tochter seines Gastfreundes, des Ritters Plippalinot, zu Bette gebracht und am Morgen beim Aufstehen bedient.[27]